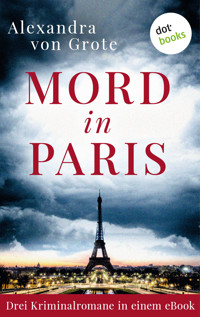5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar LaBréa
- Sprache: Deutsch
Ein Fall, der selbst erfahrenen Ermittlern eine Gänsehaut beschert: Der packende Kriminalroman „Der tote Junge aus der Seine“ von Alexandra von Grote jetzt als eBook bei dotbooks. Ein heißer und blutiger Sommer in Paris: Erst wird in der Seine die Leiche eines zwölfjährigen Jungen gefunden – gefesselt und offenbar sexuell missbraucht. Dann wird im Nobelhotel Ritz ein Prominenter erschlagen. Zwei Mordfälle, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben … doch je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto schockierender sind die Verbindungen zwischen der Pädophilenszene und der gehobenen Gesellschaft. Ein Härtetest für LaBréa, der ihn selbst in Lebensgefahr bringt! Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, „Die Sturmflut“, „Die Flucht“) verfilmt. Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: „Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.“ Freie Presse – „Der schönste Paris-Krimi seit langem.“ NDR – „Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.“ Fränkische Nachrichten – „Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.“ Stadtgespräch Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Der tote Junge aus der Seine“ von Alexandra von Grote. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch: Ein heißer und blutiger Sommer in Paris: Erst wird in der Seine die Leiche eines zwölfjährigen Jungen gefunden – gefesselt und offenbar sexuell missbraucht. Dann wird im Nobelhotel Ritz ein Prominenter erschlagen. Zwei Mordfälle, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben … doch je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto schockierender sind die Verbindungen zwischen der Pädophilenszene und der gehobenen Gesellschaft. Ein Härtetest für LaBréa, der ihn selbst in Lebensgefahr bringt!
Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, Die Sturmflut, Die Flucht) verfilmt.
Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: »Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.« Freie Presse »Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten »Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.« Stadtgespräch
Über die Autorin: Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr.phil.Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin.Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt.Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Bei dotbooks erschienen bereits der Roman »Die Nacht von Lavara«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle: »Die unbekannte Dritte« »Die Kälte des Herzens« »Das Fest der Taube« »Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa: »Mord in der Rue St. Lazare« »Tod an der Bastille« »Todesträume am Montparnasse« »Der letzte Walzer in Paris« »Der tote Junge aus der Seine« »Der lange Schatten«
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website: http://www.alexandra-vongrote.de/
***
eBook-Neuausgabe April 2016
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: istockphoto/pnphotographer
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-580-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der tote Junge aus der Seine« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Der tote Junge aus der Seine
Ein Fall für Kommissar LaBréa
dotbooks.
Personenverzeichnis
Die Familie LaBréa
Maurice LaBréa, Commissaire bei der Brigade Criminelle am Pariser Quai des Orfèvres.
Jennifer, genannt Jenny, LaBréas zwölfjährige Tochter.
Freunde der Familie
Céline Charpentier, arbeitet als Malerin und ist LaBréas Nachbarin in Paris.
Monsieur Hugo, pensionierter Postbeamter und Concierge in LaBréas Haus.
Alissa, elf Jahre, Jennys beste Freundin.
Francine Dalzon, Alissas alleinerziehende Mutter und Besitzerin der Brûlerie.
Die Kollegen
Claudine Millot, Mitarbeiterin in LaBréas Team mit dem Dienstgrad Lieutenant.
Jean-Marc Lagarde, genannt der Paradiesvogel. Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Lieutenant.
Franck Zechira, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Capitaine.
Roland Thibon, genannt der Schöngeist, LaBréas direkter Vorgesetzter mit dem Dienstgrad Directeur.
Joseph Couperin, Ermittlungsrichter mit einer Vorliebe für klassische Musik.
Dr. Brigitte Foucart, Gerichtsmedizinerin.
1. Kapitel
Ein mörderisch heißer Sommer.
Ab Ende Juli stieg die Temperatur kontinuierlich an und erreichte jetzt, in der zweiten Augustwoche, zwei Tage vor Mariä Himmelfahrt, einen Höhepunkt. Es war nicht ganz so schlimm gekommen wie im Sommer 2003, als das Thermometer in der Hauptstadt beinahe zwei Wochen lang konstant sechsunddreißig Grad Celsius angezeigt hatte. Dennoch ergriffen die Menschen ähnliche Maßnahmen wie damals. Wer es irgendwie ermöglichen konnte, fuhr ans Meer. Überfüllte Strände voller Urlauber und Touristen schienen das kleinere Übel verglichen mit einer Stadt, die sich unter einer monströsen Dunstglocke duckte und sich Tag für Tag weiter aufheizte. Nicht wenige Bewohner, die aus beruflichen oder sonstigen Gründen Paris nicht verlassen hatten und es sich leisten konnten, zogen vorübergehend in ein Hotel mit Klimaanlage. Innerhalb kurzer Zeit gab es keine Zimmer mehr.
Straßen und Boulevards zeigten sich tagsüber wie ausgestorben. Nur die nimmermüden Touristen, hart im Nehmen, schleppten sich, schwitzend und mit großen Wasserflaschen bewaffnet, zu den Sehenswürdigkeiten. Bier- und Getränkelieferanten hatten Hochkonjunktur. In einigen Betrieben wurde kurzfristig eine Urlaubssperre verhängt, was zu heftigen Protesten seitens der Gewerkschaften führte.
Auf dem Platz vor dem Hôtel de Ville hatte man Sand aufgeschüttet und Beachvolleyballfelder angelegt. Tagsüber waren diese wegen der großen Hitze meistens verwaist. Nur morgens und abends, wenn sich die Sonnenstrahlen vom Rathausplatz abwandten, trafen sich hier einige junge Leute. Mit Shorts oder Bikini bekleidet, warfen sie sich schwitzend in den Sand. Ihr Ballspiel wirkte lustlos und angestrengt und hatte etwas von einer Pflichtübung, deren Sinn allerdings im Dunkeln blieb.
Der Wasserstand der Seine war sehr niedrig. Nur 2003 war er noch niedriger gewesen. Träge floss das Wasser dahin. Es stank brackig, und in der grünbraunen, öligen Brühe trieben tote Fische.
An den rechten Seine-Ufern entlang der Ile de la Cité und der Ile Saint-Louis war die Schnellstraße Georges Pompidou auf einer Länge von dreieinhalb Kilometern gesperrt worden. Hier hatte die Stadtverwaltung, wie in jedem Sommer, Paris Plage angelegt. Der schmale Uferstreifen am Fluss war mit feinem Sand bestreut. Er stammte – ebenso wie der Belag vor dem Hotel de Ville – aus einer südlich der Stadt liegenden Sand- und Kiesgrube. Man konnte Liegestühle und Sonnenschirme mieten. Fliegende Händler boten Getränke, Sandwichs und Eis an. Schon morgens um acht lagen hier die Menschen dicht an dicht und verbrachten so die heißen Tage. Die Illusion einer Strandidylle wurde allerdings durch zwei Faktoren stark gemindert. Zum einen durch die Tatsache, dass man in der Seine nicht baden durfte und es somit keine Abkühlung gab. Zum anderen durch das entfernte, doch stetige Brausen des Stadtverkehrs. Die bleierne Glocke aus feinsten Schmutzpartikeln und weißem Sonnenlicht tat ein Übriges. Niemand, der abends von Paris Plage in seine stickige Wohnung zurückkehrte, fühlte sich erfrischt oder gar erholt.
***
Einer der heißesten Orte in diesen Tagen war das große Fernsehstudio von TF1, in dem am Abend die wöchentliche Rateshow mit Moderator Yves Ribanville stattfand. Das Studio lag nicht am Hauptsitz des Senders in Boulogne, sondern in der Innenstadt. Ribanville fragt war eine der beliebtesten Shows zur Hauptsendezeit; sie brachte hohe Einschaltquoten und bezog die Zuschauer mit ein. Letzteres bedeutete, dass einzelne Fragen an die Kandidaten auch von den Zuschauern beantwortet werden konnten. Zu diesem Zweck wurde zu jeder Sendung eine Hotline eingerichtet, und in einem Zeitraum von fünf Minuten konnten die Zuschauer ihr Statement telefonisch an die Fernsehstation durchgeben. Unter den richtigen Antworten wurde ein Gewinner ausgelost, dem ein Geldpreis von fünftausend Euro winkte.
Auch heute wurde schon ab zehn Uhr vormittags alles für die Livesendung am Abend vorbereitet. Quizmaster Ribanville würde erst am Nachmittag im Studio erscheinen und in Absprache mit der Regie und der Aufnahmeleitung einen Probedurchlauf der Sendung starten. Die gesamte Organisation dafür lag in den Händen seines jungen Assistenten Michel Delpierre. Delpierre war erst vor wenigen Monaten zum Team gestoßen. Seine Vorgängerin, die von Ribanvilles erster Sendung an mit dabei gewesen war, erschien nun als neue Wetterfee jeden Abend selbst auf dem Bildschirm. Diesen Karrieresprung verdankte sie ihrer allseits bekannten Liaison mit dem stellvertretenden Fernsehdirektor. Dieser wiederum verdankte seinen Posten einer Laune des Staatspräsidenten.
Michel Delpierre schwitzte, als er die einzelnen Kamerapositionen für die Show festlegte. Den drei Bühnenarbeitern, die in die Rolle des Quizmasters und seiner beiden Kandidaten geschlüpft waren, ging es nicht anders. Die Luft im Studio war so stickig, dass jede Bewegung einen neuen Schweißausbruch nach sich zog.
Kurz vor eins. Michel Delpierre gab das Zeichen zur Mittagspause. Er, die Techniker und das übrige Personal flüchteten in die sendereigene Kantine. Dort surrte eine Klimaanlage, die auf Hochtouren lief. Es wurden bereits Wetten darauf abgeschlossen, ob sie demnächst ausfallen würde, wie so viele Klimaanlagen in der Stadt, die mit den Extremtemperaturen völlig überfordert waren. Eineinhalb Stunden kühle Luft, ein leichtes Sommermenü mit einem Glas Rosé oder Mineralwasser, danach gingen die Vorbereitungen für Delpierre im Studio weiter. Gegen neunzehn Uhr wurden die Kandidaten erwartet. Während sie in der Maske saßen, würde Yves Ribanville ein kurzes Vorgespräch mit ihnen führen. Seine ruhige, vertrauenerweckende Art kühlte das Lampenfieber seiner Kandidaten stets ein wenig ab. Um zwanzig Uhr fünfzig begann die Livesendung.
***
Zur selben Zeit aßen Yves Ribanville und seine Familie zu Mittag. Das großbürgerliche Appartement in der Avenue Montaigne im Achten Arrondissement (dreihundert Quadratmeter, acht Zimmer, drei Bäder) hatte einen derzeitigen Marktwert von etwa zwölf Millionen Euro. Ribanvilles amerikanische Frau Candice hatte es mit in die Ehe gebracht – als Hochzeitsgeschenk ihres Vaters, eines texanischen Ölmagnaten. Inzwischen hatte Ribanville durch seine seit zwei Jahren laufende Show und die lukrativen Werbeverträge mit einer großen Supermarktkette und einem Versicherungsriesen so viel verdient, dass er sich eine solche Wohnung selbst hätte kaufen können. Doch das war ja nicht mehr notwendig.
Alle hatten die Hände gefaltet. Yves Ribanville, der in Interviews nie vergaß, zu erwähnen, dass er praktizierender Katholik und aktives Mitglied der Kirchengemeinde St. Philippe du Roule war, sprach das Tischgebet. Candice, eine Mittdreißigerin mit perfektem Makeup, grünblauen Augen, die früher einmal gestrahlt hatten und heute Enttäuschung um verlorenes Glück widerspiegelten, hatte eine gleichgültige Miene aufgesetzt. Sie und die beiden Töchter Joelle und Lilly hielten die Köpfe gesenkt. Aus den Augenwinkeln sah Ribanville, dass die zwölfjährige Lilly ihre Fingernägel blutrot angemalt hatte.
»… und segne, was du uns bescheret hast. Amen.« Ribanville hob den Kopf und lehnte sich zurück.
»Amen«, erwiderten die anderen. Der Moderator nahm seine Serviette, legte sie auf den Schoß und runzelte die Stirn.
»Lilly, habe ich dir nicht neulich schon gesagt, ich mag keine roten Fingernägel?« Seine Stimme klang leise und weniger vorwurfsvoll als enttäuscht. Lilly verdrehte genervt die Augen und tauschte einen raschen Blick mit ihrer jüngeren Schwester.
»Ach Papa, was ist denn an roten Fingernägeln so schlimm?«
»Sie sehen nuttig aus.«
»Nuttig? Was ist denn das?«, wollte die neunjährige Joëlle von ihrer Mutter wissen.
Candice Ribanville, geborene Clark, bediente sich mit einer Portion Salat und reichte die Schüssel weiter. Statt ihrer Tochter zu antworten, wandte sie sich an ihren Mann. Ihre Stimme mit dem amerikanischen Akzent, den sie in all den Jahren nicht abgelegt hatte, klang kühl und distanziert.
»Lass doch solche Bemerkungen, Yves. Die Kinder können nichts damit anfangen.«
»Ich schon«, warf Lilly schnippisch ein. »Nuttig, das kommt von Nutte. Und 'ne Nutte ist eine Frau, die … «
»Halt den Mund!«, fuhr Candice ihre Tochter an. »Ich dulde solche Gespräche nicht am Tisch! Außerdem hat dein Vater Recht. Rote Fingernägel sind ordinär. Deshalb entfernst du dir das Zeug gleich nach dem Essen.«
»Amen«, murmelte Lilly, verzog schmollend den Mund und nahm sich ein Stück Baguette.
Das Mittagessen verlief ohne viel Reden. Maria, das serbische Hausmädchen, servierte als Hauptgang gebratene Hühnerbrüstchen auf Spinatbett. Während Candice sich mehrfach Wein nachschenkte, trank Ribanville nur Mineralwasser. Seine Gedanken kreisten bereits um seine abendliche Sendung. Die Jubiläumssendung, die Einhundertste. Mit der Auswahl der beiden Kandidaten war er diesmal besonders zufrieden. Ein Milliardär und ein Clochard aus dem Parc de Belleville – das fiel aus dem Rahmen. Gleichzeitig schien eine solch extreme Mischung hochaktuell. Angesichts der Wirtschaftskrise und der galoppierenden Vernichtung von Arbeitsplätzen würde die Mittelschicht zunehmend verschwinden. Bald gab es vermutlich nur noch ganz Reiche und ganz Arme. Der Clochard aus dem Parc de Belleville schien also der ideale Gegenpart zu dem Milliardär Léon Soulier, einem persönlichen Freund von Ribanville. Soulier besaß neben einer florierenden Softwarefirma einen Fußballclub, der in der Ersten Liga spielte, sowie den Medienkonzern MediaFrance, wozu mehrere Verlage, ein Rundfunksender und diverse Internetplattformen gehörten. In einem Interview in einer seiner eigenen Zeitungen hatte Soulier vor wenigen Tagen erklärt, dass er den gesamten Geldbetrag, den er bei der Show heute Abend gewinnen würde, einer gemeinnützigen Einrichtung spenden wollte. Von dem Clochard war keine entsprechende Äußerung bekannt.
Als sein Handy klingelte, erhob sich Ribanville und verließ das Esszimmer. Erst dann nahm er das Gespräch an. Es war Louis Bouvier, der ihn anrief, und toi, toi, toi für die heutige Sendung wünschte.
»Schade, dass ich nicht zu deiner Party heute Abend kommen kann«, sagte Louis mit seiner sonoren Stimme. »Aber bei der Hitze ist mir die Fahrt einfach zu anstrengend.«
Mit Louis Bouvier verband Ribanville eine langjährige Freundschaft. Trotz ihres Altersunterschieds von beinahe zwanzig Jahren hatten sie gemeinsame Interessen. Sie trafen sich regelmäßig in Bouviers Anwesen in der Normandie, manchmal auch in größerer Runde. Ein weiterer Freund, Jean-François Kahn, war noch enger mit Ribanville verbunden. Die beiden kannten sich schon eine Ewigkeit. Jean-François hatte im Hafen von Deauville eine schöne Motorjacht liegen. Tagesausflüge zum Fischen oder ein Kurztrip an die englische Kanalküste – das waren entspannende Freizeitvergnügungen, die ein gestresster Fernsehmoderator zu schätzen wusste.
Jetzt bedankte er sich für den Anruf seines Freundes, versprach, über das lange Feiertagswochenende zu kommen, und stellte das Handy ab.
***
Louis Bouvier legte sein Mobiltelefon auf den Tisch, lächelte und seufzte. Er beneidete Yves nicht um seinen Job in dem heißen und stickigen Fernsehstudio. Zweihundert Kilometer nördlich von Paris, in dem kleinen Ort Blonville-sur-Mer, vier Kilometer von Deauville, waren die Temperaturen nicht viel erträglicher als in der Hauptstadt. Die schwache Brise, die vom Meer herwehte, glich eher einem heißen, afrikanischen Wüstenwind. Die sonst immer grünen Wiesen und Weiden im Flachland der Normandie hatten in den letzten Wochen eine schmutzig braune Farbe angenommen. Abend für Abend zogen Gewitterwolken auf und schürten die Hoffnung auf Regen. Doch am nächsten Tag lag das Land ebenso trocken und verdorrt wie zuvor im milchigen Licht.
Die Räume des quadratisch angelegten Gebäudes mit Innenhof und meterdicken Außenmauern boten Kühle und Schutz gegen die Temperaturen, die sich auch hier seit Tagen bei vierunddreißig Grad Celsius eingependelt hatten. Das Anwesen Le Cloître war, wie der Name sagte, ein ehemaliges Kloster, gegründet von den Mönchen des Templerordens nach Ende des zweiten Kreuzzuges. Die Ordensbrüder, die das Kloster bis zum Verbot des Ordens durch die Inquisition zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts bewohnten, verbanden die Ideale des Rittertums mit denen der Mönche. Nach dem Ende der Templer erlebte das Kloster eine stürmische und wechselhafte Geschichte. Bis zur Revolution nutzten Benediktinermönche das Anwesen. Während der Revolution wurden sie vertrieben, die Kirche und das Kloster geplündert und Teile des Hauptgebäudes niedergebrannt. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts kaufte ein reicher Stahlindustrieller aus Lothringen den Besitz der zuständigen Diözese ab. Er restaurierte die beschädigten Gebäude und machte sie zu seinem Landsitz. Bis zum Zweiten Weltkrieg blieb Le Cloître im Besitz seiner Familie. Als die Deutschen das Land besetzten, richteten sie im ehemaligen Kloster ihre Kommandantur ein. Ein Teil der alten Mönchsklausen wurde von der Gestapo als Gefängniszellen und Folterkammern genutzt. Nach der Befreiung im Sommer 1944 stand Le Cloître jahrzehntelang leer und drohte zu verfallen. Die Nachfahren des Bergwerkbesitzers hatten das Anwesen Mitte der vierziger Jahre an den Staat verkauft und das Land verlassen. Erst zu Beginn der siebziger Jahre zog wieder Leben in die alten Gebäude ein. Zunächst entdeckte die Filmbranche Le Cloître als authentischen Drehort für Kostüm- und Ritterfilme. Danach erstand ein bekannter Filmproduzent den Besitz. Er restaurierte, erneuerte und ließ eine Zentralheizung einbauen. Der nächste Besitzer hieß dann Louis Bouvier.
Le Cloître hatte früher über weitläufige Ländereien verfügt, die im Lauf der Jahrhunderte größtenteils parzelliert und verkauft worden waren. Heute betrug der Landbesitz nur noch zwanzig Hektar. Die zum Kloster gehörige Kirche stammte aus der Frühromanik und war trotz der Wirren der Zeit in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben. Sie befand sich nicht in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Klostergebäudes, sondern lag etwa einhundertfünfzig Meter entfernt im Park.
Auf die Außenmauer des Klosters neben der eisenbeschlagenen, schweren Eichentür des Haupteingangs war das Kreuz des Templerordens gemalt, rot auf weißem Grund. Es handelte sich um ein sogenanntes Tatzenkreuz, ursprünglich das Wappen aller Kreuzfahrer. Als Louis Bouvier das Anwesen kaufte, waren die Farben völlig verblasst. Er ließ einen Maler aufwendige Proben mit verschiedenen, nicht mehr gebräuchlichen Pigmenten anfertigen, damit der Farbton des Kreuzes genau getroffen wurde. Ein helles Blutrot. Bouvier hatte es auf historischen Abbildungen von Templern entdeckt. Die Mönchsritter trugen das rote Kreuz auf ihren Schilden, ihren Mänteln und auf der schwarzweißen Templerfahne.
Der Innenhof von Le Cloître, umschlossen von einem Kreuzgang, war der einzige Ort, wo Louis Bouvier sich tagsüber im Freien aufhielt. Eine hundertjährige Blutbuche spendete Schatten, und das Plätschern eines marmornen Springbrunnens wirkte erfrischend und beruhigend.
Der Hausherr verbrachte die heißeste Zeit des Tages, auf dem Bett liegend, in seinem Schlafzimmer. Gewöhnlich dehnte er seine Siesta bis in die späten Nachmittagsstunden aus. An Hitze, insbesondere an feuchte, tropische Hitze, war er beinahe zeit seines Lebens gewöhnt. Seit seinem Eintritt in den diplomatischen Dienst vor mehr als dreißig Jahren hatte er sich vorwiegend in Asien aufgehalten. In den letzten zwanzig Jahren hatte er der französischen Republik als Konsul in Bangladesch gedient, dann in Kalkutta, in Bangkok … Zuletzt in Ho-Tschi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon.
Le Cloître hatte er kurz nach seiner Pensionierung 2004 gekauft. Mit der nicht sehr üppigen Pension eines in den Ruhestand getretenen Staatsbeamten hätte er sich ein solches Anwesen nie leisten können. Doch Ex-Konsul Bouvier war schon immer ein Glückspilz gewesen. Als einziger Verwandter einer sehr reichen Tante zweiten Grades erbte er nach deren Tod ihr gesamtes Vermögen. Es belief sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Er kaufte das Anwesen als Altersruhesitz und ließ einige Innenräume umbauen und renovieren. Es gab zu viele Räumlichkeiten, als dass man sie alle bewohnen konnte. Bouvier baute den Ostflügel als Gästetrakt aus. Den Westflügel des Klosters legte er still. Türen wurden zugemauert, Zimmer leergeräumt oder als Abstellplatz genutzt. Zu Anfang gingen seine Pläne dahin, auf dem Gelände Stallungen zu errichten. Louis Bouvier war ein Pferdenarr, und eine Vollblutzucht hätte ihm einen Herzenswunsch erfüllt. Doch dann hatte er es sich anders überlegt. Abgesehen von den erheblichen finanziellen Investitionen, die sein schönes Erbe beträchtlich hätten schrumpfen lassen, gab es Dinge, mit denen man sich lieber nicht mehr belasten sollte.
***
Mittagszeit.
Bouvier öffnete die Augen. Einen Moment lang hatte er seinen Erinnerungen nachgehangen. Er liebte es, seine Gedanken in die Vergangenheit schweifen zu lassen. Erinnerungen sind das Brot des Alters, hatte irgendjemand einmal geschrieben. Vom Schwelgen in Erinnerungen führte für Bouvier ein gerader Weg in die Gegenwart. Das Leben war spannend, es bot immer wieder Neues, auch wenn man schon dreiundsechzig Jahre zählte. Wichtig war, sich nicht wie dreiundsechzig zu fühlen. Louis Bouviers gefühltes Alter betrug Mitte vierzig, manchmal auch weniger.
Er trank den letzten Schluck aus seinem Whiskyglas (die Angewohnheit, schon mittags mit Whisky zu beginnen, hatte er aus Asien in die Normandie mitgebracht) und erhob sich aus seinem bequemen Korbsessel. Ein heißer Luftzug raschelte in den Blättern der Blutbuche. Die beiden Dobermannrüden Ajax und Achill, die auf den Steinen vor dem Springbrunnen lagen, hoben träge ihre Köpfe.
Der Ex-Konsul strich kurz über ihre Schnauzen und schlenderte ins Haus, wo ihn ein köstliches Mittagessen erwartete. Gefüllte Lammschulter, über Stunden im Ofen bei kleiner Flamme geschmort. Lisa, seine Köchin, stammte aus einer Bauernfamilie in Champs-Rabats, einem nahe gelegenen Dorf. Ihr Bruder besaß die größte Schafherde weit und breit, und seine Lämmer landeten in regelmäßigen Abständen in Louis Bouviers Kochtöpfen.
Das Leben ist schön, dachte der Ex-Konsul, als er die Haustür öffnete. Der Anrufbeantworter in der Halle blinkte. Eine Nachricht von seinem Freund und Nachbarn Jean-François Kahn.
»Hallo, Louis, ich bin's. Wenn es dir recht ist, komme ich schon gegen halb sechs. Sonst sag mir kurz Bescheid.«
Louis Bouvier lächelte. Wenn Jean-François früher als geplant auftauchte, hatte er immer irgendeine Überraschung im Gepäck. Der Gedanke daran stimmte Bouvier heiter und euphorisch. Nach dem Essen und vor der gewohnten nachmittäglichen Siesta würde er in den Weinkeller gehen und einige Flaschen Chateau Lafitte Jahrgang fünfundachtzig holen, um sie rechtzeitig zu dekantieren. Gewisse Dinge waren eben teuer und exklusiv. Und ein guter Rotwein gehörte dazu.
***
Nachdem Jean-François Kahn eine Nachricht auf Louis Bouviers Anrufbeantworter hinterlassen hatte, griff er erneut nach dem Telefonhörer und wählte die Nummer der Klinik. Heute war normalerweise der Tag, an dem er seine Frau Mireille besuchte. Jeden zweiten Mittwoch im Monat, eine feste Gewohnheit. An diesem Mittwoch, dem dreizehnten August, würde der Termin jedoch entfallen. Zum einen weil es bei dieser Hitze als Zumutung erschien, sich in den Wagen zu setzen und fünfunddreißig Kilometer über Land zu fahren. Auch wenn sein roter Peugeot 407 natürlich über eine Klimaanlage verfügte. Zum anderen war am Morgen per Kurier ein Paket geliefert worden. Er war begierig, die Ware in Augenschein zu nehmen. Exklusive Kostbarkeiten, für die er ein Vermögen bezahlt hatte. Deshalb konnte er es auch kaum erwarten, sie seinem Freund Louis Bouvier zu zeigen, dessen Urteil als Kenner er besonders schätzte.
»Psychiatrische Klinik St. Anselme«, meldete sich eine mürrische Stimme. Sie gehörte Lucien, einem vierschrötigen Pfleger, den Jean-François schon seit Jahren kannte.
»Hier Jean-François Kahn«, erwiderte er.
»Ah, Herr Staatssekretär!« Die Stimme wurde sofort eine Spur höflicher, beinahe devot. Jean-François war zwar seit Jahren pensioniert, und die Anrede »Staatssekretär« gehörte der Vergangenheit an. Doch er korrigierte den Pfleger nicht.
»Heute kann ich leider nicht kommen, Lucien. Sagen Sie meiner Frau Bescheid?«
»Selbstverständlich, Herr Staatssekretär.«
»Wie geht es ihr denn?«
»Unverändert, Monsieur. Sie hat immer wieder lichte Momente, wenn ich das mal so nennen darf. Soll ich Sie mit Dr. Chandon verbinden?«
»Nicht notwendig, Lucien. Wie schlagen die Medikamente an?«
»Sehr gut, meint der Doktor. Ihre Frau ist die meiste Zeit sehr ruhig. Sie spricht jetzt wieder manchmal von Ihnen. Allerdings genauso ungereimtes Zeug wie früher.« Lucien lachte. »Aber dass Sie heute kommen wollten, das weiß sie!«
»Ich hoffe, sie ist nicht allzu enttäuscht.« Jean-François Kahn fingerte eine Zigarette aus der Packung und ließ das goldene Feuerzeug aufschnappen, das seine Frau ihm einmal geschenkt hatte.
»Ich sage ihr, dass Sie heute verhindert sind, Herr Staatssekretär.«
»Danke Lucien. Dann bis nächsten Monat«, sagte Jean-François Kahn und legte den Hörer auf.
Er zog den Rauch in die Lunge und betrachtete einen Moment das Feuerzeug, auf dem seine Initialen eingraviert waren. JFK … Damals, als es auf seinem Geburtstagstisch lag, hatte er über die feine Anspielung auf den berühmten Politiker geschmunzelt und mit Mireille herumgerätselt, ob John F. Kennedy überhaupt geraucht hatte? Sie hatten beide keine Ahnung.
Wie lange war das her? Es musste sein vierzigster Geburtstag gewesen sein. Alles schien so weit weg, fast als wäre es nie gewesen. Seine Ehe, die er vor dreißig Jahren geschlossen hatte, die Geburt seines Sohnes Georges, der schon vor Jahren den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte und im fernen Australien lebte. Und Mireille … seit fünfzehn Jahren befand sie sich in der Klinik St. Anselme. Schizophrenie, hatten die Ärzte seinerzeit diagnostiziert. Begonnen hatte es mit Wahnvorstellungen und Verfolgungsängsten, denen mehrere Selbstmordversuche folgten, ohne dass ein erkennbarer Grund dafür vorlag. Kahn suchte die beste Klinik für sie aus, er wollte sie in guter Obhut wissen. Das war er ihr schuldig. Die letzten Jahre seiner Dienstzeit als Staatssekretär im Außenministerium verbrachte er allein in Paris. Dort galt er als Partylöwe und charmanter Plauderer. Man dichtete ihm schnelllebige Frauenbekanntschaften an, doch das waren nur Gerüchte. Nach der Pensionierung zog er nach Blonville-sur-Mer, wo er herstammte. Das Haus, in dem er aufgewachsen war und das seit Generationen seiner Familie gehörte, hatte Mireille nie mit ihm zusammen bewohnt. Einige Male war sie mit ihm hier zu Besuch gewesen, als seine Eltern noch lebten und Mireille noch nicht in der Klinik war.
Eine Besserung ihres Krankheitszustandes würde es niemals geben. Ihr Aufenthalt in St. Anselme war lebenslänglich. Hier kümmerte man sich um sie. Die Welt, in der sie lebte, war hermetisch abgeschlossen. Nach außen hin und auch, was Mireilles Inneres betraf. Sie ließ niemanden hinein. Nur manchmal gab es vehemente verbale Ausbrüche, unberechenbar und gegen ihren Mann gerichtet. Doch jeder sah dies als eine Begleiterscheinung ihrer Krankheit an.
So lebte er nun seit Jahren eine Art Junggesellendasein. Ein verheirateter Mann, der eine Scheidung nie in Betracht gezogen hatte, der keine Geliebte unterhielt und der – in mehrfacher Hinsicht – zu seinen Wurzeln zurückgefunden hatte.
Er verließ sein Arbeitszimmer, in dem eine angenehme Kühle herrschte. Gegen die hohen Wände aus Naturstein und den ziegelroten Klinkerfußboden hatten die sommerlichen Extremtemperaturen keine Chance.
In der Küche wärmte er sich eine Fleischpastete auf und tranchierte ein kaltes, gebratenes Hühnchen. Nach seiner mittäglichen Siesta würde er ein wenig im Internet surfen und sich dann auf den Weg zu Louis Bouviers Anwesen machen.
2. Kapitel
LaBréa holte tief Luft, tauchte und versuchte, Jenny an den Beinen zu packen. Doch seine Tochter war schneller. Sie schwamm ein paar Züge, lachte und spritzte ihm eine Ladung Wasser ins Gesicht, als er prustend auftauchte. Céline saß am Beckenrand, ließ die Füße ins Wasser baumeln, und schaute den beiden zu.
Es war wenig Betrieb im Schwimmbad, was daran liegen mochte, dass es kein Freibad war. Es befand sich im dritten Stock des Forum des Halles, nur wenige Minuten Fußweg von LaBréas Wohnung entfernt. Mit seinem Fünfzigmeterbecken bot es passionierten Schwimmern ideale Bedingungen. In seiner Jugend war LaBréa einige Jahre Mitglied in einem Schwimmverein gewesen und hatte bei den Pariser Jugendmeisterschaften einmal den dritten Platz über hundert Meter Delfin belegt. Die Leidenschaft fürs Schwimmen hatte er sich bewahrt. Seit Beginn der Canicule, der Hundstage Ende Juli, ging er beinahe jeden Vormittag mit Céline und Jenny hierher. Die Hitze in seiner Atelierwohnung war unerträglich geworden. Es gab keine Klimaanlage, und die gläsernen Oberlichter im Dach heizten die Räume auf. Kater Obelix litt besonders unter den Temperaturen. Tagsüber schlief er meistens in dem winzigen Garten, der an die Küche grenzte. Dort streifte das Sonnenlicht nur morgens den schmalen Plattenweg, der zu der Zwerg-Zypresse und den Kräuterbeeten führte, die Céline im Frühjahr angelegt hatte. Obelix streckte sich auf den kühlen Steinen aus, schlief den ganzen Tag und kam nur zum Fressen in die Wohnung.
LaBréa warf einen Blick auf die Wanduhr an der Schmalseite des Hallenbades. Es war kurz nach zwölf. Für dreizehn Uhr hatte er sich mit Ermittlungsrichter Couperin zum Mittagessen verabredet. Die Ermittlungen im Mordfall Antoine Verrin waren abgeschlossen. Der Inhaber mehrerer Spielsalons in der Rue St. Denis war vor zwei Wochen in seiner Wohnung erschossen worden. Den Täter, einen mehrfach vorbestraften Waffenschieber aus Kroatien, hatten LaBréa und seine Mitarbeiter bald gefasst. Der ermordete Antoine Verrin war in illegale Waffengeschäfte verwickelt gewesen und hatte versucht, seine kroatischen Partner über den Tisch zu ziehen. Es gab ein glasklares Motiv, eindeutige Spuren. Ein hieb- und stichfester Fall, auch wenn der Täter kein Geständnis abgelegt hatte. LaBréa und Couperin wollten noch einige Details für die Anklageschrift besprechen, deshalb diese Verabredung zum Essen.
Paris im Sommer schien kein Pflaster für Gewaltverbrechen zu sein. Jedenfalls nicht für solche, die in LaBréas Zuständigkeit fielen. Zwar hatten die Wohnungseinbrüche stark zugenommen, was sich dadurch erklärte, dass viele Bewohner ihre Fenster nachts offen ließen. Auch Schlägereien häuften sich, je höher das Thermometer stieg. Alkohol und heiße Temperaturen bildeten eine Mischung, bei der die Menschen aggressiv wurden. Doch ein Tötungsdelikt hatte es in den letzten vierzehn Tagen nicht gegeben. So konnte LaBréa ein paar geruhsame Tage einschieben und Überstunden abbummeln. Seinen Jahresurlaub würde er in der letzten Augustwoche nehmen und mit Céline und Jenny ans Meer fahren. Vor knapp vier Wochen hatten Jennys Sommerferien begonnen. Am 18. August reiste Jenny zu ihrer Tante Julie nach Aix-en-Provence. Julie war die Schwester von LaBréas verstorbener Frau Anne. Sie hatte Kinder in Jennys Alter, und das Mädchen freute sich darauf, die Stadt zu verlassen und ein wenig Zeit auf dem Land zu verbringen. Julies Familie bewohnte ein ausgebautes provençalisches Bauernhaus etwas außerhalb von Aix. Es gab ein Schwimmbad im Garten und ganz in der Nähe einen Reitstall.
Céline wollte in der kommenden Woche einige Tage bei ihrer Familie in Burgund verbringen, bevor sie zusammen mit LaBréa nach Aix fuhr, um Jenny für den gemeinsamen Meeresurlaub abzuholen.
***
Eine Viertelstunde später verließen die drei das Forum des Halles. Draußen schlug ihnen die geballte Hitze des Tages entgegen. Das Schwimmen hatte sie erfrischt, doch das würde nicht lange Vorhalten.
Céline und Jenny begleiteten LaBréa zur Métrostation Les Halles und gingen zu Fuß weiter. Jenny wollte zu ihrer Freundin Alissa in die Brûlerie. Seit Beginn der Schulferien halfen die beiden Mädchen an den Nachmittagen Alissas Mutter Francine im Geschäft und verdienten sich so ein zusätzliches Taschengeld.
Im Métrowagen waren sämtliche Fenster gekippt, dennoch stand die Luft. Der Mittagsverkehr hatte soeben eingesetzt, und die Fahrgäste drängten sich dicht aneinander.
Eingezwängt zwischen einem englischen Touristenpärchen (der junge Mann trug ein schmuddeliges Unterhemd und Shorts, seine Begleiterin ein enges, ärmelloses Top mit tiefem Ausschnitt) und zwei älteren schwarzen Männern stand er in der Nähe der Tür. LaBréa hasste den Körperkontakt mit fremden Menschen, vor allem im Sommer. Das Touristenpärchen roch nach Schweiß, und LaBréas Hand kam an der Haltestange mit dem klebrigen Arm des Engländers in Berührung. Er seihst hatte den Temperaturen insofern Rechnung getragen, als er seit Tagen klassische Lacoste-Hemden in wechselnden Farben und ein helles Leinenjacket trug, dessen Ärmel aufgekrempelt waren.
Wenige Stationen weiter stieg er auf der Ile de la Cité aus. Über den Quai de la Corse schlenderte er Richtung Polizeipräsidium. Auf der anderen Seite der Seine, am künstlichen Strand Paris Plage, lagen die Menschen wie die Heringe und boten ihre halbnackten Körper der trüben, weißlichen Sonne als Beute dar. LaBréa blieb einen Moment stehen, schüttelte den Kopf angesichts dieser Unvernunft und setzte seinen Weg fort. Gleich darauf bemerkte er, dass am Pont Neuf ein Feuerwehrboot heranfuhr. An einer Stelle der Brücke war vor einigen Wochen ein Gerüst angebracht worden, das bis ins Wasser reichte. Irgendwelche Reparaturarbeiten wurden dort durchgeführt, Einzelheiten kannte LaBréa nicht. Jetzt ließen sich zwei Männer in Tauchermontur über den Rand des Bootes ins Wasser gleiten. An einem der eingerüsteten Brückenpfeiler sah man bereits zwei weitere Taucher. Gleich darauf brauste ein Polizeiboot heran und nahm Kurs auf den Pont Neuf. Neben den Beamten der Wasserschutzpolizei entdeckte LaBréa eine bekannte Gestalt an der Reling. Es war Brigitte Foucart, die Gerichtsmedizinerin. LaBréa überlegte nicht lange, holte sein Handy aus der Jackentasche und tippte auf die Kurzwahltaste für Brigittes Nummer.
»Du bist auf dem Polizeiboot?«, fragte er, als sie sich meldete. »Was ist denn los?«
»Woher weißt du das, Maurice? Bist du unter die Hellseher gegangen?«
»Dreh dich mal nach rechts, Brigitte. Ich stehe oben auf der Straße. Wenn du mich brauchst, komm ich runter an den Quai und springe gleich aufs Boot.«
Er beobachtete, wie sie sich zu ihm wandte.
»Eine Leiche in der Seine. Könnte durchaus sein, dass wir dich brauchen, Maurice!« Sie gab den Polizisten einen Wink und deutete in LaBréas Richtung. Das Boot brauste heran.
***
Die Leiche lag bäuchlings mit dem Gesicht im Wasser, eingeklemmt zwischen Brückenpfeiler und den letzten Sprossen des Baugerüstes. Es war ein kleiner, fast schmächtiger Körper. Auf der gesamten Rückenfläche und dem Hinterkopf klebte eine Schicht aus Schlick, Blättern, Resten von Papier, Plastiktüten und anderen Abfällen. Deshalb bemerkten Brigitte und LaBréa auch nicht gleich, dass die Hände des Toten auf dem Rücken zusammengebunden waren. Als einer der Taucher den Körper ein wenig anhob, sahen sie es und tauschten einen vielsagenden Blick. Es gab keinen Zweifel: Das hier war ein Fall für die Mordkommission.
»Das ist doch ein Kind, oder?«, fragte LaBréa leise. Brigitte zuckte mit den Schultern.
»Kann ich noch nicht sagen. Warten wir's ab.«
Der Gendarmeriehauptmann der Wasserschutzpolizei ließ das Boot so nah wie möglich heranfahren. Noch immer war das Gesicht des Toten nicht zu erkennen. Der zweiarmige Auslegekran des Polizeibootes wurde nach Backbord hinausgefahren. An den Enden verfügte er über breite Zugriemen, die die Taucher jetzt vorsichtig um Brust und Beine des Leichnams legten. Dann wurde der Körper ins Boot gehoben. Die Barkasse fuhr einige Meter weiter, um im Schatten unter dem Brückenbogen Schutz vor der gleißenden Mittagssonne zu suchen.
Auf dem Pont Neuf und an den Seinequais hatten sich inzwischen Neugierige eingefunden, die das Geschehen verfolgten. Als das Polizeiboot ihren Blicken entschwand, zerstreuten sie sich.
Die Taucher gingen zurück an Bord des Feuerwehrbootes, das kurz darauf davonfuhr.
Brigitte Foucart, die ihre Schutzkleidung übergezogen hatte, kniete sich auf den Boden und entfernte vorsichtig Unrat und Schlick vom Rücken und aus den Haaren des Toten. Der Leichnam war vollständig nackt. Dort, wo eine weißblaue Nylonschnur in die über Kreuz gefesselten Handgelenke schnitt, hatte sich die Haut in Streifen gelöst. Das Fleisch darunter schimmerte grünlich. Erste Fäulniserscheinungen. Jetzt drehte Brigitte den Leichnam um. Bei dem Menschen, der mit zusammengebundenen Händen aus der Seine gefischt worden war, handelte es sich um einen Jungen. LaBréa schätzte, dass er nicht älter als zwölf, höchstens dreizehn Jahre alt sein konnte.
LaBréa blickte in das vom Wasser aufgeschwemmte Gesicht. Als Erstes fielen ihm die starken, schwarzen Farbspuren an den Lidrändern des Jungen auf. Eyeliner? War er geschminkt worden? Hatte er es selbst getan? Die weit aufgerissenen Augen wirkten trüb und farblos. Auf den halbgeöffneten Lippen und an den Nasenlöchern hatte sich ein feinblasiger Schaumpilz gebildet. LaBréas Blick wanderte zur Mitte des Körpers, zu dem kindlichen Geschlechtsteil und der Grünfärbung am rechten Unterbauch, einem weiteren Indiz für den beginnenden Fäulnisprozess. Einen Moment kämpfte LaBréa gegen die Übelkeit an, die in ihm aufstieg. An den Fingern des Jungen hatte sich bereits Waschhaut gebildet, ebenso an den Füßen. Teilweise war die Haut auch dort bereits abgelöst. Wasserleichen sahen auch nach wenigen Tagen Liegezeit im Wasser grauenvoll aus und stanken bestialisch. LaBréa holte ein Papiertaschentuch aus seiner Hosentasche und drückte es sich vor den Mund.
Niemand sprach zunächst ein Wort. LaBréa deutete auf die Augenränder des Jungen.
»Wahrscheinlich Eyeliner, oder?«
»Ja. Die Spuren sind gut erhalten. Wir werden sehen, was es ist.«
Brigitte öffnete den Mund des Jungen, dessen Lippen auch jetzt nach dem Tod noch sensibel wirkten. Ein Schwall brackiges Wasser quoll heraus, und ein grünlich gelber Käfer von etwa drei Zentimetern Länge krabbelte über die Lippen auf die rechte Wange des Toten. Mit flinker Geste griff Brigitte Foucart nach dem Tier und fing es in ihrer Hand. Aus ihrem mobilen Einsatzkoffer nahm sie eine Plastikdose und ließ das Insekt hineingleiten, bevor sie das Gefäß sorgfältig verschloss. Eingehend betrachtete sie den Käfer, der sich fürs Erste tot stellte, und wandte sich dann an LaBréa.
»Ein Gelbbrandkäfer. Lebt in Bächen, Flüssen, Tümpeln. Frisst Kaulquappen, junge Fische – und Aas.«
Vorsichtig tastete sie mit dem Finger die Mundhöhle des Jungen ab.
»Hinten am Gaumen, da hat er schon angefangen. Da spüre ich ein Loch.« Mit scharfem Blick taxierte sie die Wangenoberfläche. »Von außen ist nichts zu sehen. Das Tier war noch nicht lange bei der Arbeit.«
Anzeichen von Gewalteinwirkung waren im Gesicht nicht zu entdecken. An den Armen erkannte LaBréa Spuren von Hämatomen. Er deutete darauf.
»Sieht aus, als wäre er festgehalten worden«, meinte er.
»Das schaue ich mir später noch genauer an«, erwiderte Brigitte. Ihr Augenmerk richtete sich auf die Oberschenkel und die Hüften des Jungen, die tiefe Verletzungen aufwiesen.
»Das könnten Treibverletzungen sein«, meinte Brigitte. »Wer weiß, wo der Junge in die Seine geworfen wurde.«
»Er könnte also beim Treiben im Wasser an irgendwelchen Brückenpfeilern hängen geblieben sein, oder hier am Baugerüst?«, fragte LaBréa
Die Gerichtsmedizinerin nickte.
»Vielleicht ist der Körper auch in die Nähe einer Schiffsschraube geraten.«
»Wie lange liegt er schon im Wasser?«
»Nicht sehr lange, Maurice, so viel steht fest. Die Totenstarre hat sich im Kiefer zwar schon gelöst, aber das geht bei den momentanen Temperaturen schnell. Aber auf keinen Fall befindet er sich schon Wochen oder gar Monate im Wasser. Es gibt keine Fettwachsbildung und erste Fäulniserscheinungen nur den Handgelenken und Unterbauch. Das erkennt man an der grünlichen Einfärbung. Bei den momentanen heißen Temperaturen würde eine Wasserleiche bereits nach wenigen Tagen ganz anders aussehen.«
»Dann liegt er also erst seit kurzer Zeit im Fluss?«
»Ein, zwei Tage, würde ich sagen. Genaueres nach der Autopsie, wie immer.«
»Der Wasserstand der Seine ist im Moment ungewöhnlich niedrig. Vielleicht mit ein Grund, warum er so schnell entdeckt wurde.«
Brigitte nickte.
»Ja. Wahrscheinlich können wir von Glück sagen, dass der Fluss Niedrigwasser hat. Sonst wäre er vielleicht erst viel später gefunden worden. Das hätte alles nur noch erschwert.«
»Die entscheidende Frage, Brigitte, ist doch die: Wurde er ins Wasser geworfen, als er bereits tot war, oder hat er noch gelebt und ist elendig ertrunken?«
Brigitte lächelte, erhob sich und strich ihren Schutzkittel glatt.
»Für mich ist das eine der einfachsten Fragen überhaupt. Ich sehe mir seine Lungen und die Atemwege an, dann kann ich es dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.«
LaBréa wandte sich an den Gendarmeriehauptmann.
»Wer hat die Leiche eigentlich entdeckt?«
»An der Anlegestelle »Vedettes du Pont Neuf« wartete ein Mann auf das Ausflugsboot Richtung Canal St. Martin und bemerkte etwas am Brückenpfeiler. Er hatte sein Fernglas dabei und meinte, einen Körper im Wasser zu sehen. Da hat er die Notrufnummer gewählt. Zuerst kam das Boot der Feuerwehr, dann wir. Voilà.« Der Mann nahm seine Mütze vom Kopf und strich sich mit der Hand über die schweißnasse Fläche seiner beginnenden Glatze.
LaBréa griff nach seinem Handy und wählte die Nummer seines Mitarbeiters Franck Zechira.
»Wo sind Sie gerade, Franck?«, fragte er.
»Wenn Sie's genau wissen wollen: Ich liege im kalten Wasser in meiner Badewanne.«
»Dann trocknen Sie sich schnell ab und kommen Sie ins Büro. Es gibt Arbeit. Und sagen Sie Claudine und Jean-Marc Bescheid. In einer halben Stunde steigt die Talkrunde.«
Ebenso wie er bummelten seine Mitarbeiter in den letzten Tagen ihre Überstunden ab und verbrachten, jeder auf seine Weise, die heißen Tage. Im Anschluss an das Gespräch mit Franck wählte LaBréa die Nummer des Ermittlungsrichters. Er sagte die Verabredung zum Mittagessen ab und informierte ihn über den Fund der Wasserleiche.
LaBréa warf einen letzten Blick auf den toten Jungen, den Brigitte soeben mit einem weißen Tuch bedeckte. An einer Anlegestelle in der Nähe des Gerichtsmedizinischen Instituts würde man den Leichnam von der Polizeibarkasse auf einen Wagen umladen und in den Sezierraum schaffen. LaBréa beneidete Brigitte nicht um die Autopsie und war froh, dass er nicht dabei sein musste. Was die Ermittlungen in diesem Mordfall betrafen – sie würden schwierig werden, das wusste er. Eine nackte Kinderleiche. Keine Papiere, kein Name, keine besonderen rassischen Merkmale. Schwarze Haare und ein dunkler Teint. Nichts wies auf die Identität des Jungen hin. LaBréa und seine Leute würden am Punkt null anfangen. Wenn in Paris und Umgebung kein Kind als vermisst gemeldet worden war, auf das die Beschreibung des Jungen passte, schwanden die Chancen auf eine rasche Aufklärung rapide.
LaBréa ließ sich an der Dampferanlegestelle »Vedettes du Pont Neuf« absetzen, überquerte die Place Dauphine und betrat zwei Minuten später die Eingangshalle des Polizeipräsidiums. Angenehme Kühle empfing ihn, die jedoch nur kurz währte. In seinem Büro, dessen Fensterfront nach Süden wies, schlug ihm abgestandene, stickige Luft entgegen. Es nützte nicht viel, die Fenster zu öffnen, da von draußen nur noch mehr Hitze hereinströmte. Jalousien oder Vorhänge gab es nicht. So beschloss LaBréa, dass die heutige Talkrunde im Büro der Mitarbeiter stattfinden sollte. Dort führten die Fenster auf einen schmalen Innenhof, der den ganzen Tag im Schatten lag.
***
Wenig später war die Talkrunde komplett. Jean-Marc, der Paradiesvogel, erschien als Letzter. Francks Anruf hatte ihn im Bois de Boulogne erreicht, wo er am schattigen Ufersaum des Unteren Sees eine Decke ausgebreitet hatte und eingeschlafen war. In bunten Bermudashorts, Flip-Flops und einem grell gelben, ärmellosen T-Shirt war er von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln direkt zum Quai des Orfèvres gekommen.
»Tut mir leid, Chef«, sagte er, als er das Büro betrat. »Aber umziehen konnte ich mich leider nicht mehr.«
Franck grinste.
»Pass bloß auf, dass der Schöngeist dich heute nicht sieht. Der rastet sonst komplett aus.«
Direktor Thibon, genannt Schöngeist, war LaBréas direkter Vorgesetzter. Normalerweise fuhr er im August immer in Urlaub. Er besaß ein Ferienhaus an der Côte d'Azur mit einem Stück Privatstrand, auf das er besonders stolz war. In diesem Sommer hatte das Schicksal seine Pläne durchkreuzt: Seine Frau lag mit einem komplizierten Beinbruch im Krankenhaus und kam in einigen Tagen in eine Rehaklinik. So flog Thibon nur an den Wochenenden in den Süden, um wenigstens zeitweilig der Hitze der Stadt zu entfliehen.
LaBréa informierte seine Mitarbeiter über den Fund der Wasserleiche.
»Mit gefesselten Händen in den Fluss geworfen?« Claudine war entsetzt. »Wer macht denn so was?«
»Wir wissen noch gar nichts«, stellte LaBréa sachlich fest. »Abgesehen davon, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach Mord ist. Aber wir kennen weder den Tatort noch die Umstände, unter denen der Junge gestorben ist.«
»Irgendjemand wird ihn doch vermissen, oder?« Franck blickte in die Runde.
»Das ist nicht gesagt. Viele Kinder verschwinden, und niemand meldet sie als vermisst.« LaBréa schenkte sich ein Glas Mineralwasser ein und trank es in einem Zug leer.
»Ich gehe die Vermisstenanzeigen durch«, sagte Claudine. LaBréa nickte.
»Ja, und Franck hilft Ihnen dabei. Aber beschränkt euch nicht auf die Fälle in Paris. Erkundigt euch in allen umliegenden Départements, besonders in denen, durch die die Seine fließt.«
»Ein minderjähriger Junge, entsorgt wie ein Stück Müll…«, sagte der Paradiesvogel leise. »Da gibt's nicht viele Möglichkeiten. Gewalt in der Familie, sexueller Missbrauch …«
»Daran habe ich natürlich auch sofort gedacht«, erwiderte LaBréa. »Aber warten wir ab, was Dr. Foucart rausfindet.«
»Was ist mit den Binnenschiffern? Den Ausflugsbooten, Chef?«
»Das ist der nächste Punkt, Jean-Marc. Wir beide setzen uns mit den Schifffahrtslinien in Verbindung. Welche Fracht – und Personenschiffe sind in den letzten Tagen durch Paris gefahren? Hat irgendjemand vom Schiff aus was Verdächtiges beobachtet? Zum Beispiel, ob sich irgendwo an den Ufern jemand auffällig verhielt. Oder auf einer Brücke. Es könnte auch sein, dass der Junge direkt von einem Schiff aus über Bord geworfen wurde. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu.«
»Moment mal.« Claudine tippte etwas in ihren Computer ein und las laut vor. »Die Seine … hier hab ich's. Sie entspringt in Burgund und mündet bei Le Havre in den Ärmelkanal. Länge: 776 Kilometer. Schiffbare Länge: 560 Kilometer. Und schiffbar ist der Fluss ab Nogent-sur-Seine, das ist in den Ardennen.«
LaBréa nickte.
»Ich weiß, was Sie sagen wollen, Claudine. Von Nogent-sur-Seine bis Paris ist es eine ganz schöne Strecke.«
»Genau.« Claudine warf erneut einen Blick auf ihren Bildschirm. »Und vergessen wir nicht die Nebenflüsse, die auf der gesamten Länge bis Paris in die Seine münden. Er kann auch von dort her in den Fluss geschwemmt worden sein.«
»Ich denke, er lag nicht länger als ein, zwei Tage im Wasser?«, fragte Franck.
»Ja, und daher können wir das Gebiet auch eingrenzen«, sagte LaBréa. »Jean-Marc, rufen Sie die Schifffahrtbehörde an und erkundigen Sie sich wegen der Strömungsverhältnisse des Flusses.«
»Die werden bei dem niedrigen Wasserstand anders sein als sonst.«
»Richtig. Deshalb müssen wir in Erfahrung bringen, welche Strecke ein im niedrigen Wasser treibender Körper in welcher Zeit zurücklegt. Von Dr. Foucart erfahren wir hoffentlich die möglichst exakte Liegezeit des Körpers im Fluss. Mit diesen Anhaltspunkten haben wir eine Chance.«
3. Kapitel
Eric Lecadre, der bekannte Theaterschauspieler, knöpfte sein Polohemd zu, steckte es in die Hose und schloss den Gürtel. Er betrachtete sich in dem großen Badezimmerspiegel und lächelte zufrieden. Mit seinen fünfundvierzig Jahren wirkte er mindestens zehn Jahre jünger. Dass er seine Figur gehalten hatte und einen athletisch durchtrainierten Körper besaß, verdankte er seinen guten Genen, dem täglichen Training auf dem Laufband und den Hantelübungen, die er morgens und abends absolvierte. Die Haut spannte sich straff und solariumgebräunt über das schmale Gesicht mit der geraden, klassischen Nase. Die muskulösen Arme waren nahezu unbehaart. Mit den schmalen Hüften, den breiten, aber nicht zu breiten Schultern sowie dem knackigen Gesäß wirkte sein Körper makellos. In seiner Jugend und auch später noch, auf der Schauspielschule, nannten sie ihn El Greco. Nicht in Anlehnung an den gleichnamigen spanischen Maler, nein. Den Spitznamen bekam er, weil er dem Idealbild des griechischen Jünglings zu entsprechen schien. Erhärtet wurde diese Einschätzung durch die blonden, leicht gelockten Haare, deren Schnitt seinen klassischen Kopf noch betonte. Andere hatten ihn auch mit dem David von Michelangelo verglichen. Wo immer er sich zeigte, auf Partys, beim Einkäufen, beim Sonntagsbummel über die Champs Elysees – er zog bewundernde Blicke auf sich. Eric Lecadre gehörte zu den Menschen, bei denen man annahm, Schönheit, Talent und nobler Charakter gingen Hand in Hand.
Alle großen Rollen, die sich einem Schauspieler boten, hatte er in jungen Jahren gespielt. Er war nicht besser als andere Kollegen. Er sah nur besser aus und galt als Liebling der Frauen. Er spielte Romeo, Hamlet, Lozenzaccio, Don Carlos, Orestes, El Cid. Bis zu Beginn der Theaterferien vor einigen Wochen stand er als Faust in einer aufsehenerregenden Inszenierung auf der Bühne der Comédie Française. Im Herbst würde er an der Seite von Isabelle Huppert die männliche Hauptrolle in einem Film von Claude Chabrol spielen. Er hatte bereits in vielen Filmen mitgewirkt, und war einem großen Publikum im Land bestens bekannt. Ein Promi, der zur Crème de la Crème der Pariser Gesellschaft gehörte.
Mit einem Seufzer löste er sich von seinem Spiegelbild und verließ das Badezimmer. Aus dem Salon ertönte die Stimme seiner Frau Chantal.
»Du bist noch da?«, fragte sie erstaunt. »Ich dachte, du wärst längst weg!« Er hörte ihre schweren Schritte und war einen Moment in Versuchung, ganz schnell die Wohnung zu verlassen, um Chantal nicht mehr begegnen zu müssen. Doch schon stand sie im Flur und schüttelte erstaunt den Kopf.
»Wie lange geht denn die Besuchszeit im Krankenhaus?«
Eric nahm sein safrangelbes Sommerjackett vom Garderobenständer und holte seine Sonnenbrille aus der Schublade des Flurschränkchens.
»Françoise ist doch Privatpatientin!«, sagte Eric milde lächelnd.
»Stimmt!«, murmelte Chantal zerstreut. »Da gelten die normalen Besuchszeiten nicht.«
Françoise Thibon war eine Kollegin vom Theater. In der Faust-Inszenierung spielte sie Frau Marthe, wenngleich sie sich mit Ende vierzig viel zu jung für die Rolle fühlte, wie sie gleich zu Anfang der Proben betont hatte. Vor zwei Wochen hatte sie sich unglücklicherweise auf einer Treppe am Montmartre beim Fotoshooting zu einer Homestory das Bein gebrochen und lag nun im Krankenhaus Val de Grâce. Der geplante Urlaub mit ihrem Mann Roland, dem Direktor der Brigade Criminelle am Quai des Orfèvres, fiel dadurch ins Wasser. Das war schade, denn Françoise und Roland hatten Eric und Chantal für Ende August in ihre Villa an die Côte d'Azur eingeladen. Erics für heute geplanter Krankenbesuch galt nicht allein der Sorge um die verunglückte Kollegin. Er wollte sich vor allem die Option auf eine spätere Einladung in die Villa und an den Privatstrand der Thibons offenhalten. Eric Lecadre war geizig und immer auf seinen Vorteil bedacht. Und wenn man das Geld für ein Hotel oder die Miete für ein Ferienhaus sparen konnte, umso besser. Die Schnorrermentalität blieb seinen Freunden und Bekannten nicht verborgen. Doch man nahm es ihm nicht übel, weil sich die meisten Leute gern mit der Gesellschaft dieses blendend aussehenden Mannes schmückten.
Er warf seiner Frau einen flüchtigen Blick zu. Chantal war zwanzig Jahre älter als er und hatte sich trotz vieler Anstrengungen nicht gut gehalten. Ihre Haut wirkte schlaff und verwelkt, was sie mit einem starken Make-up zu kaschieren versuchte. Die tiefen Kräuselfalten auf der Oberlippe zeugten von jahrzehntelangem Zigarettenkonsum. Wer an einer Zigarette zieht, spitzt automatisch die Lippen. Und besonders bei Frauen hat dies fatale Folgen. Auch an Chantals Zähnen erkannte man die Kettenraucherin. Eric hatte sich das Rauchen vor langer Zeit abgewöhnt. In einem Beruf, wo beinahe jeder qualmte (und die meisten sehr viel tranken), war er seitdem fast so etwas wie ein exotisches Exemplar.
Im Oktober wurde Chantal fünfundsechzig. Ihre Haare, die sie inzwischen färbte und die früher tiefschwarz gewesen waren, lichteten sich an einigen Stellen. Sie selbst fand am dramatischsten, dass sie völlig ihre Figur verloren hatte. Seit Beginn des Klimakteriums glich sie mehr und mehr einer Matrone. Ihr Frauenarzt, der auch bekannte Stars und Sternchen zu seinen Patienten zählte, hatte ihr Hormone verschrieben. Zunächst glaubte sie fest an deren Wirkung. Erst als sie dreißig Kilo mehr wog, setzte sie sie ab. Doch die vielen Pfunde blieben, und seit einigen Jahren hatte Chantal die Hoffnung aufgegeben, sich je wieder auf ihr altes Gewicht herunterhungern zu können.
Seit zweiundzwanzig Jahren war Eric nun mit ihr verheiratet. Das Geheimnis ihrer Ehe lag einzig und allein darin, dass sie einander von Anfang an nützlich waren und sich gegenseitig benutzten. Chantal Coquillon galt jahrzehntelang als die mächtigste Schauspieleragentin in Paris. Sie schob Karrieren an und konnte sie ebenso leicht beenden. Ihr langer Arm reichte bis in die Intendanzen der wichtigsten Pariser Theater. Sie war mit Jean Vilar befreundet gewesen, mit Beckett, Sartre, Ionesco und natürlich mit
Sagan, deren Niedergang sie mit schmerzlicher Anteilnahme miterleben musste. Zu ihrem engeren Freundeskreis gehörten neben einer Anzahl wichtiger Politiker auch namhafte Filmproduzenten und Regisseure. Ganze Generationen von französischen Kinostars verdankten ihr die Karriere. Vor zwei Jahren hatte sie ihren Agentenjob an den Nagel gehängt. Seitdem schrieb sie ihre Memoiren, für die ihr ein großer Publikumsverlag bereits einen Vorschuss in sechsstelliger Höhe gezahlt hatte. Das Buch wurde mit Spannung erwartet, versprach sich der Verlag doch intime Klatsch- und Tratschgeschichten aus der Welt der Kulturschickeria.
Als sie Eric kennenlernte, verliebte sie sich unsterblich in ihn. Trotz des großen Altersunterschiedes oder vielleicht gerade deshalb. Er ließ sie charmant zappeln, wies sie nicht direkt zurück, schlief sogar hin und wieder mit ihr. Irgendwann hatte sie begriffen, dass sie vielleicht nicht sein Herz erobern konnte, aber dass es eine andere Möglichkeit gab, ihn an sich zu binden. Wenn auch nur durchschnittlich talentiert, war Eric doch sehr ehrgeizig. Er wollte nach oben, und sie konnte ihm dazu verhelfen. Sie stellte nur eine Bedingung: Er sollte sie heiraten. Sie schlossen ein Geschäft miteinander ab. Wenn er sie heiratete, würde sie ihm alle Freiheiten lassen, sich um seine Karriere kümmern und einen großen Star aus ihm machen. Der Preis einer ehelichen Bindung schien Eric dafür nicht zu hoch. Alles, was ihn erotisch und emotional anzog, lief nebenher, und Chantal drückte mehr als ein Auge zu. Sie formte ihn wie einen rohen Diamanten, dem man den entscheidenden Schliff verpasst. Durch ihre Verbindungen in die höchsten Kreise der Pariser Gesellschaft begann Erics kometenhafter Aufstieg, zu dem er nichts beisteuerte als sein unverschämt gutes Aussehen, ein unbedeutendes Quentchen Talent und das Versprechen, wenn schon nicht das Bett (oder nur sehr selten), so doch Tisch, Wohnung und das gesellschaftliche Leben mit Chantal Coquillon zu teilen.
»Hast du Yves angerufen und ihm für die Sendung heute Abend toi, toi, toi gewünscht?«, fragte Chantal und steckte die Hände in die Taschen ihres weiten Rockes, der ihren plumpen Körper großräumig verhüllte.
Mit gespielt theatralischer Geste griff Eric sich an die Stirn.
»Du liebe Güte, das hab ich ganz vergessen! Könntest du das bitte übernehmen, Chantal? Und zu seiner Party heute Abend nach der Sendung kommen wir natürlich! «
Sie nickte, lächelte kurz und trat auf ihn zu.
»Also, Chéri«, sagte sie und gab ihm rechts und links einen Kuss auf die Wange. Er roch ihren schlechten, nach saurem Magen und Zigaretten stinkenden Atem, und hielt einen Moment die Luft an.
»Grüß bitte Françoise von mir«, fuhr sie fort. »Und sag ihr, ich kann sie erst besuchen, wenn es nicht mehr so heiß ist. Mein Kreislauf. Bei der Hitze spielt er total verrückt.«
»Mach ich, mein Schatz.« Eric verließ die Wohnung. Im Blumenladen unten an der Ecke würde er noch einen Strauß gelber Rosen kaufen (nicht zu teuer, vielleicht gab es Sonderangebote) und dann mit dem Taxi zum Krankenhaus fahren. Er blickte auf seine Uhr, eine teure Patek Philippe. Chantal hatte sie ihm zum dritten Hochzeitstag geschenkt.
Drei Uhr nachmittags. Die Zeit, in der die Hitze des Tages am unerträglichsten war. Eric Lecadre hoffte nur, dass er ein Taxi mit Klimaanlage erwischte.
***
Das Mittagessen hatte spät begonnen, und soeben wurde der Kaffee gereicht. Frédéric Dubois trank ihn schwarz und ohne Zucker. Léon Soulier gab zwei Stück Zucker in die Tasse. Er achtete nicht auf seine Figur. Klein und übergewichtig, mit Glatze, stets geröteten Wangen und einer roten Nase scherte er sich nicht um sein Äußeres.
Die beiden saßen sich im Restaurant Closerie des Lilas an einem etwas abseits stehenden Tisch gegenüber, wo sie ungestört ihre geschäftliche Besprechung führen konnten. Dubois war Musikproduzent und Teilhaber an einer Plattenfirma, die zu Léon Souliers Konzern MediaFrance gehörte. Dass sie beide bei diesen unerträglichen Temperaturen noch in Paris weilten, hatte viele Gründe. Léon Soulier war am Abend Gast in der Rateshow Ribanville fragt, und Frédéric Dubois arbeitete auf Hochtouren an mehreren Projekten und konnte die Stadt nicht verlassen. Unter anderem bastelte er an einer neuen Studio-Software, die in wenigen Wochen getestet werden sollte. Soulier hatte viel Geld in diese Entwicklung gesteckt, die die Musikproduktion revolutionieren würde. Einmal patentiert und in andere Länder verkauft, versprach die neue Software satte Gewinne.
Jetzt, nach einem wunderbaren Menu (Melone mit Portwein, Rotbarbenfilets auf Mangospalten, frischer Ziegenkäse, eine Himbeercharlotte als Dessert, dazu ein weißer Burgunder) war der geschäftliche Teil ihrer Unterhaltung beendet.
»Ist deine Frau mit dem Jungen schon weg?«, fragte Dubois und trank den letzten Schluck Kaffee. Schweißperlen standen auf seiner Stirn, und er tupfte sie mit der Serviette ab. Sein Jackett aus Jeansstoff hatte er schon lange abgelegt. Der kräftige Oberkörper mit dem Waschbrettbauch steckte in einem kurzärmeligen, blauen Hemd mit Button-down-Kragen. Dazu trug er schwarze Designer-Cargohosen mit überdimensional großen Taschen. Darin hatte er seine drei Handys verstaut, seine Brieftasche, seinen Terminkalender und mehrere Packungen Kaugummis ohne Zucker.
»Gestern Abend hat sie den Flieger genommen«, erwiderte Léon Soulier. »Aber am Atlantik ist es auch nicht kühler als in Paris.«
»Und die Sendung heute Abend?«
»Die sieht sie sich im Fernsehen an. Ich wollte nicht, dass sie mit ins Studio kommt. Das war ihr, glaube ich, auch ganz recht.«
Dubois senkte ein wenig die Stimme und funkelte seinen Freund und Geschäftspartner neugierig an.
»Kennst du eigentlich die Fragen schon? Ich meine, hat Yves dir irgendwelche Tipps gegeben?«
Léon schmunzelte verschmitzt und strich mit der flachen Hand über seine Glatze.
»Was meinst du, Frédi, hat er oder hat er nicht?«
»Ach komm schon, mir kannst du es doch verraten! «
»Tu ich aber nicht. Denk, was du willst, aber von mir erfährst du nichts!«
»Also hat er dir Hinweise gegeben! « Frédéric verschränkte die Arme über der Brust und lehnte sich zurück. »Das sehe ich dir doch an, ich kenne dich, Léon ! «
»Wenn du dich da mal nicht täuschst, mein Lieber! « Léon Soulier winkte den Kellner herbei. »Die Rechnung bitte.«
»Aber nach der Party heute Abend kannst du es mir ja verraten. Dann ist die Show gelaufen. Außerdem halte ich sowieso dicht, das weißt du doch.«
»Ich denke, du kommst gar nicht zur Party?«
»Stimmt, ich werd's nicht schaffen. Dann sagst du es mir eben morgen früh.«
Eines seiner drei Handys klingelte, und Frédéric fingerte es aus der linken Oberschenkeltasche.
»Ja? – Jetzt schon?« Frédéric warf einen Blick auf seine Uhr. »Sag ihm, ich bin in einer Viertelstunde da!« Er steckte das Handy weg und wandte sich an Léon.
»Armand sitzt schon in meinem Büro. Der kann einfach nicht pünktlich sein. Kommt immer zu früh.«
»Besser zu früh als zu spät«, entgegnete Léon und holte sein Ledermäppchen mit den Kreditkarten aus der Brusttasche seines Jacketts. Er warf einen flüchtigen Blick auf die Rechnung, die der Kellner ihm soeben brachte, und gab ihm seine American-Express-Karte.
»Aber Armand ist nun mal der Spezialist für die Safety«, fuhr er fort und nickte bedeutungsvoll.
Darum ging es. Um die Sicherheit der Daten eines zusätzlichen Internetportals, das der Konzern in den nächsten Tagen einrichten würde. Ein weiteres wichtiges Projekt, an dem Frédéric mit Armand arbeitete und das ihn daran hinderte, dem Pariser Sommer zu entfliehen und in Urlaub zu fahren.
***
Vor dem Lokal verabschiedeten sie sich. Die Musikstudios von MediaFrance lagen in einer Seitenstraße des Boulevard Montparnasse unweit der Closerie des Lilas. Während Frédéric die wenigen Schritte trotz der brütenden Hitze zu Fuß gehen wollte, stieg Léon in seinen Bentley. Sein Fahrer hatte in der Zwischenzeit irgendwo eine Kleinigkeit gegessen und dann vor dem Restaurant auf ihn gewartet. Léon selbst setzte sich nie ans Steuer. Er besaß nicht einmal den Führerschein.
Im Wagen lief die Klimaanlage, und die getönten Scheiben schützten nicht nur gegen neugierige Blicke, sondern auch gegen das helle Sonnenlicht. Der Fahrer lenkte den Wagen in östlicher Richtung über den Boulevard Montparnasse.
Léon hatte das Jackett seines sandfarbenen Anzugs (ein Gemisch aus Seide und feinster Pimabaumwolle) neben sich auf die Rückbank gelegt und rief Yves Ribanvilles Assistenten Delpierre im Fernsehstudio an. Er ließ sich noch einmal bestätigen, dass er keinesfalls vor neunzehn Uhr im Sender sein musste. Das war gut, denn Léon Soulier hatte noch einige wichtige Dinge zu erledigen und fuhr deshalb in die Konzernzentrale in der Rue Poliveau.
Auf der Höhe des Krankenhauses Val de Grâce entdeckte er Eric Lecadre, der mit einem Strauß Blumen in der Hand gerade aus einem Taxi stieg.
»Halten Sie mal kurz an, Raymond«, sagte Léon zu seinem Fahrer. Léon ließ die Scheibe herunter und rief quer über die Straße: »Eric?«
Erstaunt drehte Eric Lecadre den Kopf, dann lachte er.
»Léon! So ein Zufall. Ich sag's ja immer: Paris ist ein Dorf!« Er wartete, bis die Ampeln auf Rot schalteten, überquerte die Straße, beugte sich ins offene Wagenfenster und grinste. »Lange nicht gesehen, oder?« Das sollte ein Witz sein, denn sie hatten sich erst kürzlich unter ebenso ungewöhnlichen wie erbaulichen Umständen getroffen. »Bin gerade auf dem Weg zu einem Krankenbesuch. Eine Kollegin vom Theater. Komplizierter Beinbruch. Und du?«
»Frédéric und ich waren zusammen beim Mittagessen. Du kommst doch heute Abend, oder?«
»Natürlich! Chantal wird auch dabei sein. Und deine Frau?«
»Sie ist mit Benoît schon in Biarritz. In einer Woche komme ich nach.«
»Hast du Lampenfieber, Léon?«
»Ach Quatsch! Bei den läppischen Fragen, die zu erwarten sind? Ich hab schon ganz andere Sachen überstanden.« Beide lachten.
Mit der flachen Hand schlug Eric leicht auf das Dach des Wagens, eine Art liebevoller Klaps.
»Ich muss los. Krankenbesuche, darum drängt man sich ja nicht gerade. Ich bin froh, wenn ich da wieder raus bin.«
»Salut Eric! Bis später.« Léon schloss die Scheibe und gab seinem Fahrer das Zeichen, weiterzufahren. Eric ging über die Straße auf den Eingang des Krankenhauses zu, drehte sich noch einmal um und winkte dem Bentley nach.
4. Kapitel
Zäh und scheinbar endlos zog sich der Nachmittag dahin. Chantal Coquillon lag in ihrem abgedunkelten Schlafzimmer und spürte die schwitzende Masse ihres Körpers wie eine Last, die sie nie wieder würde abschütteln können. Der seidene Morgenrock, über den schweren Brüsten geöffnet, klebte ihr auf der Haut. Ihr Atem ging rasselnd. Sie wusste, dass sie unbedingt mit dem Rauchen aufhören sollte, doch sie schaffte es einfach nicht. Immer wieder hatte sie mit guten Vorsätzen angefangen, und spätestens nach drei Tagen gab sie auf. Auch jetzt war die Gier nach dem Gift überwältigend. Auf dem Nachttisch lag eine Schachtel Pall Mall ohne Filter, ihre Marke seit vierzig Jahren. Sie kämpfte noch einen Augenblick mit sich, seufzte dann und griff nach der roten Packung und dem Billigfeuerzeug aus dem Supermarkt. Schon der erste Zug hatte etwas Beruhigendes. Obwohl sie gleich nach dem Mittagessen ein Valium geschluckt hatte, in der Hoffnung auf einen Mittagsschlaf, fühlte sie sich wie aufgeputscht. Die Tabletten wirkten nicht mehr. Das stellte sie schon seit Wochen fest und hatte sich vorgenommen, ihren Arzt nach etwas Stärkerem zu fragen.