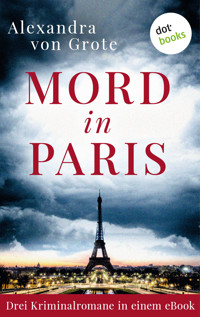5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar LaBréa
- Sprache: Deutsch
Tanz in den Tod: Der packende Kriminalroman „Der letzte Walzer in Paris“ von Alexandra von Grote jetzt als eBook bei dotbooks. Eiskalte Spannung aus Paris: Die 78-jährige Madame Géminard wird erdrosselt in ihrer Pariser Wohnung aufgefunden. Offenbar tanzte die passionierte Walzertänzerin bis zu ihrer letzten Sekunde mit ihrem Mörder. Doch niemand hat den Täter gesehen, und auch die Fingerabdrücke vor Ort bringen Kommissar LaBréa nicht weiter. Als auf dem Gelände eines Pariser Bahnhofs eine weitere Tote gefunden wird, sieht niemand einen Zusammenhang, denn dieses zweite Opfer ist offenbar schon vor vielen Jahren ums Leben gekommen. Doch dann macht Kommissar LaBréa eine schockierende Entdeckung: Die Fingerabdrücke an beiden Tatorten stimmen überein! Wann wird der Täter wieder zuschlagen? LaBréa muss handeln – und die Spur führt ihn direkt ins bekannte Tanzlokal „Paradis“ … Die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa wurde erfolgreich von Nico Hoffmanns Produktionsfirma teamworx (Donna Leon, „Die Sturmflut“, „Die Flucht“) verfilmt. Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: „Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.“ Freie Presse – „Der schönste Paris-Krimi seit langem." NDR – „Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.“ Fränkische Nachrichten – „Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.“ Stadtgespräch Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Der letzte Walzer in Paris“ von Alexandra von Grote. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch: Die 78-jährige Madame Géminard wird erdrosselt in ihrer Pariser Wohnung aufgefunden. Offenbar tanzte die passionierte Walzertänzerin bis zu ihrer letzten Sekunde mit ihrem Mörder. Doch niemand hat den Täter gesehen, und auch die Fingerabdrücke vor Ort bringen Kommissar LaBréa nicht weiter. Als auf dem Gelände eines Pariser Bahnhofs eine weitere Tote gefunden wird, sieht niemand einen Zusammenhang, denn dieses zweite Opfer ist offenbar schon vor vielen Jahren ums Leben gekommen. Doch dann macht Kommissar LaBréa eine schockierende Entdeckung: Die Fingerabdrücke an beiden Tatorten stimmen überein! Wann wird der Täter wieder zuschlagen? LaBréa muss handeln – und die Spur führt ihn direkt ins bekannte Tanzlokal „Paradis“ …
Die Presse über Alexandra von Grotes Kriminalromane: »Alexandra von Grote schreibt spannende Krimis, sie vermittelt ein Lebensgefühl voller Intensität und Leichtigkeit.« Freie Presse »Spannung, detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten »Ähnlich wie die Krimis der Skandinavier immer mit einer Spur Schwermut durchsetzt sind ... so sind die LaBréa-Krimis von der französischen Art, das Leben zu genießen, durchdrungen. Allein deshalb lohnt schon die Lektüre der Krimis von Alexandra von Grote.« Stadtgespräch
Über die Autorin: Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr.phil. Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin. Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt. Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Bei dotbooks erschienen bereits der Roman »Die Nacht von Lavara«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle: »Die unbekannte Dritte« »Die Kälte des Herzens« »Das Fest der Taube« »Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa: »Mord in der Rue St. Lazare« »Tod an der Bastille« »Todesträume am Montparnasse« »Der letzte Walzer in Paris« »Der tote Junge aus der Seine« »Der lange Schatten«
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website: http://www.alexandra-vongrote.de/
***
eBook-Neuausgabe August 2016
Copyright © der Originalausgabe 2010
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maira Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Bildmotivs von istockphoto/Beboy_Itd
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-579-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der letzte Walzer in Paris« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Der letzte Walzer in Paris
Ein Fall für Kommissar LaBréa
dotbooks.
Personenverzeichnis
Die Familie LaBréa
Maurice LaBréa, Commissaire bei der Brigade Criminelle am Pariser Quai des Orfèvres.
Jennifer, genannt Jenny, LaBréas zwölfjährige Tochter.
Freunde der Familie
Céline Charpentier, arbeitet als Malerin und ist LaBréas Nachbarin in Paris.
Monsieur Hugo, pensionierter Postbeamter und Concierge in LaBréas Haus.
Alissa, elf Jahre, Jennys beste Freundin.
Francine Dalzon, Alissas alleinerziehende Mutter und Besitzerin der Brûlerie.
Die Kollegen
Claudine Millot, Mitarbeiterin in LaBréas Team mit dem Dienstgrad Lieutenant.
Jean-Marc Lagarde, genannt der Paradiesvogel. Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Lieutenant.
Franck Zechira, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Capitaine.
Roland Thibon, genannt der Schöngeist, LaBréas direkter Vorgesetzter mit dem Dienstgrad Directeur.
Joseph Couperin, Ermittlungsrichter mit einer Vorliebe für klassische Musik.
Dr. Brigitte Foucart, Gerichtsmedizinerin
Prolog
Sie stellte den Radiorekorder im Wohnzimmer an und legte eine Kassette ein. Sofort hellte sich ihre Miene auf. Im heiteren Rhythmus der Akkordeontöne wiegte sie ihren Oberkörper leicht hin und her. Ein Lächeln, gedankenverloren und wie aus einer anderen Zeit, legte sich über ihre Züge.
Sie drehte die Lautstärke ein Stück weiter auf und schloss die Augen. Starke Arme, sehnig und muskulös, umfassten ihre Taille und wirbelten sie herum. Ein Schwindel erfasste sie – wie damals vor dem Krieg, als sie Kind war und auf dem Jahrmarkt vor dem Eiffelturm Karussell fuhr. Ganz benommen war sie nach den Fahrten, wenn sie dann an einer der Kirmesbuden Süßigkeiten und bunte Luftballons gekauft bekam.
Doch das war lange her.
Seitdem hatte das Leben sie mit all seinen Stürmen, Schrecken und Enttäuschungen heimgesucht und geprüft. Nur wenige Menschen überstehen eine solche Prüfung unbeschadet.
Sie war allein. Alberts Tod lag viele Jahre zurück. Von dem fernen Kontinent, wohin ihre einzige Tochter vor dreißig Jahren ausgewandert war, kamen keine Briefe mehr, keine Telefonate, nichts. Nie mehr! Der Tod war grausam in seiner Unabänderlichkeit. Die Brutalität dessen, was geschehen war, hatte ihr einige Zeit zu schaffen gemacht. Inzwischen war der Schmerz versiegt, wie ein Rinnsal in der Dürre, doch die Trauer hatte sie nie verlassen. An manchen Tagen stülpte sie sich über ihre Seele wie eine Glasglocke, unter der sie zu ersticken drohte.
An ihren eigenen Tod dachte sie jeden Tag. Mit einer gewissen Neugierde fragte sie sich manchmal, in welcher Gestalt er wohl käme? Und was würde wohl ihr letzter Gedanke sein, wenn es so weit war? Vielleicht hätte sie keine Gelegenheit zu einem letzten Gedanken, weil der Tod sie im Schlaf überraschte. Schnell und schmerzlos, anders, als es ihrer Tochter beschieden gewesen war. Das wäre das Beste und der einzige Wunsch, den sie noch haben würde.
Nein, nicht der einzige! Bevor sie sanft entschlief, wollte sie noch einen letzten Walzer tanzen …
Sie lächelte. Die Musik verklang. Das nächste Stück trug den Titel »Paris en Fête«. Sie kannte alle Stücke auf der Kassette.
Erneut drehte sie am Lautstärkeknopf und ging ins Bad. Als sie sich kurz darauf ankleidete, wählte sie die Garderobe sorgfältig aus. Ein gelb-lila geblümtes Seidenkleid mit langen Ärmeln, die mit einem schmalen Bündchen abschlossen. Dazu passten die lila Wildlederpumps, ihre Lieblingsschuhe. Noch einige Spritzer Chanel Nummer 5, die Turmalinkette ihrer Großmutter, den Brillantring, den Albert ihr 1951 zur Verlobung geschenkt hatte. Zufrieden betrachtete sie ihr Bild im Spiegel des Kleiderschranks. Mit der dunkelbraunen Echthaarperücke (leicht gelockt, Ponyfransen), die sie sich vor einer Woche zugelegt hatte, und derentwegen ihre spärlichen, grauen Haare ganz kurz geschnitten werden mussten, sah sie entschieden jünger aus, als sie war. Und so fühlte sie sich auch.
Die Uhr auf der Anrichte im Wohnzimmer zeigte kurz nach acht. Noch war keine Eile geboten. Der ganze Vormittag lag vor ihr. Doch sie wollte festlich gekleidet und geschminkt sein, für den Fall, dass er früher kam, sie vielleicht in ein Café ausführte (möglicherweise auch zum Mittagessen), bevor sie sich später in einem der Lokale ins Getümmel stürzten.
Es war ein Vergnügen, das sie sich beinahe jeden Sonnabendnachmittag gönnte.
Beschwingt spitzte sie die Lippen und pfiff die Melodie mit, die aus dem kleinen Rekorder laut durch die Wohnung klang.
Gegen halb neun klingelte es. War er das vielleicht schon? So früh kam er sonst nie … Ihr Herz schlug schneller. Sie zupfte die Perücke zurecht, fuhr mit der Zunge vorsichtig über ihre karmesinrot geschminkten Lippen, damit sie frisch und erwartungsvoll wirkten, und ging mit eiligen Trippelschritten zur Tür.
Sie hatte richtig vermutet. Etwas unbeholfen und schüchtern stand er im halb dunklen Treppenhaus. In der rechten Hand hielt er einen Blumenstrauß. Unter dem offenen Regenmantel trug er einen nachtblauen Nadelstreifenanzug mit silberner Krawatte. Die Augen waren hinter einer verspiegelten, dunkel getönten Brille verborgen.
»Komm rein«, sagte sie und betrachtete ihn wohlwollend. Dass sein Blick hinter der getönten Brille so gar nicht zu dem jungenhaften Lächeln passte, das er ihr wie üblich zur Begrüßung schenkte, bemerkte sie erst, als es zu spät war.
1. Kapitel
Der erste Oktobertag begann mit Regen. In feinen, gleichmäßigen Bahnen rann er über das Glasdach der Atelierwohnung und perlte nach unten, wo eine Regenrinne ihn auffing.
LaBréa erwachte und lauschte dem monotonen Geräusch, das so klang, als trommelten Finger in gleichmäßigem Rhythmus auf eine Schreibtischplatte.
Es war noch nicht hell draußen. LaBréa warf einen Blick auf den Wecker und ließ sich aufs Kissen zurückfallen. Er zog die Decke um die Schultern und beschloss, sich noch zehn Minuten zu gönnen und das angenehme Gefühl des Dämmerns auszukosten, halb im Schlaf, halb wach.
Er hatte geträumt. Die letzten Bilder des Traums verflüchtigten sich wie ein sommerlicher Duft, der sich zu rasch im Raum verteilt. Er befand sich in einem großen Haus mit vielen Zimmern. Die meisten von ihnen waren unbewohnt, die Möbel mit weißen Tüchern abgedeckt. Im Traum wurde deutlich, dass es LaBréas Elternhaus war. Doch es sah anders aus als das Haus seiner Kindheit. Plötzlich stand seine Tochter Jenny auf dem langen Flur, von dem rechts und links die Zimmer wie in einem Hotel abgingen. Sie trug ihren Fußballdress, und LaBréa wollte ihr sagen, dass sie mit den Stollenschuhen nicht über das gute Parkett laufen könne. Doch bevor er dazu kam, öffnete sich eine der Zimmertüren, und Céline betrat den Flur. In der figurbetonten Bluse und den gut sitzenden Jeans sah sie attraktiv und sexy aus. Sie lächelte, hakte Jenny unter, und beide kamen strahlend auf LaBréa zu. Das Kläcken von Jennys Fußballschuhen hallte tausendfach wider. Als sie bei ihm waren, nahmen sie ihn in die Mitte, und Jenny sagte: »Jetzt!« Sie sprang in die Luft. Céline tat es ihr nach. LaBréa nahm erstaunt wahr, dass beide über dem Fußboden schwebten. Dann sprang auch er hoch und schwebte plötzlich. Wie schwerelos glitt er über den Flur, der nach oben hin offen war und den Blick auf einen wolkenlosen Himmel freigab. Immer höher flog LaBréa, bis er die Stadt aus der Vogelperspektive sah. Und Jenny und Céline folgten ihm …
LaBréa atmete tief durch und wollte sich noch einmal das Gefühl seines schwebenden Körpers in Erinnerung rufen, der im Traum die Gesetze der Erdanziehung außer Kraft gesetzt hatte. Doch es gelang ihm nicht.
Er wälzte sich noch einige Male hin und her, schlug dann die Bettdecke zurück und streckte sich.
***
Als er die Schlafzimmertür öffnete, drangen aus der Küche leise Stimmen.
»Seid ihr etwa schon auf?«, rief LaBréa und gähnte.
»Haben wir dich geweckt?«, kam Jennys Gegenfrage.
»Nein, das nicht«, brummte LaBréa und ging in die Küche. »Aber dass ihr so früh schon wach seid, wundert mich, ehrlich gesagt.«
Beinahe wäre LaBréa über Kater Obelix gestolpert, der satt und zufrieden ins Wohnzimmer stolzierte und offenbar schon gefressen hatte.
Am Tisch unter dem Fenster, durch das man in den kleinen Garten sah, saßen LaBréas Tochter Jenny und ihre Freundin Alissa. Beide trugen Schlafanzüge und Hausschuhe. Sie tranken Orangensaft und löffelten soeben die letzten Reste aus ihren Müslischalen.
LaBréa gab seiner Tochter drei Küsschen auf die Wangen.
»Morgen, Chérie.«
»Morgen, Papa.«
»Morgen, Alissa. Gut geschlafen?«
»Morgen, Monsieur«, sagte Alissa und warf ihm einen kurzen Blick aus ihren stark geröteten Augen zu.
LaBréa legte seine Hand auf ihre Schulter und fragte besorgt: »Hast du geweint?«
»Das sind ihre neuen Kontaktlinsen«, warf Jenny rasch ein. »Die verträgt sie nicht so gut. Aber der Trainer hat gesagt, mit der Brille kann sie nicht mehr im Tor stehen.«
»Ich weiß, ich weiß!« Ein wenig abwehrend hob LaBréa die Hände. »Diese Geschichte höre ich jetzt mindestens zum fünften Mal.«
Jenny sah ihren Vater missbilligend an und verzog genervt den Mund.
»Mit den Kontaktlinsen, das stimmt«, sagte Alissa. »Aber außerdem schlafe ich nicht so gut in letzter Zeit.« Sie nahm die Müslischale hoch und trank einen Rest Milch.
»Hm.« LaBréa nickte. Er wusste, warum Alissa geweint hatte, und versuchte sie zu trösten: »Das wird schon werden, Alissa. Glaub mir. Du kommst darüber hinweg, auch wenn es vielleicht noch eine Weile dauert.«
»Das habe ich ihr auch gesagt«, mischte sich Jenny ein. »Wenn die Eltern sich trennen, kann man nichts machen. In den meisten Fällen nehmen sie sowieso keine Rücksicht auf die Kinder.«
Sie nickte ihrem Vater bedeutungsvoll zu, und LaBréa verkniff sich ein Schmunzeln. Woher hatte seine Tochter bloß diese altkluge Art?
»Die neue Frau ihres Vaters ist total doof«, fuhr Jenny fort. »Aber heute ist Sonnabend, und das Gericht hat ja festgelegt, dass Alissa an den Wochenenden zu ihrem Vater soll.«
LaBréa sah, dass dem Mädchen erneut die Tränen kamen. Rasch legte er wieder seine Hand auf ihre Schulter und meinte: »Dein Papa ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Du hast dich mit ihm immer gut verstanden, oder?«
Alissa nickte.
»Na also. Sei nicht traurig. Das Ganze ist ja noch ziemlich frisch. Es braucht seine Zeit, bis sich alles einspielt. Ich weiß, das ist kein Trost. Aber es geht vielen Kindern wie dir. Und oft noch schlimmer.«
Alissa schob ihre Schüssel beiseite und sah Jenny an.
»Mir reicht es schon, wie es bei mir ist. Wenn ich Jenny nicht hätte, mit der ich über alles reden kann, ich weiß gar nicht …« Der Rest ihres Satzes ging in einem Schluchzen unter. Jenny sprang auf, ging zu ihrer Freundin und legte tröstend den Arm um sie.
»Weine nicht, Alissa. Vielleicht kannst du deinen Vater anrufen und ihm sagen, dass du heute nicht kommst?«
»Das geht nicht.« Alissa schnäuzte sich die Nase. »Dann denkt Papa doch, Maman hätte mich aufgewiegelt, damit ich am Wochenende nicht zu ihm gehe. Das redet ihm alles diese blöde Ziege ein. Ständig hetzt sie gegen mich und Maman.«
LaBréa warf einen Blick auf die Küchenuhr, die neben dem Fenster an der Wand hing.
»Viertel nach sieben«, sagte er. »Ich gehe mich jetzt schnell rasieren, und dann könnt ihr ins Bad.«
Gleich darauf schlurfte er durchs Wohnzimmer. Obelix lag auf seinem Lieblingsplatz im Sessel und schlief. LaBréa strich ihm übers Fell und murmelte ein paar Worte. Obelix öffnete kurz sein linkes Auge, nur um es gleich wieder zu schließen.
***
Als LaBréa sich seinen Trenchcoat überzog und mit den Mädchen die Wohnung verließ, meinte Jenny: »Wir haben heute nur bis zwölf Uhr Schule. Um zwei machen wir ein Testspiel gegen eine Mädchenmannschaft aus Versailles.«
»Esst ihr dann in der Kantine?«
»Ja, leider«, erwiderte Jenny seufzend. »Und sonnabends ist das Essen noch schlimmer als in der Woche. Die sparen, wo sie nur können. Ich kriege Magenschmerzen, wenn ich nur daran denke!«
LaBréa nickte ergeben. Auch das Thema »Schulkantine« kannte er zur Genüge. Zu Hause war Jenny nie mäkelig, was das Essen anging. Doch mit der Schulkantine stand sie permanent auf Kriegsfuß.
Kurz darauf überquerten sie den Innenhof. Der Regen hatte nachgelassen. Vor dem Barometer an der Schuppenwand stand Monsieur Hugo, der Concierge. Er drehte sich zu LaBréa, begrüßte ihn und meinte skeptisch: »Keine Chance, Commissaire. Im Moment regnet es zwar kaum noch, aber da freuen wir uns zu früh. Die Ausläufer des Bretagne-Tiefs legen gegen Mittag erst richtig los. Dauerregen bis mindestens morgen Abend und heftige Gewitter.«
Jenny und Alissa tauschten einen raschen Blick, und Alissa meinte ein wenig resigniert: »Superwetter für unser Spiel. Da steht die Torlinie total unter Wasser.«
»Schönen Tag noch, Monsieur«, rief LaBréa dem Concierge zu und hob grüßend die Hand. Monsieur Hugo lachte.
»Tja, den mache ich mir. Ich hab mir in der Videothek ein paar amerikanische TV-Krimiserien ausgeliehen.« Er lächelte verschmitzt. »Sie kennen ja meine Leidenschaft fürs Verbrechen, Commissaire.«
Und ob LaBréa diese Leidenschaft kannte! Wenige Monate, nachdem er mit Jenny in dieses Haus gezogen war, hatte Monsieur Hugo begonnen, LaBréa bei aktuellen Ermittlungen Ratschläge zu erteilen. Er stellte Theorien über Tatmotive auf, spekulierte über mögliche Verdächtige. So gut er konnte, ging LaBréa solchen Gesprächen aus dem Weg. Wenn es sich nicht vermeiden ließ, griff er Monsieur Hugos – überwiegend absurde – Ideen zum Schein auf und versprach, den Hinweisen nachzugehen. Als der Concierge vor wenigen Monaten vom Bastille-Killer zusammen mit Jenny als Geisel genommen wurde, hatte sein »kriminalistisches Gespür« allerdings kläglich versagt. Mit einem simplen Verkleidungstrick hatte der Mörder ihn damals überrumpeln können.
Während die Mädchen Richtung Straße gingen, klopfte LaBréa kurz ans Atelierfenster seiner Nachbarin Céline. Seit geraumer Zeit waren er und die Malerin ein Paar. Sie hatten bereits ihre erste Beziehungskrise hinter sich, denn LaBréa hatte Céline mit seiner alten Jugendfreundin Jocelyn betrogen. Der Vorfall war inzwischen vergessen und stand nicht mehr zwischen ihnen. Sie trafen sich täglich, aßen oft gemeinsam mit Jenny in LaBréas Wohnung zu Abend, gingen am Wochenende ins Kino. Wenn Jenny bei Alissa über Nacht in der Brûlerie blieb, schlief Céline in LaBréas Wohnung. Inzwischen hatte Jenny sich daran gewöhnt, dass es im Leben ihres Vaters eine neue Frau gab. Mit Céline verstand sie sich gut, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, dass Céline beim Thema »Mädchenfußball« eisern zu Jenny hielt und deren Leidenschaft für Fußball teilte.
»Ich weiß gar nicht, wieso du dich so darüber aufregst«, hatte Céline ihm einmal gesagt. »Lass sie doch. Sie hat Spaß daran. Andere Mädchen in ihrem Alter sitzen nur noch vor dem Computer oder haben sogar schon einen Freund. Sei froh, dass sie Sport treibt und in ihrer Freizeit nicht irgendwo rumhängt.«
Gelegentlich dachte LaBréa an die letzte Weltmeisterschaft in Deutschland, als die beiden pausenlos vor dem Fernseher hockten. Als Zinédine Zidane im Endspiel gegen Italien nach seinem Foul vom Platz gestellt wurde, hatten beide geweint, während LaBréa kopfschüttelnd in der Küche stand und sich einen Drink mixte.
Die Vorhänge waren zugezogen, was LaBréa ungewöhnlich fand, da Céline im Allgemeinen immer früh aufstand. Vielleicht war sie einkaufen gegangen. Er beschloss, sie etwas später anzurufen.
***
In der Rue Charlemagne, in der Jennys Schule lag, stauten sich die Autos. Eltern setzten ihre Kinder ab, Lehrer suchten nach einem Parkplatz. LaBréa verabschiedete sich von den beiden Mädchen.
»Also dann, macht's gut und viel Spaß beim Spiel heute.«
LaBréa wollte gerade die Straße überqueren, als in langsamem Tempo ein roter Porsche heranrollte und seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Mann hinter dem Steuer beugte sich zu seiner Beifahrerin und tauschte einen langen Kuss mit ihr. Jetzt stieg die Frau aus. Es war Jocelyn Borei, LaBréas Jugendfreundin, mit der er vor einigen Monaten eine Affäre gehabt hatte. Als Lehrerin an Jennys Schule unterrichtete sie die höheren Klassen. Wie stets war sie elegant gekleidet. In einer wohlkalkulierten Bewegung warf sie ihre blonde Mähne zurück, hob lässig die Hand und lächelte LaBréa zu.
»Hallo, Maurice«, sagte sie mit ihrer tiefen, wohlklingenden Stimme und blickte ihm einen Moment in die Augen. Lag in ihrem Blick so etwas wie Genugtuung? Ein kleines, weibliches Triumphgefühl? Offenbar war der Fahrer des Luxusschlittens ihr neuer Freund. Ja, sie genoss die Vorstellung, dass LaBréa vielleicht beeindruckt war, möglicherweise sogar eifersüchtig.
Doch da täuschte sie sich. Für LaBréa war ihre Affäre endgültig abgeschlossen. Auch die schönsten Jugenderinnerungen verblassen irgendwann. Er mochte sie, mehr aber auch nicht. Das hatte er ihr unmissverständlich klargemacht. LaBréa lächelte zurück: »Hallo, Jocelyn!« Mit eiligen Schritten ging Jocelyn auf den Eingang der Schule zu und drehte sich noch einmal nach ihm um. LaBréa fasste den Porschefahrer etwas genauer ins Auge. Mit seinen gewellten braunen Haaren und der randlosen Brille sah er gut aus. Er erinnerte LaBréa an jemanden, doch ihm fiel nicht ein, an wen. Jemand, den er aus den Medien kannte. Ein Politiker? Jemand aus der Showbranche? LaBréa schob den Gedanken beiseite und machte sich auf den Weg zu Francine Dalzons Brûlerie, wo er nach alter Gewohnheit frühstücken wollte.
Der heutige Sonnabend war sein freier Tag. Nach dem Frühstück hatte er einige Besorgungen zu erledigen, und anschließend wollte er in der Musikabteilung der Fnac im Quartier Latin nach einer seltenen Jazz-CD für seine Sammlung stöbern.
Kurz darauf überquerte LaBréa die Rue St. Antoine. In der Bäckerei Paul kaufte er zwei Croissants. Sonnabends waren es immer zwei. Die Tüte mit dem noch warmen Gebäck in der Hand schlenderte er zur Place des Vosges. Céline fiel ihm wieder ein, und er fischte sein Handy aus der Manteltasche. Nach fünfmaligem Klingeln meldete sie sich.
»Hallo, Céline«, sagte LaBréa.
»Morgen, Maurice.« Célines Stimme hörte sich kühl und distanziert an. LaBréa stutzte.
»Ich hab vorhin an dein Fenster geklopft. Warst du nicht zu Hause?«
»Doch.« Es klang gedehnt und wie von weit her.
»Aber?«, hakte LaBréa nach und wunderte sich, dass Céline so kurz angebunden war. Er fragte sich, welchen Grand es dafür gab. »Wolltest du mich nicht sehen?«
»Ich habe Besuch, Maurice. Adrien ist gestern Abend gekommen.«
Abrupt blieb LaBréa stehen.
»Adrien?!«, sagte er ungläubig. »Ich denke, der lebt seit Jahren in England.«
»Er nimmt an einem Kongress in Paris teil und übernachtet während dieser Zeit bei mir.«
LaBréa schluckte. Adrien Castan (oder hieß er Castellan?) war Célines Exfreund. Vor drei Jahren hatten sie sich getrennt, und LaBréa wusste, dass die Trennung für Céline schmerzlich gewesen war. Jetzt tauchte Adrien plötzlich in Paris auf und wohnte bei Céline. Was hatte das zu bedeuten? Eifersucht stieg in ihm auf, ein Gefühl, das er normalerweise nicht kannte.
»Wie lange bleibt er denn?«, wollte LaBréa wissen.
»Übers Wochenende.«
»Verstehe«, erwiderte LaBréa, obgleich er es nicht verstand. Wieso bot Céline diesem Adrien, der sie damals so schamlos betrogen und verlassen hatte, ihre Gastfreundschaft an? Angeblich hatte sie seit der Trennung keinen Kontakt mehr zu ihm, oder stimmte das etwa nicht? LaBréa beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen und sich Klarheit zu verschaffen.
»Läuft etwas zwischen euch, Céline?«, fragte er ohne Umschweife und spürte, wie sein Herz schneller schlug. »Dann sag es mir bitte. Ich habe keine Lust, in irgendwas hineinzugeraten.«
»In irgendwas hineinzugeraten, Maurice?« Ein leises Lachen ertönte; es erschien ihm fremd und voller Ironie. »Ausgerechnet du sagst das! In was bin ich denn hineingeraten, als ich vor einigen Monaten in Barcelona war und du nichts Besseres zu tun hattest, als mit deiner Jugendfreundin Jocelyn ins Bett zu steigen ? ! «
»Ach, so ist das!« LaBréas Stimme wurde unwillkürlich lauter. »Eine billige Retourkutsche!«
»Typisch für dich, dass du das sagst.«
»Ich dachte, wir hätten die Sache geklärt. Hattest du mir nicht gesagt, dass das nicht mehr zwischen uns steht?«
»Adrien hat geschäftlich in der Stadt zu tun und ist tagsüber unterwegs. Ich darf doch wohl bei mir übernachten lassen, wen ich will, oder nicht?«
»Natürlich darfst du das, Céline. Aber wenn dadurch deine alte Liebe wieder aufgefrischt wird, sieht es schon anders aus. Ich …«
Céline unterbrach ihn, und er meinte, so etwas wie Schadenfreude in ihrer Stimme zu hören.
»Eifersüchtig, Maurice? Jetzt siehst du selbst mal, wie das ist. Aber du wirst es schon überstehen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Wenn du willst, können wir morgen früh zusammen auf den Markt gehen. Adrien hat den ganzen Tag Termine.«
»Wie schön, dass ich dann der Lückenbüßer sein darf«, sagte LaBréa, und im gleichen Moment hasste er sich für seinen Sarkasmus. Doch es gelang ihm nicht, Wut und Enttäuschung zu unterdrücken. »Nein danke. Ich kann meinen Sonntag allein verbringen.«
Er schaltete sein Handy aus und steckte es in die Manteltasche.
Hoffentlich begegne ich diesem Typen nicht zufällig, dachte er. Auf dem Weg zu seiner Wohnung musste er an Célines Haustür vorbei, und da lag es nahe, dass man aufeinandertreffen konnte. Céline hatte ihm einmal ein Foto von Adrien gezeigt. Er war groß und blond, Mund- und Kinnpartie zeugten von ausgeprägter Willenskraft. Solche Männer bekamen immer das, was sie wollten. Und wenn ein Exfreund sich nach Jahren bei seiner Ehemaligen meldet, will er ja wohl an das anknüpfen, was einmal gewesen war. Erneut gab es LaBréa einen Stich. Der Verdacht ist ein schleichendes Gift, hatte er einmal gelesen. Oder war das einer jener klugen Sprüche, mit denen LaBréas Vorgesetzter, Direktor Thibon, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu glänzen pflegte? Hier erschien es einmal passend. Hatte Céline ihn letzte Nacht etwa mit Adrien betrogen? Unzufrieden mit sich selbst und der Situation presste er die Lippen zusammen und setzte seinen Weg fort.
2. Kapitel
Um diese Zeit herrschte sonnabends in der Brûlerie noch kein Betrieb. Die Gäste, die wochentags vor der Arbeit bei Francine noch schnell einen Kaffee tranken, blieben heute weg. Alissas Mutter stand hinter dem Tresen und blätterte in einer Tageszeitung. Als LaBréa ihr die Hand reichte und sie begrüßte, legte sie die Zeitung beiseite.
»Ah, Commissaire! Guten Morgen! Haben Sie die Mädchen zur Schule gebracht? Möchten Sie einen Kaffee?«
LaBréa nickte. Unauffällig musterte er Francine, die sich an der Espressomaschine zu schaffen machte. Sie sah übernächtigt aus und hatte in den letzten Wochen stark abgenommen. Ihr Haar hing stumpf und strähnig herab, ihre Kleidung wirkte nachlässiger als früher. Die Tatsache, dass ihr Mann sich Hals über Kopf in eine andere Frau verliebt hatte, war für sie völlig überraschend gekommen und hatte sie in eine tiefe Krise gestürzt. Wenige Tage nach der Scheidung hatte er dann seine neue Freundin geheiratet.
Francine stellte den Kaffee auf den Tresen, und LaBréa fragte vorsichtig: »Wie geht es Ihnen, Madame?«
Sie lächelte etwas verkrampft und atmete tief durch.
»Na ja, wie es einem so geht, wenn der Ehemann plötzlich den Turbo einlegt und sich ohne zu zögern in ein neues Leben katapultiert. Die schnellste Scheidung Frankreichs, hat mein Anwalt gesagt.« Ein depressiver Zug lag um ihren Mund. »Nicht mal drei Wochen, dann war er frei.«
LaBréa sah, dass ihre Hand zitterte.
»Verhält er sich denn korrekt?«, wollte er wissen. »Ich meine, finanziell, mit dem Unterhalt für Alissa?«
»Oh ja, da kann ich nicht klagen.« Es klang bitter. »Das läuft alles bestens. Er legt Wert darauf, als guter Vater dazustehen. In den Weihnachtsferien möchte er mit Alissa nach Martinique fliegen. Aber sie will nicht.«
»Weil seine neue Frau auch mitfliegt, nehme ich an.«
»Genau. Die beiden verstehen sich nicht.«
LaBréa biss in sein Croissant und gab zwei Stücke Zucker in den Kaffee.
»Sie hat auch keine Lust, die Wochenenden bei ihm zu verbringen«, fuhr Francine fort. »Weil er nie allein was mit ihr unternimmt.«
»Ich weiß«, sagte LaBréa. »Sie hat heute Morgen so etwas angedeutet. Reden Sie doch mal mit Ihrem Exmann.«
»Das kann ich mir sparen, das bringt gar nichts. Abgesehen davon, dass zwischen uns absolute Funkstille herrscht. Aber nicht durch meine Schuld. Er steht völlig unter dem Einfluss seiner neuen Frau. Sie lässt ihn praktisch keine Sekunde allein. Früher konnte er so was nicht ausstehen. Aber, na ja – ich weiß auch nicht, warum so viele Männer ab einem gewissen Alter glauben, all ihre früheren Überzeugungen über Bord werfen zu müssen, wenn eine junge Frau in ihr Leben tritt und den zweiten Frühling einläutet.«
Sie ließ sich ein Glas Wasser einlaufen und trank es in einem Zug leer. LaBréa nippte an seinem Kaffee und griff nach dem zweiten Croissant.
»Für Sie und Alissa tut mir das alles sehr leid«, sagte er mit vollem Mund. »Aber wenn ein Partner aus der Ehe ausbrechen will, ist es besser, man trennt sich. Zu kitten ist so etwas meistens nicht.«
»Das sage ich mir auch. Aber wenn einem plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird, kann einen kaum etwas trösten.«
Francines Worte versetzten ihm einen Stich. Er dachte an das unerfreuliche Telefonat mit Céline. Sie und Adrien saßen jetzt beim Frühstück. Schwelgten sie in Erinnerungen an alte Zeiten? Hatte Céline vergessen, wie sehr dieser Mann sie damals verletzt hatte? Was war in der letzten Nacht zwischen ihnen passiert? Der Gedanke daran war ihm unerträglich.
Wie schnell doch ein Partner bereit ist, den anderen zu betrügen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, dachte er. Selbstmitleid ergriff ihn, ein Gefühl, das irgendwie guttat. Dass er selbst vor einigen Monaten
den ersten Schritt zum Seitensprung getan hatte, sah er als fernes Ereignis an, das keine Bedeutung mehr für ihn hatte. Es erschien ihm gemein und ungerecht, dass Céline sich jetzt offenbar dafür rächte.
***
Er hatte gerade den Seinequai erreicht, als von Westen her eine dunkle Wolkenwand aufzog. Sie verschluckte die wenigen Sonnenstrahlen, die sich zwischenzeitlich zaghaft gezeigt hatten. Ein eigenartiges, beinahe gelbliches Licht fiel auf die Häuserfassaden.
LaBréa schlug den Kragen seines Trenchcoats hoch und beschleunigte seine Schritte.
Sein Handy klingelte. Er fingerte es aus der Manteltasche. Es war Franck Zechira. Das konnte nichts Gutes bedeuten.
»Morgen, Franck, was gibt's?«, fragte LaBréa und blieb stehen.
Schweigend hörte er den Ausführungen seines Mitarbeiters zu.
»Gut«, sagte er dann. »Ist Dr. Foucart schon unterwegs? Aha. Und Claudine und der Paradiesvogel? Umso besser. Ich bin jetzt an der Place St. Gervais. Ich mache mich gleich auf den Weg und bin in zehn Minuten da.«
***
Der Straßenabschnitt vor der Hausnummer 15, Rue Barbette im 3. Arrondissement, war abgesperrt. Mehrere Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht, sowie ein Leichenwagen parkten vor dem Haus, einem Fin-de-Siecle-Gebäude mit dunkel verfärbter Sandsteinfassade.
Claudine wartete bereits auf ihn. In knappen Worten setzte sie LaBréa von den Ereignissen in Kenntnis.
»Der Name der Frau ist Griseldis Géminard, achtundsiebzig Jahre alt, verwitwet.«
»Griseldis?« LaBréa lachte. »Komischer Vorname. Klingt irgendwie altertümlich.«
»Mittelalter, Chef. Keltisch oder angelsächsisch, vermute ich.«
»Wer hat sie gefunden?«
»Der Nachbar. Franck ist gerade bei ihm und befragt ihn. Die Tür war nur angelehnt, und er hat sie durch Zufall gefunden.«
»Gibt es eine Concierge in diesem Haus?«
»Ja, sie wohnt im Hinterhof. Aber sie ist übers Wochenende verreist, hat der Nachbar gesagt. Sonntags gegen sechs käme sie meistens wieder, meinte er.«
Sie stiegen die steinerne Treppe hinauf, die vom Hausflur in den zweiten Stock führte. Unterwegs begegneten sie dem Polizeifotografen, der LaBréa kurz begrüßte und ihm versprach, dass die Fotos in der nächsten halben Stunde auf LaBréas Rechner sein würden.
Die Wohnung der Toten, vier Zimmer, Küche und Bad, vermittelte einen Eindruck von Gediegenheit. Es gab antike Möbel und Teppiche, Glasvitrinen mit edlem Porzellan, bequeme, geblümte Polstermöbel. An den Wänden hingen alte Stiche und mehrere Stillleben in Öl. In einem Bücherregal entdeckte LaBréa juristische Fachliteratur. Die Menschen, die hier gewohnt hatten, hatten einen gehobenen, bürgerlichen Lebensstil gepflegt. Die Wohnung war in tadellosem Zustand, keins der Zimmer war durchsucht oder verwüstet worden, so dass auf den ersten Blick nichts auf einen Raubmord schließen ließ.
Der Leichnam lag auf dem Bett im Schlafzimmer, an dessen Längsseite ein Kleiderschrank aus gedrechseltem Nussbaumholz stand. Brigitte Foucart, die Gerichtsmedizinerin, hatte bereits mit ihrer Arbeit begonnen. Ganz gleich, wann in Paris ein Mord geschah, wenn der Fundort der Leiche in Brigittes Einsatzgebiet lag, war sie stets eine der Ersten am Tatort, meistens sogar noch vor LaBréa und seinen Mitarbeitern.
Die Tote trug ein auffälliges Seidenkleid und dazu passende lila Schuhe, von denen der linke unters Bett gerutscht war, genau wie die Handtasche der Frau aus schwarzem Krokoleder. Griseldis Géminard lag auf dem Rücken und hatte die Arme weit ausgebreitet.
Wie Christus am Kreuz, dachte LaBréa. Die alte Frau trug eine Perücke, die ihr halb vom Kopf gerutscht war. Durch ihre spärlichen weißgrauen, zu einem kurzen Mecki geschnittenen Haare schimmerte die helle Kopfhaut. Zunächst entdeckte LaBréa keine äußeren Verletzungen; es war auch kein Blut zu sehen. Er wartete, dass Brigitte Foucart sich äußerte.
»Sie wurde erdrosselt«, sagte diese im selben Moment, als ahnte sie LaBréas Gedanken.
»Womit?«
»Mit etwas sehr Weichem, vermute ich. Vielleicht ein Seidenschal, ein Tuch oder Ähnliches.«
Brigitte zeigte auf den Hals der Toten. Dort war nur eine leichte Verfärbung zu sehen.
»Es gibt keine ausgeprägten Strangulierungsmerkmale, wie bei einem Strick, einer Drahtschlinge oder einem Gürtel beispielsweise.«
LaBréa nickte. Dass das Opfer stranguliert worden war, erkannte er jetzt an anderen, typischen Anzeichen. An den Blutungen in den Augen der Frau, den Hämatomen im gesamten Kopfbereich. Ihr zartes Gesicht mit den fein geschwungenen Brauen, die auf altmodische Weise rasiert und mit einem dünnen Strich nachgezogen waren, ähnelte einem zerbrechlichen Puppenantlitz. Der schmale Mund war an der Oberlippe herzförmig geschminkt, damit er voller wirkte. In jüngeren Jahren hätte man sie wohl als hübsch bezeichnet. Jetzt durchzogen Kerben und Falten ihre welken Wangen, die Mundpartie und die Stirn, wie Risse in einem ausgetrockneten Flussbett. Die Haut unter dem Kinn hing schlaff herunter. Der gnadenlose Prozess des Alterns, dachte LaBréa. Irgendwann hat er uns alle im Griff …
»Ein Schal oder Ähnliches lag hier nirgendwo herum«, bemerkte Jean-Marc, der sich zu ihnen gesellt hatte. Wie stets war er schrill und bunt gekleidet, was ihm den Spitznamen »Paradiesvogel« eingebracht hatte.
Brigitte erhob sich und strich ihren Schutzoverall glatt.
»Vielleicht wurde die Mordwaffe, wenn ich das mal so sagen darf, wieder schön säuberlich zusammengefaltet und in den Kleiderschrank zurückgelegt«, bemerkte sie. »Ältere Damen besitzen oft eine ganze Sammlung von Tüchern und Seidenschals.«
»Das können wir ja feststellen.« LaBréa gab Claudine und Jean-Marc einen Wink. Beide begannen mit der Durchsuchung der Wohnung, wobei Claudine sich gleich den Kleiderschrank vornahm.
LaBréa wandte sich wieder an die Gerichtsmedizinerin. »Der Todeszeitpunkt, Brigitte?«
Die Antwort kam rasch.
»Lange liegt sie noch nicht hier, Maurice. Nur das Kiefergelenk ist schon starr. Rigor Mortis, die Totenstarre, könnte also etwa eine halbe Stunde nach dem Exitus eingesetzt haben. Aber hier, sieh mal.« Die Gerichtsmedizinerin hob vorsichtig den Arm der Toten an. Die Gelenke ließen sich ohne Probleme bewegen. »Meiner Einschätzung nach ist sie höchstens zwei Stunden tot. Aber das ist natürlich noch nicht amtlich. Außerdem vermute ich, dass sie von hinten stranguliert wurde. Möglicherweise im Stehen. Sie ist eine kleine, zierliche Person. Für jemanden mit normaler Körperkraft war das kein Problem. Danach hat der Mörder sie aufs Bett gelegt. Hindrapiert, sozusagen.«
»Sie hatte sich schick gemacht,« sagte LaBréa nachdenklich. »Geschminkt, ihre Perücke aufgesetzt. Wollte sie ausgehen? So kleidet sich doch normalerweise niemand an einem regnerischen Oktobersonnabend.«
»Vor allem nicht schon morgens.«
LaBréa hob vorsichtig den Rocksaum des Kleides hoch. Wäsche und Strumpfhose der Toten schienen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Fragend sah er Brigitte an.
»Sieht nicht so aus, als wäre sie vergewaltigt worden, oder?«
»Das ist auch mein erster Eindruck«, erwiderte diese. »Aber ich will erst die Autopsie abwarten. Man kann nie wissen. Heutzutage ist alles möglich.«
La Brea gab ihr Recht. Noch einmal betrachtete er den Leichnam und fragte sich, wer und aus welchem Grund an einem Sonnabendmorgen eine alte Frau erwürgen sollte? Er atmete tief durch.
»Dein persönlicher Eindruck, Brigitte?«
Die Gerichtsmedizinerin wiegte nachdenklich den Kopf.
»Na ja, wenn du mich so direkt fragst – ich denke, sie kannte ihren Mörder. Oder ihre Mörderin. Auch für eine Frau wäre es nicht schwer gewesen, sie zu töten, so zierlich, wie das Opfer ist. Keine Kampfspuren, soweit ich feststellen kann. Ganz offensichtlich hat sie sich nicht gewehrt. Und wenn, dann nur ganz schwach.«
»Das deckt sich mit meiner Vermutung. Die Tür wurde nicht aufgebrochen. Wahrscheinlich hat sie den Mörder hereingelassen, möglicherweise sogar erwartet.«
»Ich kann dir mehr sagen, wenn wir ihre Fingernägel auf Hautpartikel und Faserspuren untersucht haben.«
LaBréa nickte. Dann schüttelte er den Kopf.
»Warum bringt jemand eine alte Frau um? In dieser Wohnung fehlt augenscheinlich nichts, und ein Sexualdelikt scheidet wohl auch aus.«
Brigitte zuckte nur mit den Schultern und gab ihren Leuten Anweisung, den Leichnam fortzuschaffen.
***
10. September 2001
Die Zeit strich durchs Zimmer, nimmersatt und geräuschlos. Es war kein richtiges Zimmer. Eher eine Behausung. Ein Verschlag. Eine Schlafstatt. Ein Dach überm Kopf. Ein wenig Schutz in einer Welt, in der für ihn kein Platz reserviert worden war.
Mit weit aufgerissenen Augen lag er da und starrte in die Dunkelheit, die sich wie ein Schlund öffnete. Von fern drangen die immer gleichen Geräusche an sein Ohr. Manchmal kamen sie näher, dann entfernten sie sich wieder.
Die Luft war heiß und stickig, obwohl der Sommer zu Ende ging.
September. Eine Nacht im September. Eine Nacht wie viele andere in seinem Leben.
Wie viel Uhr mochte es sein? Er wusste es nicht, wollte es auch nicht wissen. Vor einer Weile war die Tür ins Schloss gefallen. Er hatte sich schlafend gestellt, als der Besucher sich über ihn beugte und sein stinkender Atem über seine Wangen strich wie ein giftgetränktes Tuch. Nachdem der Mann gegangen war, ertönten wenig später Dollys Schritte auf dem Holzfußboden. Sie ging zum Waschbecken, drehte den Hahn auf.
Er öffnete die Augen einen Spalt. Dolly wandte ihm den Rücken zu. Die weit ausgeschnittene Bluse glitt von ihren Schultern, die im Dunkeln seltsam schimmerten. Wie immer trug sie keinen Büstenhalter. Reglos beobachtete er sie. Dolly zog die Nase hoch und räusperte sich, als sie sich mit routinierten Bewegungen unter den Achseln und zwischen den Beinen wusch. Dann wurde der Wasserhahn abgedreht, und sie griff nach dem Handtuch, das auf dem Hocker neben dem Becken lag.
»Bist du wach?«, fragte sie ihn, doch ihre Stimme klang so, als erwarte sie keine Antwort. Und so antwortete er auch nicht, schloss nur rasch die Augen und tat weiter so, als schliefe er.
Ihre Schritte entfernten sich.
Er drehte sich zur Wand und seufzte. Etwas musste geschehen.
Er hörte, wie sie die Flasche aufschraubte. War es die zweite oder die dritte an diesem Tag? Billiger Fusel vom Discounter an der Ecke. Von draußen drangen die gewohnten Geräusche herein und mischten sich mit der Musik von der Kassette.
Endlich schlief er ein.
***