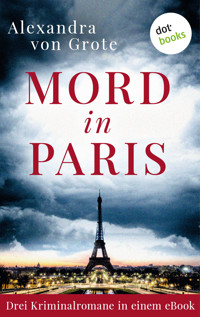
9,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Stadt der Liebe hat tiefe Abgründe: Der fesselnde Krimi-Sammelband »Mord in Paris« von Alexandra von Grote jetzt als eBook bei dotbooks. Paris, eine Stadt wie ein Traum – und doch schläft das Verbrechen hier nie … Kommissar LaBréa lässt sich in seine Heimatstadt versetzen, weil er hofft, hier endlich die Erinnerungen an den tragischen Tod seiner Frau verarbeiten zu können. Doch schon bald muss er nicht nur die Schattenwelt der Filmindustrie kennenlernen, sondern auch die mörderischen Seiten der französischen Metropole: Bei einem besonders spektakulären Fall deutet zunächst alles auf einen Rachemord hin – doch dann wird eine weitere grausam zugerichtete Leiche entdeckt, der eine Kassette mit Ravels »Bolero« auf die Brust gelegt wurde. Hat der Täter noch weitere Opfer im Blick? Für LaBréa beginnt ein Wettlauf mit der Zeit … Spannend, abgründig, faszinierend: »Detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Krimi-Sammelband »Mord in Paris« von Alexandra von Grote versammelt die Bestseller »Mord in der Rue St. Lazare«, »Tod an der Bastille« und »Todesträume am Montparnasse«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1286
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Paris, eine Stadt wie ein Traum – und doch schläft das Verbrechen hier nie … Kommissar LaBréa lässt sich in seine Heimatstadt versetzen, weil er hofft, hier endlich die Erinnerungen an den tragischen Tod seiner Frau verarbeiten zu können. Doch schon bald muss er nicht nur die Schattenwelt der Filmindustrie kennenlernen, sondern auch die mörderischen Seiten der französischen Metropole: Bei einem besonders spektakulären Fall deutet zunächst alles auf einen Rachemord hin – doch dann wird eine weitere grausam zugerichtete Leiche entdeckt, der eine Kassette mit Ravels »Bolero« auf die Brust gelegt wurde. Hat der Täter noch weitere Opfer im Blick? Für LaBréa beginnt ein Wettlauf mit der Zeit …
Spannend, abgründig, faszinierend: »Detailverliebte Milieuschilderungen und stimmige Figuren sind die Zutaten eines Krimi-Menüs, das jedem Fan des Genres munden wird.« Fränkische Nachrichten
Über die Autorin:
Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr. Phil.
Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin.
Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt.
Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website:
www.alexandra-vongrote.de/
Bei dotbooks erschienen bereits der Roman »Die Nacht von Lavara«, der Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle:
»Die unbekannte Dritte«
»Die Kälte des Herzens«
»Das Fest der Taube«
»Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa:
»Mord in der Rue St. Lazare«
»Tod an der Bastille«
»Todesträume am Montparnasse«
»Der letzte Walzer in Paris«
»Der tote Junge aus der Seine«
»Der lange Schatten«
Die ersten drei Fälle von Kommissar LaBréa sind in diesem Sammelband enthalten.
***
eBook-Sammelband-Originalausgabe August 2020
Das Copyright der Einzelbände finden Sie gesammelt am Ende dieses eBooks.
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/ZaZa Studio und AdobeStock/Beboy
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-047-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Mord in Paris« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Mord in Paris
Drei Kriminalromane in einem eBook: »Mord in der Rue St. Lazare«, »Tod an der Bastille« und »Todesträume am Montparnasse«
dotbooks.
Die Familie LaBréa
Maurice LaBréa, Commissaire bei der Brigade Criminelle am Pariser Quai des Orfèvres.
Jennifer, genannt Jenny, LaBréas zwölfjährige Tochter.
Freunde der Familie
Celine Charpentier, arbeitet als Malerin und ist LaBréas Nachbarin in Paris.
Monsieur Hugo, pensionierter Postbeamter und Concierge in LaBréas Haus.
Alissa, elf Jahre, Jennys beste Freundin.
Francine Dalzon, Alissas alleinerziehende Mutter und Besitzerin der Brûlerie.
Die Kollegen
Claudine Millot, Mitarbeiterin in LaBréas Team mit dem Dienstgrad Lieutenant.
Jean-Marc Lagarde, genannt der Paradiesvogel, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Lieutenant.
Franck Zechira, Mitarbeiter in LaBréas Team, Dienstgrad Capitaine.
Roland Thibon, genannt der Schöngeist, LaBréas direkter Vorgesetzter mit dem Dienstgrad Directeur.
Joseph Couperin, Ermittlungsrichter mit einer Vorliebe für klassische Musik.
Dr. Brigitte Foucart, Gerichtsmedizinerin.
Mord in der Rue St. Lazare
Kommissar LaBréa hofft auf den Zauber von Paris. Um über die Ermordung seiner Frau hinwegzukommen, hat er sich in seine Heimatstadt versetzen lassen. Und tatsächlich: die Wiederentdeckung der vertrauten Straßen und Plätze, die Ruhe in seiner gemütlichen Wohnung im Herzen des Marais-Viertels – das besondere Flair der Stadt scheint zu wirken. Doch dann wird ein bekannter Filmproduzent ermordet. Kommissar LaBréa ermittelt unter Hochdruck und stößt auf ein Netz aus Intrigen, Lügen und Erpressung …
Für M. in Dankbarkeit und in Erinnerung an »unser Paris«
»Es gibt immer ein Drehbuch, auch wenn du es nicht immer kennst.«
JOYCE CAROL OATES, Blond
1. KAPITEL
Anne stand am anderen Ufer des Sees und winkte ihm aufgeregt zu. Er wollte seine Hand heben und zurückwinken, doch sein Arm ließ sich nicht bewegen, gehorchte ihm nicht. Das Wasser im See, eine dunkle, glatte, fast ölige Fläche, schäumte plötzlich auf und überspülte die Uferböschung, von der aus Anne ihm unvermindert Zeichen gab.
Er drehte sich um. Die Häuser am Kai ragten in den Himmel, höher als gewöhnlich, so kam es ihm vor. Restaurants und Cafés waren geschlossen. Vor dem Lokal, dessen Fenster und Türen mit Brettern vernagelt waren, türmten sich Tische und Stühle auf dem Bürgersteig, als wären sie ausrangiert worden.
Als er erneut auf den See blickte, war Annes Gestalt am Ufer verschwunden. Er trat ein paar Schritte nach vorn, suchte das Wasser mit seinen Blicken ab. Jetzt schwamm sie direkt auf ihn zu, den Kopf mühsam über den Fluten haltend. Er sah, wie sie versuchte, ihm immer noch zuzuwinken. Jetzt umspülte das Wasser seine Füße. Warm drang es in sein Schuhwerk ein. Als er genauer hinsah, war es Blut. Es färbte seine hellen Socken und kroch die Hosenbeine hoch wie Flüssigkeit auf einem Stück Löschpapier.
Angst erfasste ihn. Er hatte Anne aus den Augen verloren. Wo war sie? Da sah er sie wieder Ihr Kopf wippte auf den Wellen des Sees, dessen Farbe inzwischen deutlich als dunkelrot zu erkennen war. Es war, als bewegte Anne sich auf der Stelle, ja, als entfernte sie sich sogar wieder
Über den See schoss eine Motoryacht heran. Sie ähnelte in ihrer Schnittigkeit dem Boot, das er in Marseille besessen hatte und mit dem er mit Anne und Jenny oft aufs Meer hinausgefahren war. Das aufheulende Motorengeräusch brach sich an den Häuserfassaden am Hafenkai und wurde als Echo zurückgeworfen. Ein Geisterschiff; kein Mensch schien das Boot zu steuern.
In diesem Moment schrie Anne laut um Hilfe. Sie hatte die Yacht gesehen und ruderte verzweifelt mit den Armen.
Er wollte sie warnen. »Tauch einfach ab!«, wollte er rufen, doch die Stimme versagte ihm. Inzwischen hatte das blutrote Wasser seine Hüfte erreicht. Die Beine knickten ihm weg. Er warf sich nach vorn und begann zu schwimmen. Mit Entsetzen stellte er fest, dass er das Schwimmen verlernt hatte. Als er mit weit aufgerissenen Augen nach unten in die warme Flut driftete, sah er Anne auf sich zuschwimmen, aber sie kam nicht näher. Sie öffnete den Mund und schrie erneut, doch der Motorenlärm des Bootes, der unter Wasser laut und verzerrt klang, verschluckte ihren Schrei. Noch einmal hob sie den Arm, eine Bewegung wie in Zeitlupe.
Jetzt sah er den Kiel des Motorbootes und die sich wie rasend drehende Schiffsschraube. Während das Boot direkt auf Anne zuhielt und mit seiner ganzen Wucht ihren Körper erfasste, sank er immer tiefer auf den Grund des Sees ...
LaBréa erwachte. Soeben hatte der Wecker geklingelt. Sieben Uhr. Er spürte Schweißperlen auf seiner Stirn. Als er den Kopf drehte, blickte er in Obelix' grüngelbe Augen. Der Kater lag mit seinem ganzen Gewicht auf LaBréas rechtem Arm, der eingeschlafen war. Das Tier reagierte unwillig, als es jetzt weggescheucht wurde.
»Wieso liegst du nicht bei Jenny und quetschst ihr die Arme ab?«, knurrte LaBréa.
Er schlug die Bettdecke ein Stück zurück, gähnte und streckte seinen Körper. Dann schüttelte er seine Hand, die taub geworden war, ballte sie mehrmals zur Faust und spürte, wie das Blut langsam in die Fingerspitzen zurückströmte. Der Kater warf ihm noch einen missbilligenden Blick zu und stolzierte beleidigt durch die angelehnte Schlafzimmertür ins Wohnzimmer. Er war ein mächtiges Tier, mit langem schwarzem Perserfell.
LaBréa atmete tief durch. Es war derselbe Traum gewesen wie so oft in den letzten Wochen und Monaten. Fast jedenfalls. Es gab ein paar Varianten, seit er ihn träumte. Manchmal schwamm Anne nicht in einem See, sondern rannte über eine Straße, durch ein Waldstück oder über eine weite Fläche auf ihn zu. Doch nie kam sie an. Und nie konnte er sich auf sie zubewegen. Wie gelähmt, festgefroren stand er an Uferrändern, an Waldsäumen, in Straßenschluchten, wo Anne in unüberbrückbarer Distanz vor ihm auftauchte. Diese Träume endeten stets gleich, nämlich mit Annes Tod. Er ereilte sie in unterschiedlichen Situationen. Mal erfasste ein Auto sie, dann wieder fiel Anne tot zu Boden, wie von unsichtbarer Hand niedergeschmettert. Manchmal wurde sie auch erschossen. Von irgendwoher ertönte ein trockener Knall, aus einer versteckten Waffe abgefeuert. Nie kamen andere Menschen in diesen Träumen vor. Anne und er waren allein inmitten dieser kalten, düsteren Traumlandschaft, umgeben von unsichtbaren Todesschützen und Geisterfahrern und einem Meer aus Blut.
So war es ja auch gewesen. Unmengen Blut, das den Teppichboden von Annes Sprechzimmer in der Praxis getränkt hatte, als LaBréa sie fand. Sieben Messerstiche in Hals, Brust und Bauch. Blutverschmierte Haare. Das Gesicht zur Seite gedreht. Die linke Hand über den Kopf gereckt. Als letzter, verzweifelter Hilferuf? Gegen die beiden Junkies, die an jenem Freitagabend in ihre Praxis eingedrungen waren, hatte sie keine Chance. Wegen 75 Euro, die Anne in ihrem Portemonnaie bei sich trug, musste sie sterben.
LaBréa befand sich damals nur wenige Straßen entfernt am alten Hafen, in der Bar de la Marine. Dort feierte Jeff, einer von LaBréas Mitarbeitern, seinen Abschied aus dem Polizeidienst. Er war sechzig Jahre alt und ging in den Ruhestand. Der Wirt des Lokals hatte ein üppiges Buffet aufgefahren, mit Austern, Langustenschwänzen und seiner berühmten hausgemachten Bouillabaisse, und die Stimmung unter den dreißig Gästen entwickelte sich prächtig. Gegen zehn Uhr abends hatte Jenny ihren Vater über sein Handy angerufen und ihm mitgeteilt, dass Anne noch nicht nach Hause gekommen war. In der Praxis meldete sich niemand, sagte sie, und ihre Stimme klang ängstlich.
Das Gespräch mit seiner Tochter hatte LaBréa in eine plötzliche Unruhe versetzt, die er sich nicht erklären konnte. Irgendetwas stimmte nicht, das spürte er. Zwar arbeitete Anne oft bis tief in die Nacht in der Praxis, erledigte Bürokram, schrieb Gutachten. An diesem Tag jedoch wollte sie gegen sieben zu Hause sein und mit Jenny Crêpes backen. Undenkbar, dass sie das Versprechen ihrer Tochter gegenüber nicht einhielt. LaBréa kannte niemanden, der zuverlässiger und pünktlicher war als seine Frau. Deshalb war er in jener Nacht auch so in Sorge und verließ die Abschiedsfeier seines Kollegen vorzeitig.
Es war ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Bis Mitte Februar hatte heftiger Mistral geblasen, doch seit einer Woche zog ein laues Lüftchen durch die Stadt. In den Gärten blühten die Mimosen und Mandelbäume, und die Erde roch nach Frühling und Aufbruch. LaBréa ging rasch über die Hafenpromenade und bog in die Rue Fort Notre Dame ein. In der nächsten Querstraße lag Annes Arztpraxis, in einem Flachbau mit grünen Fensterläden, die an diesem Abend nicht geschlossen waren. LaBréa sah, dass kein Licht brannte. Die Tür schien verschlossen, doch als er näher kam, war sie lediglich angelehnt.
LaBréa erhob sich aus dem Bett, rieb sich mit beiden Händen die Augen und verließ das Schlafzimmer.
Es regnete.
Durch die rechteckigen Oberlichtfenster des geräumigen Wohnzimmers und die Glastüren, die von dort aus in den kleinen Garten führten, fiel das fahle Oktoberlicht. Dennoch wirkte eine solche Atelierwohnung zu ebener Erde auch an grauen Tagen beinahe hell und freundlich. Mit der Wohnung hatte er Glück gehabt. Wo fand man so etwas mitten in Paris? Die Wohnung hatte einem Maler gehört, der nach Spanien übergesiedelt war. Normalerweise wurde ein solches Domizil unter der Hand weitervermittelt. Doch LaBréas Bruder Richard, der in Paris eine Maklerfirma betrieb, war mit dem Maler befreundet. Als LaBréa und Jenny vor drei Wochen von Marseille nach Paris umzogen, war die Wohnung nicht nur frei geworden, sondern dank Richards fürsorglicher Planung auch komplett renoviert.
Es gab einen großen Wohn-/Essraum, von dem durch Rigipswände und eine Tür eine Ecke abgetrennt war, die LaBréa als Schlafzimmer nutzte. Die Küche war winzig und zum Wohnzimmer hin offen. In der Nähe der Eingangstür, am Ende eines kleinen Flurs, befanden sich das Bad und Jennys Zimmer. Und dann natürlich der Garten: ein typischer Stadtgarten, nach hinten mit einer hohen Mauer uneinsehbar vom Nachbargrundstück abgegrenzt. Im Frühjahr würde LaBréa auf den schmalen Rabatten Blumenbeete anlegen. Auf Höhe der Küche, von der zwei Fenster und eine Glastür in den Garten führten, wuchs eine Zwergzypresse, die der Vorbesitzer der Wohnung gepflanzt hatte.
Obelix lag ausgestreckt auf der Wohnzimmercouch und hob den Kopf, als er LaBréa sah. Dann gähnte er und streckte die rechte Pfote vor.
LaBréa ging in die Küche und schenkte sich ein Glas Wasser ein. Während er es langsam austrank, lauschte er dem Regen, der in monotonem Singsang auf die gläsernen Oberlichter fiel.
Die Zeiger der Küchenuhr standen auf sieben Uhr zehn. Er würde Jenny noch schlafen lassen. Vor halb acht musste sie nicht aufstehen. Wenn er sich rasiert und angekleidet hatte und das Frühstück vorbereiten würde, wollte er sie wecken.
Obelix kam mit wiegendem Gang und hochgestelltem Schwanz in die Küche und blickte LaBréa erwartungsvoll an.
»Ja, ja, ich weiß«, brummte LaBréa. »Du meinst, du musst immer der Erste sein.« Er holte eine angebrochene Dose Katzenfutter aus dem Kühlschrank und füllte Obelix' Napf, der unter dem Fenster stand. Sofort machte sich der Kater über sein Fressen her und schmatzte genüsslich.
LaBréa stellte das leere Glas ins Spülbecken.
Heute war Sonnabend. In seinem Büro am Quai des Orfèvres würde er sich in aller Ruhe mit dem neuen Computerprogramm vertraut machen, das der Polizeipräfekt vor wenigen Tagen bei der Brigade Criminelle hatte installieren lassen. Da die Polizei in Marseille mit einem ähnlichen System ausgerüstet war, dürfte ihm die Einarbeitung nicht schwerfallen.
Keine Hektik. Keine Besprechungen mit seinen Mitarbeitern, die er Talkrunden zu nennen pflegte. Diese Bezeichnung für das morgendliche Brainstorming in seinem Büro hatte er seinerzeit schon in Marseille eingeführt. Der letzte Fall lag genau zwei Tage zurück und war gelöst. Jetzt traten Staatsanwaltschaft und Justiz auf den Plan, und LaBréa hoffte, dass es ein einigermaßen ruhiges Wochenende werden würde. Flüchtig sah er das Gesicht von Pierre Verdini vor sich. Ein hübsches, fast zartes und irgendwie kindliches Gesicht mit großen, dunklen Augen. Wer hätte einem solchen Mann zugetraut, dass er in einer Filiale der Crédit Agricole zwei Geiseln in seine Gewalt bringen, eine von ihnen erschießen und dann mit der anderen und einer Plastiktüte mit knapp 50 000 Euro durch halb Paris zu fliehen versuchen würde?
Vor dem Bad blieb LaBréa einen Moment stehen und lauschte. Dann lächelte er kurz. Aus dem Zimmer seiner Tochter, das direkt daneben lag, erklang leise Musik. Ein Song von Anastacia, wenn er sich nicht irrte. Inzwischen kannte er sich gut aus in Jennys CD-Sammlung. LaBréa klopfte an die Tür.
»Herein!«
Jenny saß aufrecht im Bett und hatte ein Buch aufgeschlagen. Sie hatte ihr Zimmer in der neuen Wohnung genauso eingerichtet wie das Zimmer in LaBréas Haus im Marseiller Stadtteil Estaque. Über dem Bett hing ein Poster von David Beckham. Daneben ein Foto von Jennys Mädchenmannschaft in ihrem Club in Marseille. Auf dem Bett und der kleinen Couch an der Längsseite des Zimmers gab es ein paar Plüschtiere und zwei wertvolle alte Puppen, die Jenny von ihrer Großmutter mütterlicherseits zum zehnten Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Der Schreibtisch mit dem Computer stand am Fenster, das den Blick in den kleinen Garten freigab. Links vom Schreibtisch hing ein großes Foto an der Wand, das Mutter und Tochter zeigte. LaBréa hatte es im vorletzten Sommer auf dem Motorboot aufgenommen. Anne hatte lachend den Arm um Jenny gelegt, die eine Grimasse schnitt. Annes blonde Haare flatterten im Wind, und Jenny hielt eine Eistüte in der linken Hand. Mutter und Tochter sahen sich nur wenig ähnlich. Jenny hatte die dunklen, dichten Haare ihres Vaters, die sie halb lang geschnitten trug. Und dieselbe Augenfarbe wie LaBréa: ein tiefes, beinahe violettes Blau.
»Guten Morgen, Chérie. Du bist ja schon wach.«
»Morgen, Papa. Ich bin schon lange wach. Weil der Regen so trommelt.« Sie hob ihren Kopf und blickte nach oben. »An die blöden Oberlichter im Dach werde ich mich nie gewöhnen. Das ist unheimlich laut.«
»Ja, aber dafür hell, während andere Wohnungen um diese Jahreszeit noch vollkommen dunkel sind.«
»Bei so 'ner Helligkeit kann ich überhaupt nicht schlafen.«
Jenny blickte ihren Vater an. LaBréa kannte diesen Blick. Seine Mischung aus Vorwurf, Traurigkeit und verhaltenem Schmerz schnitt ihm jedes Mal aufs Neue ins Herz. Der Umzug nach Paris war gegen Jennys Wunsch geschehen. Doch für LaBréa hatte es nach Annes Ermordung keine andere Möglichkeit gegeben. Als die beiden Junkies nach vierzehn Tagen fieberhafter Fahndung wie durch ein Wunder gefasst werden konnten, hatte er keine Genugtuung verspürt. Nur das dumpfe Gefühl der Hoffnungslosigkeit, die die kommenden Jahre wie mit einer dicken grauen Plane zu ersticken drohte. Etwas war vorbei, unwiederbringlich verloren. Nichts und niemand würde je die Lücke füllen können. Sein ganzes Leben war mit Annes Tod in tausend Stücke zersprungen. LaBréa wusste, dass er nicht die Kraft haben würde, die Scherben zusammenzukehren, wenn er in seiner gewohnten Umgebung blieb. Als ob der Umzug nach Paris seine freie Entscheidung gewesen wäre! Er war die einzige Chance, ein winziger Strohhalm, um die Geschehnisse in Marseille zu vergessen.
LaBréas Gedanken eilten zurück zu jenem Abend, an dem es geschah. Als sei es gestern gewesen, erinnerte er sich an jedes Detail. Er springt die drei Stufen hoch, die zum Eingang der Praxis führen. Die Tür ist lediglich angelehnt, als hätte jemand heimlich das Haus verlassen und keinen Lärm machen wollen. LaBréas Herz fängt wie wild an zu klopfen. In diesem Moment weiß er es bereits. Er stößt die Tür zum Wartezimmer auf, tastet nach dem Lichtschalter und verspürt die untrügliche Gewissheit, dass Anne etwas zugestoßen ist und dass er zu spät kommt. Die Tür zum Sprechzimmer steht sperrangelweit offen. Und da liegt sie, abgestochen wie ein Stück Vieh. Auf dem Teppichboden sind blutige Fußabdrücke zu sehen. Das Riffelmuster einer neuen Turnschuhmarke. Die Abdrücke werden später dazu führen, dass die Täter identifiziert werden können. Am Morgen der Tat hatte einer von ihnen die Schuhe in einem Sportgeschäft in der Innenstadt gekauft ...
Als die Spurensicherung am Tatort eintraf und LaBréas Kollege Duvall die Ermittlungen aufnahm, verließ LaBréa wie in Trance den Ort des Verbrechens. Er schlug das Angebot eines Kollegen aus, der ihn nach Hause fahren wollte, und nahm auch kein Taxi. Er wollte zu Fuß gehen, Zeit gewinnen, um das Unfassbare zu begreifen und sich auf das vorzubereiten, was ihn erwartete: Jenny die schreckliche Wahrheit beizubringen. Noch in der Nacht war dann Annes Schwester aus Aix-en-Provence gekommen und hatte Jenny für ein paar Tage zu sich geholt.
LaBréa riss sich aus seinen Gedanken.
»Du kannst noch ein paar Minuten im Bett bleiben, solange ich im Bad bin.« Er deutete auf das Buch, das Jenny in der Hand hielt. »Was liest du denn da?«
»Ich lerne Vokabeln. Wir schreiben heute 'ne Englischarbeit. In der zweiten Stunde. Bringst du mich nachher zur Schule?«
LaBréa nickte.
»Mach ich.« Er drehte sich zur Tür. »Frühstück wie immer?«
Jenny schüttelte den Kopf.
»Nee. Der Trainer hat gestern gesagt, ich soll morgens Müsli essen. Mit viel Milch und Trockenfrüchten drin. Das sei gut für den Muskelaufbau.«
»Ach ja, tatsächlich?« LaBréa verzog das Gesicht. Er hatte sich nie eine Tochter gewünscht, die sich Gedanken um ihren »Muskelaufbau« machte. Und er hätte viel darum gegeben, wenn Jenny eine andere Sportart als ausgerechnet Fußball zu ihrem Hobby auserkoren hätte.
»Haben wir denn so was im Haus? Müsli, meine ich.« LaBréa verabscheute diese neumodischen Essgewohnheiten. Von jeher aß er morgens ein Croissant ohne Butter mit Konfitüre, am liebsten Aprikosenkonfitüre. Dazu ein bis zwei Tassen starken schwarzen Kaffee – und der Tag konnte beginnen.
»Alissa hat mir gestern was mitgegeben. Ihre Mutter kauft es im Bioladen auf der Rue de Rivoli.« Alissa war Jennys neue Schulfreundin. Sie spielte ebenfalls in der Mädchenfußballmannschaft des Sportvereins, dem Jenny gleich nach der Umsiedelung aus Marseille beigetreten war.
»Wir haben bis zwei Uhr Schule, danach gehen wir eine Stunde zum Training«, fuhr Jenny fort. »Anschließend bin ich dann noch bei Alissa.«
»Gut, ich hole dich gegen halb fünf dort ab.« LaBréa schloss die Tür und schlurfte ins Badezimmer.
Kurz vor acht verließen sie die Wohnung.
Der Regen hatte etwas nachgelassen und war in ein feines Nieseln übergegangen. LaBréa spannte seinen schwarzen Schirm auf. Jenny zog die Kapuze ihrer Goretexjacke über den Kopf und warf die Sporttasche über ihre Schulter.
Nach dem ersten Hof, in dem die Atelierwohnung von Céline Charpentier, der Malerin, lag, erreichten sie den überdachten Flurdurchgang, der zur Straße führte. Im Treppenhaus neben den Briefkästen führte eine Tür zur Wohnung von Monsieur Hugo. Als pensionierter Postbeamter verdiente er sich ein monatliches Zubrot mit kleinen Diensten und Gefälligkeiten, die in früheren Zeiten ein Concierge erledigt hatte.
Die Rue des Blancs Manteaux, im Herzen des alten Marais gelegen, war eine ruhige Straße. Im Nebeneingang gab es eine Änderungsschneiderei. Einige Häuser weiter lag der Hammam Les Bains du Marais, ein Sauna- und Massageparadies. Ein Glücksfall, hatte LaBréa gleich gedacht. Er litt unter starken Nackenverspannungen und wollte sich tüchtig durchkneten lassen, sobald er Zeit dazu finden würde.
An diesem Morgen hing dichter Nebel über den Dächern und kroch die Häuserfronten entlang bis auf die Bürgersteige.
Noch einmal fiel LaBréa der Traum ein, der ihn kurz vor dem Aufwachen heimgesucht hatte. Ja, auch Nebellandschaften waren in diesen Albträumen schon vorgekommen, aus denen Anne sich wie ein Phantom herausschälte, auf ihn zuging, ohne sich zu nähern, um sich bald darauf wieder in nichts aufzulösen.
Roter Nebel. Als hätte jemand gigantische Mengen eines farbigen Sprays benutzt. Ein Spray wie mit feinen Blutpartikeln durchsetzt.
2. KAPITEL
An der Ecke Rue Vieille du Temple, schräg gegenüber vom Restaurant Au Gamin de Paris, parkten mehrere kleinere Lastwagen und Kombis. Bürgersteig und Straße waren mit weiß-roten Banderolen abgesperrt. Auf einem der Lastwagen las LaBréa den Schriftzug CineTransport. Junge Männer in flippiger Kleidung trugen Scheinwerfer ins Haus, Metallständer, große Rollen mit Silberfolie und Unmengen von Kabeln. Eine junge Frau mit dicker Kladde unter dem Arm ging mit gewichtiger Miene zu einem der Lastwagen, wechselte einige Worte mit ihren Kollegen und eilte ins Haus zurück. Vor einem wohnwagenähnlichen Gefährt mit aufgeklapptem Seitenfenster, einem Cateringwagen, standen zwei Männer. Der eine hielt einen Pappbecher in der Hand, der andere biss herzhaft in ein Sandwich.
Auf dem Bürgersteig war ein Podest aufgebaut, auf dem zwei Beleuchter standen und einen riesigen Scheinwerfer montierten, der eines der Fenster im ersten Stock hell anstrahlte.
Jenny stieß ihren Vater mit dem Ellbogen an.
»Ich glaube, hier wird 'n Film gedreht, oder Papa?«
»Da hast du sicher recht.«
Jennys Augen glitzerten.
»Supergeil! Da würde ich gern mal zusehen, wie die so was machen. Oder mitspielen! Vielleicht brauchen die noch jemanden in meinem Alter?!« Sie lachte verlegen. »Vielleicht mach ich später auch mal so was.«
LaBréa runzelte die Stirn und sagte spöttisch: »Ich denke, du willst Profifußballerin werden?«
Jenny zuckte mit den Schultern. »Kommt darauf an, ob sie bis dahin Frauen in der Liga zulassen.«
LaBréa hoffte inbrünstig, dass das nie der Fall sein würde.
Jetzt entdeckte er vor dem Eingang des Hauses, in den die Filmleute ihre Geräte schleppten, ein bekanntes Gesicht. Céline Charpentier, die Nachbarin aus dem Gartenhaus im ersten Hof, führte ein lebhaftes Gespräch mit einem älteren Mann. Er war schlank, groß und trug auffällige, schwarz-weiße Schuhe, wie die Ganoven in alten Gangsterfilmen. Die Schuhe schienen angesichts des nassen Wetters unpassend und ließen auf einen eitlen Charakter schließen. Den Kragen seines Regenmantels hatte er hochgeschlagen, und eine knallrote Baseballkappe mit dem Schriftzug Never back to Hollywood bedeckte sein dichtes weißes Haar. An seiner Art zu sprechen und dem hochmütigen Gesichtsausdruck erkannte LaBréa, dass dieser Mensch Macht besaß, Geld oder wahrscheinlich beides.
»... sie erpressen dich und halten sich für die Größten! Künstler sind Parasiten«, sagte er soeben zu Céline und fügte mit einem ironischen Lächeln hinzu: »Anwesende natürlich ausgenommen, meine Liebe! Du brauchst dich also nicht auf den Schlips getreten zu fühlen.«
In diesem Augenblick entdeckte Céline sie. Der Regen perlte über ihre schwarzen, leicht gewellten Haare. Unter einem durchsichtigen Regencape trug sie eine enge, bordeauxrote Hose und einen dazu passenden Pullover. Ihre grün-braun gesprenkelten Augen blickten LaBréa erwartungsvoll an. Er grüßte, auch Jenny murmelte ein »Guten Morgen«.
»Guten Morgen«, erwiderte Céline mit ihrer warmen, tiefen Stimme.
»Wird hier ein Film gedreht?«, fragte Jenny neugierig.
»Richtig.« Céline lächelte flüchtig. »Darf ich vorstellen?«, sagte sie zu LaBréa. »Monsieur Molin, der Produzent des Films. Kommissar LaBréa, mein neuer Nachbar und seine Tochter.«
Der Filmproduzent nickte kurz und musterte LaBréa mit scharfem Blick, während er Jenny völlig ignorierte.
»Kriminalpolizei?«, fragte er.
LaBréa nickte.
Molin entblößte eine Reihe strahlend weißer Zähne. LaBréa sah sofort, dass dies die Arbeit eines guten und sündhaft teuren Zahnarztes war. Jacketkronen vom Allerfeinsten.
Vertraulich legte der Produzent seine Hand auf Célines Arm.
»Ein Kriminalkommissar als Nachbar, das kann nie schaden, Céline!« Es klang ein wenig von oben herab. LaBréa mochte den Mann nicht.
»Komm, Jenny«, sagte er zu seiner Tochter. »Wir müssen weiter, sonst kommst du zu spät zur Schule!« Er nickte Céline knapp zu und bog mit Jenny in die Rue Vieille du Temple ein. Als er sich noch einmal kurz umdrehte, sah er, dass Céline ihm nachblickte. Vom Filmproduzenten war nichts mehr zu sehen.
LaBréa fragte sich, was Céline Charpentier wohl mit diesen Filmleuten zu schaffen hatte. Der Produzent duzte sie ... LaBréa wusste nicht viel von seiner neuen Nachbarin. Sie lebte allein und war Malerin. Er schätzte sie auf Ende dreißig, Anfang vierzig, aber da konnte man sich bei Frauen täuschen. Ihre schöne Stimme war ihm gleich beim ersten Mal aufgefallen, als sie sich am Tag von LaBréas Einzug im Hof begegneten. Das war nun drei Wochen her. Céline hatte ihn damals in ihre Wohnung gebeten und ihm einen Kaffee angeboten. In ihrem Atelier, einem großzügigen Raum mit einem riesigen Glasdach, standen ringsum an den Wänden und auf einer Staffelei Bilder. Abstrakte Formen, kühne Farben, wie LaBréa auf den ersten Blick sehen konnte. Doch er verstand nicht viel von Malerei. An jenem Umzugstag hatte er sich noch keine fünf Minuten bei Céline aufgehalten, als ein mordsmäßiger Krach ihn zusammenzucken ließ. Gleich darauf wurden deftige Flüche ausgestoßen. Einer der Möbelpacker hatte den wunderbaren, in einen alten Goldrahmen gefassten Kristallspiegel fallen lassen, Annes Erbstück von ihrer Großmutter. LaBréa hatte sich für den Kaffee bedankt und war nach draußen geeilt. Das war die bisher einzige längere Begegnung mit der neuen Nachbarin gewesen.
Der Regen hatte aufgehört. LaBréa klappte seinen Schirm zusammen. In der Rue des Rosiers kaufte er Jenny im Feinkostgeschäft Jo Goldenberg zwei Mohnbagel, die sie mit zum Training nehmen wollte. Mittags blieb sie in der Schule, obgleich das Essen in der Schulkantine entsetzlich war, wie Jenny ihrem Vater jeden Tag aufs Neue versicherte. Doch LaBréa ignorierte Jennys Beschwerden, die allesamt damit zusammenhingen, dass sie den Umzug nach Paris noch nicht verkraftet hatte.
Wenig später überquerten sie die Rue de Rivoli, auf der sich der morgendliche Berufsverkehr staute. So weit das Auge reichte, standen die Autos Stoßstange an Stoßstange, bis zum Louvre.
Jennys Schule befand sich in der Rue Charlemagne, einer ruhigen Seitenstraße. Scharen von Schülern strömten in das alte Gebäude.
»Also, bis heute Nachmittag, Papa. Salut!«, sagte Jenny und gab ihrem Vater einen flüchtigen Kuss. Gleich darauf war sie verschwunden.
Durch die Rue du Fauconnier gelangte er zum Quai des Célestins und von dort aus auf die Île St.-Louis. Erneut setzte der Nieselregen ein, zu dem sich jetzt ein scharfer Herbstwind gesellte, der das ölige, bleifarbene Wasser der Seine an die Kaimauern klatschen ließ.
Auf der Brücke zur Île de la Cité fegte der Wind so stark, dass LaBréas Mantelschöße flatterten. Immer wieder wurde der Schirm nach außen gestülpt, und LaBréa klappte ihn schließlich zu. Wie mit feinen Nadeln traktierte der Wind sein Gesicht und wirbelte seine dichten schwarzen Haare durcheinander.
Vor der Kathedrale Notre-Dame parkten bereits die ersten Reisebusse. Eine Touristengruppe schälte sich aus einem kompakten Doppeldecker. Die Menschen stemmten sich gegen den Wind. Im Sommer wimmelte der Platz vor der Kathedrale von Touristen. Doch auch zu dieser tristen Jahreszeit kamen viele Besucher in die Stadt. Paris hatte immer Saison, selbst im November und im Februar, den beiden ungemütlichsten Monaten des Jahres.
Am Nordturm der Kathedrale war ein Gerüst angebracht. Solange LaBréa zurückdenken konnte, gab es Baugerüste an der Kathedrale. In seiner Kindheit und Jugend, die er im Haus seiner Eltern im 14. Arrondissement verbracht hatte, wurde das gewaltige Bauwerk jahrelang mittels Hochdruck-Sandstrahlgeräten gereinigt. Über die Jahrhunderte hatte sich eine schwarze Schmutzpatina in den hellen Sandstein gefressen. Damals erschien es wie ein Wunder, dass Notre-Dame Stück für Stück in neuem Glanz erstrahlte und die düstere Aura ihrer verschmutzten Fassade verlor. Insgesamt hatte sich das Stadtbild von Paris in den letzten fünfunddreißig Jahren des 20. Jahrhunderts gewandelt und durch das groß angelegte Sandstrahlprogramm die Farbe ihrer ursprünglichen Bausubstanz wiedererhalten. Es mutete befremdlich an, wenn man heutzutage einen alten Film aus den Fünfziger- oder Sechzigerjahren sah, als Paris mit seinen Seinebrücken und Kirchen, mit den Häuserfassaden an den großen, repräsentativen Boulevards noch wie geschwärzt wirkte.
LaBréa warf einen letzten Blick auf das Gotteshaus und setzte seinen Weg fort. Er bog in den Quai du Marché Neuf ein, der an der Polizeipräfektur vorbei in sein Büro am Quai des Orfèvres führte.
Der uniformierte Polizist vor dem Eingang trat aus einem Wachhäuschen heraus und grüßte, als LaBréa sein Dienstgebäude betrat. Gleich danach lief er die große Steintreppe hoch in den ersten Stock, wo sich sein Büro befand. Es war ein ausgedehnter Raum mit einfacher, doch funktionaler Möblierung, einer kleinen Sitzgruppe, einer vorsintflutlichen Videoanlage und nagelneuem Computer. Er zog seinen regennassen Trench aus und hängte ihn ans Fensterkreuz, direkt neben die Heizung, die er voll aufdrehte und die sogleich angenehme Wärme im Raum verströmte.
LaBréa fuhr seinen Rechner hoch und loggte sich ein. Hauptmann Franck Zechira, einer seiner drei Mitarbeiter und der Computerfreak der Abteilung, hatte ihm eine kleine Anleitung geschrieben, wie das neue Programm am leichtesten zu handhaben sei. Mithilfe dieser Software konnten erstaunliche Dinge bewerkstelligt werden, und die europaweite Vernetzung der einzelnen nationalen Polizeidienste war ein gutes Stück vorangekommen.
3. KAPITEL
In gemächlichem Tempo zog sich der Vormittag dahin. Kurz vor elf Uhr blickte LaBréa auf die Uhr und dachte daran, dass Jenny jetzt bei ihrer englischen Klassenarbeit saß und schwitzte. Er ging zum Automaten am Ende des Korridors und holte sich einen Pappbecher heißen Kaffee, der so bitter schmeckte, dass sein Gaumen sich zusammenzog.
Kurz darauf läutete das Telefon auf seinem Schreibtisch.
»Ja?«, sagte LaBréa.
Es war Hauptmann Franck Zechira.
»Ich wollte nur fragen, ob Sie mit dem Programm klarkommen, Chef«, sagte er. Im Hintergrund erklangen laute Geräusche. Applaus, Stimmengewirr und eine Lautsprecherstimme. LaBréa konnte kaum verstehen, was Franck sagte, als er fortfuhr: »Sind meine Anmerkungen und Tipps gut verständlich?«
»Ja, ich komme prima klar damit, Franck. Wo sind Sie eigentlich? Hört sich an, als wären Sie auf einer Sportveranstaltung?!«
Franck lachte.
»So was Ähnliches, Chef. Ich bin auf der Rennbahn.«
»Ach so!«, antwortete LaBréa. »In Longchamps?«
»Genau.«
»Und, ist Ihnen das Glück schon hold gewesen?«
»Ich wag's gar nicht zu sagen, Chef, aber vor einer halben Stunde habe ich 1780 Euro eingesackt. Einlaufwette.«
»Gratuliere!« LaBréa lachte. »Dann weiterhin viel Glück, Franck, und schönes Wochenende.«
»Danke, Chef.« Am anderen Ende wurde aufgelegt.
LaBréa schüttelte den Kopf und schmunzelte. Neben seiner Leidenschaft für alles, was mit Computern, Internet und Informatik im Allgemeinen zu tun hatte, frönte Franck Zechira einem zweiten Hobby: dem Pferderennen. Seine Wochenenden verbrachte er auf der Rennbahn in Longchamps oder Vincennes. In LaBréas Abteilung war es ein offenes Geheimnis, dass Franck sein eher karges Hauptmannsgehalt durch regelmäßige Wettgewinne gehörig aufbesserte. Er besaß bereits eine große Eigentumswohnung im feinen 5. Arrondissement, die er an ein betuchtes Diplomatenehepaar vermietet hatte.
Gegen halb eins schloss LaBréa seine Computerprogramme, zog den Mantel an und ging hinaus auf den Quai des Orfèvres.
Der Wind hatte zugenommen. Auf der Place Dauphine, die gleich hinter dem Polizeipräsidium lag, trieb er das Laub vor sich her und schüttelte die kahlen Äste der Bäume. An der Südseite des Platzes gab es das Restaurant Henri IV, in dem LaBréa schon einige Male zu Mittag gegessen hatte. Dort bot man eine einfache, rustikale Küche mit Spezialitäten aus dem Südwesten an. Von seinem Vorgesetzten, Direktor Roland Thibon, hatte er gleich nach seinem Dienstantritt erfahren, dass man nur im Winter ins Henri IV gehen könne. Im Sommer würde es von Touristen buchstäblich »geentert«, wie eine königliche Fregatte zur Zeit des Sonnenkönigs von einem Haufen Piraten. LaBréa hatte diesen Vergleich seltsam gefunden. Doch Direktor Thibon pflegte auch sonst eine blumige Sprache, die nicht so recht mit seiner Tätigkeit als höherer Kriminalbeamter zusammenpasste. Möglicherweise war dies auf den Einfluss seiner Frau zurückzuführen, die als Schauspielerin an der Comédie Française engagiert war. Thibon ließ keine Gelegenheit aus, das entsprechend zu erwähnen.
Heute, am Sonnabend, da die umliegenden Büros in der Polizeipräfektur und im Justizpalast verwaist waren, saßen nur wenige Gäste an den Tischen. LaBréa bestellte einen Bauernsalat mit Croûtons und einer Scheibe Foie gras, dazu ein Glas frischen weißen Loire-Wein. Während er auf das Essen wartete, zog er einen Computerausdruck aus seiner Manteltasche und vertiefte sich in die Kriminalstatistik der Jahre 2002 und 2003 des 3. und 4. Arrondissements. Insgesamt wiesen die Erhebungen ein Abnehmen der Kriminalität in diesen Bezirken um durchschnittlich 4,5 Prozent aus, wobei sowohl die Delikte der Schwerstkriminalität als auch die der Kleinkriminalität erfasst waren.
Als der Kellner mit dem Salat kam, steckte LaBréa die Papiere weg. Gleich darauf klingelte sein Handy. Es war Jenny.
»Na, wie hast du die Englischarbeit überstanden?«, wollte LaBréa wissen.
»Ganz gut. Ich hatte es mir schwerer vorgestellt.«
»Umso besser. Hast du jetzt Mittagspause?«
»Hm. Wir gehen gerade in die Kantine. Soll ich dir sagen, was es gibt?« Jenny schwieg einen Moment und wartete auf eine Reaktion ihres Vaters. Doch LaBréa sagte nichts. »So'n Ragout mit angepapptem Reis! Das hatten sie neulich schon, und es schmeckte wi-der-lich!« Jenny betonte jede einzelne Silbe, und LaBréa verkniff sich ein Lachen. »Alissa meint, das wäre Pferdefleisch. Ich weiß nicht, warum ich so einen Fraß essen soll!«
»Jetzt steiger dich doch da nicht hinein, Chérie!«, antwortete LaBréa. »Das ist mit Sicherheit kein Pferdefleisch, sondern Rind- oder Lammfleisch.«
»Jedenfalls schmeckt es eklig! Hoffentlich kriege ich keine Fleischvergiftung.«
LaBréa wechselte das Thema.
»Wann soll ich dich in der Brûlerie abholen, Jenny?«
Am Ende der Leitung ertönte ein tiefer Seufzer.
»Ich hab's dir doch heute Morgen gesagt, Papa. Bis zwei Uhr hab ich Schule, dann Training, und ab halb vier oder vier bin ich bei Alissa! Warum kannst du nie richtig zuhören? Du hast doch selbst gesagt, dass du gegen halb fünf kommst!«
»Ja, stimmt. Entschuldige bitte, Chérie!«, beeilte sich LaBréa zu sagen. Und er fügte hinzu: »Ist es nicht zu kalt zum Training, bei dem Wetter und dem scharfen Wind?«
»Bei so 'nem Wetter trainieren wir in der Halle. Auch das hab ich dir schon oft gesagt, Papa.« Es klang resigniert, und ehe er etwas erwidern konnte, hatte Jenny das Gespräch beendet.
Gegen vierzehn Uhr verließ LaBréa das Restaurant und machte sich auf den Heimweg. Er eilte zur Metrostation Châtelet, denn bei diesem Wetter – es regnete erneut –wollte er nicht zu Fuß nach Hause gehen. An der Station St. Paul le Marais stieg er aus. Beim chinesischen Traiteur besorgte er diverse Salate und Frühlingsrollen, in der Pâtisserie nebenan zwei Schälchen Mousse au Chocolat als Nachtisch. Auch wenn er in den letzten Wochen gelernt hatte, die Nörgeleien seiner Tochter hinsichtlich des Essens in der Schulkantine mehr oder weniger zu ignorieren, regte sich doch so etwas wie ein schlechtes Gewissen in ihm. Insbesondere, da er selbst im Henri IV hervorragend gespeist hatte. Mit einem leckeren Abendessen und dem Video Herr der Ringe 2, das er in der Videothek in der Rue de Rivoli ausleihen wollte, wäre Jenny sicher wieder versöhnt.
Nachdem LaBréa seine Besorgungen erledigt hatte, nahm er den Weg durch die Rue des Rosiers. Vor den koscheren jüdischen Geschäften und den Läden standen Schlangen von Menschen. In den Cafés saß vorwiegend jüngeres Publikum.
An der Ecke Rue Vieille du Temple waren die Dreharbeiten des Filmteams noch nicht beendet. Der Scheinwerfer, der ein Zimmer im ersten Stock beleuchtete, wirkte seltsam deplatziert. Geschäftig eilten einige Filmleute hin und her. Auch am Cateringwagen herrschte reger Betrieb. Eine dynamisch wirkende Frau kam aus dem Haus gelaufen und trieb ihre Kollegen an:
»Los, Tempo! In zehn Minuten geht es weiter mit Bild 24. Drei Einstellungen. Davon ein Close-up. Wir brauchen noch zwei Meter Schiene, Sébastien!« Die leuchtend blaue Strähne in ihrem dunkelblonden, kurz geschnittenen Haar passte nicht so recht zum Alter der Frau, die Anfang bis Mitte vierzig sein mochte. Gleich darauf eilte sie ins Haus zurück.
Seine Nachbarin Céline oder den arrogant wirkenden Filmproduzenten konnte LaBréa nirgends entdecken.
Fünf Minuten später tippte er den Code ins Tableau seiner Haustür ein und stieß sie auf.
Monsieur Hugo, der pensionierte Postbeamte, hatte ihn kommen hören und öffnete seine Wohnungstür. Er war ein zierlicher alter Mann, dessen Augen flink hin und her tanzten. Die spärlichen grauen Haare hatte er sorgfältig gescheitelt. Wenn er seinen Mund zu einem Lächeln verzog, wie jetzt, als er LaBréa begrüßte, sah er aus wie ein melancholischer Clown. Er überreichte LaBréa ein Paket.
»Das hat der Postbote für Sie abgegeben, Commissaire.«
»Danke, Monsieur Hugo. Was haben Sie dafür ausgelegt?«
»Nichts, Monsieur.«
LaBréa nahm das Paket. »Schönen Tag noch!«
Der Alte nickte, lächelte erneut und schloss seine Wohnungstür.
In Céline Charpentiers Atelier im ersten Hof brannte Licht. Die Vorhänge waren nicht zugezogen, und LaBréa sah, wie seine Nachbarin vor ihrer Staffelei stand und eine jungfräulich weiße Leinwand kritisch betrachtete. Als sie zu dem großen Tisch ging, wo ihre Farben und Pinsel standen, huschte LaBréa schnell vorbei, für den Fall, dass ihr Blick in den Hof fallen und sie ihn entdecken könnte.
Kurz darauf machte er es sich in seinem Wohnzimmer gemütlich. Er legte eine alte Platte von Kid Ory auf und öffnete das Paket, das Monsieur Hugo für ihn in Empfang genommen hatte. Es war der Winterkatalog einer großen Warenhauskette, den er sogleich in den Papierkorb warf.
LaBréa beschloss, dass es nicht zu früh war für einen Aperitif. Er schenkte sich ein Glas selbst gemachten Orangenwein ein und bemerkte, dass die Flasche beinahe leer war. Demnächst musste er beim Marokkaner an der Place d'Aligre bittere Orangeschalen kaufen. Zusammen mit einem guten, trockenen Weißwein ergab das Gemisch, nachdem es ein paar Tage mazeriert und dann gefiltert wurde, einen köstlichen hausgemachten. Aperitif.
Als er sich mit dem Glas in der Hand auf einen der Sessel setzte, die Augen schloss und der wunderbaren alten Jazzaufnahme lauschte, sprang Obelix auf seinen Schoß und fing laut an zu schnurren.
Es war kurz nach drei. LaBréa hatte noch genügend Zeit, bis er seine Tochter bei ihrer Freundin abholen würde.
4. KAPITEL
Die Brûlerie befand sich unter den Arkaden der Place des Vosges. Sie gehörte Alissas Mutter. Ihr Mann, ein Major der Landstreitkräfte, war die wenigste Zeit des Jahres in Paris. Als Angehöriger einer Spezialeinheit wurde er meistens zu Auslandseinsätzen abkommandiert. Seit einigen Wochen gehörte er zur internationalen Friedenstruppe in Afghanistan. Urlaub bekam er nur einige Male im Jahr, und so sah Jennys Freundin ihren Vater höchst selten.
Im Sommer, wenn die Ladentür weit offen stand, zog der verlockende Duft von frisch geröstetem Kaffee über den Platz und lockte Scharen von Touristen an. Das Geschäft blühte, denn Francine Dalzons Brûlerie war die einzige Kaffeerösterei weit und breit und eine Attraktion ganz eigener Art. Mit der großen, kupfernen Röstmaschine, den geöffneten Säcken mit Rohkaffee sowie den großformatigen Fotos von der Kaffeeernte in den Hochtälern Mittelamerikas vermittelte das Geschäft einen Hauch von Exotik und Fernweh. Für einen Euro fünfzig, einen für Pariser Verhältnisse geradezu sensationell niedrigen Preis, konnte man an einem der Stehtische eine Tasse frisch zubereiteten Mokka zu sich nehmen. Davon wurde an normalen Geschäftstagen reichlich Gebrauch gemacht.
LaBréa betrat nun den Laden, um Jenny abzuholen. Zusammen mit Alissa stand sie hinter dem Ladentisch. Die beiden Mädchen bemerkten LaBréa zunächst nicht, da sie gerade eine Frau bedienten, deren Alter schwer zu schätzen war.
»Für die Kaffeemaschine, meine Kleine«, hörte LaBréa die Kundin sagen, »und das heißt, nicht zu fein.« Jenny schüttete die Bohnen in die vollautomatische Kaffeemühle und stellte sorgfältig die Mahlstufe ein. Alissa kassierte inzwischen und gab das Wechselgeld heraus.
»Hallo, ihr beiden!«, sagte LaBréa und nickte der Frau zu. »Ist deine Mutter nicht da, Alissa?«
»Doch. Sie ist oben in der Wohnung.«
»Hallo, Papa.« Jenny umarmte ihren Vater, während die Kundin ihm einen flüchtigen Blick zuwarf und den Laden verließ.
Die Hintertür, die zum Treppenhaus führte, wurde temperamentvoll aufgestoßen. Es war Alissas Mutter, die buchstäblich hereinrauschte.
»Na, wie findet ihr mich?« Sie öffnete ein wenig den Mantel und stolzierte wie ein Mannequin nach vorn.
Jetzt sah sie, dass die beiden Mädchen nicht allein im Laden waren.
»Oh, Commissaire! Gut, dass Sie da sind. Was sagt Ihr geübtes männliches Auge?« Sie drehte sich einige Male um die eigene Achse und lachte kokett.
LaBréa betrachtete sie wohlwollend. Unter dem Mantel, den sie jetzt noch weiter zurückschlug, trug sie ein hellblaues Chiffonkleid mit weich fallendem Volantrock. Auf ihren hockhackigen Schuhen war sie beinahe so groß wie LaBréa.
»Oh, là, là!«, sagte er und nickte anerkennend. »Gehen Sie aus?«
»Ich gehe ins La Rose des Roses. Das kennen Sie doch sicher, Monsieur.«
LaBréa nickte.
»Wer kennt es nicht? Früher, gegen Ende der Sechzigerjahre, ging meine Mutter auch hin und wieder an den Wochenenden dorthin. Sie nahm eine Freundin mit, und mein Vater durfte nichts davon wissen!«
»Ja, die kleinen Geheimnisse der Frauen!« Francine lachte, und auf beiden Wangen bildete sich ein Grübchen.
»Die meisten gehen heutzutage in die Remise.« Francine zupfte ihre Haare zurecht. »Dabei ist das La Rose des Roses viel netter. Die Musik ist auch besser. Da spielt immer eine Liveband. In der Remise sparen sie seit ein paar Jahren daran und legen Platten beziehungsweise CDs auf.«
»Ja, das ist natürlich nicht dasselbe!«
»Du siehst super aus, Mama!« Stolz umarmte Alissa ihre Mutter. »Findest du nicht, Jenny?«
Jenny nickte und musterte Francine mit einer Mischung aus Bewunderung und verhaltener Skepsis.
»Doch, echt Klasse!«, sagte sie schließlich.
Alissa rückte ihre Brille zurecht.
»Ach übrigens, Mama, ich sehe beim Training fast nichts mehr, weil ich die Brille nicht aufsetzen darf. Der Trainer hat gesagt, ich soll Kontaktlinsen tragen.« Alissa stand im Tor von Jennys Mädchenmannschaft, die bei einem kleinen Fußballverein trainierte, dessen Sportplatz und überdachtes Trainingsgelände sich in der Nähe des Lycée Technique befanden.
»Na gut, Chérie«, sagte Francine. »Nächste Woche gehen wir zum Optiker, wenn du willst. Mein Gott, warum nimmst du nicht Ballettunterricht, statt dich wie ein Gassenjunge auf einem Bolzplatz herumzutreiben? Was sagen Sie denn zu alledem, Commissaire?«
LaBréa wiegte nachdenklich den Kopf und wollte etwas Zustimmendes erwidern. Da Jenny ihm jedoch einen warnenden Blick zuwarf, schwieg er lieber und schmunzelte nur.
»So«, fuhr Alissas Mutter fort. »Jetzt machen wir den Laden dicht, denn ich muss los.« Sie sah auf ihre Uhr. »Schon kurz nach halb fünf!« Rasch knöpfte sie ihren Mantel zu und gab ihrer Tochter einen Kuss auf jede Wange. »Bis dann, mein Schatz. Ich bin so gegen zehn, spätestens elf zu Hause. Tau dir ein Fertiggericht in der Mikrowelle auf, oder kauf dir bei Bruno eine Pizza.«
»Kann ich nicht doch noch ein bisschen mit zu Jenny gehen?«
Francine blickte LaBréa fragend an. Der nickte und sagte: »Sie kann auch bei uns essen. Ich bringe sie dann später zurück.«
»Macht es Ihnen auch nichts aus, Commissaire?«
»Keineswegs, Madame Dalzon. Haben Sie Nachricht von Ihrem Mann?«
»Heute Mittag rief er an. Nach diesem fürchterlichen Attentat in der letzten Woche geht bei allen ISAF-Soldaten die Angst um. Jeden Abend bete ich für ihn. Weihnachten kommt er zum Glück endgültig aus diesem grauenvollen Land zurück.«
Als ob ihr noch etwas einfiele, ging sie rasch hinter den Ladentisch und füllte eine Schütte frisch geröstete Kaffeebohnen in eine Halbpfundtüte. Sie verschloss sie sorgfältig und reichte sie LaBréa.
»Hier, Commissaire. Brasil ist doch Ihre Lieblingssorte.«
LaBréa bedankte sich. Als er sein Portemonnaie zücken wollte, wehrte Francine entrüstet ab.
»Wollen Sie mich beleidigen, Monsieur? Und jetzt raus mit euch allen!«, sagte sie lachend. »Ich muss noch die Kasse in den Tresor schließen und den Laden absperren.«
Das Licht auf der Place des Vosges war so düster, als wäre die Dämmerung bereits hereingebrochen. Einige Geschäfte unter den Arkaden hatten noch geöffnet, doch insgesamt herrschte wenig Betrieb.
»Wieso hat deine Mutter sich so schick gemacht?«, fragte Jenny ihre Freundin. »Wohin geht sie denn? Auf 'ne Party?«
Alissa strich sich eine Strähne ihrer langen schwarzen Haare aus dem Gesicht und schob erneut ihre Brille zurecht.
»Nee, nicht auf 'ne Party. Meine Mutter geht in ein Tanzlokal.«
Entgeistert starrte Jenny Alissa an, dann fing sie an zu kichern.
»In ein Tanzlokal? Was denn für 'n Tanzlokal?«
»Du brauchst gar nicht so blöd zu lachen!« Alissa klang beleidigt. »Nur weil du etwas nicht kennst, musst du dich nicht gleich darüber lustig machen.«
»Ich mach mich doch gar nicht lustig! Tanzlokal – das klingt nur so komisch.«
»Wieso klingt das komisch? Das heißt nun mal so. Da spielen sie Musette-Walzer. Sie kennen doch auch diese Tanzlokale, Monsieur LaBréa, oder?«
»Ja, die kenne ich«, sagte LaBréa amüsiert.
»Und meine Mutter ist supergut im Tanzen!«
»Mit wem tanzt sie denn da? Allein?« Jenny blickte ihren Vater ein wenig hilflos an.
Alissa lächelte mitleidig.
»So 'n Quatsch! Du hast aber auch echt von nichts Ahnung. Da sind jede Menge Leute, die da sonnabends hingehen.«
»In Marseille gab's so was nicht.«
»Das gab's dort sicher auch. Du kanntest nur niemanden, der so was als Freizeitbeschäftigung und Hobby hatte.«
»Meine Mutter spielte in ihrer Freizeit Tennis. Oder wir sind an den Wochenenden raus aufs Meer gefahren.« Jenny griff nach LaBréas Hand und hielt sie ganz fest.
Es entstand ein kurzes Schweigen. Alissa legte den Arm um die Schulter ihrer Freundin. Dass Jennys Mutter vor einem guten halben Jahr in Marseille ermordet worden war, wusste sie. Wenngleich sie sich vermutlich nicht vorstellen konnte, wie man sich fühlen mochte, wenn man die eigene Mutter durch ein Verbrechen verloren hatte.
Eine Viertelstunde später erreichten sie die Rue des Blancs Manteaux. Jenny hatte Alissa unterwegs erzählt, dass dort Dreharbeiten zu einem Film stattfanden. Tatsächlich standen die Lastwagen noch auf der Straße, und der Scheinwerfer auf dem Podest war voll eingeschaltet. Während LaBréa langsam weiterging, warfen die beiden Mädchen einen neugierigen Blick in den Hausflur. Dort befand sich allerlei Gerät: kleine und große Scheinwerfer und Lampen, Unmengen von Kabeln, Stativen und andere Dinge, die sie nicht kannten. Jetzt kam aus dem ersten Stock eine Frau mit blauer Haarsträhne heruntergelaufen.
»Was wollt ihr denn hier?«, herrschte sie die beiden Mädchen barsch an. »Raus mit euch, hier wird gearbeitet!«
»Blöde Ziege!«, murmelte Alissa, als sie zurück auf die Straße gingen und die Frau außer Hörweite war.
5. KAPITEL
Verstohlen glitt der Tag herein. Wie ein Glasperlenspiel trommelte der Regen auf die durchsichtigen Oberlichter der Atelierwohnung. In der Ferne erklang die Kirchenglocke von Notre-Dame des Blancs Manteaux.
Sonntag.
Als das Telefon zum ersten Mal läutete, war es kurz vor neun.
LaBréa hob schlaftrunken den Kopf. Durch den offenen Spalt der angelehnten Schlafzimmertür hörte er, wie Jenny ins Wohnzimmer lief und den Hörer abnahm.
»Hallo?«
LaBréa stöhnte und fasste sich an die Stirn. Seine Schläfen hämmerten, und in seinen Ohren dröhnte es.
Der Herr der Ringe, dachte er, und drei Worte fielen ihm dazu ein: Kampf, Hektik, Lärm. Eine nervtötende Geräuschkulisse. Zusammen mit Jenny und ihrer Freundin Alissa hatte er sich am Abend das Video angesehen. Während die beiden Mädchen das Geschehen mit atemloser Spannung verfolgten, fühlte er sich nach beinahe drei Stunden wie erschlagen. Als er Alissa gegen einundzwanzig Uhr zurück nach Hause brachte, war er froh, noch ein paar Schritte zu Fuß gehen zu können, um den Kopf wieder einigermaßen frei zu bekommen. Doch anscheinend hatte es nicht viel genützt. LaBréa beschloss, gleich als Erstes zwei Aspirintabletten zu nehmen.
»Papa?« Jenny stand vor der Schlafzimmertür und klopfte an.
»Ja? Komm ruhig rein, Jenny.«
Seine Tochter steckte den Kopf durch die Tür.
»Onkel Richard ist am Telefon.«
»So früh schon?«, brummte LaBréa. Richard war sein jüngerer Bruder. Er besaß eine gut gehende Immobilienagentur im 1. Arrondissement. Vor einigen Jahren hatte er sich ein Landhaus in der Nähe von Versailles gekauft, wo er die Wochenenden mit seinen häufig wechselnden Freundinnen verbrachte. Seit ihrem Umzug nach Paris waren LaBréa und Jenny zweimal dort gewesen.
»Er fragt, ob wir heute Mittag rauskommen.« Jenny verzog das Gesicht und senkte unwillkürlich ihre Stimme. »Dazu hab ich echt keine Lust. Da ist es so langweilig. Außerdem hast du versprochen, dass du heute Nachmittag mit Alissa und mir ins Kino gehst.«
LaBréa nickte vage. Sein Bedürfnis, bei diesem scheußlichen Wetter aufs Land zu fahren, war zwar gering. Doch die Alternative, mit den beiden Mädchen Kick it like Beckham zu sehen, war auch nicht gerade verlockend. Wieso hatte er sich gestern Abend breitschlagen lassen? Jenny und ihre neue Freundin konnten doch allein ins Kino gehen! Ein Streifen über ein indisches Mädchen in London – Jenny hatte ihm den Inhalt erzählt –, das gegen den Willen ihrer Eltern in einer Mädchenmannschaft Fußball spielt, interessierte ihn wirklich nicht. Er konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Jenny ihn aus rein pädagogischen Gründen in diesen Film schleppen wollte.
»Was ist denn nun, Papa?« Jennys Stimme klang ungeduldig. »Soll ich Onkel Richard absagen?«
LaBréa wirkte unentschlossen.
»Sag ihm, ich rufe ihn in einer halben Stunde zurück.«
Wenig später stand Jenny in der winzigen Küche und bereitete ihr Müsli zu. LaBréa, in bequemen Cordhosen und schwarzem Rollkragenpullover, machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen und warf einen skeptischen Blick in Jennys Schüssel. Er selbst war vor wenigen Minuten im strömenden Regen zur Bäckerei in die Rue du Temple gelaufen, um sich zwei frische Croissants zu holen. Sonntags waren es immer zwei, im Unterschied zu den Wochentagen.
Zum zweiten Mal an diesem Morgen läutete das Telefon. Diesmal schrillte LaBréas Handy, das stets eingeschaltet auf seinem Nachttisch lag.
Mit wenigen Schritten war er in seinem Schlafzimmer. »Ja?« LaBréa hörte einen Moment zu und war plötzlich hellwach.
»Danke, Brigadier«, sagte er. »Verständigen Sie die Spurensicherung und rufen Sie Dr. Foucart an. Die Nummern haben Sie ja. Schicken Sie mir einen Wagen? Gut.«
Er stellte das Handy ab und ging rasch ins Wohnzimmer. Jenny stand in der Küchentür und warf ihm einen beunruhigten Blick zu.
»Ist irgendwas, Papa?«
LaBréa antwortete nicht. Er wählte rasch eine Nummer auf seinem Festnetzapparat, die er auswendig kannte. Nach einer Weile wurde am anderen Ende abgehoben.
»Claudine? Hier ist LaBréa.« Claudine Millot war neben Franck Zechira und Jean-Marc Lagarde LaBréas dritter Mitarbeiter. »Tut mir leid, dass ich Sie am Sonntag stören muss. Fahren Sie bitte in die Rue du Renard Nr. 21, Höhe Centre Pompidou-Beaubourg. Männliche Leiche, mehr weiß ich auch noch nicht. Rufen Sie Franck an? – Der ist ins Weekend gefahren? Das glaube ich nicht. Sicher treibt er sich wieder auf irgendeiner Rennbahn herum. Versuchen Sie's über sein Handy. Wenn er abgeschaltet hat, haben wir eben Pech.«
Er legte den Hörer auf und ging in die Küche.
»Ich muss weg, Jenny.« Hastig schenkte er sich eine Tasse Kaffee ein, nahm ein noch warmes Croissant aus der Tüte und biss hinein.
Jenny sagte nichts. An ihrem Gesichtsausdruck konnte LaBréa die Enttäuschung ablesen. Schnell fügte er mit vollem Mund hinzu:
»Dann gehst du eben allein mit Alissa ins Kino! Hier.« Er zog sein Portemonnaie aus der Tasche und reichte Jenny einen Zehn-Euro-Schein. »Und tu mir den Gefallen und ruf Onkel Richard an, dass wir heute leider nicht kommen können.«
LaBréa ging ins Schlafzimmer, wo das Holster mit seiner Dienstwaffe, einer Beretta 9 mm Parabellum, im Kleiderschrank lag. Er nahm die Pistole und sein Handy, zog im Flur den Trenchcoat über und griff nach seinem Regenschirm.
Jenny folgte ihm zur Haustür.
»Mein Wagen ist sicher schon da«, sagte LaBréa und umarmte seine Tochter. »Mach's gut. Ich ruf dich nachher an. Wenn du weggehst, schalte bitte dein Handy ein.«
»Im Kino muss man die Handys abschalten«, bemerkte Jenny bockig.
»Und mittags kannst du die Reste von gestern Abend essen. Es sind noch Frühlingsrollen im Kühlschrank und ein Rest Currysalat.«
Jenny nickte und sah ihren Vater mit großen Augen an.
»Warum kannst du nicht einen Beruf haben wie andere Väter auch?« Es klang traurig und schnitt LaBréa ins Herz. Doch was sollte er darauf antworten? Also sagte er nichts, öffnete die Haustür und lief hinaus in den Regen, der gleichmäßig und schwer vom Himmel fiel.
Der Straßenabschnitt bei der Hausnummer 21 in der Rue du Renard war bereits abgesperrt. Mehrere Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht sowie ein Leichenwagen parkten vor dem Haus, einem großbürgerlichen Fin-de-Siecle-Gebäude. Einige Straßenpassanten standen gaffend herum. Die beiden Fahrer des Leichenwagens, die noch auf ihren Einsatz warten mussten, lehnten rauchend am Auto und versuchten mit einer jungen Frau anzubändeln, die mit ihrem Hund an der Leine das Geschehen neugierig verfolgte.
LaBréa zeigte dem uniformierten Polizisten, der sich am Eingang postiert hatte, seinen Dienstausweis. Dann warf er einen Blick auf die Messingschilder neben der Eingangstür. Es gab zwei Arztpraxen im Haus, eine Kanzlei und eine Filmproduktionsgesellschaft mit dem Namen Les Films du Diable.
»Im dritten Stock, Commissaire«, sagte der Polizist. »Die Filmproduktion.«
»Gibt es in diesem Haus nur gewerbliche Räume?«
»Nein. Es gibt auch einige Privatwohnungen.«
Obwohl ein Fahrstuhl vorhanden war, lief LaBréa die Treppen hoch. An der Eingangstür kam ihm Claudine Millot entgegen.
»Morgen, Chef«, sagte sie. Ihre Stimme klang ungewöhnlich tief und passte nicht so recht zu ihrer eher zierlichen Gestalt. Ihre blonden, glatten Haare trug sie halb lang geschnitten. Um ihren Mund lag ein energischer Zug. Doch wenn sie lachte, wirkte sie ausgesprochen weiblich und sanft. Ihre kleine Körpergröße hatte schon so manchen darüber hinweggetäuscht, dass Claudine Millot nicht nur hervorragend mit der Waffe umgehen konnte, sondern auch mehrere Kampfsportarten beherrschte. Sie besaß den schwarzen Karategürtel und betrieb Kickboxen. Das alles war sicher nicht zuletzt auf den Einfluss ihres Mannes zurückzuführen. Jean-Claude Millot, ehemaliger Angehöriger einer Gendarmeriespezialeinheit, versah seinen Dienst als Leibwächter des Premierministers.
»Morgen, Claudine.« LaBréa knöpfte seinen Trench auf und betrat das geräumige Entree der Filmproduktion. »Und?«
»Das Opfer ist der Produzent und Inhaber der Filmfirma. Eine bekannte Größe in der Filmbranche.«
»Wie heißt der Mann?«
»Jacques Molin.«
LaBréa runzelte die Stirn.
Molin? Hatte seine Nachbarin Céline ihm diesen Mann gestern nicht vorgestellt?
»Aber ich warne Sie, Chef: Das ist kein schöner Anblick!«
Claudine führte ihn in ein großes Büro. Die Ausstattung schien teuer zu sein und wirkte protzig. Schwere Ledersessel und ein runder Marmortisch standen im Raum, ein wuchtiger Schreibtisch mit einem modernen Flachbildschirmcomputer prangte an der Fensterfront. An der linken Wand hingen eingerahmte Filmplakate, an der rechten Seite gab es ein riesiges Regal mit Unmengen von Akten, einigen Videokassetten und Fotos, die den Produzenten mit bekannten Schauspielern zeigten.
Zwei Mitarbeiter der Spurensicherung suchten in ihren weißen Overalls den Raum akribisch ab. Der Fotograf schoss seine Bilder.
Das Opfer lag wenige Meter vor dem Schreibtisch in der Raummitte. Seine Hände waren mit einer Nylonschnur nach vorn über Kreuz gefesselt. Jacques Molin trug Anzughose, Weste und ein Hemd mit aufgerollten Ärmeln. Seine teure Rolex-Uhr war von der Fessel halb verdeckt. Claudine hatte nicht übertrieben – es war ein scheußlicher Anblick. Das Gesicht des Mannes war nur noch eine Masse aus Fleisch und Knochen und bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die weißen Haare klebten blutverschmiert am Kopf. Für einen Moment wurde LaBréa übel, und er war nahe daran, in Ohnmacht zu fallen. Plötzlich befand er sich wieder in Annes Arztpraxis, wie vor sechs Monaten. Ihr lebloser Körper, die schweren Verletzungen, das Blut ... Er konnte es förmlich riechen. Doch das hier war das Blut eines anderen. Er musste sich zusammenreißen und das Bild seiner ermordeten Ehefrau mit aller Macht verdrängen. Sonst würde er bald den Punkt erreichen, an dem er seinen Beruf an den Nagel hängen konnte. In vier Mordfällen hatte er seit Annes Tod ermittelt. Jedes Mal war der Anblick der Leichen für ihn eine Tortur gewesen.
LaBréa atmete tief durch und warf einen Blick auf den Schreibtisch des Toten. Dort lag eine rote Baseballkappe mit der Aufschrift Never back to Hollywood. An den Füßen des Opfers entdeckte LaBréa jene schwarz-weißen Schuhe, die ihm bereits am gestrigen Morgen aufgefallen waren. Kein Zweifel, der Tote musste tatsächlich Jacques Molin sein.
Brigitte Foucart, die Gerichtsmedizinerin, hatte bereits mit ihrer Arbeit begonnen. Sie kniete auf dem Boden und untersuchte den Toten. LaBréa kannte Brigitte schon seit mehr als zwanzig Jahren. Damals hatte er als junger Inspektor bei der Pariser Mordkommission angefangen. Inzwischen musste Brigitte bestimmt schon Ende fünfzig sein und kurz vor ihrer Pensionierung stehen. Sie trug ihre dichten grauen Haare burschikos kurz geschnitten, war von kräftiger Statur und galt in gerichtsmedizinischen Kreisen als Institution. Sie liebte sportlich-bequeme Kleidung und hatte eine Vorliebe für gut sitzende Flanell- oder Gabardinehosen, schicke Pullis oder Blusen und dazu passende Blazer. Jetzt hatte sie die übliche Schutzkleidung übergezogen. Mit ihrem Mann, einem bekannten Pariser Urologen, war sie seit beinahe dreißig Jahren verheiratet. Die Ehe war kinderlos geblieben, was Brigitte keineswegs bedauerte.
Als sie LaBréa sah, entblößte sie ihre starken, einem Pferdegebiss ähnlichen Zähne zu einem flüchtigen Lächeln.
»Hallo, Maurice. Schöne Schweinerei, und das am Sonntag und vor dem Mittagessen! Da kommt einiges auf mich zu. Du siehst ja selbst, wie er aussieht. Frag mich jetzt bloß nicht nach Einzelheiten.«
»Ich kenne den Mann. Ich habe ihn gestern Vormittag noch gesehen.«
»Ach ja?« Brigitte klang überrascht.
»Ja. Eine Nachbarin hat ihn mir vorgestellt. Er ist Filmproduzent und hat in meiner Straße gedreht. Da trug er auch diese Baseballkappe.« Er zeigte auf die Mütze.
Claudine Millot schaltet sich ein.
»Ja, die Produktionsfirma steht mitten in Dreharbeiten. Die Frau des Opfers ist übrigens bereits benachrichtigt. Sie wohnt in Le Pecq und kommt in Kürze her.«
»Was heißt das, sie wohnt in Le Pecq? Wohnte ihr Mann nicht dort?«
»Doch, aber sie sagte mir am Telefon, dass er meistens in der Stadt übernachtet hat, wenn Dreharbeiten stattfanden. Nach Drehschluss gäbe es oft noch Besprechungen, meinte sie.«
»Wo bleibt eigentlich Franck?«, fragte LaBréa etwas ungehalten.
»Ich habe ihn noch nicht erreichen können, Chef, ihm aber eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen.«
»Na schön, hoffen wir, dass er sich bald meldet. Was ist mit Jean-Marc?«
»Der hat einige Tage Urlaub und ist übers Wochenende zu seiner kranken Mutter nach Nizza geflogen.«
»Ach ja, richtig.« LaBréa erinnerte sich.
»Er kommt heute Abend zurück.«
»Wer hat die Leiche gefunden?«
»Die Produktionsleiterin. Eine Frau namens Nadine Capelli. Sie kam heute Morgen gegen neun hierher, um den morgigen Dreh vorzubereiten.«
»Demnach hatte sie einen Schlüssel zu den Firmenräumen?«
»Ja. Die Frau sitzt nebenan in ihrem Büro. Die Sekretärin des Produzenten ist ebenfalls eingetroffen.«
LaBréa wandte sich an Brigitte Foucart, die sich vom Fußboden erhob und den Schutzkittel auszog.
»Der Todeszeitpunkt, Brigitte. Nur eine ungefähre Einschätzung.«
»Na schön, Maurice. Rigor mortis ist voll ausgeprägt. Ich schätze, dass er seit mindestens acht Stunden tot ist. Aber genau lege ich mich da noch nicht fest.«
»Ist das die Tatwaffe?« Brigitte Foucart nickte. Neben der Leiche lag ein Golfschläger. Schlagfläche und Schaft des Schlägers waren mit getrocknetem Blut überkrustet. Wenn der Täter die Tatwaffe zurückließ, musste er sich sehr sicher sein. Es war kaum anzunehmen, dass er Fingerabdrücke auf dem Griff hinterlassen hatte. LaBréa wandte sich erneut an die Gerichtsmedizinerin.
»Er wurde also erschlagen.«
»Ich würde sagen, dass ihm gezielt das Gesicht zerstört wurde. Seine Hände sind gefesselt. Soweit ich bisher sehen kann, hat er am Körper keine weiteren Verletzungen. Keine Hautabschürfungen, keine Hämatome. Doch ob die Schläge tatsächlich die Todesursache waren, sei noch dahingestellt.«
»Wieso?«
Brigitte zuckte mit den Schultern und blickte ihn ernst an.




























