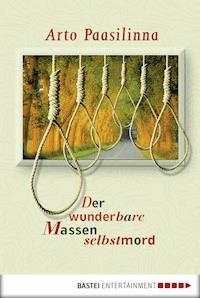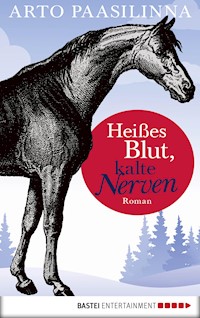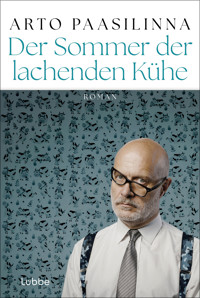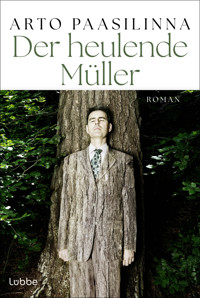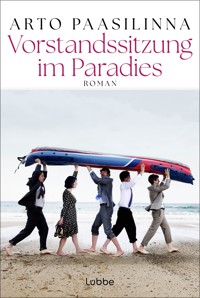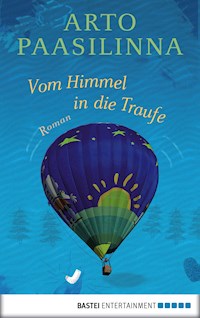Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der liebe Gott hat die Nase gestrichen voll von den Menschen und ihren Missetaten. Er braucht Abstand, ist schlichtweg urlaubsreif. Nur, wer soll ihn vertreten? Der Heilige Petrus winkt dankend ab. Warum nicht einem Menschenkind den Job anbieten? Und so klopft Erzengel Gabriel bei Kranführer Pirjeri Ryynänen an. Frohen Mutes besteigt der sogleich den Himmelsthron ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:4 Std. 50 min
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Arto Paasilinna
Der liebe Gott macht blau
Roman
Aus dem Finnischen von Regine Pirschel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der finnischen Originalausgabe: AUTA ARMIAS
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1989 by Arto Paasilinna
Published by arrangement with WSOY, Helsinki
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2008 by Bastei Lübbe AG, Köln
Die Übersetzung wurde von einer überarbeiteten Fassung des finnischen Originals vorgenommen.
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0143-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1
Gott ist ein gutaussehender Mann. Er ist 178 Zentimeter groß, ein wenig stämmig, aber wohlproportioniert und von aufrechter Haltung. Seine Gesichtszüge sind ebenmäßig, mit gerader Nase und hoher Stirn, der Blick ist von sanfter Bestimmtheit, wenn auch recht müde. Gottes Ohren stehen nicht ab, und sie sind frei von Ohrenschmalz. Er hat weder Kinn- noch Oberlippenbart. Sein Haar ist brünett, er trägt es glatt und gescheitelt, auf der rechten Seite – von ihm aus betrachtet –, es ist kurz, und an den Schläfen schimmert es grau. Trotzdem wirkt Gott noch nicht sehr alt.
Seine Finger sind lang, schmal und unberingt. Gott hat keinen Adamsapfel.
Er trägt einen grauen, gut sitzenden Flanellanzug, dessen Schnitt verrät, dass er aus den 50er Jahren stammt. Das Jackett ist zweireihig und hat schwarze Knöpfe, die Hosen sind mit Aufschlägen gearbeitet. Dazu trägt er schwarze Halbschuhe zum Schnüren aus weichem Leder, Größe 42. Gott bevorzugt kurze Unterhosen. Unter dem Jackett trägt er eine Weste und unter der Weste Hosenträger. Sein Hemd ist aus Baumwolle von guter Qualität, und es hat kein Herstelleretikett, dasselbe gilt auch für seine übrige Kleidung.
Gott benutzt kein Parfüm, und er riecht nicht nach Schweiß. Der Duft, der ihn umgibt, ist sanft männlich, seine Stimmlage ein klangvoller Bariton.
Er strahlt ein selbstverständliches Charisma aus und wirkt sehr kultiviert. An seinen Augen sieht man, dass er außerordentlich intelligent ist. Auf seiner edlen Stirn haben sich Furchen gebildet, die von Anstrengung und Müdigkeit zeugen.
Er ist der Gott der Christenheit, Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmächtige Vater, unser Herr, der allerhöchste, gnädige Gott … unter vielen Namen bekannt. Er entspricht nicht ganz dem Bild, das sich die Menschheit von ihm gemacht hat – er ist kein graubärtiger Alter, trägt keinen Umhang und keinen Hirtenstab, und über seinem Kopf schwebt kein Heiligenschein. Er sieht wie ein Mensch und nicht wie der Gott in unserer Phantasie aus, was nicht verwundern darf, denn er hat ja den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen.
Zwischen Gott und seinem Sohn gibt es eine gewisse Ähnlichkeit – Jesus Christus kommt eindeutig nach seinem Vater, wenngleich er auch Züge seiner Mutter Maria trägt. Man kann sagen, dass er die Nase seiner Mutter, jedoch die Augen seines Vaters geerbt hat.
Der Allmächtige wohnt sowohl im Himmel als auch auf Erden und ist durch seine Engel überall anwesend. Er besitzt die göttliche Gabe, sich durch die Kraft des bloßen Gedankens jederzeit überallhin begeben zu können, und wohin er auch geht, folgen ihm seine Gehilfen mit allem notwendigen Zubehör.
So ist das Erscheinungsbild des lieben Gottes, Herrscher über Himmel und Erde.
Gott saß in seinem geliebten ledernen Ohrensessel, und dieser stand in einem runden Turm, der zu einem alten Schloss in Bulgarien gehörte. Dieses Ungetüm von Schloss war vor langer Zeit im Sjutkja-Gebirge nahe der Stadt Dospati und des kleinen Dorfes Hjornakurdzali errichtet worden. Einst hatte es ein Nonnenkloster beherbergt, doch jetzt stand es leer. In Bulgarien gab es nicht mehr viele Nonnen, und die Adelsgeschlechter waren ausgestorben, die Revolution hatte die letzten Reste ausgetilgt. Das Schloss stand auf einem Berg, und Gott liebte den weiten Ausblick. Es war ein wolkiger Herbsttag. Ein paar Krähen flogen zwischen dem Schloss und dem nahen Berghang umher, sie kreischten laut, denn oben in den Wolken kreiste mit finsterem Blick ein hungriger Adler.
Vor hunderten Millionen Jahren, in der Morgendämmerung der Zeiten, war es Gott in den Sinn gekommen, einen netten neuen Planeten zu schaffen, eine Art Versuchsballon, bestens geeignet, allerlei glückliches Leben darauf anzusiedeln. Gott war damals noch jung und experimentierfreudig gewesen. Das Material für den Erdball konnte er mühelos aus dem kosmischen Müll der Umgebung gewinnen, hauptsächlich von einem kleinen Stern namens Sonne. Nachdem Gott die Anziehungskraft und die Umlauf bahn und die übrigen Grundlagen des neuen Planeten geregelt hatte, konzentrierte er sich darauf, ihn mit Leben zu bevölkern.
Die Aufgabe war anfangs äußerst interessant und dankbar. Gott schuf verschiedene Zellen und primitive Wesen, die munter zu leben begannen. Er bevölkerte den neuen Planeten mit allerlei Krebsen und Schnecken, ließ seiner Phantasie freien Lauf, während er die verschiedensten Körperstrukturen, genetischen Zusammensetzungen, Farben und Lebensweisen ausprobierte. Er überließ es den Organismen, sich zu teilen und vor sich hin zu wachsen. Nach Verlauf mehrerer Jahrhunderte beschloss er, es mit ein paar höher entwickelten Arten zu probieren, zunächst mit Fischen und Echsen. Dadurch angeregt, schuf er danach eine Vielzahl von Vögeln, später Säugetiere, und am Ende, aus einer Laune heraus, formte er aus den intelligentesten Säugetieren zunächst den Affen und schließlich ein Wesen, das ihm selbst ähnelte, den Menschen. Dies war Gottes allerletzter Schöpfungsakt, und er sollte ihn noch bereuen.
Gott hat einen guten Charakter, und einen solchen wollte er auch dem Menschen geben. Im Trubel des Schöpfungsaktes hatte er jedoch offenbar nicht aufgepasst, es war ein echtes Missgeschick gewesen. Während Gott arbeitete, war es offenbar dem Satan höchstpersönlich gelungen, seine teuflischen Gene unter die an sich guten Erbanlagen des neuen Wesens zu mischen, und seither hat Gott nichts als Ärger mit der Menschheit. Vielleicht hatte der Satan auch bereits bei der Erschaffung der entwickelteren Säugetierarten seine Finger im Spiel gehabt? Denn als Gott den Wolf plante, schwebte ihm ein nettes pelziges Tier vor, das gut in den kalten Regionen des Erdballs zurechtkäme. Der Wolf sollte nach Gottes Vorstellungen von sanftem und friedlichem Wesen sein, er sollte Gras fressen und in fröhlichen Rudeln durch die verschneite Steppe traben. Als der Wolf aber fertig war, musste Gott feststellen, dass da etwas gründlich danebengegangen war. Der Wolf versuchte ihn in die Ferse zu beißen und musste getötet werden. Zuvor hatte sich das Raubtier aber bereits über die ganze nördliche Halbkugel ausgebreitet. Auf gleiche Weise tauchten überall auf der Erde andere Raubtiere auf, bis sich schließlich der Mensch als das grausamste aller Wesen erwies, das manchmal eben einfach teuflisch sein konnte.
Gott wünschte sich den Menschen als Retter seiner Schöpfung, gab ihm einen Verstand und verschiedene Gefühle. Sein Ziel war es, dass der Mensch die Welt von den blutrünstigen Raubtieren befreien sollte. Ab und zu tauchten auch tatsächlich ein paar anständige Exemplare auf. Die allermeisten Menschen waren jedoch so streitsüchtig, gierig, gemein und machthungrig, dass Gott ihrem Treiben nur noch traurig zuschauen konnte.
Je kultivierter der Mensch wurde, desto schurkischer wurde er. Im Laufe der Geschichte lernte er, Völker zu bilden, und er eignete sich Kriegstechniken an. Unaufhörlich führte er grausame Kriege, sodass auf der Welt in nie gekanntem Ausmaß Leid und Schmerz gesät wurden.
Vor zweitausend Jahren versuchte Gott, das Geschehen auf der Welt zum Besseren zu wenden, indem er seinen einzigen Sohn Jesus Christus aussandte, die Menschen zu beruhigen. Es handelte sich um eine Notlösung.
Das Vorhaben scheiterte. Die Menschen verhielten sich ihrem Wesen entsprechend, sie machten dem Gottessohn das Leben zur Hölle, verspotteten ihn, kaum jemand nahm ihn ernst. Schließlich gingen die Menschen so weit, dass sie den arglosen und gutgläubigen Burschen töteten, dazu noch auf grausamste Weise. In der ihnen eigenen mitleidlosen Art nagelten sie den armen, unschuldigen Jesus lebend mit Händen und Füßen an ein Kreuz. Gott blieb nichts weiter übrig, als seinen Sohn von den Toten zu erwecken und in den Himmel zu rufen, damit er dort seine Wunden lecken konnte.
Heute ist Jesus irgendwo im Weltall in Begleitung eines gewissen Rutja unterwegs. Soweit sich Gott erinnern konnte, war das der Sohn des finnischen Donnergottes, eine Art Kollege von Jesus, stammte zumindest aus der gleichen göttlichen Kaste. So viel zu diesem Thema, dachte Gott müde. Er hatte getan, was er konnte, um die Welt vor dem Verderben zu retten, aber die Menschheit hatte keine Besserung erkennen lassen.
Gott war enttäuscht und verbittert. Sein gutes Herz war müde von all dem Leid, das die Menschen verursachten. Ihm kam der finstere Gedanke, den ganzen erbärmlichen Planeten aus seiner Bahn zu stoßen. Einfach kurzen Prozess machen! Die Erdkugel würde um ihre Achse kreisen, würde in die Kälte des Außenkosmos stürzen und in tausend Stücke zerspringen, wenn sie in das alles verschlingende schwarze Loch fiele.
Gott setzte diesen verzweifelten Gedanken allerdings nicht in die Tat um. Er hatte in Jahrmillionen währender Arbeit immerhin so viel herrliches und schönes Leben auf der Erde geschaffen, dass es schade gewesen wäre, all das nur wegen der Bösartigkeit der Menschen zu zerstören.
Vielleicht bestand ja noch Hoffnung? Sollte er ein weiteres Mal den harten Kampf aufnehmen, alle himmlischen Heerscharen versammeln und dem Menschen das Böse austreiben? Es würde enorme Kraft kosten, darüber war sich Gott im Klaren. Er fühlte sich zu müde für diesen Kampf, war die Welt und ihre Angelegenheiten leid; wenn es so weiterginge, wäre er bald gänzlich ausgebrannt. Gott litt wie kein anderer an mentaler Erschöpfung. Er stand unter schwerem Stress.
Der Allmächtige seufzte erschöpft. Wenn er wenigstens mal ein Jahr lang Urlaub machen und, frei von den Sünden der Welt, ausruhen könnte! Das wäre herrlich. Er könnte beispielsweise auf die Kehrtkugel reisen, den nächstgelegenen Planeten im Universum. Dort führten Wesen, die einen höheren Entwicklungsstand als die Menschen hatten, in aller Stille ein anständiges und frommes Leben. Gott fühlte sich wirklich reif für ein Sabbatjahr, er erinnerte sich, dass er bereits seit dem Ersten Weltkrieg unter Depressionen litt.
Der Allmächtige hatte zwei enge Gehilfen, so etwas wie himmlische Kanzleichefs, den heiligen Petrus und den Erzengel Gabriel. Beide waren fähige und erfahrene Beamte. Petrus war seinerzeit ein tüchtiger Fischer, später dann ein Jünger Jesu und schließlich Apostel gewesen. Der Erzengel Gabriel hatte über lange Zeit himmlisch-administrative Erfahrungen gesammelt, er kannte die Angelegenheiten der Welt fast ebenso gut wie Gott selbst.
Petrus und Gabriel hatten energisch gegen Gottes düsteren Plan zur Vernichtung der Welt protestiert. Immerhin hätte das für sie den Verlust ihrer Stellung bedeutet, da ihre Fähigkeiten nach dem Weltuntergang wohl kaum auf einem anderen Planeten gefragt sein würden. Sie waren Spezialisten für die Angelegenheiten der Menschheit, Gefangene der Erde. Die fremden Bedingungen auf einem anderen Planeten hätten das Ende ihrer Karriere bedeutet. So hatten sie denn Gott gegenüber versichert, dass die Vernichtung der Erde eine äußerst unüberlegte Tat, eine große Sünde wäre, und sie hatten erreicht, dass er sein schreckliches Vorhaben aufgab. Also durfte die Erdkugel, zumindest vorerst, auf ihrer Bahn bleiben, der Weltuntergang würde zunächst einmal ausfallen.
Ein Sabbatjahr wollte Gott aber dennoch einlegen, darauf bestand er. Er war so müde und hatte die Welt so gründlich satt, er konnte die schrecklichen Taten der Menschen einfach nicht mehr ertragen. Petrus und Gabriel fanden den Gedanken verständlich, wenngleich auch ungewöhnlich. Ein »urlaubender Gott«, allein schon der Begriff wirkte irgendwie radikal. Auf jeden Fall musste ein Vertreter für Gott her, der sich um die Angelegenheiten der Welt kümmerte, während Gott selbst seinen verdienten Urlaub machte und für die Zukunft Kräfte sammelte.
Gott war der Ansicht, dass sich Petrus oder Gabriel gleichermaßen als seine Urlaubsvertretung eigneten. Er vertraute ihnen. Ein Jahr war schließlich nur eine kurze Zeitspanne in der Geschichte der Menschheit, in der ohne Weiteres die Kanzleichefs das Amt ausüben konnten.
Der Gedanke entsetzte sowohl Petrus als auch Gabriel. Kaum jemand kannte so gut wie sie den elenden Zustand der Welt, unter keinen Umständen wollten sie die Verantwortung für die Geschicke der Menschheit tragen, nicht mal einen Monat, geschweige denn ein ganzes Jahr lang. Zwar war das Angebot, Gott zu spielen, an sich schmeichelhaft, aber trotzdem war die Aufgabe einfach zu undankbar. Gottes Gehilfen lehnten das verlockende Angebot ab. Ja, es wäre zweifellos eine Ehre, das Amt zu übernehmen, doch alles hat seine Grenzen. Außerdem waren beide schon jetzt mehr als genug mit ihren eigenen Pflichten ausgelastet; zusätzlich noch Gott zu sein, überforderte sie.
Gabriel schlug einen Kompromiss vor. Wenn man nun einen frommen und fähigen Menschen mit der Vertretung betrauen würde? Vor allem Petrus unterstützte den Gedanken. Letzten Endes hatten ja die Menschen ihre Probleme selbst verursacht, es wäre also nur gerecht, wenn einer von ihnen eingesetzt würde, wenigstens ein Jahr lang die schmutzige Wäsche zu waschen, die sie mit ihrem schlimmen Treiben angehäuft hatten.
Gott dachte darüber nach. Der Vorschlag erschien ihm auf einmal recht plausibel.
»Außerdem«, sagte Erzengel Gabriel, »sollte es doch nicht schwer sein, interessierte Menschen für das höchste Amt der Welt zu finden.«
»Der Mensch muss endlich die Verantwortung für seine Taten übernehmen«, fügte Petrus nachdrücklich hinzu.
»Ja, vielleicht«, äußerte Gott zögernd.
Nachdem er den Vorschlag gründlich bedacht hatte, stimmte er seinen Ratgebern zu. Der Beschluss stand fest, und Gott erklärte:
»Ich, der müde und rechtmäßige Gott, beauftrage euch: Sucht auf Erden nach einem frommen Menschen, der zu meinem Stellvertreter taugt!«
Sie beschlossen, die Stelle des amtierenden Gottes öffentlich auszuschreiben. In Kenntnis der menschlichen Natur konnten sie davon ausgehen, dass sich der größte Teil der Menschheit bewerben würde, auf jeden Fall aber alle Deutschen und alle Savolaxer.
Gott schaute hinauf in die Berge. Zufällig schoss gerade in diesem Moment ein Adler aus den Wolken herab und packte mit seinen Krallen eine kreischende Krähe. Gott erschauerte.
»Jener Adler hat recht viel vom Menschen«, äußerte er. Dann dachte er an das Opfer, die Krähe.
»Und auch die Krähe ist nicht gerade ein Glanzstück … Besser wäre, ich hätte sie nicht geschaffen.«
2
Birger Ryynänen, genannt Pirjeri, war ein vierzigjähriger Kranfahrer. Er verdiente sich seine Brötchen auf einer Baustelle der Firma Haka mitten im Zentrum von Helsinki, in der Kluuvikatu, wo er vierzig Meter über der Straße zwischen Himmel und Erde schwebte. Pirjeri hatte eine akzeptable, leicht stämmige Figur und war brünett. Seine Haare kämmte er sich zur selben Seite wie der liebe Gott. Pirjeri roch werktags nach Schweiß, denn er musste mehrmals am Tag in die luftigen Höhen seiner Kabine hinaufklettern. Er hatte weder Bart noch Schnauzer.
Pirjeris Hände waren sehnig, und an den Fingern steckte kein Ring, zumindest nicht mehr seit seiner Scheidung.
Pirjeri trug einen lose sitzenden Overall, auf dem Rücken stand in Großbuchstaben HAKA. Seine Füße steckten in blauen Turnschuhen. Pirjeri benutzte auf der Arbeit kein Parfüm und trank kein Bier, in der Freizeit schon.
Pirjeri Ryynänen war ein tüchtiger und gebildeter Mensch. Er war auch intelligent und humorvoll, aber kein eigentlicher Witzbold. Nach dem Abitur hatte er begonnen, Staatswissenschaften zu studieren, doch nachdem er eine Studentin der Zahnmedizin geheiratet hatte, hatte er sein Studium abgebrochen und gejobbt, damit sich seine Frau frei von finanziellen Sorgen ihrem Studium zur Pflege der menschlichen Kauleiste widmen konnte. Er war Verkäufer in einem Alko-Geschäft gewesen und dabei ein recht guter Weinkenner geworden. Später hatte er vorübergehend als Bibliothekar, zweimal während des Winters als Aushilfslehrer in der Grundschule von Kuusamo, danach als Stauer im Helsinkier Osthafen und als Fahrer eines Tanklasters gearbeitet, und mit zunehmender beruflicher Erfahrung war er schließlich Bauarbeiter in der Hauptstadt geworden.
Neben seinen Gelegenheitsjobs hatte Pirjeri Ryynänen sein Studium der Staatswissenschaften so lange fortgesetzt, bis er den Abschluss des Kandidaten in der Tasche hatte. Das Papier hätte ihn berechtigt, sich in dieser oder jener Behörde zu bewerben, doch die Lauf bahn eines kleinen Beamten interessierte ihn in dieser Phase seines Lebens nicht mehr: Die Beamten leisteten wenig, in den Dienststellen wurde intrigiert, und die Bezahlung war schlecht.
Die letzten Jahre hatte Pirjeri Ryynänen in luftiger Höhe auf seinem Turmdrehkran gesessen und sowohl die weite Sicht als auch das recht ansehnliche Gehalt genossen. Pirjeri war ein Mann, dem das Leben und die Arbeit kein Kopfweh bereiteten. Er verschwendete schon seit Jahren keinen Gedanken mehr an eine Fortsetzung des Studiums der Staatswissenschaften, auch nicht an eine Lizentiatarbeit oder eine Dissertation. Zwar wäre er in der Lage dazu gewesen, aber es interessierte ihn nicht mehr: Pirjeri hatte eine befriedigende, einsame und ruhige Arbeit hoch über der quirligen Baustelle und der ganzen Stadt gefunden. Er wollte allein arbeiten, ohne dass ihn jemand störte, über den Köpfen der anderen thronen, ohne freilich jemanden zu erniedrigen. Er war ein Mann mit Weitblick.
Pirjeris Frau Jaana hatte sich bald nach Abschluss ihres Studiums von ihm scheiden lassen, sie hatte ihn auf der gesellschaftlichen Erfolgsleiter überholt. Es war ein Unding, dass die Ehefrau in der Wohnung in Töölö eine einträgliche Zahnarztpraxis betrieb und im selben Haushalt ein geschasster Hilfslehrer lebte, der sich sein Geld als gewöhnlicher Hafenarbeiter verdiente. Das gemeinsame Kind Mirkka wurde bei der Scheidung der Mutter zugesprochen, für den Unterhalt hatte der Vater aufzukommen. Pirjeri zahlte achtzehn Jahre lang Alimente.
Pirjeri stammte ursprünglich aus dem Stadtteil Alppila in Helsinki, seine Eltern waren nach dem Krieg aus der Provinz dorthin gezogen. Sein Vater, Gutsverwalter Johannes Ryynänen, war durch das Landbeschaffungsgesetz arbeitslos geworden, seine Dienststelle, ein großes Landgut in Myrskylä, hatte einen beträchtlichen Teil des Grund und Bodens an Umsiedler aus Karelien abtreten müssen. Johannes Ryynänen war nach Helsinki gezogen, wo er Arbeit als Straßenbahnfahrer gefunden hatte.
Pirjeris Mutter war vornehmerer Herkunft, sie war die Tochter eines Pfarrers der Landkirchengemeinde von Lohja. Nach ihrer Kenntnis stammte ihre Familie ursprünglich aus Frankreich, die Vorfahren waren Wallonen gewesen, die zur Zeit Gustavs II. als Metall- und Bergarbeiter nach Schweden geholt worden waren. Pirjeris Mutter behauptete gern, dass jene Familie namens Ventuerée, die im achtzehnten Jahrhundert ins finnische Mustio umgezogen war, sogar dem niederen Adel angehört hatte. Ihr Vater, Pfarrer Kristo Ventturoinen, hatte in der Dreißigerjahren im großen Stil Ahnenforschung betrieben und die Geschichte der Ventuerées untersucht, aber als sich herausgestellt hatte, dass es in der Familie, außer dem wallonischen Stammvater, auch eine ganze Reihe von Pferdedieben, Mördern und Gottesleugnern gegeben hatte, hatte er die Sache auf sich beruhen lassen. Pirjeris Mutter war also eine geborene Ventturoinen. In ihrer Familie hatte es mehrere Pfarrer gegeben, der bedeutendste von ihnen war Anatoli Ventturius, Probst von Yli-Kiiminki, gewesen.
Pirjeris Mutter benutzte nur selten eine Straßenbahn, die von ihrem Gatten gelenkt wurde. Das war auch besser so, denn sie hatte einen hitzigen Charakter und konnte es sich nicht verkneifen, den Fahrstil ihres Mannes zu kritisieren. Zu Zeiten des Generalstreiks passierte es einmal versehentlich, dass die Eheleute im selben Wagen auf der Hauptlinie saßen. Da war der Streit vorprogrammiert. Pirjeris Mutter konnte es wieder einmal nicht lassen, an ihrem Mann herumzumäkeln, und sie rief ihm von ihrem Sitz aus giftige Bemerkungen zu, unter anderem über seine Art, zu bremsen und zu beschleunigen.
Die Fahrt ging von Kallio nach Hakaniemi. Die Gattin schimpfte wie gewöhnlich über die zu hohe Geschwindigkeit. Ryynänen mochte sich von seiner Frau nicht belehren lassen und fuhr allzu hastig die abschüssige Strecke zum Hakaniemi-Markt hinunter. Wenn man auf den Markt einbiegt, fährt man durch eine Kurve. Die hohe Geschwindigkeit ließ die Bahn aus den Schienen springen, und sie kippte um. Auf der Seite liegend, rutschte sie bis auf den Markt, alle Fensterscheiben, die mit dem Straßenpflaster Kontakt hatten, zerbrachen. Ein Fahrgast wurde leicht verletzt, das zweite Opfer war ausgerechnet Frau Ryynänen. Sie schlug mit dem Kopf gegen die Haltestange im Wagen und handelte sich eine schlimme Verletzung ein, die ihr Sprachzentrum dauerhaft lähmte. Von da an herrschte wieder Eintracht in der Wohnung der Ryynänens in Alppila.
Der Vater hätte seinen Sohn gern Kauko genannt, aber die Mutter wollte es vornehm; »Birger« hörte sich in ihren Ohren sowohl adelig als auch hübsch an. Vor dem Krieg in Myrskylä war ihre erste Liebe ein Student namens Birger gewesen, Sohn eines gewissen Ingenieurs Lönström.
Der Bursche hatte auf den Feldern der Pfarrei im Heu gearbeitet, und die Mutter erinnerte sich ihr Leben lang, wie schmuck jener Birger ausgesehen hatte, als er, mit der Studentenmütze auf dem Kopf, durch das raschelnde Heu zu ihr gekrochen war. Die Mutter rief ihren Sohn nie Pirjeri, so wie alle anderen, sondern stets: »Birger, Liebling.«
Nach dem Unfall in der Straßenbahn sprach Pirjeris Mutter kein Wort mehr. Und so geriet auch der offizielle Namen des Sohnes in Vergessenheit, denn niemand benutzte ihn mehr. Inzwischen war Pirjeris Mutter bereits tot, der Vater seit Jahren pensioniert. Er wohnte immer noch in der kleinen Zweizimmerwohnung in Alppila. Auf seiner Kommode stand das Modell einer Straßenbahn der damaligen Hauptlinie. Er hatte es kurz vor seiner Pensionierung bei einem Eisangelwettbewerb des Personals der Verkehrsbetriebe gewonnen.
Der zweite Gegenstand mit Erinnerungswert in seiner Wohnung war ein verrosteter Eggenzahn aus seinen Verwalterjahren in Myrskylä.
Pirjeri hatte neuerdings eine Freundin, bei der er wohnen durfte, eine geschiedene Frau namens Eija Solehmainen, sie war gut dreißig Jahre alt und arbeitete in der staatlichen Druckerei. Eine anständige Person, gutaussehend und tüchtig, allerdings ungeheuer eifersüchtig. Die beiden wohnten in der Runeberginkatu in Töölö, in der dritten Etage und zur Straße hinaus. Sie hatten sich an den Verkehrslärm gewöhnt, und die Nachbarn offenbar auch an den Lärm in der Wohnung, denn Eija machte Pirjeri von Zeit zu Zeit heftige Szenen, immer dann, wenn sie ihn im Verdacht hatte, dass er sie betrog. Dabei zerschmiss sie gern Geschirr und weinte herzzerreißend. Oft schrie sie aus vollem Hals.
Pirjeris Mutter hatte ihren Sohn zu lutherischer Frömmigkeit erzogen, hatte ihn in die Sonntagsschule geschickt, ihn Abendgebete und geistliche Lieder gelehrt. Pirjeri war konfirmiert worden, und er war nicht einmal in seiner Studentenzeit aus der Kirche ausgetreten, obwohl das damals, in den Sechzigerjahren, sehr in Mode gewesen war.
Pirjeri wuchs zu einem sanften und gutmütigen Burschen heran, zu einem Menschen, der seinen Glauben kannte. Er wurde allerdings kein frömmelnder Schlappschwanz, sondern ein robuster Mann, der notfalls auch hart reagierte. Er setzte durchaus seine großen Pranken ein, falls es die Situation erforderte.
Pirjeri war auch jetzt mit vierzig Jahren noch in gewissem Maße gläubig, auf finnisch ungläubige Art. Er praktizierte Religion nicht, indem er in die Kirche ging, ihm reichte eine persönliche Beziehung zu Gott. Er sandte im Bedarfsfalle ein frei gestaltetes, inbrünstiges Gebet zum Himmel. Wurde es erhört und seine Bitte erfüllt, war es gut, und Pirjeri fand seinen Glauben an die Existenz des Allmächtigen bestätigt. Hatte er aber umsonst gebetet, zuckte er nur die Achseln und sagte sich, dass es kein Verlust gewesen war, allem Anschein nach gab es doch keinen Gott. In kalten Wintern, wenn er in seiner öden und zugigen Kranfahrerkabine saß und ihn die schneidenden Winde durchfuhren, bat er Gott zum Zeitvertreib um besseres Wetter, damit nicht der Rheumatismus seine Gelenke zuschanden machte. An sonnigen Sommertagen fielen seine Gebetsaktivitäten schwächer aus.
Die Arbeit eines Kranfahrers war einsam und manchmal auch langweilig. Unten auf der Baustelle trödelten die faulen Handlanger herum, tranken Kaffee oder rauchten, der Kran stand dann still und unbeweglich da, manchmal stundenlang. Der Fahrer hockte finster in seiner Kabine, da er nicht extra hinunterklettern mochte. Es blieb jedem Fahrer selbst überlassen, wie er seine Zeit auf solchen Baustellen verbrachte. In Pirjeris Kabine lagen immer ein paar Bücher griff bereit, Romane oder auch Sachbücher, ebenso ein Feldstecher mit scharfer Linse, mit dem er die Welt um sich herum betrachtete. Er pflegte sich vielfältige Gedanken über das Weltgeschehen zu machen.
In den letzten Jahren hatte Pirjeri begonnen, einseitige Gespräche mit Gott zu führen. Auch jetzt blickte er aus dem Kranfenster schräg nach oben zum Himmel, in die Gegend über dem Finnischen Meerbusen, wo er Gott vermutete, und sagte:
»Verehrter Herrgott, guten Tag, hier spricht wieder mal Pirjeri Ryynänen aus Finnland.«
Dann wartete er eine Weile, damit Gott seine momentane Beschäftigung unterbrechen und sich auf den tagesaktuellen Monolog des Kranfahrers konzentrieren konnte.
»An deiner Stelle würde ich mich stärker in die Schreckensregime der afrikanischen Militärdiktatoren einmischen. Denk nur an die Hutu, die viele tausend Tutsi getötet haben, ihre Soldaten sind von Dorf zu Dorf gezogen und haben die Leute einfach abgeschlachtet. Wenn ich Gott wäre, hätte dieses Morden auf der Welt ein Ende. Was treibst du eigentlich dort oben im Himmel? Gibt es dich überhaupt? Taugst du zum Gott? Und dann die Lage in Indien, von der schon vorige Woche die Rede war. Allein in Kalkutta sterben täglich hundert Menschen an Hunger und Krankheiten. Es sieht nicht gut aus!«
Pirjeri Ryynänen nahm sämtliche Krisenherde der Welt durch, zählte alle Gebiete mit Hungersnot, die Länder mit politischer Verfolgung und Folter, die schlimme Not vergewaltigter Frauen, die Unterdrückung bestimmter Rassen, Freiheitsberaubung auf … und immer in Abständen ließ er einfließen, dass all dies auf der Stelle ein Ende hätte, wenn er über göttliche Macht verfügen würde.
Manchmal steigerte sich Pirjeri so sehr in seine Monologe hinein, dass er in Rage geriet, in seiner hallenden Glaskabine die Stimme erhob und in Gottes Richtung, also zum Himmel über dem Finnischen Meerbusen, die Fäuste schwenkte, dem Allmächtigen die Leviten las. Der Kranfahrer zitterte regelrecht vor ohnmächtiger Wut, wenn er an das grenzenlose Leid der Völker der Welt dachte und daran, dass er die Dinge in keiner Weise beeinflussen konnte – abgesehen davon, dass er manchmal Weihnachtspakete an die Kinder einer Dschungelschule in Nicaragua schickte. Ein gewöhnlicher Arbeiter vermag nicht die ganze Welt zu verbessern. Ein Arbeiter ist nicht Gott.
Pirjeri verlangte von Gott Glück und alltägliches Wohl für die Menschen und Tiere. Wenn Gott Probleme hatte, die Dinge auf der Welt unmittelbar und sofort in Ordnung zu bringen, warum konnte er dann nicht zumindest den Lebenden das kleine Quäntchen alltäglichen Glücks zugestehen? Was zwang ihn, jeweils die schlechteste der möglichen Alternativen zu wählen, zum Beispiel ein altes Mütterchen vom Lande auf Glatteis ausrutschen und sich den Oberschenkel brechen zu lassen? Warum fiel einem mageren Negermädchen eine Kokosnuss mit tödlicher Wucht auf den Kopf und nicht eine herrliche Bananenstaude vor die Füße? Alles war doch schließlich nur eine Frage der glücklichen Fügung.
Warum war den Menschen als lebenslange Belastung quälende Todesangst auferlegt worden? Wem nützte das? Warum mussten sich Mensch und Tier auch hierin unterscheiden? Pirjeri erklärte dem lieben Gott, dass der eigentliche Unterschied zwischen Mensch und Tier darin bestehe, dass das Tier nicht fähig sei, an den Tod zu denken, seinen eigenen also, und der Tod anderer Tiere bedeutete für ihn bestenfalls frische Nahrung.
Könnte er entscheiden, so wie Gott, würde er sich um den Weltfrieden kümmern, schwor Pirjeri. Glück und Weltfrieden, dafür würde er sorgen, und er würde den Menschen die unnötige Todesangst nehmen.
Pirjeri Ryynänen war ein tief empfindender humaner Mensch, dem die Not auf der Welt ein tägliches Sorgenthema war.
Pirjeri hatte nur wenig Freunde und keine unmittelbaren Arbeitskollegen, hoch oben in der einsamen Kranfahrerkabine knüpft man nun mal keine Kontakte. Einen guten Kumpel hatte er allerdings, den glücklosen kleinen Geschäftsmann Torsti Rahikainen, ein Mann in Pirjeris Alter. Die beiden machten oft gemeinsame Spaziergänge am Meer und philosophierten über den Lauf der Welt. Rahikainen steckte stets voller verrückter Ideen, sprudelte geradezu davon über. Er war ständig bereit, sich in neue Geschäfte zu stürzen, aber bisher hatte sich ihm noch nicht die Gelegenheit geboten, zu wirklichem Wohlstand zu gelangen. Rahikainen war ein unruhiger Charakter, mit einem Hang zu Risiken, und er ging sie auch ein, um dann ein ums andere Mal feststellen zu müssen, dass seine finanziellen Mittel nicht weit genug reichten. Er war ein vom Leben gebeutelter vitaler Mann, den Pirjeri auf gewisse Weise liebte. Wenn Pirjeri Vermögen besessen hätte, dann hätte er, ohne zu zögern und ohne auf Sicherheiten zu bestehen, große Summen in Rahikainens Geschäfte investiert.
Oft betete Pirjeri beim lieben Gott für Rahikainen. Er äußerte die Hoffnung, dass der Allmächtige seinem Freund wenigstens so viel Glück bescheren würde, dass dieser ohne finanzielle Sorgen die Tragfähigkeit seines Lebens erproben könnte. Pirjeri schätzte, dass hunderttausend Mark die Mindestsumme wäre, die Rahikainens Leben in Fluss bringen würde.
3
Der Erzengel Gabriel und der heilige Petrus führten in der Bibliothek des alten bulgarischen Nonnenklosters ein hektisches Krisengespräch. Auf der Tagesordnung stand nur ein einziger Punkt, aber der war umso wichtiger. Sie mussten für den Allmächtigen einen Stellvertreter finden.
Erzengel Gabriel erklärte gleich zu Beginn, dass ihm schon seit Langem Gottes Müdigkeit aufgefallen sei. Dieser brauche tatsächlich einen langen Erholungsurlaub, womöglich reiche ein Jahr nicht einmal aus. Gabriel fand, dass Gott in letzter Zeit sehr trübsinnig geworden sei, das zeige sich schon daran, dass er seine Zeit mit Vorliebe in diesem schimmeligen, heruntergekommenen Schloss hinter dem Mond, um nicht zu sagen an diesem gottverlassenen Ort, verbringe.
Petrus warf ein, dass dies kein gottverlassener Ort sei, da Gott sich ja eben hier befand, in seinem ledernen Ohrensessel im Klosterturm saß und apathisch auf die Berge starrte, wenn auch fern der Zentralgebiete.
»Ich habe vielleicht den falschen Ausdruck gewählt, aber einladend ist dieser Ort jedenfalls nicht. Die feuchten Steinwände machen auch mich über kurz oder lang depressiv«, erklärte Gabriel.
»Unser Herr ist wirklich reif für einen Urlaub«, bestätigte Petrus. Er erwähnte, dass Gott neuerdings zerstreut sei, die Arbeit funktioniere nicht recht. Vor einigen Wochen zum Beispiel, als er für den Rückflug der Zugvögel von der nördlichen Halbkugel in die warmen südlichen Zonen hätte sorgen müssen, habe er die alten Systeme gründlich durcheinandergebracht.
»Stell dir vor! Unser Herr schickte eines Tages einfach sechstausend Flamingos aus der Nilebene in die sibirische Tundra, ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Nun, die Vögel flogen natürlich los, begaben sich in großen Scharen erst in die Türkei und von dort um das Kaspische Meer herum bis hinter den Ural, nach Sibirien also. Es war für die armen Tiere eine schreckliche Reise, und dort am Ziel werden sie gewiss erfrieren.«
Der Erzengel Gabriel war entsetzt. Wie war dieser Missgriff möglich gewesen? War die Sache publik geworden? Konnte man sie irgendwie korrigieren?
Petrus erklärte, dass die Flamingoschwärme größtenteils über unbewohntes Gebiet hinweggeflogen waren und dass fern in den asiatischen Steppen oder gar in der sibirischen Tundra zum Glück keine Ornithologen unterwegs waren. Einer der unglücklichen Vögel hatte sich jedoch nach Finnland verirrt. Dort waren noch nie Flamingos frei umhergeflogen. In der Gegend von Oulu, auf einer Insel namens Hailuoto, hatten Vogelkundler diesen nach Sibirien verbannten Flamingo gesichtet. Daraus hatte die finnische Presse natürlich eine Sensation gemacht und das Thema gründlich durchgehechelt. Man hatte sogar Fotos des armen Tieres veröffentlicht.
»Ich musste mir schleunigst etwas einfallen lassen, wie ich den Flamingo aus Finnland wegkriege, und beschloss, mich einer Brandgans zu bedienen, die ist ja auch von Natur aus ein Zugvogel. Ich richtete es so ein, dass die Gans und der Flamingo Freundschaft schlossen, das hat geklappt, und nun flattern die beiden zusammen dort auf Hailuoto umher. Wenn die Gans in den Süden fliegt, ist der Flamingo hoffentlich so schlau, mit ihr gemeinsam Finnland zu verlassen und dort nicht weiter für Aufsehen zu sorgen. Dies ist nur ein unerheblicher Vorfall im Vergleich mit den großen Problemen der Welt, sechstausend Flamingos fallen nicht ins Gewicht, aber es ist symptomatisch«, seufzte Petrus.
»Es wäre schlimm, wenn der Teufel sagen kann, dass das Weltenbuch durcheinandergeraten ist«, äußerte sich auch der Erzengel besorgt.
»Die Sache mit der Urlaubsvertretung müssen wir vorläufig unbedingt geheim halten. Einigen wir uns darauf, dass wir die Pläne nicht publik machen, bevor nicht der Stellvertreter seinen Dienst angetreten hat«, schlug Petrus vor.
»Schon allein wegen des Rufes der Welt sollten wir nicht darüber sprechen. Denk nur, falls zum Beispiel Allah von der Situation erfährt. Er war sowieso die ganzen letzten Jahre schon vollkommen außer Rand und Band«, konstatierte Gabriel.
»Nun, Allah ist insgesamt höchst seltsam, den muss man nicht für voll nehmen«, beruhigte Petrus ihn.
»Allah ist als Gottheit auf jeden Fall ein hitziger Mann«, warnte Gabriel. »Und er hat eine große Anhängerschaft unter den Wüstenvölkern.«
Die himmlischen Kanzleichefs widmeten sich nun der praktischen Lösung des Problems. Als Erstes erstellten sie ein vorläufiges Berufsbild Gottes. Das fiel ihnen leicht, denn beide wussten aus Erfahrung sehr genau, welche Aufgaben Gott zustanden und welche sie wiederum selbst mithilfe ihrer Engelsscharen verantworteten.
Der Apostel und der Erzengel kamen zu dem Schluss, dass der praktikabelste Weg, die geeignete Person für die Vertretung Gottes zu finden, der Gebetskontakt wäre. Die Menschen beteten schließlich immer eifrig. Tag und Nacht wandten sie sich mit allen möglichen Anliegen an Gott. Millionen Gebete wurden heraufgeschickt, und sie alle mussten im Prinzip auch ausgewertet werden. Allerdings gab es, angesichts des hohen Bedarfs, zu wenig Arbeitskräfte im Himmel. Es war schier unmöglich, sämtliche Gebete anzuhören, geschweige denn, Stellung dazu zu nehmen und die Wünsche der Absender zu erfüllen. Die Engelsschar konnte diese Aufgabe schlicht und einfach nicht bewältigen. So hatte sich die Praxis durchgesetzt, dass nur die besonders inbrünstigen und sachlichen Gebete angehört und der Weiterbehandlung zugeführt wurden. Das waren durchschnittlich fünfzehn Prozent aller Gebete, aber immerhin mehrere Millionen jeden Tag. Aus dieser Menge stellten die niedersten Engel nach eigenem Gutdünken, manchmal auch durch das Los, eine Auswahl zusammen, etwa zwei, drei Prozent, zu denen dann Stellung genommen wurde. Letzten Endes führte vielleicht nur jedes tausendste Gebet zu entsprechenden Maßnahmen, aber immerhin. Zum Beispiel in der Kanzlei des vorhin erwähnten Allah kam laut Petrus’ Informationen nur eines von zehntausend Gebeten ans Ziel, und selbst davon wurden die wenigsten in der gewünschten Art und Weise erfüllt. Dort wurde also enorm ausgesiebt, aber der Islam war ja als Religion noch jung, man hatte noch keine Erfahrung bei der Vorgehensweise.
»Wir könnten folgendermaßen verfahren: Wir hören uns jetzt eine Woche lang die intelligentesten und inbrünstigsten Gebete an und lassen dann die Engel aus dieser Personengruppe die geeignetsten Kandidaten für die engere Auswahl vorschlagen. Wären zehntausend genug, um einen Stellvertreter für Gott zu finden?
»Das wird bestimmt eine schweißtreibende Angelegenheit«, prophezeite der Erzengel Gabriel.
»Uns bleibt keine andere Wahl. Gottes Verfassung macht es dringend notwendig, seinen Stellvertreter so schnell wie möglich zu finden.«
Nach diesem Gespräch machten sich der heilige Petrus und der Erzengel Gabriel daran, die Gebetsmühle in der Praxis zu drehen. Sie riefen einige hochrangige Vorgesetzte der Engel zusammen und delegierten die Aufgabe an sie weiter. Jetzt musste konzentriert gelauscht werden, die Heerscharen der Engel mussten diesbezüglich genaue Anweisungen bekommen. In der nächsten Woche sollten sie den Intellekt, die Erfahrung, den Bildungsstand, die Frömmigkeit, den Mut, die Phantasie und den Fleiß der Betenden bewerten. Ziel war es, den besten Christen der Welt zu finden, nicht mehr und nicht weniger. Die Engel durften nicht schludern, sie trugen jetzt eine große Verantwortung.
Zu diesem Zeitpunkt wurde den Engeln natürlich noch nicht der eigentliche Zweck der Suche mitgeteilt. Es stand zu befürchten, dass einer oder mehrere von ihnen aus Dummheit oder Naivität das Geheimnis, dass man auf der Suche nach einem neuen Gott für das Christenvolk war, preisgeben würde. Unter den Engeln, sogar unter den Heiligen, gab es allerlei Flattergeister, Frömmigkeit ging keineswegs immer mit Scharfsinn einher. Das hatten Petrus und Gabriel in der Praxis tausende Male feststellen müssen. Gabriel hatte einmal spitz bemerkt: je frommer ein Engel, desto dümmer.
In dieser Septemberwoche wurden die Gebete des Christenvolkes tatsächlich alle im Himmel angehört, sie wurden erfasst, und es wurden provisorische Statistiken angefertigt. Innerhalb der Woche gingen mehr als siebenhundert Millionen Gebete ein. Der größte Teil davon war natürlich blanker Unsinn und gab keinen Anlass, etwas zu unternehmen. Die Menschen baten Gott darum, ihre Hühneraugen zu entfernen, auf ihrer Glatze Haare wachsen zu lassen, den bösen Nachbarsjungen zu vermöbeln, Kleidung zu besorgen, die Fenster zu putzen … lauter solchen Quatsch. Es gab unendlich viele Bitten um Geld, auch hätte sich Gott in Liebesaffären mit unterschiedlichsten Hintergründen einmischen sollen. Ein Teil der Gebete war verbittert und blutrünstig; von Gott wurde verlangt, ganze Familien, Stämme, Völker oder Völkergemeinschaften auszurotten. Die überwiegende Mehrheit der Gebete war selbstsüchtig und eigennützig. Außerdem betete ein beachtlicher Teil der Menschen im Unglauben, also ohne eigentlich auf Gottes Existenz zu vertrauen. Die meisten Gebete wurden gewohnheitsmäßig gesprochen, das betraf vor allem die Abendgebete, ferner gab es die von den Pastoren im Rahmen ihres Amtes gesprochenen Gebete. Diese bildeten natürlich eine Kategorie für sich.
Aber die Engel hörten auch viele echte, innige Bitten, die wirklicher Not und Verzweiflung entsprangen. Auch für die Angehörigen wurde gebetet, fromme Menschen wandten für die eigene Familie, das Heim, das Vaterland und die Menschheit ihre Blicke zum Himmel. Aus diesen Personen wurde die Klientel für das engere Auswahlverfahren zusammengestellt, insgesamt mehr als eine Million Menschen.
Nach Ablauf der Woche gaben Petrus und Gabriel den Engeln, die mit der Sache befasst waren, genauere Anweisungen für die Auswahl. Die gesuchte Person musste äußerst anspruchsvollen Kriterien genügen. Administrative Kompetenz war eines der Auswahlkriterien, ebenso unbeugsame Rechtschaffenheit. Intelligenz galt als Grundvoraussetzung. Humor, Mut, ein lebhafter Geist … unzählige Eigenschaften sollten die Auswahl beeinflussen.
Inzwischen wurde nochmals Gott kontaktiert, er sollte sich dazu äußern, ob er einen Mann oder eine Frau als Stellvertreter wünschte. Falls eine Frau nicht für die Aufgabe in Frage kommen sollte, würde man sich beim Auswahlverfahren die halbe Arbeit sparen.
Gott wunderte sich über die Frage. Dann wurde er ungehalten: Die Frau sei genau wie der Mann ein Teil der Schöpfung, sie sei ebenso klug und kompetent, außerdem oft von ihrem Wesen her warmherziger und auf jeden Fall rein äußerlich weitaus hübscher anzusehen. Gott fand, dass es keinen Hinderungsgrund gebe, nicht auch eine Frau zu seiner Stellvertreterin zu wählen. In manchen rückständigen Ländern durften keine Frauen zu Priestern ernannt werden, aber diese Art von Unterdrückung würde jedenfalls im Himmel nicht geduldet werden.
Da eine Geschlechterdiskriminierung nicht in Frage kam, musste die strenge Auswahl anhand wirklicher Fakten