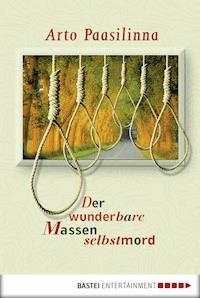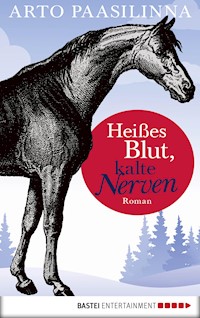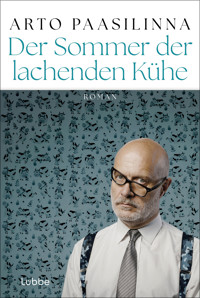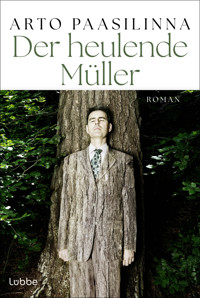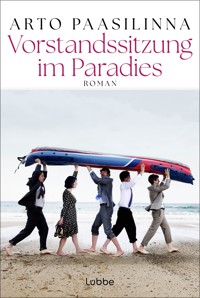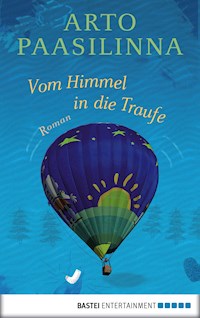9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles muss man selber machen! Der Finne Surunen bricht auf, um in Mittelamerika den politischen Gefangenen Lopez zu befreien. Sonst macht es ja keiner.
Die erste Etappe führt ihn jedoch nach Moskau, wo er die wodkareiche Gastfreundschaft des Pinguinforschers Lebkov genießt. Als er dann im zentralamerikanischen Diktaturstaat ankommt, hält man ihn für einen kommunistischen Terroristen. Ein Land namens Finnland existiere doch gar nicht. Surunen lässt sich nicht beirren und befreit Lopez schließlich aus der Haft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Alles muss man selber machen! Der Finne Surunen bricht auf, um in Mittelamerika den politischen Gefangenen Lopez zu befreien. Sonst macht es ja keiner. Die erste Etappe führt ihn jedoch nach Moskau, wo er die wodkareiche Gastfreundschaft des Pinguinforschers Lebkov genießt. Als er dann im zentralamerikanischen Diktaturstaat ankommt, hält man ihn für einen kommunistischen Terroristen. Ein Land namens Finnland existiere doch gar nicht. Surunen lässt sich nicht beirren und befreit Lopez schließlich aus der Haft …
Arto Paasilinna
Weltrettenfür Anfänger
RomanÜbersetzung aus dem Finnischen vonRegine Pirschel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1986 by Arto Paasilinna and WSOY
First published by Werner Söderström Ltd in 1986 with the Finnish title »Vapahtaja Surunen«.
Published by arrangement with Bonnier Rights Finland, Helsinki.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Umschlaggestaltung: FAVOURITBUERO; München
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock/Vadym Necuyporenko; shutterstock/Hein Nouwens
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3289-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1. TeilKalmanien
Wenn Kummer rauchen würde, wäre die ganze Erde mit Ruß bedeckt.
(Alte Volksweisheit)
1
Es ist ein kalter Winterabend, und die Straßen der Großstadt sind leer. Nur ein einsames Räumfahrzeug ist unterwegs, um die Bürgersteige vom frisch gefallenen Schnee zu befreien. Am Nachthimmel spiegelt sich das bunte Licht, das die Farbfernseher in die Fenster der Wohnhäuser malen.
Auf dem Tisch brennt eine Kerze. In ihrem warmen Lichtschein sieht man zwei Menschen sitzen, eine Frau und einen Mann. Sie sind einander zugewandt, halten sich bei den Händen und schauen sich in die Augen. Die Frau hat schönes rotes Haar, sie wirkt sehr reizvoll in dieser stimmungsvollen Beleuchtung. Sie ist vielleicht knapp über dreißig, der Mann ein wenig älter. Er wirkt ergriffen, ernst, und seine Augen blicken besorgt.
Neben der Kerze stehen zwei Gläser, dazu eine Flasche mit warmem, aber trotzdem leichtem Château-Wein aus Frankreich. Der Käse auf dem Tablett bildet mit seinem feinen Aroma die passende Ergänzung zum schimmernden Wein. Das Paar wirkt gebildet. Beide haben feuchte Augen. Sie plaudern mit leisen, traurigen Stimmen. Auf den ersten Blick wirkt die Situation außerordentlich romantisch.
Die Frau erzählt die Geschichte ihres Großvaters Juho Immonen. Der Mann war zu Beginn des Jahrhunderts Gutsverwalter in Hauhola. 1916 trat er in das Schutzkorps ein. Während des Bürgerkrieges suchten verrohte Truppen der Roten das Gutshaus heim, dessen Besitzer längst geflüchtet waren. Die Roten plünderten das Fleischmagazin, brannten die Scheune und die Sauna nieder und durchlöcherten mit ihren Bajonetten die wertvollen Gemälde im Blauen Salon des Herrenhauses. Als Verwalter Immonen versuchte, das Eigentum des Gutsbesitzers zu verteidigen, schlugen ihn die Angreifer halb tot, banden ihn auf einen Schlitten und fuhren ihn zum nahen See. Dort knüpften sie ihn mit den Füßen an eine Birke und ließen ihn, mit dem Kopf nach unten, dort hängen, bis er nicht mehr sprechen konnte. Schließlich stach ihm einer der Angreifer mit dem Bajonett in den Bauch. Sie schnitten den Leichnam ab und schleiften ihn zu einem Wasserloch, das sie in Ufernähe ins Eis geschlagen hatten. Als im Frühjahr das Eis schmolz, wurde der Leichnam in der Flussmündung an einer Eiche gefunden.
Dies ist die schreckliche Geschichte, die Musiklehrerin Anneli Immonen erzählt. Sie hatte sie in ihrer Kindheit unzählige Male gehört. Als sie später im Erwachsenenalter nach Helsinki zog, schloss sie sich der finnischen Sektion von Amnesty International an. Anneli Immonen hatte sich dem Ziel verschrieben, dass niemand mehr so wie ihr Großvater gequält und getötet werden dürfe.
Der Mann drückt ihre Hand. Auch er hat Erinnerungen, die bis ins Jahr 1918 zurückreichen. Sein Großvater, der Schneider Ananias Surunen, nahm an der Front von Vilppula am Bürgerkrieg teil, geriet in der Endphase des Krieges in Gefangenschaft und wurde zusammen mit seinen Kameraden nach Raahe transportiert. Siebenhundert rote Aufständische wurden im dortigen Gebäude der Bürger- und Handelsschule interniert. Während des Frühjahrs kamen hundertsiebzig von ihnen ums Leben: Hundertzweiundsechzig starben an Hunger und Krankheiten, sieben wurden durch ein Erschießungskommando hingerichtet, und ein Mann wurde lebendig begraben. Letzterer war frierend in eine der leeren Holzkisten in der Leichenkammer gekrochen, in denen die Toten ins Massengrab transportiert wurden.
Die Männer des Begräbniskommandos merkten, dass sich in einer Kiste ein Lebender befand. Nach kurzer Diskussion beschlossen sie, ihn zusammen mit den anderen zu begraben, denn hätten sie einen nicht begrabenen Häftling ins Gefängnis zurückgebracht, hätte man ihnen das angekreidet und sie ebenfalls hingerichtet. So verschlossen sie denn die Kiste trotz des Widerstandes des Mannes und übergaben auch ihn der Erde.
Im Sommer wurde Ananias Surunen in die Zwangsanstalt von Tammisaari verlegt, wo man ihn zu Tode folterte. Nach seinem Tod wurde er versehentlich zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt, aber dieses Urteil zu verbüßen blieb dem Schneider erspart. Als man in der Verwaltung den Irrtum bemerkte, wandelte man in den Protokollen das Zuchthausurteil in ein Todesurteil um.
So sitzen also an diesem Winterabend die beiden Menschen zusammen und erzählen sich gegenseitig ihre Familiengeschichte. Es sind die Musiklehrerin Anneli Immonen und der Magister der Fremdsprachen Viljo Surunen. Sie sind sich auf der Versammlung des Ortsvereins von Amnesty International begegnet und anschließend in Anneli Immonens Wohnung gegangen, um die Bekanntschaft zu vertiefen. Sie sind beide warmherzige Menschen, und sie beschließen, sich von nun an gemeinsam für die politischen Häftlinge dieser Welt einzusetzen. Die Nacht verrinnt, endlich erlischt auch die Kerze, aber die beiden reden immer noch im Dunkeln miteinander, halten sich umschlungen. Sie schenken sich Liebe und schwören, dass auch die Welt ihren Teil abbekommen soll.
Das ganze Frühjahr hindurch schrieben Magister Surunen und Anneli Immonen gemeinsam Beschwerdebriefe an zahlreiche Diktatoren und forderten sie auf, die politischen Häftlinge aus den Gefängnissen ihres Landes zu entlassen und dafür zu sorgen, dass dort niemand mehr wegen seiner Meinung inhaftiert oder gefoltert wird. Dutzende Briefe, Dutzende Appelle flatterten von Helsinki in alle Teile der Welt. Anneli Immonen und Magister Surunen schrieben nach Mittelamerika, nach Südamerika, nach Afrika und nach Ost-Europa. Sie übernahmen sogar die Patenschaft für einen Häftling, einen Mann namens Ramon López, der in einem Gefängnis im Staate Kalmanien in Mittelamerika schmachtete. Anneli hatte sich bereits vor Jahren für ebendiesen López eingesetzt – leider vergeblich.
Im Staate Kalmanien wurden immer wieder die Menschenrechte verletzt. Im vergangenen Herbst hatten paramilitärische Einheiten die Bewohner eines ganzen Bergdorfes ermordet. Nur ein sechsjähriges Mädchen hatte das Massaker wie durch ein Wunder überlebt. Sie hatte sich auf einem Zuckerrohrlaster versteckt, und die Soldaten hatten ihn nicht durchsucht. Aus dem Land flohen die Menschen scharenweise in die Nachbarstaaten El Salvador, Honduras und vor allem nach Nicaragua. Kalmanien wurde seit zig Jahren diktatorisch regiert. Ein Militärputsch folgte auf den anderen, und wenn sich zwischendurch mal eine Zivilregierung etablierte, so wurde sie alsbald wieder vertrieben, und das blutige Regime ging weiter.
Im Jahre 1979 wurden in Kalmanien Hunderte Studenten und Linke verhaftet, die man der Vorbereitung einer Revolution bezichtigte. Ein solcher Verdacht bedeutete in Kalmanien Folter und Tod. Die meisten der Verhafteten wurden bereits bei den Verhören getötet. Einige kamen ins Gefängnis, darunter auch der Hochschullehrer Ramon López, damals erst achtundzwanzig Jahre alt und Vater dreier kleiner Kinder. Inzwischen war Ramon fünfunddreißig, aber er saß immer noch ohne Urteil im Staatsgefängnis von Kalmanien. Magister Surunen schickte Geld an López’ Frau, und sie schrieb zurück, dass ihr Mann noch lebe, aber in sehr schlechter Verfassung sei.
Je weiter das Frühjahr voranschritt, desto klarer erkannte Magister Surunen, dass Ramon López nicht freikommen würde, selbst wenn sie beide von Helsinki aus immer wieder Briefe an den Präsidenten Kalmaniens, Generalleutnant Ernesto de Pelegrini, schickten. Es war gewiss wichtig, die Versammlungen von Amnesty zu besuchen, auch war es angenehm, anschließend bei Anneli zu sitzen und Rotwein zu schlürfen, aber all das schien letztlich nutzlos. Selbst wenn Surunen kistenweise Rotwein trank und kiloweise Käse aß, letztlich, so wurde ihm immer deutlicher bewusst, würde all das Ramon nicht weiterhelfen. Der würde in dem stinkenden Gefängnis verfaulen, obwohl er doch in Finnland zwei Paten hatte.
Surunen sagte sich, dass auch seinen Großvater leider niemand aus der Zwangsanstalt von Tammisaari gerettet hatte. Hatte es überhaupt jemand versucht? Die Großmutter hatte Verpflegungspakete hingebracht, hatte an die Beamten appelliert, aber trotzdem war der Schneider zu Tode gefoltert worden. Wäre Magister Surunen zu den Haftzeiten seines Großvaters ein erwachsener Mann gewesen, hätte er vielleicht etwas Konkretes unternehmen, zum Beispiel dem Großvater zur Flucht verhelfen können.
Na schön, die Zeiten waren vorbei. Mochte der Schneider in Frieden ruhen. Jetzt galt es, an Ramon López’ elendes Schicksal zu denken.
Der Sommer kam. In der Schule fand die Abschlussfeier statt, den Abend dieses Tages verbrachte das Paar zu Hause bei Anneli Immonen. Surunen brachte ihr Blumen mit. In der Mikrowelle wärmten sie Krabben-Sandwiches. Die Musiklehrerin spielte auf dem Klavier Chopin. Surunen öffnete die Sektflasche. Vor ihnen lagen mehrmonatige Sommerferien.
»Ich habe darüber nachgedacht, Anneli, ob ich nicht nach Amerika reisen sollte«, sagte Magister Surunen zu seiner Freundin.
»Ich komme mit.« Sie fand sofort Gefallen an der Idee.
Surunen erklärte ihr jedoch, dass das nicht gehe. Sein Ziel sei nicht New York, ja nicht einmal Los Angeles. Er beabsichtige, nach Mittelamerika, genauer gesagt nach Kalmanien, zu reisen. Und dorthin solle sich eine junge Frau besser nicht wagen, nicht mal in Begleitung eines Mannes.
»Ich kann mich verständigen, spreche fünfzehn Sprachen, außerdem habe ich den Wehrdienst absolviert und bin noch gut in Form. Ich werde dort bestimmt klarkommen, aber du solltest besser in Finnland bleiben. Gut möglich, dass ich dich hier brauche, du könntest mir zum Beispiel Geld schicken, falls meine eigenen Reserven unterwegs zur Neige gehen.«
Anneli Immonen dachte über die Sache nach. Sie begriff sofort, dass Magister Surunen die Reise nach Kalmanien nicht als Tourist antrat. War es jedoch klug, sein Leben zu riskieren und in ein Land zu reisen, in dem ein blutrünstiger General die Macht innehatte?
»Du bist immer so ungeduldig«, sagte sie.
Magister Surunen nahm die Hand aus ihrer Bluse.
»Das meinte ich nicht. Ich finde nur, dass wir warten sollten. Vielleicht kommt Ramon irgendwann frei, wir müssen uns nur weiter für ihn einsetzen. Ich schreibe im Sommer neue Appelle und schicke sie überall hin.«
Magister Surunen erklärte, dass er den Glauben an die Wirkung von Briefen verloren hatte. Ein Finne glaubt gar nichts, ehe er nicht selbst sieht, was in einem Land los ist. Surunen betonte, dass er nach Kalmanien reisen wolle, um herauszufinden, wie man Ramon und womöglich auch anderen politischen Häftlingen helfen könne. Von hier aus, von der anderen Seite des Atlantiks, ließ sich nur schwer etwas erreichen, das war inzwischen klar, aber direkt vor Ort wäre die Situation eine andere.
»Ich versuche, beim Präsidenten vorzusprechen. Oder ich besuche das Gefängnis, demoliere sämtliche Schlösser und lasse alle Insassen frei.«
»Aber wenn die Bestien dort dich töten?«, stöhnte Anneli Immonen.
Surunen musste zugeben, dass auch diese Möglichkeit bestand. Die Reise in eine Diktatur war bisweilen lebensgefährlich.
»Aber ich bin Junggeselle, da trauert keine große Familie, so wie beispielsweise bei Ramon López.«
Anneli Immonen sah ihn unglücklich an, begriff aber, dass sie ihn nicht mehr umstimmen konnte. Sie goss Sekt ins Glas und reichte es Surunen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, aber sie versuchte tapfer zu sein. Sie war eine verständige Frau, die wusste, was angebracht war und was nicht.
»Du musst dort vorsichtig sein, Liebster.«
Noch am selben Abend schickten die beiden ein verschlüsseltes Telegramm an eine Person in Kalmanien, die sie durch Briefwechsel kannten, es handelte sich um den Universitätsdozenten Jacinto Marco Aurelio Cardenas. Surunen informierte ihn über seine Absicht, Kalmanien zu besuchen, und bat ihn, Lopez’ Frau Consuelo Espinoza de López, die zu ihrem Mann Kontakt hielt, eine entsprechende Nachricht zukommen zu lassen.
Am Morgen erwachte der Magister in Anneli Immonens Wohnung mit einem leichten Brummschädel. Er erinnerte sich an den sektseligen Abend und an seinen Entschluss, nach Kalmanien zu reisen. Er betrachtete die neben ihm ruhende Musiklehrerin und sagte dann halb zu sich selbst:
»Ich muss mir sofort Geld besorgen.«
Bei diesen Worten erwachte Anneli Immonen. Sie schlang die Arme um seinen Hals und versprach, ihm alles zu leihen, was sie besaß.
»Nein, ich muss zur Bank gehen. Für die Reise nach Kalmanien braucht man wirklich eine Menge Geld. Schon allein die Flugtickets kosten Unsummen, auch wenn ich, wie es meine Absicht ist, mit der Aeroflot über Moskau und Havanna fliegen werde.«
»Wir können mein Auto verkaufen«, versprach Anneli Immonen. »Das bringt vielleicht genug Geld für den Hinflug, den Rest erbittest du von der Bank.«
Nach dem Frühstück marschierte Surunen zur Geschäftsbank, um über die Finanzierung seiner Reise zu verhandeln. Er war dort seit fünfzehn Jahren Kunde und glaubte, dass er den Kredit ohne Weiteres bekäme, schließlich warben die Banken heutzutage offensiv mit Krediten aller Art.
Surunen erklärte Ökonom Siirilä, dem Direktor, dass er beabsichtige, ins Ausland zu reisen, wofür er einen Kredit von etwa zwanzigtausend Mark benötige.
»Gewiss, das lässt sich machen, Sie scheinen ja eine recht ausgedehnte Tour zu planen …, auch ich hatte schon mal vor, bis ans andere Ende der Welt zu fliegen und mich mal richtig auszutoben. Aber mir fehlt es am Geld und auch an der Zeit …, frei nach dem Sprichwort, dass die Kinder des Schusters keine anständigen Schuhe besitzen.«
Surunen erklärte, dass er nicht beabsichtige, auf seiner bevorstehenden Reise herumzusumpfen.
»Ich reise nämlich nach Kalmanien.«
Ökonom Siirilä unterbrach das Ausfüllen des Kreditantrages.
»Nach Kalmanien? Was haben Sie denn ausgerechnet dort zu suchen? Das ist ja nun wirklich kein bevorzugtes Touristenziel, soweit ich weiß.«
Surunen gestand, dass er keine touristische Reise plane. Er wolle das Land vorrangig aus humanitären Gründen besuchen. In Kalmanien herrsche eine undurchsichtige politische Situation. Folter sei weit verbreitet. Menschen verschwanden einfach, und man hörte nie wieder von ihnen. Surunen wolle, so sagte er, ganz persönlich einigen Einwohnern des Landes helfen, die sich in Schwierigkeiten befanden. Er kenne einige Fälle, in denen Unterstützung erforderlich sei. Er habe sich jetzt endlich zum Handeln entschlossen und wolle die Reise antreten, für die gute Sache.
Ökonom Siirilä war entsetzt.
»Sie sind wohl nicht bei Trost. Glauben Sie ernsthaft, dass sich unsere Bank an der Finanzierung einer derart irrsinnigen Reise beteiligt? Nur gut, dass die Sache zur Sprache kam. Ihren Kreditantrag kann ich unmöglich befürworten.«
Siirilä warf das Antragsformular in den Papierkorb. Sein Blick streifte Surunens Kundenkarte, und er sagte:
»Sie besitzen anscheinend eine Kreditkarte unserer Bank. Eigentlich müssten wir auch die einziehen, jedenfalls so lange, bis Sie zur Vernunft kommen, aber sei’s drum. Der finanzielle Rahmen ist ja kaum relevant. Aber einen eigentlichen Kredit für die genannten humanitären Zwecke wird es von uns nicht geben. Da müsste es sich schon um ein vernünftigeres Investitionsvorhaben handeln.«
»Ist das tatsächlich Ihr Ernst?«, fragte Magister Surunen ungläubig.
»Absolut. Ein alter Kunde begibt sich auf die Reise, um sich für irgendwelche transatlantischen Revolutionäre umbringen zu lassen …, das passt nicht ins Unternehmensprofil unserer Bank. Tut mir leid.«
2
Schockiert verließ Magister Surunen die Bank. So also lagen die Dinge? Die gute alte Bank seines Vertrauens lieh ihm kein Reisegeld. Sollte er auf sein Vorhaben verzichten, nur weil die große finnische Geschäftsbank sich außerstande sah, Reiseträume von Weltverbesserern zu finanzieren? Was würde Ramon López von dieser traurigen Wendung halten, jener politische Häftling, der in dem elenden Gefängnis in Kalmanien saß, und den Surunen bereits von der vielversprechenden Reise unterrichtet hatte?
Surunen beschloss, ein konkurrierendes Geldinstitut aufzusuchen. Gegenüber auf der anderen Straßenseite befanden sich gleich zwei weitere Bankfilialen. Surunen wählte die nächstgelegene. In Finnland gibt es mehr Bankfilialen als Milchläden. Das liegt wohl daran, dass die Banken das Geld haben, Niederlassungen zu eröffnen, die Verkäufer von Milch und Brot aber nicht. Womöglich ist Geld ohnehin wichtiger als anständiges Essen?
Beim zweiten Bankbesuch verriet der Magister den wahren Zweck und auch das Ziel seiner Reise nicht mehr. Stattdessen erklärte er großspurig, dass er in die Karibik fahren wolle, um mal richtig die Sau rauszulassen. Dafür brauche er Geld. Er kündigte an, mit seinem Gehaltskonto in diese neue Bank zu wechseln, und so versprach man ihm bereitwillig einen Kredit in jeder gewünschten Höhe. Surunen wählte eine Summe von dreißigtausend Mark. Lachend wurde das entsprechende Formular ausgefüllt, man schüttelte dem Kunden die Hand und führte ihn zum Valutaschalter. Der zuständige Abteilungsleiter zwinkerte Surunen zu und sagte:
»Dann lassen Sie es nur ordentlich krachen. Am liebsten würde ich mitkommen.«
Dann rief Surunen seinen Arzt an, der ihn sofort zu sich bestellte. Er riet seinem Patienten:
»Trink kein Wasser in Kalmanien, trink Rum. Wate im Dschungel nicht mit nackten Beinen durch Flüsse, die Piranhas schnappen unversehens zu. Und noch eins: Hüte dich vor Prostituierten.«
Der Arzt schrieb Surunen einige Rezepte für die Reise aus. Anschließend ging Surunen ins Gesundheitszentrum, um sich gegen Tetanus, Polio, Cholera und Gelbfieber impfen zu lassen.
In Kalmanien musste es um diese Jahreszeit außerordentlich heiß sein, aber im Gebirge war es sicherlich kühler, und vielleicht war es nötig, auch dorthin zu reisen. Er rief also in der kubanischen Botschaft an, erzählte von seiner Absicht, über Moskau und Havanna nach Kalmanien zu reisen, und erkundigte sich, wie er sich dafür am besten ausrüsten sollte. Kalmanien hatte keine Vertretung in Skandinavien, aber in Kuba würden doch wahrscheinlich ähnliche Wetterverhältnisse herrschen, nicht wahr?
Der Sekretär der kubanischen Botschaft erzählte ihm bereitwillig, was er einpacken sollte: solide Kleidung, sowohl für heiße wie auch für kalte Tage.
»Unter uns gesagt, Sie sollten die Anschaffung einer schusssicheren Weste ins Auge fassen. Ich habe Kalmanien vor einigen Jahren besucht, und angesichts der Lage, die damals dort herrschte, habe ich mich hinterher beglückwünscht, dass ich das Land lebend verlassen konnte. Entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber meiner Meinung nach ist Kalmanien eine blutende Hämorrhoide am Globus.«
Surunen bedankte sich für die Ratschläge.
Sollte er auch seine langschäftigen Gummistiefel in den Koffer stopfen, oder würde er auf Kalmaniens Straßen mit Turnschuhen auskommen? Anneli Immonen fand, dass seine schweren, klobige Gummistiefel nur Kosten verursachen würden, wenn er sie mitnähme. Das Gepäck hätte dann Übergewicht, und dafür würden die Fluggesellschaften horrende Summen berechnen. Surunen verzichtete auf die Stiefel und packte die Turnschuhe ein. Wenn ihm vor Ort Wasser in die Schuhe liefe, dann würde der tropische Sommer rasch alles wieder wegtrocknen, sagte er sich.
Surunen wollte über zwei sozialistische Länder nach Kalmanien reisen. An den Stempeln im Pass ließe sich die Route ablesen, und es wären deswegen sicherlich Scherereien in Kalmanien zu erwarten, das ein eifriger Verbündeter der USA war. Die Machthaber im Land fürchteten bis an die Grenzen der Hysterie, vom Kommunismus unterwandert zu werden. Surunen war sich sicher, dass ihm die Einreise verweigert werden würde, wenn er bei der Grenzkontrolle seine Passstempel aus Moskau und Havanna vorzeigte.
Er löste das Problem, indem er sich einen neuen Pass besorgte. Auf dem Polizeirevier von Vantaa, das für ihn zuständig war, erklärte er, dass er seinen Auslandspass verloren habe, und da er beabsichtige, durch die Welt zu reisen, beantrage er einen neuen Pass. Der Beamte wollte wissen, unter welchen Umständen der Pass abhandengekommen war, und warum Surunen den Verlust erst jetzt melde. Surunen erwiderte, dass er bisher keinen Pass gebraucht habe. Dann erzählte er, wie sein Pass im vergangenen Sommer bei einem Aufenthalt in Venedig abhandengekommen war: Er hatte spätabends eine Gondelfahrt gemacht, dabei plötzlich Bauchkrämpfe bekommen und dringend die Toilette aufsuchen müssen. Aus verständlichen Gründen hatte er sich nicht vom Rand der Gondel aus direkt in den Kanal erleichtern können – das war Touristen allein schon durch Italiens Hygienebestimmungen untersagt –,und so hatte er den Gondoliere bestechen müssen, damit der ihn auf dem schnellsten Wege ins nächste Restaurant fuhr. Wegen des Alters und der Langsamkeit des Gondoliere und der Beschaffenheit des Bootes hatte er es jedoch nicht rechtzeitig zur Toilette geschafft. Ihm war mitten im abendlich beleuchteten Venedig ein peinliches Malheur passiert. Er hatte sich darüber so furchtbar erschrocken, dass er sich unter einer Bogenbrücke rasch seiner Unterhose entledigt und sie in den Kanal geworfen hatte. Allerdings hatte er, weil er von den Taschendieben in Italien wusste, daheim vor seiner Abreise eine Geheimtasche in seine Unterhose genäht, in der er alle wichtigen Papiere aufbewahrte: die Reiseschecks, den Pass und das Flugticket. All das war mitsamt der Unterhose im Kanal gelandet. So hatte er denn mit einem provisorischen Pass, den er sich im örtlichen Konsulat besorgt hatte, nach Hause reisen müssen.
Eine Woche später überreichte ihm der Leiter des Polizeireviers seinen neuen Pass. Der Beamte erwähnte zwar, dass es beim finnischen Konsulat in Venedig keinen Eintrag in Bezug auf Surunens verlorenen Pass gebe, dass die Erklärung, die er abgegeben habe, aber so umfassend gewesen sei, dass sie die Ausstellung eines neuen Dokuments allemal rechtfertige.
Jetzt besaß Surunen zwei Pässe. Den einen wollte er im Osten, den anderen im Westen benutzen. Und gleichzeitig nahm er sich vor, dass er, sollte er lebend aus Kalmanien zurückkehren, zusammen mit Anneli Immonen Venedig besuchen würde. Er selbst war zweimal in Rom und einmal in Neapel gewesen, aber noch kein einziges Mal in Venedig.
Das Visum für die Sowjetunion erhielt er ohne Probleme innerhalb von zehn Tagen. Es berechtigte zu einem einmonatigen Aufenthalt im Land.
Für Kalmanien beantragte er kein Visum, denn er befürchtete, es nicht schnell genug zu bekommen. Er wollte es erst an Ort und Stelle beantragen. Zumindest ein Transitvisum würde man ihm dort geben, vermutete er, denn schließlich konnte er den Pass eines freundlich gesinnten Staates vorweisen.
Surunen besorgte sich auch einen internationalen Führerschein, wenngleich die Mitarbeiter des Automobilclubs keine Garantie dafür übernehmen wollten, dass das von ihnen ausgestellte Dokument den Magister berechtigte, in Kalmanien Auto zu fahren. Sie waren sich nicht sicher, ob es dort überhaupt Straßen gab, von Autos und Verkehrsregeln ganz zu schweigen. In ihren Unterlagen fanden sich unter dem Stichwort Kalmanien keinerlei Einträge betreffs des Straßenverkehrs und der dazugehörigen Fahrzeuge. Somit konnte Surunen nicht sicher sein, ob dort Rechts- oder Linksverkehr herrschte. Er beschloss also, zunächst die Straßenmitte zu benutzen, bis er verstanden hätte, wie der Verkehr funktionierte.
An der Universität Helsinki besorgte er sich ein Empfehlungsschreiben, das ihn als Sprachforscher mit speziellem Interesse für die Sprachen und Dialekte Lateinamerikas auswies. Das Ganze wurde mit zahlreichen Stempeln versehen, und zu Hause goss Surunen in die untere Ecke noch rotes Siegelwachs, in das er in Ermangelung von etwas Besserem sein feierlich wirkendes, aus Rekrutenzeiten stammendes Schießabzeichen der Klasse III drückte, um so keinerlei Zweifel an dem rein wissenschaftlichen Zweck seiner Forschungsreise aufkommen zu lassen.
Dann noch die Reiseversicherung. Als Surunen erzählte, wohin er fahren wollte, sagte man ihm bei der Versicherungsgesellschaft, dass man keine große Lust habe, die Versicherung abzuschließen.
»Zu riskant, die Reise«, erklärte ihm der Berater. »Unsere Gesellschaft ist alt und solvent, und wir möchten allen Kunden gerne ihre Wünsche erfüllen. Wir haben sogar der veralteten Sägeindustrie Versicherungen gewährt, aber irgendwo muss es eine Grenze geben. Die ist in Ihrem Falle leider überschritten.«
Bei Versicherungsgesellschaften ist man jedoch stets hilfsbereit, wenn es um Neuabschlüsse geht. Und so riet man Surunen, sich an eine risikofreudige internationale Rückversicherungsgesellschaft zu wenden, die zum Beispiel darauf spezialisiert war, den Transport von hochexplosivem Brennstoff durch Erdbebengebiete zu versichern oder Lebensversicherungen für Äthiopier abzuschließen.
Surunen entschied sich, nur für die Anfangsetappe der Hinreise, also für die Strecke Helsinki–Moskau–Havanna, eine Reiseversicherung abzuschließen. Diese wurde ihm problemlos gewährt, und sie war nicht einmal besonders teuer.
Zwei Wochen waren seit der Abschlussfeier in der Schule und dem Beginn der Sommerferien vergangen. Magister Surunen war bereit für die Reise. Anneli Immonen begleitete ihren Freund auf den Bahnhof und zum Schnellzug nach Moskau. Zu diesem Zweck bestellte sie ein Taxi. Warum das notwendig war, erkannte Surunen erst am Ziel, als Anneli ihm ein Bündel Reiseschecks überreichte, ausgestellt auf eine Gesamtsumme von zehntausend Mark. Anneli hatte ihr altes Auto verkauft und wollte Surunen mit dem Geld die gefährliche und anspruchsvolle Reise erleichtern.
Er brachte kein Wort heraus, so fassungslos machte ihn ihre aufopferungsvolle Geste. Auch sonst gestaltete sich der Abschied sehr gefühlvoll. Die Stimmung war ähnlich schicksalhaft wie im Jahre 1939, als Staatspräsident Paasikivi mit seiner Entourage nach Moskau reiste, um über die Bedingungen zu verhandeln, unter denen die Sowjetunion bereit sein würde, den Winterkrieg zu beginnen. Damals hatte das Verabschiedungskommando für die Delegation ein Kampflied gesungen. Die Lehrerin Anneli Immonen verabschiedete Surunen heute zu einer mindestens ebenso heiklen Reise in die Diktatur Kalmanien. Sie sang kein Lied, obwohl es ihr nicht an Können fehlte. Anneli Immonen weinte und küsste ihren Freund.
Dann fuhr der Zug samt Surunen ab.
3
Magister Surunens Reisegefährte im Schlafwagenabteil des Nachtschnellzuges nach Moskau war ein mürrischer Russe, ein Kerl in den Sechzigern, der sich anfangs darauf beschränkte, mit freudloser Miene die vorbeigleitende Landschaft zu betrachten. Auch als der Zug über die Grenze fuhr, munterte das den Mann nicht auf. Man trank Tee und knabberte Kekse. Je weiter der Zug gen Moskau vorankam, desto finsterer blickte der Russe drein. Schließlich konnte er wohl seine üble Laune selbst nicht mehr ertragen und entnahm seiner Aktentasche eine Flasche Whisky, schraubte sie auf und fragte Surunen beiläufig, ob der auch einen Drink wollte.
Als beide ein paar Schlucke genommen hatten, fragte der Reisegefährte, woher Surunen so fließend Russisch konnte. Surunen erzählte ihm, dass er von Beruf Sprachlehrer war. Sprachen waren zugleich auch sein Hobby. Er konnte sich in fünfzehn Sprachen verständigen, fünf oder sechs davon sprach er fließend.
Der andere stellte sich vor: Sergei Lebkov, Fischereiexperte.
»Ich habe mich jetzt fast zwei Jahre lang ohne Unterbrechung im Ausland aufgehalten«, erklärte er. Wie sich herausstellte, hatte er als Vertreter seines Landes auf der Seerechtskonferenz in Den Haag gearbeitet und Fischereiprobleme diskutiert. Er hatte endlos über Fangbeschränkungen für Blauwale verhandelt, aber gerade als das Abkommen vor einem Jahr fertig und zur Unterzeichnung bereit gewesen war, hatte man ihn zum Pinguinexperten ernannt und in die Konferenz geschickt, die sich mit diesen Tieren befasste, genauer gesagt in eine Sonderkommission, die den Schutz der Königspinguine in den Küstengewässern der südlichen Halbkugel zum Thema hatte.
Lebkov betonte, dass gerade er entscheidend zum Zustandekommen des weltweiten Fangverbots für Blauwale beigetragen hatte. Er hatte von jeher den Standpunkt vertreten, dass die Blauwale allzu wertvolle Lebewesen waren, als dass man Tran aus ihnen kochen durfte.
»Wie Sie sicherlich wissen, füttern weltweit reiche Leute ihre Hunde und Katzen mit Walfett, auch an Blaufüchse, aus denen man Felle herstellt, wird es verfüttert. Sind tausend in Farmen gezüchtete Blaufüchse an Kapitalistenweibern etwa ein schönerer Anblick als ein einziger lebender, proletarisch freier Blauwal?«, fragte Lebkov erregt.
Surunen bestätigte, dass der Blauwal, der aus den Meereswellen seine Fontänen pustete, in der Tat schützenswert war, doch andererseits fand er persönlich auch Frauen attraktiv, die sich in blauschimmernde Pelze hüllten. Müsste er jedoch wählen, wäre er auf Seiten der Blauwale. Frauen waren auch ohne Pelze attraktiv, aber allein schon der Gedanke an einen zu Tran verkochten Blauwal war widerlich.
Vor einem Jahr, als die Verhandlungen zum Abkommen über Blauwale abgeschlossen waren, hatte man aus Moskau einen jungen Spund nach Den Haag geschickt und ihm die Sache übertragen. Gleichzeitig hatte man Lebkov schnöde versetzt und dafür gesorgt, dass er sich fortan mit den – an sich durchaus wichtigen – Pinguinen befassen musste. Lebkov seufzte. Man hatte ihm im Handstreich die Ergebnisse seiner jahrelangen Bemühungen geraubt. Er hatte ja gar nichts gegen die Königspinguine, gewiss nicht, aber man hätte ihm dennoch die Chance geben sollen, das Schutzabkommen für Blauwale mit zu unterzeichnen. Natürlich lag es ihm fern, die Handlungsweise des Kreml zu kritisieren, aber Surunen konnte sehen, wie sehr ihn die Sache betrübte. Heutzutage wurden in Moskau junge Aufsteiger bevorzugt. Altgediente Mitarbeiter wurden verdrängt, Erfahrung wusste man einfach nicht mehr zu schätzen.
Lebkov erzählte, dass er im Jahre 1922 in Chabarowsk geboren worden war. Als junger Mann hatte er auf einem Fischtrawler im Ochotskischen Meer gearbeitet. Ende des Zweiten Weltkrieges war er mit von der Partie gewesen, als die Russen auf den Kurilen landeten. Nach dem Krieg war er nach Moskau gegangen, wo er eine weißrussische Schönheit zur Frau genommen hatte. Diese hatte sich zunächst als Glücksfall erwiesen, aber in den letzten Jahren war sie fett und im gleichen Maße zänkisch geworden. Je mehr sie an Gewicht zulegte, desto boshafter wurde sie.
»Was mag bloß der Grund sein«, sinnierte der traurige Lebkov und füllte erneut die Gläser. Der Zug passierte das Leningrader Industriegebiet. Es war bereits dunkler Abend, die Stimmung gedämpft. Surunen wunderte sich über die Sache mit Lebkovs Frau, und er sagte, dass die finnischen Frauen umso sanfter wurden, je dicker sie waren.
Lebkov gestand ihm, dass er sich schon seit zwei Jahren nicht mehr traute, daheim in Moskau vorbeizuschauen. Die Briefe seiner Frau, die ihn in Den Haag erreicht hatten, waren in einem derart gereizten Ton gehalten, dass ihm ein Urlaub zu Hause nicht erstrebenswert erschienen war. Daraus hatte seine Frau fatale Schlüsse gezogen. Ihr war der Verdacht gekommen, dass Sergei mit holländischen Frauen fremdging. Ihrer Meinung nach ließen sich Ausländerinnen von den Männern leicht herumkriegen. Beabsichtigte ihr Ehemann, seine Angetraute daheim in Moskau zu verlassen? Liebte er hübsche westliche Püppchen, machte er mit ihnen rum und vergaß seine Pflichten im fernen Heimatland?
Um ihre grundlosen Zweifel hinsichtlich der vermeintlichen Zierlichkeit holländischer Frauen auszuräumen, hatte Lebkov bei einem Amsterdamer Kunsthändler eine Kopie von Rembrandts berühmter Nacktstudie gekauft. Er hatte sie seiner Frau als Neujahrsgeschenk geschickt und erwartet, dass das Gemälde in der verbitterten Frau Zärtlichkeit geweckt hätte. Das Gegenteil war eingetreten: Das Geschenk war daheim als Beleidigung gewertet worden, seine Frau hatte es zerrissen und die Fetzen an das Familienoberhaupt in Den Haag zurückgeschickt. Im beigefügten Brief hatte sie ihre Bestürzung über seinen krankhaften Hang zu nackten Frauen zum Ausdruck gebracht.
Kein Wunder, dass Sergei Lebkov so lange wie irgend möglich im Ausland ausgeharrt hatte. Junge Beamte des Ministeriums, die die Umstände nicht kannten, hatten allerdings im vergangenen Winter angefangen zu rätseln, was den Pinguinexperten Jahr um Jahr in Den Haag hielt. Sie hatten Lebkovs Hintergrund durchleuchtet, aber nichts Verdächtiges gefunden. Natürlich nicht, denn die Durchleuchtung hätte in Moskau und nicht in Den Haag stattfinden müssen. Nun, wie dem auch sei, Lebkov war von der russischen Vertretung in Den Haag inoffiziell aufgefordert worden, wenigstens ab und zu nach Hause zu fahren, und so hatte er sich jetzt auf den Weg gemacht. Den Kreml scheute er nicht, er war in jeder Hinsicht ein anständiger Mann und ein guter Kommunist, aber die bevorstehende Begegnung mit seiner Frau jagte ihm Angst ein. Der angestaute Groll aus zwei Jahren wartete darauf, sich zu entladen, und die Entladung würde sehr heftig werden, das wusste Lebkov aus Erfahrung.
Zwischendurch plauderten die Männer auch ganz locker miteinander. Surunen erzählte, dass er über Moskau und Havanna nach Kalmanien reisen wollte. Er müsste in Moskau übernachten, die Maschine der Aeroflot würde erst am Morgen des übernächsten Tages starten.
»Übernachte bei uns, guter Mann«, rief Lebkov freudig. Ihm gefiel der Gedanke, dass der Empfang daheim weniger rabiat ausfallen würde, wenn ein ausländischer Gast dabei wäre, der zudem ein gebildeter Sprachforscher war. In Anwesenheit eines Ausländers, der gut Russisch konnte, würde Mavra wohl kaum wagen zu toben. »Du sparst Hotelkosten, und bei uns kriegst du auch ein Abendessen. Lass uns am Kolchosmarkt vorbeifahren, dort kaufen wir gute Zutaten ein und besänftigen Mavra gemeinsam! Finnisch-russische Freundschaft der praktischen Art!«
Am Morgen traf der Zug in Moskau ein. Die vom Whisky beduselten Männer schleppten ihre Koffer hinaus, warteten eine Weile auf dem nebeligen Bahnhofsvorplatz, bis sie ein Taxi erwischten, mit dem sie direkt zu einem Restaurant fuhren. Das war Lebkovs Idee gewesen. Er bestellte belegte Brote und eine Flasche Wodka.
»Die Brote können Sie haben, aber Wodka gibt es nicht – neue Bestimmung«, belehrte sie der Kellner. Er schlug vor, dass die Männer Saft anstelle von Wodka trinken sollten.
Sergei Lebkov holte seinen Pass heraus, aus dem der Kellner ersehen konnte, dass er hier keinen x-beliebigen Durchschnittsbürger vor sich hatte, sondern einen internationalen Pinguinexperten, einen Mann, der zwei Jahre lang draußen in der Welt die sowjetischen Ideale und die Kommunistische Partei des Landes vertreten hatte …, also Wodka her, und zwar sofort! Aber die neuen Bestimmungen waren dergestalt, dass nicht einmal eine gehobene gesellschaftliche Position half, sie zu umgehen. Im Gegenteil, je höher gestellt ein Genosse, desto besseres Benehmen erwartete man heutzutage von ihm. Einem schlichten Parteisoldaten würde der Kellner womöglich einen Tropfen Wodka abzwacken, vor allem wenn er sähe, dass der Mann litt und schwer verkatert war, aber einem hohen Funktionär dabei zu helfen, sich selbst zu erniedrigen …, oh nein, auf keinen Fall.
Sergei Lebkov stand auf. Er sagte, dass er dann auch auf die belegten Brote verzichtete. »Lecken Sie mich doch! Und trinken Sie Ihren Wodka, ich gehe.« Auf der Straße knurrte er:
»Schlimm ist das Leben in Russland geworden …, Moskau ist nicht mehr so, wie es einmal war.« Surunen bekam Mitleid mit dem alten Mann, der in seiner Heimatstadt mit trockener Kehle seinen Kater ertragen musste. Er kaufte im Berijoshka einige Flaschen Wodka, und bald hellte sich Sergei Lebkovs Blick auf. Nach ein paar heilsamen Schlucken fuhren die beiden Gefährten zum Kolchosmarkt, um Gemüse und andere Lebensmittel zu besorgen. Surunen erbot sich, die Einkäufe zu bezahlen, aber Lebkov lehnte ab.
»Nicht doch, Bruder, vergeude nicht dein Geld, spar es dir für Kalmanien auf. Du bist hier mein Gast.«
Der Pinguinexperte beabsichtigte, seine Frau mit einem ganz besonderen Geschenk zu verwöhnen. Bei seiner Abreise aus Den Haag hatte er holländische Süßigkeiten gekauft, aber vielleicht empfahl es sich, auch noch etwas Größeres zu besorgen. Die beiden Männer traten also in die Markthalle, in der Waren aller Art angeboten wurden, von der Waschmaschine bis hin zum lebenden Eichhörnchen.
»Wie wäre es, wenn du deiner Frau ein Eichhörnchen schenkst?«, schlug Surunen vor, denn er war überzeugt, dass Frauen überall auf der Welt lebende Geschöpfe mochten.
Lebkov dachte an etwas Größeres.
»So ein kleines Eichhörnchen reicht nicht, um Mavra milde zu stimmen, da braucht es größere Kreaturen!«
Der Blick des zunehmend betrunkenen Mannes fiel auf einen breitschulterigen Adler, der angekettet auf einer Stange hockte. Der Schnabel des Raubvogels steckte in einer Lederhülle, und seine Flügel waren so fixiert, dass er sie nicht ausbreiten konnte. Diesen Vogel wollte der Pinguinexperte als Mitbringsel für seine Frau haben.
»Wenn ich Mavra den bringe, verschlägt es ihr die Sprache«, freute er sich. Er fing an, dem Verkäufer Geld hinzublättern, aber der erklärte, dass Adler an Privatpersonen nur gegen eine spezielle Genehmigung verkauft wurden. Große Raubvögel wurden hauptsächlich für Lehrzwecke gehandelt, sie wurden an Tierparks, an Universitäten und gegebenenfalls auch an höhere Parteifunktionäre abgegeben. Aber als Sergei Lebkov seinen Pass zeigte, aus dem hervorging, dass er internationaler Pinguinexperte der Kommunistischen Partei war, und weil er außerdem den Adler mit westlicher Währung bezahlen wollte, war man sich rasch handelseinig. Der Verkäufer ließ ein Taxi auf den Markt kommen und half den Männern mit ihren Koffern, Lebensmitteln und dem Adler beim Einsteigen. Eines der beiden hinteren Fenster musste halb offen bleiben, sonst hätte der Vogel nicht in den Wagen gepasst. Würdevoll betrachtete er durch das offene Fenster den lebhaften Moskauer Verkehr, während man zu Lebkovs Wohnung fuhr. Unterwegs tranken sich die Männer tüchtig Mut an, reichten auch dem Taxifahrer ihre Flasche, und der erklärte, dass das für ihn der erste Schluck seit zwei Tagen sei. Er fügte hinzu, dass er manchmal eine ganze Woche lang völlig nüchtern am Steuer sitze.
»Anfangs war es wirklich schwer, sich an dieses neue nüchterne System zu gewöhnen. Man kriegt ja richtig Angst vor dem Verkehr, alle fahren so schnell und gucken nicht nach vorn. Nüchtern ist das manchmal schwer zu ertragen.«
Der Pinguinexperte wohnte in einem Hochhaus nahe des Zentrums. In der sechsten Etage des Gebäudes steckte Lebkov seinen Schlüssel ins Schloss, die Tür öffnete sich, und die Männer traten vorsichtig ein. Die Wohnung war mit schweren Vorhängen verdunkelt, man konnte kaum etwas sehen. Auf einem Bett im Wohnzimmer ruhte, von Kissen gestützt, die große und schwere Gattin, die mit lodernden Blicken den Ankömmlingen entgegenstarrte. Lebkov hielt ihr den Adler hin, begrüßte sie, redete beruhigend auf sie ein. Der Taxifahrer stand in der geöffneten Wohnungstür, und als die gefürchtete Explosion ausblieb, wagte auch er einzutreten.
Der Adler erfüllte seinen Zweck wie die Galionsfigur eines in den Heimathafen einlaufenden Schiffes, ein Vogel mit kühnem Blick. Und als Lebkov ihn seiner Frau reichte, war die so baff, dass sie nicht anders konnte, als das Geschenk anzunehmen. Jetzt kam Surunen beflissen herbei, stellte sich vor, und als auch noch der Taxifahrer zu Hilfe eilte, hoben sie gemeinsam den Adler aufs Bett. Lebkov befestigte die Kette, die der Vogel am Bein trug, am Bettpfosten. Der riesige Raubvogel saß dort wie in seinem angestammten Nest und blickte sich prüfend um, und als das Lederfutteral von seinem Schnabel entfernt wurde, stieß er einen so schrillen Begrüßungsschrei aus, dass die Ikone in der Ecke herunterfiel.
Der Taxifahrer trug das Gepäck herein. Die Lebensmittel kamen gleich in die Küche. Gläser wurden mit Wodka gefüllt, man nahm einen Begrüßungsschluck. Frau Lebkova machte Anstalten, mit ihrem Mann zu zetern, hielt aber den Mund, als er hastige Gesten in Richtung des Magisters Surunen machte. In Anwesenheit gebildeter ausländischer Herren sollte man besser nicht zanken, Liebste …
Mavra Lebkova schluckte Wodka wie ein Waschbecken, in dem der Stöpsel fehlt. Bald heiterte sich ihre Stimmung auf, sie bot den Gästen einen Platz an und machte sich an die Zubereitung eines Festmahls. Der Hausherr schlug vor, ein wenig zu singen. Der Taxifahrer griff sich die Balalaika, die an der Wand hing, und alle sangen gemeinsam russische Romanzen. Die Einheimischen staunten, dass auch Magister Surunen sie konnte. Er erzählte, dass die Finnen, wenn sie betrunken waren, gern russische Romanzen sangen. Die Lieder waren so wehmütig und entsprachen ganz ihrem Geschmack.
Die Hausherrin mit ihren hundert Kilo Lebendgewicht präsentierte ein Essen, wie Surunen es noch nie auf seinen Reisen erlebt hatte. Der Tisch wurde mit dem Familiensilber und teurem Kristall eingedeckt. Der Taxifahrer bekam den Auftrag, Wein einzukaufen. Als Vorspeise servierte Mavra Zakuskis, kleine Häppchen: Fischsülze, Kaviar, weißrussische Fleisch- und Leberpasteten, Basturma, eine Fleischplatte nach kaukasischer Art. Als man all das gegessen und Wein und Wodka hinterher getrunken hatte, trug Mavra kalten Borschtsch auf. Anschließend folgte der Hauptgang. Mavra hatte Spanferkel gemacht, das so hervorragend schmeckte, dass Surunen sich keinen Augenblick länger wunderte, warum sie es auf ein Gewicht von mehr als hundert Kilo brachte. Zum Nachtisch gab es dann noch Schaumtorte, ein herrliches Gemisch aus Butter, Zucker, Ei, Zitrone und Gelatine, überzogen mit Schokolade. Zu der Torte trank man süßen Glühwein, und zum Dank an Mavra sangen die Männer zwei Strophen der »Moskauer Nächte«. Surunen sang ein Solo, und am Ende des Refrains schrie der Adler seinen Part so laut und schrill, dass die Fensterscheiben klirrten. Zur Belohnung bekam er Wodka. Der Taxifahrer hielt ihm den Schnabel auf, während Mavra den Alkohol hineinkippte. Der Vogel schüttelte heftig den Kopf. Trotzdem schluckte er das Zeug hinunter, und bald war er ziemlich betrunken. Er versuchte zu fliegen, schrie alles Mögliche, bis er die Augen verdrehte und auf dem Bett umkippte.
Bald nach dem Adler fiel der Taxifahrer um, dann war Lebkov selbst an der Reihe. Und schließlich hielt auch Surunen nicht mehr länger durch. Seine letzte Erinnerung hatte er an einen Raum, in dem schlafende Männer und Adler lagen. Aber eine Gestalt war noch auf den Beinen: die gewaltige Köchin, die feurige Russin Mavra Lebkova, die, wenn sie gereizt war, Furcht einflößte, die aber bei guter Stimmung ein ganzes Wohnviertel zu beköstigen vermochte.
Nachts erwachte Magister Surunen von hämmernden Kopfschmerzen. In dem dämmerigen Licht konnte er erkennen, dass er in einem breiten Sessel geschlafen hatte. Im Bett lag der Pinguinexperte, eng an seine Frau geschmiegt. Auf der Schwelle zur Küche schlief der Taxifahrer. Der Adler hatte sich von seinem Rausch erholt und war auf den Bettpfosten geklettert, auf dem er nun thronte. Surunen rieb sich die Schläfen und musterte den Vogel, der zwei Köpfe zu haben schien. Surunen schloss die Augen, versuchte sich das historische Gemälde von Edvard Isto in Erinnerung zu rufen, auf dem der zweiköpfige Adler, Russlands Wappentier, die weißgekleidete finnische Jungfrau angreift und dem unschuldigen Mädchen ein dickes Gesetzbuch entreißt, die finnische Verfassung. Der Himmel ist wolkenverhangen und dunkel, ein Gewitter naht. Fern am Horizont schimmert ein schmaler Lichtstreif, gleichsam die Hoffnung, dass sich das Wetter doch noch bessern wird.
Surunen öffnete die Augen. Der Adler sah ihn an und hatte jetzt nur noch einen Kopf. Surunen dachte darüber nach, ob die Entstehung des zweiköpfigen russischen Adlers auf den Wodka zurückzuführen war, der bewirkte, dass die Russen allerlei Dinge doppelt sahen. Dieser Gedanke rüttelte ihn vollends wach. Er ging in die Küche, aß ein paar Reste des Festmahls und zündete sich eine Zigarette an. Bald kam auch der Pinguinexperte Lebkov in die Küche geschlurft. Er war verschlafen, hatte aber keine Angst mehr. Die Nacht an der Seite seiner Frau hatte ihn wieder ins Gleichgewicht gebracht.
Lebkov sprach Surunens Reise nach Kalmanien an. Es sei richtig von ihm, ans andere Ende der Welt zu fahren, um seinen Schützling aus den Fängen der Folterer zu retten, fand er.
»Bei uns in der Sowjetunion gibt es heutzutage keine Folter mehr. In den westlichen Ländern wird allzu viel Lärm um unsere Menschenrechte gemacht. In Wahrheit unterstützen gerade die USA blutige Diktaturen in vielen Ländern der Welt.«
Er äußerte die Überzeugung, dass sich die Militärjunta von Kalmanien ohne die politische und wirtschaftliche Hilfe der USA keinen einzigen Tag an der Macht halten könnte.
Surunen erkühnte sich zu behaupten, dass auch in der Sowjetunion und in den anderen sozialistischen Ländern Andersdenkende verfolgt wurden. Aus den Berichten von Amnesty International ging eindeutig hervor, dass auch die Ostblockländer in dieser Sache nicht unschuldig waren.
»Bei euch werden die Andersdenkenden in Irrenhäuser gesperrt«, sagte er.
Das passiere nur in äußerst seltenen Fällen, erklärte Lebkov. Außerdem sei ein Bürger, der sich in seiner Dummheit gegen das System erhebe, verrückt und sei somit im Irrenhaus richtig untergebracht.
Surunen hingegen fand es falsch, Bürger, die sich dem herrschenden System widersetzten, ins Irrenhaus zu sperren. Wenn niemand das System kritisiere, könne es sich nicht entwickeln. Außerdem sei eine Zwangseinweisung nur unter Missachtung der Menschenrechte denkbar.