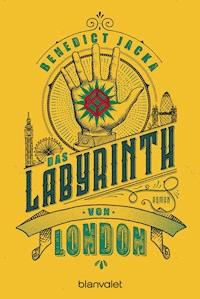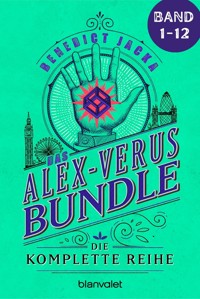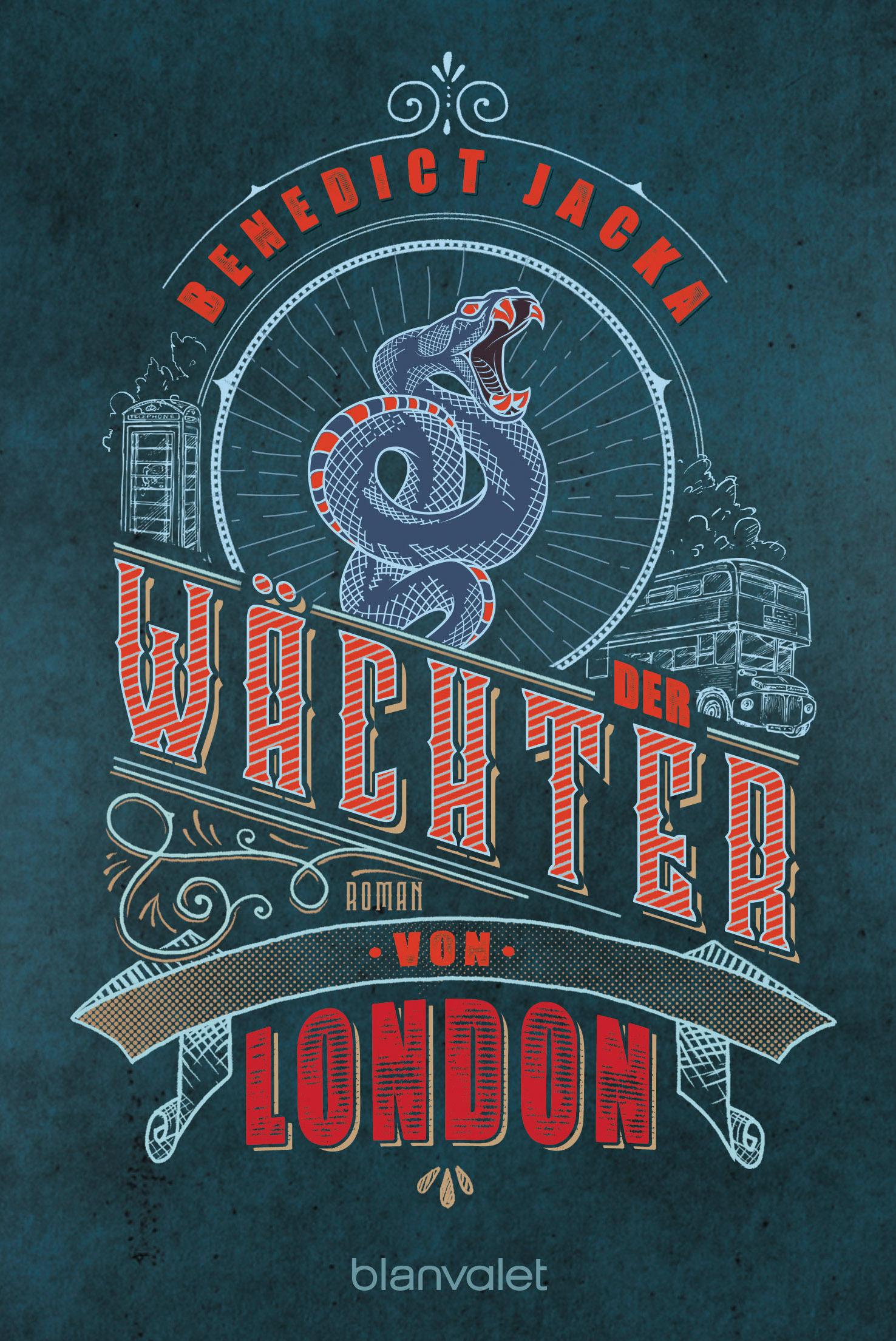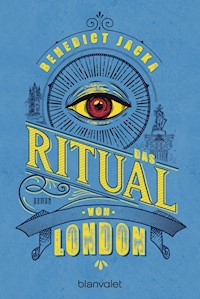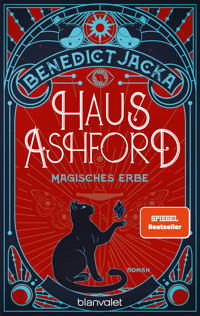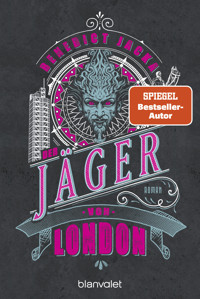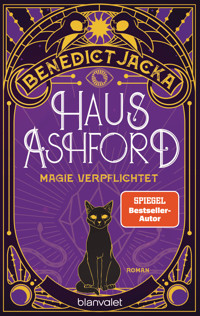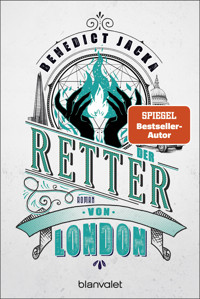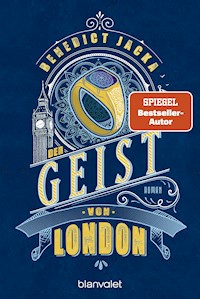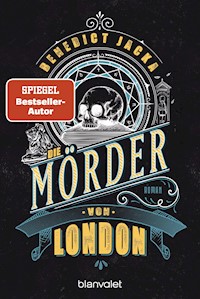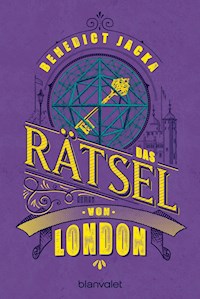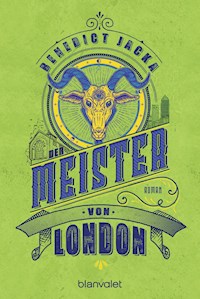
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Alex Verus
- Sprache: Deutsch
Der schlimmste Albtraum seiner Vergangenheit kehrt zurück! Im fünften Abenteuer des Londoner Magiers Alex Verus.
In London gibt es über 30.000 Polizisten – und dennoch ist die Metropole statistisch betrachtet die gefährlichste Stadt Europas. Da verwundert es nicht, dass auch Magier Opfer von Verbrechen werden, so wie die junge Lebensmagierin Anne. Doch die Entführer haben nicht mit dem Hellseher Alex Verus gerechnet. Er wird nichts unversucht lassen, um Anne zu retten. Die befindet sich inzwischen allerdings in der dunklen Domäne eines Schwarzmagiers, und dort werden sowohl Anne als auch Alex mit dem schlimmsten Albtraum ihrer Vergangenheit konfrontiert. Aber zu ihrem Glück neigen Schwarzmagier nicht nur zu Brutalität und Grausamkeit, sondern auch zu einem bemerkenswerten Mangel an Loyalität …
Die Alex-Verus-Bestseller von Benedict Jacka bei Blanvalet:
1. Das Labyrinth von London
2. Das Ritual von London
3. Der Magier von London
4. Der Wächter von London
5. Der Meister von London
6. Das Rätsel von London
7. Die Mörder von London
8. Der Gefangene von London
9. Der Geist von London
10. Die Verdammten von London
11. Der Jäger von London
12. Der Retter von London
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
In London gibt es über 30.000 Polizisten – und dennoch ist die Metropole statistisch betrachtet die gefährlichste Stadt Europas. Da verwundert es nicht, dass auch Magier Opfer von Verbrechen werden, so wie die junge Lebensmagierin Anne. Doch die Entführer haben nicht mit dem Hellseher Alex Verus gerechnet. Er wird nichts unversucht lassen, um Anne zu retten. Die befindet sich inzwischen allerdings in der dunklen Domäne eines Schwarzmagiers, und dort werden sowohl Anne als auch Alex mit dem schlimmsten Albtraum ihrer Vergangenheit konfrontiert. Aber zu ihrem Glück neigen Schwarzmagier nicht nur zu Brutalität und Grausamkeit, sondern auch zu einem bemerkenswerten Mangel an Loyalität …
Autor
Benedict Jacka (geboren 1981) ist halb Australier und halb Armenier, wuchs aber in London auf. Er war 18 Jahre alt, als er an einem regnerischen Tag im November in der Schulbibliothek saß und erstmals, anstatt Hausaufgaben zu machen, Notizen für seinen ersten Roman in sein Schulheft schrieb. Wenig später studierte er in Cambridge Philosophie und arbeitete anschließend als Lehrer, Türsteher und Angestellter im öffentlichen Dienst. Das Schreiben gab er dabei nie auf, doch bis zu seiner ersten Veröffentlichung vergingen noch sieben Jahre. Er betreibt Kampfsport und ist ein guter Tänzer. In seiner Freizeit fährt er außerdem gerne Skateboard und spielt Brettspiele.
Die Alex-Verus-Romane von Benedict Jacka bei Blanvalet:1. Das Labyrinth von London2. Das Ritual von London3. Der Magier von London4. Der Wächter von London5. Der Meister von Londonweitere Bände in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Deutsch von Michelle Gyo
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Hidden (Alex Verus 5)« bei Orbit, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2014 by Benedict Jacka
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung und -illustration: © Max Meinzold, www.meinzold.de, unter Verwendung eines Motivs von Katja Gerasimova/Shutterstock.com
Karte: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25645-6V004www.blanvalet.de
1
Der Russel Square ist einer der skurrileren Bezirke Londons. Er liegt eingepfercht zwischen der Euston Road im Norden und Holborn im Süden, und es gibt nicht genug Läden, dass der Bezirk kommerziell zu nennen wäre, und nicht genug Häuser, um ihn als reines Wohngebiet durchgehen zu lassen. Universitäten mischen sich mit Hotels, und reiche Touristen und arme Studenten drängen sich auf den belebten Straßen. Angeblich ist er »literarisch« – dank der Assoziation mit der alten Bloomsbury-Verlagsgruppe –, doch da man ein Millionär sein müsste, um sich in der Gegend heute ein Haus leisten zu können, bezweifle ich, dass man viele Künstler dort findet.
Bildungseinrichtungen hat der Russel Square allerdings reichlich vorzuweisen: Englischschulen für Auswanderer, Colleges für die Studenten und das British Museum für alle. Ich wollte zu einem der Colleges, einem langen, mächtigen braunbeigen Schlackenbetonblock, der sich Institute of Education nannte, und wie immer sah ich voraus in die Zukunft, hielt Ausschau nach Gefahr, während ich darauf zulief. Ich fand nichts, hatte es auch nicht erwartet, aber aus irgendeinem Grund zögerte ich vor dem Eingang. Einen Moment lang dachte ich darüber nach umzukehren, dann schüttelte ich missmutig den Kopf und ging hinein.
Ich heiße Alex Verus, und ich bin ein Wahrscheinlichkeitsmagier aka ein Wahrsager. Ich bilde einen Lehrling aus, erledige Auftragsarbeiten für andere Magier und führe einen Zauberladen in Camden, wenn ich nicht gerade anderweitig mit persönlichen Problemen beschäftigt bin oder mit Menschen, die mir etwas antun wollen – wobei Letzteres häufiger vorkommt, als mir lieb ist. Mit einer Handvoll Magier und einer gewaltigen Spinne bin ich gut befreundet und weniger gut mit der magischen Regierung von Britannien, die man als den »Rat der Weißmagier« kennt. Der Rat kann mich aus zweierlei Gründen nicht leiden: Erstens glaubt man dort, dass ich ursprünglich von einem besonders fiesen Schwarzmagier namens Richard Drakh unterrichtet worden sei und als sein Lehrling diverse unerfreuliche Dinge getan hätte, und zweitens verdächtigen sie mich, dass ich vor ein paar Jahren für den Tod von zwei Weißmagiern während zweier unterschiedlicher Vorfälle verantwortlich gewesen sei. Unglücklicherweise entsprechen beide Verdächtigungen der Wahrheit.
Heute war ich jedoch nicht aus diesem Grund hier.
Wie an den meisten britischen Universitäten ist die Security am Institute of Education nicht existent. Ich lief einfach am Empfang vorbei und stieg die Treppe im großen quadratischen Aufgang mit den großen quadratischen Betonpfeilern und großen quadratischen, hässlichen Gemälden hinab. Ein Schild unten wies die Logan Hall aus, doch ich ging nicht weiter geradeaus, sondern bog nach links ab. Der Gang wurde schmaler und hatte wenige Türen und Fenster. Zu meiner Rechten hörte ich eine Stimme, aber ich lief weiter um den Raum herum, wobei ich gelegentlich kleine Treppenabsätze hinaufsteigen musste. Erst als ich die Halle umrundet hatte und auf der Rückseite ankam, blickte ich durch eine der Türen.
Es war ein gewaltiger Hörsaal mit verblassten roten Sitzen, die in halbrunden Reihen nach unten zu einem erhöhten Podium aus Holz führten. Hunderte Menschen saßen dort, doch mich interessierte nur der Mann auf dem Podium. Er stand da und hielt eine Vorlesung; die Projektionsleinwand hinter ihm zeigte »Die Europäische Integration aus historischer Perspektive«. Es war seine Stimme, die ich gehört hatte.
Ich hatte die Tür nicht geöffnet, aber im Holz befanden sich Gitterglasfenster, die mir einen guten Blick hinein gewährten, und ich stand ruhig da, beobachtete den Mann. Er sah aus wie Mitte fünfzig, seine Haltung war gebeugt, und die Haare waren fast vollständig silbrig weiß. Auf den ersten Blick waren wir einander nicht besonders ähnlich, aber etwas in seinen Zügen glich meinen, nur älter und milder. Er hatte mich nicht gesehen – der Korridor war dunkler als der hell erleuchtete Saal, und ich wusste, dass die Lichter sich auf dem Fensterglas spiegeln würden. Natürlich hätte ich die Tür öffnen und eintreten können, aber ich blieb, wo ich war.
Ich stand bereits fünf Minuten so da, als ein leises Geräusch meine Aufmerksamkeit erregte. Unterschiedliche Bewegungen rufen unterschiedliche Geräusche hervor – die gleichmäßigen Schritte, wenn jemand geht, das Schaben von Füßen, das Trappeln eines Menschen, der es eilig hat – und man kann üben, sie zu filtern und diejenigen herauszuhören, die nicht hineinpassen. Das hat nichts mit Magie zu tun, nur mit Wachsamkeit – eine Urfähigkeit, die jeder erlernen kann, die jedoch den meisten Menschen im modernen Zeitalter abhandengekommen ist. Jeder, der als Raubtier oder Beute lebt, lernt sie aber schnell.
Das Geräusch, das ich gehört hatte, rührte von jemandem, der versuchte, lautlos zu sein und im Verborgenen zu bleiben, und ich trat leise in die Deckung des Türsturzes und legte eine Hand an den Griff des Messers unter meinem Mantel. Der Türsturz blockierte die Sicht, verbarg mich vor jedem hinter oder vor mir. Er blockierte auch meine Sicht … aber ich brauche meine Augen nicht, um zu sehen.
Der Gang war leer und ziemlich gewöhnlich, helle Wände und ein verblasster blauer Teppich. Mit meiner Sicht erkannte ich die Ranken möglicher Zukünfte vor mir, Adern aus Licht, die sich gabelten und in der Dunkelheit verzweigten. In jeder möglichen Zukunft unternahm ich etwas anderes, ging einen unterschiedlichen Weg, und in jeder passte sich mein zukünftiges Ich dementsprechend an: Tausende von Zukünften, die sich zu Millionen und Milliarden verästelten. Ich suchte zwei der feinen Lichtranken aus und konzentrierte mich auf sie, sodass sie stärker wurden und wuchsen. In einer trat ich aus meinem Versteck und wandte mich nach links; in der anderen ging ich nach rechts. Meine zukünftigen Ichs liefen vor mir her, und ich beobachtete sie, lenkte die möglichen Zukünfte so, dass ich weiter den Gang hinablief und erkannte, was meine Augen in der Zukunft sehen würden. Auf der rechten Seite fand mein Ich nichts. Das linke Ich nahm ein Handgemenge wahr. Die Zweige links teilten sich, vervielfachten sich, und ich führte mein zukünftiges Ich so, dass es diesem Geräusch nachging. Mehr Möglichkeiten erstreckten sich vor mir, und ich erkannte darin ein vertrautes Element, eine Art Signatur. Ich ging näher heran …
… und wusste plötzlich, wer mir folgte. In dem Augenblick waberte die Zukunft und löste sich auf: Jetzt, da mir klar war, wer es war, hatte ich keinen Grund, dort entlangzugehen und es herauszufinden. Diese möglichen Aktionen mit dem Körper auszuführen hätte wohl gut eine Minute in Anspruch genommen, aber Divination funktioniert in Gedankenschnelle und ist nur dadurch begrenzt, wie schnell und klar man sich fokussieren kann. Von Anfang bis Ende hatte alles weniger als eine Sekunde gedauert.
Von der einen Seite des Gangs hörte ich erneut eine heimliche Bewegung. Ich hatte mich ganz still verhalten, während ich meine Magie eingesetzt hatte, und mein Verfolger konnte nicht wissen, dass ich da war. Vorsichtige Schritte näherten sich den Gang entlang. Ich wartete, ließ sie näher kommen, dann trat ich aus meiner Nische, und die Finger meiner rechten Hand zuckten vor.
Das Mädchen, das mir gefolgt war, sprang zurück. Sie trug Jeans und ein hellgrünes Top, und als sie mich sah, bewegte sie sich, aber die Metallscheibe, die ich geworfen hatte, prallte von ihrem Bauch ab, bevor sie sie abwehren konnte. Sie ging in Kampfhaltung, die rechte Hand fuhr hinter ihren Rücken.
»Eine Waffe nutzt dir nichts«, sagte ich zu ihr. »Du bist tot.«
Mit einem Seufzen ließ Luna den Arm sinken und richtete sich auf. »Wie lange wusstest du, dass ich da bin?«
Luna ist zur Hälfte Engländerin und zur Hälfte Italienerin, mit heller Haut, welligem hellbraunem Haar und sehr viel mehr Selbstbewusstsein als früher. Sie ist eine Adeptin und keine Magierin, Trägerin eines alten Familienfluchs, der sie beschützt, der jedoch jeden tötet, der ihr zu nahe kommt, und seit etwa zwei Jahren mein Lehrling. Mittlerweile hat sie ihre Kontrolle über den Fluch so weit entwickelt, dass man sich fast unbeschadet in ihrer Nähe aufhalten kann, solange man sie nicht berührt.
»Wenn du es dir zur Gewohnheit machst, Magier zu beschatten«, sagte ich, »dann musst du besser darin werden, dich zu verstecken.«
»Ja, Meister«, sagte Luna resigniert und beugte sich herab, um das Ding aufzuheben, das ich ihr entgegengeschleudert hatte. Es war eine Ein-Pfund-Münze, und als ihre Finger sie berührten, sah ich den silbrig grauen Nebel ihres Fluchs, der sie umschloss. Dabei warf sie einen raschen Blick zu der Tür hinter mir und versuchte zu erkennen, was sich dahinter befand.
Innerlich verdrehte ich die Augen. »Komm schon – nach oben«, sagte ich und ging zurück zur Treppe. Die Stimme des Dozenten tönte hinter mir weiter, aber ich sah mich nicht um.
»Ich dachte, ich hätte dir aufgetragen, den Laden zu hüten«, sagte ich zu Luna.
Der Innenhof des Institute of Education war aus Stein mit ein paar vereinzelt stehenden Bäumen. Ein Fakultätsgebäude, das wie eine gewaltige Betontreppe aussah, ragte über uns auf; am bewölkten Himmel sah man von hier aus den schmalen grauen Zylinder des BT Towers. Studenten liefen und radelten allein oder zu zweit vorbei, und ein kühler Wind strich über die Steine.
»Es ist ja nicht so, als würde die Welt untergehen, wenn er ein paar Stunden lang nicht geöffnet hat«, sagte Luna. »Du machst ihn ständig zu.«
»Ich mache ihn zu. Das Schlüsselwort dabei ist ›ich‹.«
»Ich soll dein Lehrling sein«, beschwerte sich Luna. »Du bezahlst mich nicht dafür, dass ich deine Angestellte im Laden bin.«
Früher hatte Luna in Teilzeit für mich gearbeitet, sie hatte magische Gegenstände gesucht und erworben, aber seit ich sie als Lehrling angenommen hatte, bezahlte ich ihr ein Gehalt; die Ausbildung als Magier nimmt so viel Zeit in Anspruch wie ein Vollzeitjob, und ich wollte, dass sie sich auf ihre Lektionen konzentrierte.
»Um genau zu sein, sind deine Pflichten als Lehrling die, die ich dir auftrage«, erwiderte ich. »Also bezahle ich dich gerade im Moment tatsächlich dafür, meine Ladengehilfin zu sein. Außerdem brauchst du das Training.«
»Dich zu beschatten scheint mir ein besseres Training zu sein.«
Ich bedachte sie mit einem Blick.
Luna hob die Hände. »Okay, okay. Aber sieh mal, mir ist langweilig. Im Unterricht passiert nichts, es gibt keine Wettkämpfe oder Turniere, also möchte auch niemand trainieren, und Anne und Vari sehe ich im Moment kaum. Selbst Sonder taucht nicht mehr auf. Und du warst jetzt auch nicht gerade die Geselligkeit in Person.«
Ich erwiderte nichts. Ich weiß nicht, was meine Miene besagte, aber Luna zuckte ein wenig zurück. »Na, warst du halt echt nicht«, sagte sie abwehrend.
Schweigend liefen wir ein Stück. Zwei Mädchen kamen auf uns zu, sie unterhielten sich, und wir gingen auseinander, um sie zwischen uns hindurchzulassen.
»Was hast du dort gemacht?«, fragte Luna.
»Jemanden gesucht.«
»Hat es etwas mit Richard zu tun?«
»Nein.«
»Ich habe mich bloß gefragt …«
»Es hat nichts mit Richard zu tun.«
»Okay.«
»Ich habe daran gedacht, mich mit dem Typen zu unterhalten, der die Vorlesung hält.«
»Okay.«
Ich warf Luna einen scharfen Blick zu. Ihre betont neutrale Miene machte mich misstrauisch. »Wer ist er?«, fragte Luna nach einer kurzen Pause.
»Wer ist wer?«
»Der Vorlesungsmensch.«
Fast hätte ich Luna gesagt, sie solle sich verpissen. Es wäre nicht nett, sie derart zu behandeln, aber so reagiere ich automatisch, wenn es um wirklich persönlichen Kram geht. Mein Instinkt rät mir, dergleichen für mich zu behalten.
Bis letzten Sommer war mein Leben ziemlich gut gelaufen. Ich hatte zwei junge Magier bei mir aufgenommen, Anne und Variam, und dank ihnen und Luna sowie einem Weißmagier namens Sonder hatte ich zum ersten Mal seit zehn Jahren so etwas wie ein Sozialleben. Und ich hatte angefangen zu glauben, dass ich mich vielleicht endlich von meiner Vergangenheit befreit hätte.
Da hatte ich mich geirrt. Im August war eine Gruppe aufgetaucht, die sich die »Nightstalker« nannte, und sie waren auf Rache aus gewesen für eines der schlimmeren Dinge, die ich während meiner Zeit als Lehrling bei Richard getan hatte. Richard selbst hatten sie nicht finden können, aber mich schon, und sie hätten mich getötet, wenn meine Freunde mir nicht zu Hilfe gekommen wären. Danach hatte ich Luna, Sonder, Anne und Variam erzählt, warum die Nightstalker mich hatten töten wollen und aus welchem Grund sie mich so sehr hassten.
Luna hatte es überraschend gut aufgenommen. Sie hatte zwischen den Zeilen gelesen und den größten Teil der Geschichte begriffen, bevor ich ihn auch nur erzählt hatte, und daraufhin beschlossen, dass ihre Loyalität mir galt. Variam, kratzbürstig, aber zutiefst ehrenvoll, hatte sich genauso entschieden. Anne und Sonder hatten unschlüssiger reagiert, und während sie immer noch am Überlegen gewesen waren, hatte ich die Nightstalker, die jung und unerfahren und von schmerzlichem Idealismus besessen gewesen waren, in eine Falle gelockt, in der sie fast alle umgekommen waren. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl gehabt, aber das sorgte nicht dafür, dass ich mich besser fühlte.
Sowohl Anne als auch Sonder hatten den Kontakt zu mir abgebrochen, als sie es herausgefunden hatten. Mit Anne hatte ich eine kurze und schmerzhafte Unterhaltung geführt, in der sie klargestellt hatte, dass sie meine Taten für unverzeihlich hielt, und aus den gelegentlichen Versuchen, mit Sonder zu reden, schloss ich, dass er es genauso sah. Ein Teil von mir stimmte ihnen sogar zu.
Dass ich meine Vergangenheit geheim gehalten hatte, hatte mir da auch keinen Gefallen getan. Tatsächlich hatte es die Angelegenheit vielleicht sogar noch schlimmer gemacht.
»Er ist mein Vater«, sagte ich.
»Wirklich?«
»Was soll dieser Tonfall? Natürlich habe ich Eltern.«
»Äh, na ja … du sprichst nie über sie.«
»Dafür gibt es einen Grund. Nachdem sie sich getrennt hatten, habe ich meinen Vater lange nicht gesehen, und als ich ihn wieder traf, war das nach meiner Zeit bei Richard.« Damals war ich nicht gut in Form. Ich hatte den größten Teil des vorangegangenen Jahres als Gefangener in Richards Villa verbracht und regelmäßig Besuch von Richards anderem Lehrling bekommen. »Ich habe ihm Teile der Geschichte erzählt, habe die magischen Aspekte ausgelassen, aber ich habe ihm gesagt, was ich Tobruk angetan habe.« Und zwar, dass ich den gemeinen Bastard umgebracht hatte.
»Okay.«
»Mein Dad ist Pazifist«, sagte ich. »Er hält nichts von Gewalt.«
»Ernsthaft?«
»Warum ist das so schwer zu glauben?«
»Na, weil du, äh …«
Aufmerksam sah ich Luna an. »Was?«
»… diesen Satz beende ich nicht. Die Unterhaltung lief also nicht gut?«
»Mein Dad ist ein Professor für Politikwissenschaft, der Gewalt für ein Zeichen der Barbarei hält. Ich habe ihm ins Gesicht gesagt, dass ich einen vorsätzlichen Mord begangen hätte und es nicht bereute.« Rückblickend war diese Idee wirklich dumm gewesen, aber ich war nicht gerade in einem Zustand gewesen, um das zu durchdenken. »Was glaubst du, wie die Unterhaltung lief?«
»Schlimm?«
Wir hatten den Unicampus verlassen und waren wieder auf den Straßen Londons Richtung Norden zur Euston Road unterwegs.
»Redest du viel mit ihm?«, fragte Luna.
»Das letzte Mal ist einige Jahre her.«
»Weiß er, dass du …?«
»Dass ich ein Magier bin? Nein. Er glaubt, ich hätte mich auf Verbrecher eingelassen und dass Richard ein Gangsterboss sei. Ich denke, ich könnte ihn davon überzeugen, dass Richard ein Schwarzmagier ist, wenn ich mich reinhänge, aber ich glaube nicht, dass es eine großartige Verbesserung bringen würde.« Und wenn ich ihm sagen würde, was ich letztes Jahr mit diesen Adepten gemacht hatte …
»Wie wäre es, wenn ich mit ihm rede?«, schlug Luna vor.
»Nein.«
»Ich könnte …«
»Nein. Du sollst dich da nicht einmischen.« Ich sah sie an. »Verstanden?«
Lunas Augenbrauen hoben sich, und sie warf mir einen flüchtigen Blick zu. »Verstanden«, sagte sie nach einem Moment.
Ein paar Minuten liefen wir schweigend weiter. Ich wartete ab, ob Luna ihr Glück überstrapazieren würde, aber sie blieb still. Wir gingen zurück durch Londons Straßen, der Verkehr ein stetiges Hintergrundgeräusch. »Also«, sagte ich schließlich. »Wie wäre es, wenn du mir sagst, warum du wirklich hier bist?«
»Was?«
»Du bereitest dich darauf vor, mich etwas zu fragen.«
Luna verzog das Gesicht.
»Ja, es ist so offensichtlich«, sagte ich. »Also, lass hören.«
»Wenn es ein schlechter Zeitpunkt ist …«
»Luna …«
»Schon gut, schon gut«, sagte Luna. »Hast du was von Anne gehört? So in letzter Zeit.«
Ich sah sie neugierig an. »Nein.«
»Du hast ihr diese Nachricht geschickt.«
»Und ich habe ein sehr höfliches Nein als Antwort erhalten.« Es war mein dritter Anlauf gewesen. Ihre Mails beantwortete Anne wenigstens, das musste man ihr zugutehalten. »Ich dachte, ihr steht in engerem Kontakt als ich.«
Luna schien ihre nächsten Worte sehr sorgfältig zu wählen. »Denkst du, du könntest sie bitten, wieder bei dir einzuziehen?«
Überrascht sah ich Luna an, wollte fragen, ob das ihr Ernst sei. Ihr Gesicht verriet mir, dass es das war. »Ich weiß, euer Gespräch hat nicht gut geendet«, fuhr Luna eilig fort, »aber das war vor neun Monaten. Sie könnte sich beruhigt haben, oder?«
»Warum fragst du das gerade jetzt?«
»Na, es wäre sicherer, oder? Ich meine, deshalb hast du sie eingeladen, bei dir zu wohnen.«
Als ich Anne und Variam kennengelernt hatte, hatten sie bei einem Rakshasa namens Jagadev gelebt. Rakshasas sind mächtige tigerähnliche Gestaltwandler vom indischen Subkontinent – Magier trauen ihnen nicht, und umgekehrt trauen sie Magiern nicht, und beide Seiten haben gute Gründe für ihre Haltung. Jagadev hatte sie kurz darauf hinausgeworfen, sodass die beiden Lehrlinge ohne Meister dastanden, was in der magischen Gesellschaft einem Bad in einem Haifischbecken gleichkommt. Anne und Variams einziger echter Schutz bestand damals in ihrer Zugehörigkeit zum Lehrlingsprogramm der Weißmagier, einer Art magischer Uni. Das Problem war jedoch, dass man im Programm nichts zu suchen hatte, wenn man kein Weißmagier oder unabhängiger Lehrling von gutem Stand war, was auf Anne und Vari nicht zutraf. Aus diesem Grund hatte ich sie eingeladen, bei mir einzuziehen, und hatte damit Jagadevs Platz als ihr Sponsor eingenommen, bis sie letzten Sommer beide ausgezogen waren. Vari war ein echter Weißmagierlehrling geworden, der sich den Wächtern der Weißmagier angeschlossen hatte. Anne nicht.
»Damals hatten sie keinen Ort, wo sie hingehen konnten«, sagte ich. »Das ist jetzt anders. Vari hat einen Meister, und Anne hat die Wohnung unten in Honor Oak.«
»Aber sie hat niemanden, der sie sponsert.«
»Ja.« Wir überquerten die Straße gen Norden. »Aber wenigstens ist sie noch im Lehrlingsprogramm.«
Luna zögerte.
Ich sah sie an. »Was?«
»Also das …«
»Bitte, sag nicht, dass sie es verlassen hat.«
»Äh … formal gesehen nicht«, sagte Luna. »Sie wurde eher rausgeworfen.«
»Du verarschst mich. Wann?«
»Die Verkündung war gestern.«
»Warum jetzt?«, fragte ich. »Sie und Vari haben dort vor zwei Jahren oder so angefangen? Wollte sich ein Lehrer rächen oder was?«
»Nein«, sagte Luna. »Man sagt, sie hätte einen anderen Studenten angegriffen.«
Ich starrte Luna an. »Anne hat einen anderen Studenten angegriffen?«
»Ja«, sagte Luna. »Erinnerst du dich an Natasha?«
»Oh«, sagte ich. »Okay …« Natasha war ein Weißmagierlehrling, ich hatte sie im vorletzten Jahr kennengelernt. Sie war ausgeflippt, weil Luna sie aus dem Turnier gedrängt hatte, und zwar so sehr, dass sie ihr einen Zauber in den Rücken geschleudert hatte, der Luna getötet hätte, wenn Anne sie nicht geheilt hätte. Offiziell hatte ich nichts gegen Natasha ausrichten können – ihre Meisterin war zu gut vernetzt, und so war sie praktisch mit einem Klaps auf die Finger davongekommen. Allerdings hatte ich Natashas Meisterin danach getroffen und ihr dabei sehr deutlich gemacht, was mit ihrem Lehrling passieren würde, wenn sie so etwas noch mal machte. Offensichtlich hatte diese Lektion gesessen, denn sie hatte Natasha bisher von Luna ferngehalten. Wenn Anne es auf Natasha abgesehen hatte, dann standen die Chancen gut, dass Natasha es verdiente.
Und doch … »Bist du sicher, dass Anne angefangen hat?«, fragte ich. »Natasha hat sie nicht zuerst angegriffen?«
»Ich glaube nicht, dass sie die Chance dazu hatte. Sie fiel sofort um und schrie los. Man musste sie sedieren, um sie zum Schweigen zu bringen, und seither ist sie nicht wieder aufgetaucht.«
Ungläubig sah ich Luna an, aber sie schien nicht zu übertreiben. Auch sah sie nicht besonders aufgewühlt aus, aber da war ein Hauch Besorgnis – sosehr sie Grund hatte, Natasha nicht zu mögen, wusste sie doch, dass die Sache ernst war.
»Ist der Rauswurf schon durch oder noch in der Schwebe?«
»Sie haben ihn beschleunigt. Natashas Meisterin hat aber noch nicht selbst Anklage erhoben.«
»Das kann sie nicht, nicht so einfach. Das würde zu viele unangenehme Fragen aufwerfen, warum ihr Lehrling nicht ebenfalls rausgeworfen wurde nach dem, was sie in Fountain Reach mit dir gemacht hat.« Ich dachte kurz nach, dann schüttelte ich den Kopf. »Wird aber an dem Rauswurf nichts ändern. Der kommt von den Direktoren des Programms.«
»Also?«, fragte Luna. »Was denkst du?«
»Dass Anne wieder bei mir einziehen soll? Das wird nicht funktionieren. Es hätte helfen können, wenn wir das vor einem Monat getan hätten, aber jetzt wird es nicht ausreichen, damit man sie wieder zulässt.«
»Ach, scheiß doch auf die Zulassung – die meisten von den Kursen sind sowieso Zeitverschwendung. Ich mache mir Sorgen um sie. Als Lehrling allein zu sein ist eine wirklich miese Sache, oder nicht? Betest du mir das nicht ständig vor?«
»Das musst du mir nicht sagen.«
»Sie könnte als Sklavin bei einem Schwarzmagier landen oder Schlimmeres. Richtig?«
Und genau das war Anne vor ein paar Jahren bereits passiert. Das hatten wir gemeinsam. »Es wäre möglich, ja.«
»Und?«
»Was meinst du mit ›und‹?« Ich sah Luna an. »Ja, du hast recht. Als Magier oder Adept in Annes Alter allein zu sein ist eine wirklich blöde Idee, vor allem, wenn es durch den Lehrlingsflurfunk alle mitbekommen. Warum erzählst du mir das alles? Du solltest mit ihr reden.«
»Das habe ich.«
»Und?«
Luna sah unglücklich drein.
»Lass mich raten«, sagte ich. »Sie hat Nein gesagt, also kommst du jetzt zu mir?«
»Na … ja. Könntest du sie fragen?«
Der Nachteil an Lunas neuem Selbstbewusstsein ist, dass sie sehr viel weniger zurückhaltend ist, wenn es darum geht, um etwas zu bitten.
»Sie hat ziemlich deutlich gemacht, dass sie nicht mit mir reden will«, stellte ich klar. »Und wenn sie es doch je wieder tut, glaube ich nicht, dass die Idee, erneut bei mir einzuziehen, besonders weit oben auf ihrer To-do-Liste steht.«
»Es schadet nicht, zu fragen.«
»Ist das dein neues Motto für den Umgang mit Magiern, oder was?«
Luna blieb mitten auf dem Bürgersteig stehen und zwang mich so dazu, ebenfalls stehen zu bleiben und sie anzusehen.
»Ich mach mir Sorgen. Sie ist meine beste Freundin, selbst wenn ich sie zurzeit kaum noch sehe. Ich weiß, dass ihr beide nicht mehr miteinander auskommt, und ich habe die ganze Zeit nichts dazu gesagt, aber … kannst du es nicht versuchen? Es ist ja nicht so, als hättest du was zu verlieren, wenn sie Nein sagt, oder?«
Der Verkehr rollte an uns vorbei, Fußgänger wichen uns aus. Luna sah mich flehend an, und ganz plötzlich kamen mir meine Einwände sehr viel schwächer vor. Ich wollte es zwar nicht, aber Luna bat auch nicht gerade um eine große Sache … und was die Gefahr betraf, in der Anne sich befinden mochte, hatte sie nicht unrecht.
»In Ordnung«, sagte ich.
»Heute Abend?«
»Gut. Heute Abend.«
Lunas und meine Wege trennten sich, und ich lief nach Süden. Sobald ich sie nicht mehr sah, dauerte es nur ein paar Minuten, bis meine Gedanken von ihr und Anne abschweiften und sich wieder um das unangenehme Thema mit meinem Vater drehten.
Es war wohl ganz gut, dass Luna aufgetaucht war. Ohne sie hätte ich vielleicht stundenlang grübelnd im Gang gestanden. Ich hatte Luna die Wahrheit gesagt – mein Vater war vollkommen entsetzt gewesen angesichts dessen, was ich Tobruk angetan hatte (und noch einigen anderen, wo wir schon dabei sind). Den Teil, den ich ihr nicht erzählt hatte, war der, dass ich immer wieder versuchte, meinen Vater umzustimmen, obwohl ich mir nicht die geringste Chance ausrechnete. In den letzten zehn Jahren hatte ich meinen Vater vielleicht ein Dutzend Mal gesehen, und jedes Mal hatte das Treffen im gleichen erbitterten Streit geendet. Er konnte nicht verstehen, dass Gewalt jemals die richtige Entscheidung sein sollte, und ich konnte nicht verstehen, wie diese Einstellung je Sinn machen konnte – wir brachten die immer gleichen Argumente vor und reagierten auf die immer gleiche Weise, als ob wir das Drehbuch eines Theaterstücks durchgingen, das wir beide auswendig kannten, mit nur winzigen Abwandlungen, die aber letztendlich keinen Unterschied machten. Selbst jetzt, während ich durch Londons Straßen lief, ging ich zum tausendsten Mal die Einwände meines Vaters durch, debattierte die strittigen Punkte und stellte mir die Gegenargumente vor, die er vorbringen würde, damit ich auf sie antworten konnte.
Rein rational wusste ich, dass es keinen Sinn machte. Die Streitereien mit meinem Vater brachten nie etwas – sie erschöpften mich nur und ließen mich depressiv zurück –, und doch führte ich sie immer wieder. Es war, als müsste ich ihm etwas beweisen; ihn dazu bringen, zuzugeben, dass ich recht hatte und er nicht. Das war nie geschehen, und ich wusste, dass es nie geschehen würde, aber trotzdem machte ich weiter. Das Einzige, was mich davon ablenkte, war die Arbeit.
Glücklicherweise hatte ich genau deshalb eine Verabredung.
Ich traf Talisid in dem Restaurant in Holborn, das wir für gewöhnlich für unsere Gespräche nutzten, ein Italiener nahe genug an der Haltestelle, dass man gut hinkam, und groß genug, um Privatsphäre zu bieten. Talisid begrüßte mich so höflich wie immer, ein mittelalter Mann, vier oder fünf Zentimeter unter der Durchschnittsgröße, mit angehender Glatze und ergrauendem Haar. Auf den ersten Blick wirkt er für gewöhnlich so unauffällig, dass er genauso gut zum Mobiliar gehören könnte, aber ein genauerer Blick lässt etwas mehr erahnen. Ich kenne ihn seit zwei Jahren, und ich vertraue ihm mehr als sonst jemandem vom Rat, was nicht viel heißt. Wir bestellten und machten uns dann daran, die Geschäfte zu besprechen.
»Die Amerikaner haben sich zurückgemeldet«, sagte Talisid, als wir mit dem Einstiegsgeplänkel fertig waren. »Sie bieten an, die Angelegenheit im Austausch für mehr Informationen über Richard fallen zu lassen.«
»Ich sagte ihnen bereits, dass ich nicht mehr Informationen über Richard habe. Werde ich diese Unterhaltung mit den Wächtern eines jeden Landes führen müssen?«
»Bisher nur mit den beiden«, murmelte Talisid.
Der Anführer der Adepten, die mich letztes Jahr gejagt hatten, war ein amerikanischer Staatsbürger namens Will gewesen. Nach dem, was mit ihm geschehen war, hatte der Amerikanische Rat Krach geschlagen, und da Talisid mir ein paar Gefallen schuldete, hatte ich ihn um Hilfe gebeten. In den letzten paar Monaten war Talisid mein Mittelsmann gewesen und auch mein Ratgeber in Rechtsfragen, nach denen man sich wirklich nicht öffentlich erkundigen möchte. Wirklich krank ist an der Sache, dass es nach dem Magiergesetz völlig legal war, was ich mit Will und den Nightstalkern gemacht hatte. Es gibt einen Grund dafür, dass Adepten den Rat nicht besonders leiden können.
Abwesend drehte ich das Buttermesser zwischen den Fingern. »Wie schlecht ist die Idee, ihnen zu sagen, dass sie sich verpissen sollen?«
»Sie werden nicht versuchen, dich auszuliefern, wenn du dich das fragst«, erwiderte Talisid. »Aber wenn du vorhast, jemals nach Nordamerika zu reisen, ist es wohl besser, das früher als später zu bereinigen.«
»Gut«, sagte ich mit einem Seufzen. »Sag ihnen – noch mal –, dass ich keine Ahnung habe, wo Richard ist oder was er im Schilde führt, aber ich könnte ihnen ihre Akten über den Rest dieser Adepten ausfüllen. Vielleicht lassen sie so mit sich handeln.«
»Das wäre möglich. Es könnte eine direktere Herangehensweise geben.«
Ich beäugte Talisid. »Und die wäre?«
»Der Amerikanische Rat ist genauso wie wir an den Berichten über Richard interessiert«, sagte Talisid. »Wenn du sie bestätigen oder widerlegen könntest …«
Ich seufzte. »Nicht das schon wieder.«
»Du bist einzigartig qualifiziert dafür, diese Sache zu untersuchen.«
»Was zu untersuchen? Einen Haufen Gerüchte?«
»Die gleichen Gerüchte halten sich seit fast einem Jahr hartnäckig«, sagte Talisid. »Meiner Erfahrung nach deutet das auf eine aktive Quelle hin. Außerdem …«
»Gibt es einen echten Beweis?«
»Nein«, sagte Talisid nach einer sehr kurzen Pause.
»Ich bin nicht scharf darauf, auf der schwarzen Seite des Zauns herumzustochern, nur damit sich der Rat besser fühlt. Falls du das vergessen haben solltest – ich bin da nicht gerade beliebt.«
»Ich hätte gedacht, dass es dich auch eher direkt betrifft.«
»Richard ist verschwunden«, erwiderte ich. Das kam schroffer heraus als beabsichtigt. Letztes Jahr hatte ich einen Traum gehabt, in dem Richard definitiv nicht tot war, und er hatte mich deutlich mehr aufgeschreckt, als ich zugeben wollte. Doch Monate waren vergangen, und nichts war geschehen, und schließlich hatte ich mir selbst einreden können, dass es wirklich nur ein Traum gewesen sei. Der einzige Grund, aus dem ich ihn nicht vollständig aus meinem Kopf hatte verbannen können, war, dass alle anderen ständig damit anfingen.
Talisid öffnete den Mund, und ich hob die Hand und unterbrach ihn.
»Du hast mich – wie oft? – drei Mal darum gebeten, das zu tun. Die Antwort lautet immer noch Nein.«
Talisid schwieg erneut, musterte mich, und ich spürte, wie die Zukunft schwankte. »Wie du wünschst«, sagte er endlich.
Das Essen kam, und wir waren erst einmal beschäftigt. »Hast du die politischen Entwicklungen verfolgt?«, fragte Talisid dann.
»Welche?«
»Die Bewegung, Schwarzmagier in den Rat aufzunehmen, hat wieder an Fahrt aufgenommen. Derjenige, der sie am meisten voranbringt, scheint dein alter Freund Morden zu sein.«
»Er ist nicht mein Freund, und nein, davon habe ich nichts gehört. Kommt das nicht alle paar Jahre auf?«
»Diesmal könnte es anders sein – der Block, der sich für die Einheit einsetzt, gewinnt an Einfluss. Ich habe mich gefragt, ob du etwas davon gehört hast.«
»So was liegt über meiner Gehaltsklasse.«
»Wärst du daran interessiert, das zu ändern?«
Ich warf Talisid einen scharfen Blick zu. »Was soll das bedeuten?«
»Die Fraktion, die ich vertrete, hat allen Grund, wegen der aktuellen Sachlage besorgt zu sein. Ein besseres Informationsnetzwerk wäre nützlich.«
»Und du möchtest was von mir – dass ich James Bond spiele?«, fragte ich erheitert. »Ich glaube, die meisten Agenten in diesen Geschichten haben eine wirklich kurze Lebenserwartung.«
»Es ist etwas weniger dramatisch«, sagte Talisid mit einem leichten Lächeln. »Wir brauchen Informationen, keine Überfallkommandos. Wir wissen einfach nie so viel, wie wir gerne wissen würden. Es geht mehr um die Zukunft als um den Augenblick – es gibt nichts, das sofortige Aufmerksamkeit verlangt. Nur etwas für dich zum Nachdenken.«
»Hm.« Ich wollte einen Schluck Wasser nehmen, dann hielt ich inne. »Moment mal. Hast du das die ganze Zeit geplant?«
»Was meinst du?«
Ich starrte Talisid an, das Glas in der Hand, als mir plötzlich alles klar wurde. »Darauf hast du hingearbeitet, nicht wahr? Ich habe mich immer gefragt, warum jemand, der so hoch steht wie du, eine Beziehung zu einem Ex-Schwarzmagier-Wahrsager pflegt. Du hast gehofft, dass ich bei euch unterschreibe. Hast du mich die ganze Zeit getestet? Ging es bei all den Jobs darum?«
Talisid hob die Hand. »Mal langsam.«
»Bisschen spät dafür.« Ich ging die zurückliegenden Begegnungen mit Talisid durch, zog die Verbindungen. »Was ist es also?«
»Dein Schluss ist nicht direkt … falsch, aber die Reihenfolge, in der du es siehst, ist nicht ganz korrekt.« Talisid wirkte nicht besonders überrascht, und ich begriff, dass er mit der Richtung, in die diese Unterhaltung lief, gerechnet haben musste. »Ich habe dich ursprünglich kontaktiert, weil deine Stellung und deine Fähigkeiten vorteilhaft für uns sind. Auf Basis deiner Leistung habe ich dich erneut kontaktiert und so weiter. Allerdings habe ich dich nicht in vergangene Angelegenheiten einbezogen, um dir dieses Angebot zu machen. Ich mache dir dieses Angebot wegen deiner Leistung in vergangenen Angelegenheiten.«
»Und was genau ist das Angebot?«
»Verus, manchmal ist eine Zigarre auch einfach eine Zigarre. Ich sagte, dass wir Informationen bräuchten, und das meine ich genau so.« Talisid sah mich milde an. »Du bist nicht verpflichtet, Aufgaben zu übernehmen, die du nicht übernehmen möchtest. Ist das nicht genau die Basis, auf der wir zuvor schon gearbeitet haben?«
Der Unterschied ist, dass ich angestellt statt selbstständig wäre. Aber das sagte ich nicht laut, denn wie immer war Talisid vernünftig. Ich hatte mittlerweile oft genug für ihn gearbeitet, und jedes Mal war er ehrlich zu mir gewesen. Sah man es so, war das wirklich kein allzu großer Schritt.
Außer … dass es bedeutete, mich dem Rat anzuschließen. »Ich weiß das Angebot zu schätzen«, sagte ich mit Mühe. »Aber ich denke nicht, dass ich einen guten Weißmagier abgeben würde.«
»Warum?«
Weil ich mal ein Schwarzmagier war und mich der halbe Rat dafür hasst. Weil der Rat mich dem Tod überlassen hat, als ich ihn am dringendsten gebraucht hätte, und ich ihn dafür hasse. Weil ich die Mitglieder des Rats für heimtückische Wiesel halte. Und weil ich nicht glaube, dass ich das Recht hätte, mich selbst als Diener der Weißen zu bezeichnen, auch wenn der größte Teil des Rats das ebenfalls nicht verdient …
»Verus?«, hakte Talisid nach, da ich an ihm vorbeistarrte, ohne zu antworten.
»Sagen wir einfach, ich glaube nicht, dass wir miteinander auskommen würden«, erwiderte ich schließlich.
»Mir ist deine Vergangenheit bewusst.« Talisids Stimme klang sanft, und ich sah ihn überrascht an. Das Verständnis in seinen Augen mochte falsch sein, aber wenn, so wirkte es dennoch überzeugend. »Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich denke, du könntest eine Zukunft beim Rat haben. Ich werde dich nicht bedrängen, aber das Angebot steht. Wenn du Zeit hast, denk darüber nach.« Dann beglich Talisid die Rechnung und ging, ließ mich am Tisch sitzen, von wo aus ich ihm hinterherstarrte.
Ich fuhr mit der Tube ab Holborn, stieg an der Liverpool Street und erneut an der Whitechapel um und nahm dann die London Overground nach Süden über den Fluss. Es war eine lange Fahrt, und sie gab mir reichlich Zeit zum Nachdenken.
Talisids Angebot war ein größerer Schock, als es das hätte sein sollen. Seit zwei Jahren arbeitete ich immer mal wieder für ihn, und hätte ich aufgepasst, hätte ich schon vor einer Weile bemerkt, in welche Richtung das führte. Mir war es vermutlich nur nicht aufgefallen, weil ich einfach nie auf die Idee gekommen wäre, dass jemand vom Rat tatsächlich mich auf seiner Seite haben wollte.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto verlockender klang es. Talisid würde nicht mit den Fingern schnippen und mich in den inneren Kreis des Rats befördern können, aber er könnte eine Menge dazu beitragen, damit man mich akzeptierte. Und ein Weißmagier zu sein, selbst einer auf Probe, würde mein Leben auf Hunderte kleine Arten leichter machen. Rechtlich würde ich auf besserem Fuß stehen im Fall von Auseinandersetzungen, was es sehr viel unwahrscheinlicher machte, dass mich jemand überhaupt erst herausforderte, und es würde wirklich bei Lunas Ausbildung helfen. Im Lehrlingsprogramm könnte ich sie in Kurse mit beschränkter Zulassung reinschleusen, ihr vielleicht sogar einen Weißmagier als Fachausbilder suchen.
Aber … ich hatte auch Anlass zu zögern. Es gibt einen Grund, aus dem ich mit dem Rat zerstritten bin: Der Hälfte seiner Grundsätze stimme ich nicht zu, und bei der anderen Hälfte vertraue ich nicht darauf, dass sie eingehalten werden. Außerdem habe ich eine kleine, aber doch signifikante Anzahl an Feinden im Rat, einschließlich eines miesen Typen namens Levistus, und ihm näher zu kommen würde meiner Lebenserwartung nur bedingt guttun. Vor allem jedoch war ich nicht sicher, wie gut die Weißmagier des Rats mich mögen würden. Vom Schwarzmagier zum unabhängigen Magier zu werden ist eine Sache, aber von Schwarz zu Weiß zu wechseln ist etwas anderes. Talisid würde mir zwar die Tür öffnen, aber er würde nicht die Tatsache verschleiern können, dass ich ein Ex-Lehrling eines besonders berüchtigten Schwarzmagiers mit einer beunruhigenden Anzahl an Todesfällen auf dem eigenen Kerbholz war. Es gibt insgesamt wenige Weißmagier, die geringere Opferzahlen zu verzeichnen haben, aber die Tatsache, dass einige dieser Personen, deren Tod auf mein Konto geht, Weißmagier waren, würde wohl auch sie dazu bringen, sich ihre Gedanken zu machen. Und ironischerweise waren es genau die Weißmagier, bei denen es am unwahrscheinlichsten war, dass sie mir vertrauen würden, deren gute Meinung ich am meisten schätzen und deren Respekt ich mir am liebsten verdienen würde.
Vielleicht war es besser, als Unabhängiger außerhalb des Rats zu bleiben.
Aber sprach da Weisheit aus mir oder Angst?
2
Anne wohnt in Honor Oak, einem hügeligen Bezirk Londons, der größtenteils wenig Beachtung findet. Er ist nicht so teuer wie die Innenstadt, aber in London ist nichts gerade billig, und ich war mir ziemlich sicher, dass Anne es sich nur leisten konnte, hier zu wohnen, weil Sonder sie in einem Gebäude untergebracht hatte, das dem Rat gehörte. (Der Rat ist nicht bekannt für spontane Großzügigkeit, aber er besitzt eine Menge Anwesen, die er nicht nutzt, und bedenkt man, für wie viele Dinge er zuständig ist, dann geht ihm doch wohl eine Menge durch.) Annes Wohnung liegt fast ganz oben auf einem Hügel, neben einem Zugang zu einem Wäldchen. Die Hauptverkehrszeit war vorbei, aber als ich vorausblickte, sah ich voller Überraschung eine kleine Menschenansammlung.
Annes Wohnung befand sich im Erdgeschoss eines umgebauten Hauses, und vor ihrer Tür hatte sich eine Schlange gebildet. Während ich sie aus der Ferne beobachtete, begriff ich, dass die Leute anstanden und hineingehen wollten. Jetzt, da ich darüber nachdachte, erinnerte ich mich an Lunas Bemerkung, dass Anne eine Art Praxis in ihrer Wohnung betrieb. Meiner Zählung nach waren gut fünfzehn Leute dort.
Das stellte keine Gefahr dar, war aber ein Problem. Anne hatte mir nie ausdrücklich gesagt, dass ich mich fernhalten sollte, aber ich wusste, dass ihre aktuellen Gefühle mir gegenüber im besten Falle zwiespältig waren. Sie dazu zu bringen, mit mir zu reden, würde nicht leicht sein, und eine Menschenmenge, die draußen wartete, würde mehr oder weniger garantiert die Antwort »Nicht jetzt, ich bin beschäftigt« zur Folge haben. Es bot sich keine offensichtliche Lösung, also suchte ich mir eine nahe gelegene Stelle, um weiter zu beobachten.
Die Menge vor Annes Wohnung war bunt gemischt: Männer und Frauen, Weiße und Asiaten, klein und groß. Das Jüngste war ein Baby auf dem Arm, die Älteste war schätzungsweise um die fünfzig. Die meisten gehörten zur Arbeiterklasse, eine kleinere Fraktion zur Mittelschicht, und es gab zwei oder drei, bei denen ich mir ziemlich sicher war, dass sie drogenabhängig waren. Die Menschen in der Schlange fühlten sich sichtlich nicht ganz wohl miteinander, und es lag eine unterschwellige Anspannung in der Luft, wie man sie aus Jobzentren und Wartebereichen im Krankenhaus kennt. Aus der Wohnung ertönte gerade so vernehmbar Annes leise Stimme, zusammen mit der Stimme des Mannes, mit dem sie redete.
Ich setzte mich auf den Treppenabsatz über Annes Wohnung und wartete. Zwanzig Minuten vergingen, dann vierzig. Hin und wieder war eine Person fertig, und Anne ließ eine neue vor, oder ein Neuankömmling tauchte auf. Die Schlange schien eher länger als kürzer zu werden, was sich nicht gut für meinen »Warte, bis sie fertig ist«-Plan anließ. Ich spielte mit ein paar Ideen, um die Sache zu beschleunigen: Der Plan, der Rauchbomben und Feueralarm beinhaltete, war verlockend, aber ich hatte das Gefühl, Anne würde ihn nicht zu schätzen wissen. In Ermangelung eines besseren Einfalls griff ich auf das Belauschen auf kurze Distanz zurück, um zu sehen, was Anne vorhatte: Das funktioniert nicht so zuverlässig wie andere Methoden der magischen Überwachung, aber es ist praktisch unmöglich zu bemerken. (Ja, das ist Spionage. Ich bin ein Wahrsager. So etwas mache ich nun mal.)
Genau wie Luna gesagt hatte, betrieb Anne eine Praxis, und ihre Patienten waren wirklich vielfältig. Manche waren wie zu erwarten krank, wie die Frau mit der Grippe oder der Mann mit den Rückenschmerzen. Manche waren seltsam, wie der Typ, der behauptete, von seiner Katze gebissen worden zu sein. Und manche wirkten deprimierend auf mich, wie das Mädchen, das sich die Handgelenke geritzt und jetzt Angst hatte, dass jemand es sehen könnte. Anne fragte sie sanft, warum sie es getan hatte. Nach einigem Nachbohren verriet das Mädchen, dass ihr Freund sie bedroht habe. Anne fragte, ob sie darüber nachdächte, ihn zu verlassen. Das Mädchen sagte, dass sie das nicht könne, sie liebe ihn. Damit geriet die Unterhaltung mehr oder weniger in eine Sackgasse.
Annes Behandlungstechnik war interessant. Sie nutzte kaum je aktiv Magie, sondern führte einfach eine rasche Untersuchung durch, dann empfahl sie ein Heilmittel. Aus der körperlichen Untersuchung machte sie eine ziemliche Show, aber ich war mir einigermaßen sicher, dass sie sich in Wirklichkeit auf ihre Lebensmagie oder »Lebenssicht« verließ. Dies ist eine der charakteristischen Fähigkeiten von Lebensmagiern, sie »sehen« die Physiologie und die Körperfunktionen, indem sie jemanden betrachten, und das macht eine Diagnose wirklich einfach – nicht nötig zu erwähnen, dass die Gabe überaus geeignet ist, um jemanden ausfindig zu machen. Die Lebenssicht ist vermutlich die schwächste Fähigkeit, die Anne beherrscht, aber in der Magie ist es wie bei vielen anderen Dingen auch: Die mächtigsten Methoden sind nicht zwingend die nützlichsten. In der Theorie konnte Anne einfach jeden kurieren, der hereinkam, die Wunde heilen und den Körper wiederaufbauen, aber das würde sie rasch erschöpfen – Heilzauber verschlingen eine Menge physischer Energie, und sie sind auch schwerlich als Zufall abzutun. Indem sie ihre Fähigkeiten dazu nutzte, die Leute zu diagnostizieren und ihnen dann eine nicht-magische Behandlungsmethode zu empfehlen, konnte sie ihnen sehr viel effektiver helfen, ohne das Risiko einzugehen, als Magierin enttarnt zu werden. Es war eine kluge Herangehensweise.
Während ich zusah, bemerkte ich jedoch, dass die Patienten seltsam auf Anne reagierten. Sie schien kein Geld zu nehmen, sie war aufmerksam und höflich zu jedem, der durch die Tür kam, und sie war schneller und präziser als jeder Arzt. Die Patienten hätten ihr dankbar sein sollen, und manche waren das auch … aber überraschend viele waren es nicht. Sie verhielten sich geradezu anmaßend: Sie schienen nichts von dem wertzuschätzen, was Anne für sie tat; sie benahmen sich, als wäre es ihr gutes Recht. Andere stritten sich mit ihr, wenn sie nicht die Diagnose erhielten, die sie sich wünschten. Am seltsamsten waren jedoch die, denen Annes Anwesenheit irgendwie unangenehm zu sein schien. Sie baten um ihre Hilfe, aber zögerlich, als machte ihre Nähe sie nervös. Und es waren nicht nur ein oder zwei; es war eher jeder Dritte, der durch die Tür trat.
Nachdem ich über eine Stunde zugesehen hatte, bemerkte ich einen Aufstand. Ein neuer Mann war am Ende der Schlange aufgetaucht; offensichtlich war er unzufrieden mit deren Länge, denn er drängte sich nach vorn. Die Menschen, die bereits in der Schlange standen – manche warteten schon über eine Stunde –, hielten dagegen. Die Rufe und Flüche wurden immer lauter, bis der Neuankömmling in Annes Wohnung stürmte. Kurz lauschte ich auf die erhobenen Stimmen, dann stand ich auf und ging an der Menge vorbei die Stufen hinab auf den Lärm zu.
Das Behandlungszimmer in Annes Wohnung war spärlich eingerichtet, allem Anschein nach für die Öffentlichkeit vorgesehen statt für eine private Nutzung, aber es hatte dennoch eine persönliche Note: grün gepolsterte Stühle, Topfpflanzen vor den Fenstern. Zwei Türen führten in die Wohnung hinein, und beide waren geschlossen. Die Menge hatte sich ein paar Schritt weit hineingedrängt, aber sie hielt sich in der Nähe der Tür und wollte sichtlich nicht näher herankommen.
Der Grund für ihr Zögern stand in der Mitte des Zimmers und schrie Anne an. Er war ein großer Kerl, mächtig gebaut und mit vernarbtem rasiertem Schädel. Auf die Seite seines Halses war ein Spinnweb tätowiert, und auf den Knöcheln seiner rechten Faust stand in blauer Tinte ACAB. Seine Worte waren nicht leicht zu verstehen, doch er schien etwas zu wollen, und Anne stand direkt vor ihm.
Sie ist groß und schmal, mit schwarzen Haaren und rötlich braunen Augen. Sie hat eine ruhige Art, zu reden und sich zu bewegen, sodass sie meist unauffällig bleibt, doch das funktionierte diesmal nicht gut. Manche Menschen scheinen ihr Aussehen abstoßend zu finden, aber ich habe nie richtig verstanden, warum.
Anne ist eine der wenigen, die ich kenne, die mit Fug und Recht behaupten können, eine schlimmere Kindheit gehabt zu haben als Luna oder ich – vor etwa fünf Jahren, als sie noch in der Schule war, wurde sie von einem Schwarzmagier namens Sagash entführt, der sie zu seinem Lehrling machen wollte. Mit Variams Hilfe konnte sie entkommen, aber es dauerte fast ein Jahr, und Anne hat weder Luna noch mir je erzählt, was genau in diesen neun Monaten geschehen ist. Sie warf mir einen kurzen Blick zu, ohne ein Zeichen der Überraschung, als ich eintrat: Sie hatte mich kommen sehen. »Hi«, sagte ich.
»… oder nicht?«, forderte der Mann gerade mit lauter Stimme. »Ich bin, wozu die Regierung mich gemacht hat, oder nicht? Mein Dad hat mich in die Besserungsanstalt geschickt, als ich ein Kind war, und sie haben mich behandelt wie einen Verbrecher. Na, und jetzt haben sie, was sie …«
»Brauchst du Hilfe?«, fragte ich.
Anne hielt die Hand hoch und drehte sich von dem Tattootyp halb zu mir, sprach mit ihrer leisen Stimme. »Kein guter Zeitpunkt.«
»Ich würd die Öffentlichkeit und die Polizei fertigmachen wie nix. Die würden gar nicht checken, was abgeht. Das ist Ungeziefer, die sind nichts für mich. Sie würden gar nicht …«
»Ich muss doch sehr bitten!«, sagte ich zu dem Kerl.
Der Tattootyp sah mich finster an. »Wer zur Hölle bist du?«
»Freund von ’nem Freund. ’tschuldige, kenn ich dich?«
Ich nahm wahr, wie die Gedanken des Typen einen anderen Gang einlegten. Es ging langsam vonstatten, und ich sah, wie sich die möglichen Zukünfte vor mir verzweigten. Er könnte sich aufplustern; er könnte sich zurückziehen; er könnte einen Kampf anzetteln. Ich hoffte, er würde sich für Letzteres entscheiden. Der Tattootyp war groß und fies, aber mein Begriff von fies ist ziemlich verdreht im Vergleich zu dem von normalen Leuten, und als ernste Bedrohung schaffte er es nicht einmal auf meinen Radar. Mein Tag war stressig gewesen, und die Aussicht, es an jemandem auszulassen, war sehr viel verlockender, als sie es hätte sein sollen.
»Alex!«, sagte Anne.
Ich warf ihr einen Seitenblick zu. »Was ist?«
»Bitte nicht.«
»Nicht was?«
»Du weißt, was.« Anne wirkte leicht frustriert. »Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber mir geht’s gut.«
Der Tattootyp hatte verwirrt zwischen uns beiden hin- und hergesehen. Jetzt schlich sich etwas Fieseres in seine Miene, und ich spürte, wie sich die Zukünfte verschoben. Er müsste ernsthaft dämlich sein, handgreiflich zu werden, während ich, Anne und die Menge in der Tür ihn beobachteten, aber dumme, aggressive Menschen laufen wirklich nicht Gefahr auszusterben, und der Tattootyp lieferte ein super Beispiel für diese Sorte.
»Hey! Ich rede verdammt noch mal mit dir!«, tönte er.
»Tut mir leid«, sagte Anne zu ihm. »Ich habe hier keine Drogen. Wenn du dich hinsetzt, kann ich …«
»Halt dein verdammtes Maul!« Der Tattootyp machte einen Schritt vor und beugte sich über Anne. Er hatte keinen besonderen Größenvorteil, aber seine Masse glich das aus. »Erzähl mir keinen Scheiß. Sie haben alle gelogen, und ich hab dafür gesorgt, dass sie verdammt noch mal dafür bezahlen, ja?« Er machte noch einen Schritt vor und griff dabei nach Anne. »Ich …«
Meine Finger zuckten, als er die Hand nach ihr ausstreckte. Ich wollte einschreiten, und ich konnte den Ablauf der Bewegungen mit absoluter Klarheit sehen: Ich würde seinen Arm abwehren, er würde mich packen, ich würde ihn abschütteln, er würde die Entschuldigung haben, die es brauchte, damit er nach mir schlagen konnte, und das würde mir die Entschuldigung liefern, die ich brauchte, um ihn plattzumachen. Er war vielleicht stark, aber ich war schneller und besser trainiert, und ich konnte jede seiner Bewegungen voraussehen. Das konnte nur auf eine Art enden …
… und Anne hatte mir gerade sehr deutlich gesagt, genau das nicht zu tun. Anne weiß, was ich kann, und deshalb hatte sie »Bitte nicht« gesagt. Sie war nicht in Gefahr – aus der Nähe ist sie sehr viel tödlicher als ich. Wenn ich einschritt, würde ich das nicht für sie tun; ich würde aus Stolz handeln, würde versuchen, etwas zu beweisen.
Ich wich nicht zurück. Der Mann packte Anne, seine dicken Finger umfassten ihren Oberarm vollständig. »Ich sag’s dir nicht noch mal.«
Anne hielt den Blick des Mannes fest, und ganz plötzlich sah sie auf subtile Weise anders aus. Die meisten Menschen zucken zusammen, wenn man sie packt, aber Anne nicht. Sie starrte ohne eine Reaktion zu dem Mann auf; es sah nicht einmal so aus, als würde sie atmen. »Ich habe nicht, was du suchst«, sagte sie deutlich. »Lass mich bitte los.«
Ich merkte, wie der Mann zögerte. Irgendwo in seinem von Toxinen vernebelten Hirn versuchte die Botschaft durchzudringen, dass Anne sich nicht gerade wie ein Opfer verhielt. Doch wenn jemand dumm genug ist, einen Streit vor einer Menschenmenge anzufangen, dann braucht es für gewöhnlich eine deutlich überlegene Macht, ihn zum Aufgeben zu bewegen, und Anne sieht nun mal nicht gefährlich aus. Er griff nach ihrem Hals.
In Annes Augen flackerte es.
Mit Divinationsmagie kann man in der Zeit voraussehen, aber nicht zurück. Trifft jemand eine Entscheidung, kann man, falls man schnell ist, einen Blick auf die Optionen erhaschen, zwischen denen er sich entscheidet. Für den Bruchteil einer Sekunde, während Anne die Hand hob, sah ich, wie sich verschiedene Möglichkeiten auftaten, flüchtige Bilder, die in den einzelnen Strängen aufleuchteten: ein subtiler Zauber, Reglosigkeit und Stille, ein Körper, der zusammensinkt, jemand, der sich die Lunge aus dem Leib schreit, mehr Gerede … Halt, zurück, was war das Letzte …?
… und weg war es. Annes Finger berührten das Handgelenk des Mannes, und grünes Licht glühte, das innerhalb eines Augenblicks wieder verschwunden war. Der Zauber war komplex, einer, den ich noch nicht gesehen hatte.
Der Mann taumelte und blieb stehen. Die Aggressivität verschwand aus seinem Blick, und ganz plötzlich sah er nur noch verwirrt aus.
»Bitte, setz dich«, sagte Anne. Ihre Stimme war noch immer höflich, und der Mann gehorchte, sank auf einen Stuhl, als wären seine Glieder sehr schwer. Anne drehte sich zu mir um. »Ich bin ein wenig beschäftigt.«
Ich erwiderte ihren Blick – was hatte ich da kurz gesehen? –, dann schüttelte ich es ab. Vielleicht hatte ich es mir eingebildet. »Ist das deine Art, mich zu bitten, an einem anderen Tag wiederzukommen?«
»Ja.« Anne sah mich ruhig an. »Es tut mir leid. Ist gerade kein guter Zeitpunkt.«
Ich schwieg, dann nickte ich. Ich ging durch die Menge nach draußen, drängte mich an den Leuten vorbei. Hinter mir hörte ich, wie Anne sie wieder hinausscheuchte.
Neben dem Haus, in dem sich Annes Wohnung befand, waren Schrebergärten oder ein kleiner Park, wie es von außen aussah, abgeriegelt von einem Eisenzaun und einem verschlossenen Tor. Es gab kein Schild, aber mein Handy zeigte ihn mir als Garthorne Road Nature Reserve an.
Drinnen war das Naturschutzgebiet sehr viel größer, als es von der Straße her ausgesehen hatte, es erstreckte sich nach links und rechts und bildete einen langen Streifen Land hinter den Häusern, die ihn verbargen. Eisenbahnschienen durchschnitten es, formten ein abgetrenntes Tal mit bewaldeten Hängen. Ich stieg über den Zaun, sah mich kurz um, dann setzte ich mich auf eine Holzbank und wartete.
Die Zeit verstrich. Die Sonne ging unter, und der Himmel wurde erst blau, dann dunkelblau und schließlich schwarz, von unten beschienen vom orangefarbenen Glühen der Londoner Skyline. Solche Orte hatten mich schon immer angezogen, verborgen hinter Straßen und Häusern – ich mag die Natur, aber im Herzen bin ich ein Städter, und am wohlsten fühle ich mich mitten in der Stadt. Das Naturschutzgebiet war nahezu finster, die Straßenlampen von Bäumen und Häusern verdeckt, und der Wind raschelte in den Blättern, wurde kräftiger und schwoll wieder ab. Von Zeit zu Zeit fuhr ein Zug über die Schienen, er ratterte und dröhnte und brüllte und hinterließ dann gespenstische Stille. Während ich ruhig dasaß, hörte ich es im Unterholz rascheln, als sich die nächtlichen Bewohner des Gebiets an meine Anwesenheit gewöhnten. Ich erkannte die Bewegungen der rasch flitzenden Nagetiere und einen Igel, der nur ein paar Schritte entfernt vorbeitrappelte. Der Wind blies die Wolken weg, und Sterne schimmerten von den klaren Flecken am Himmel herab.
Es war beinahe zehn, als ich jemanden hörte, der sich vom Eingang des Naturschutzgebiets näherte, Schritte auf Gras, die den Hügel hinab auf mich zukamen. Ich konnte den exakten Moment spüren, in dem Anne mich mit ihrer Lebenssicht erfasste, denn sie blieb stehen. Ich sah, wie sich die Möglichkeiten verzweigten – würde sie herkommen oder wieder gehen? –, doch genau so, wie ich wusste, dass sie mich gesehen hatte, wusste sie, dass ich sie gesehen hatte. Die Zukunft, in der sie wieder ging, erlosch, und einen Augenblick später bemerkte ich einen schmalen Schatten vor den Bäumen.
»Hey«, sagte ich.
»Ich dachte, du wolltest gehen«, erwiderte Anne. Ihr Gesicht konnte ich in der Dunkelheit nicht sehen.
»Ich sagte nicht, wohin.«
Ich hörte Anne seufzen. »Ich werde mich genauer ausdrücken müssen, oder?« Sie schwieg kurz. »Woher wusstest du, dass ich hierherkommen würde?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Dieser Ort passt zu dir.«
Anne war neben einem alten Lehmofen stehen geblieben. Ich hatte damit gerechnet, dass sie Abstand hielt, aber sie ging weiter, trat um einen Holzstapel, dann setzte sie sich auf die Bank mir gegenüber, zog die Füße in einen Schneidersitz. Eine Weile saßen wir schweigend da.
»Es ist nett hier«, sagte ich schließlich. Ich meinte es so. Trotz der Eisenbahnschienen und der Straßen drum herum wirkte das Naturschutzgebiet friedlich.
»Es gehört nicht mir.«
»Du kommst oft her, nicht wahr?«
»Wenn ich kann«, antwortete Anne. Ich konnte ihre Gesichtszüge im schwachen Sternenlicht jetzt gerade so erkennen.
Schweigen. »Gut«, sagte ich dann. »Wie läuft die Praxis?«
»Ist okay.« Anne klang müde.
»Arbeitest du noch in dem Supermarkt?«
»Ja.« Anne sah zu mir auf. »Ich glaube dir nicht, dass du hier bist, um über meinen Job zu reden.«
»Ich habe gehört, du hast das Lehrlingsprogramm verlassen.«
»Sagt man das?«
»Nicht direkt.« Ich verstummte, aber Anne ging nicht darauf ein. Na gut, drum herum zu schleichen funktionierte sowieso nicht. »Man sagt, du wurdest rausgeworfen, weil du Natasha angegriffen hast.«
Anne schwieg.
»Stimmt es?«, fragte ich.
»Tut das was zur Sache?«
»Ja, das tut was zur Sache. Möchtest du mir nicht wenigstens deine Version der Geschichte erzählen?«
Anne klang erschöpft. »Warum die Mühe?«
Ich wusste nicht recht, was ich dazu sagen sollte. »Hat Natasha dich angegriffen? Oder hat Natasha dich reingelegt?«
»Nein«, sagte Anne und seufzte. »Sie hat sich nur wie … Natasha benommen.«
»Und … was hast du dann getan?«
»Möchtest du das wirklich wissen?« Anne sah zu mir auf, begegnete meinem Blick in der Dunkelheit. »Ich habe all ihre Schmerzrezeptoren ausgelöst und sie in Schleife gelegt, sodass sie für einige Stunden nicht aufhörten zu feuern.«
Ich starrte sie an. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Anne so etwas tat. Nun gut, wenn ich darüber nachdachte, hatte ich sie schon einmal genau so etwas tun sehen, schlimmer sogar, aber …
»Das richtet keinen dauerhaften Schaden an«, sagte Anne, als ich nichts erwiderte. Es klang defensiv.
»Was hat sie getan?«
»Nichts«, sagte Anne frustriert. »Nichts anderes als sonst. Sie sagte etwas darüber, was ich angeblich getan hätte, um im Programm zu bleiben. Es war nicht mal das Schlimmste, was sie an dem Tag von sich gab, vielleicht war es nicht mal unter den Top Ten, und Natasha ist auch nicht die Schlimmste von ihnen. Es war nichts Besonderes. Es war nur … der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das war alles.«
»Was waren denn all die anderen Tropfen?«, fragte ich leise.
Anne stieß den Atem aus. »Weißt du, wie lange ich schon im Programm bin?«
»Nein.« Ich war Anne zum ersten Mal bei Lunas Lehrlingszeremonie begegnet, vor fast zwei Jahren. »Zwei Jahre?«
»Drei und noch was.« Anne sah mich an. »Weißt du, wie viele Tage ich zu den Kursen gegangen bin und mich niemand daran erinnert hat, dass die Weißmagier mich da nicht haben wollen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Keiner«, sagte Anne. »Sie mögen mich nicht. Weil ich bei Sagash war. Weil ich bei Jagadev war. Weil ich eine Lebensmagierin bin. Weil ich wegen Mordes festgenommen wurde, und manche von ihnen glauben, dass man mich hätte verurteilen sollen. Wenn es nicht aus dem einen Grund ist, ist’s aus einem anderen, und ich bin es einfach leid. Weißt du, was ich zuerst gefühlt habe, nachdem ich herausfand, dass ich rausgeworfen worden bin? Erleichterung. Weil ich sie nicht mehr jeden Tag sehen muss. Als ich damals ins Programm kam, dachte ich, dass ich zu den Weißmagiern gehören und eines Tages akzeptiert werden würde. Als ich mich dann mit Mädchen wie Tash und Christine auseinandersetzen musste, dachte ich, dass sie schon darüber wegkommen würden, dass es nicht ewig so weitergehen würde, aber … es hört nie auf. Ich hab die Schnauze so voll davon, wie es in den Kursen mit den Weißmagiern läuft. Ich bin es leid, dass die anderen Lehrlinge hinter meinem Rücken tuscheln, wie die Lehrer bei Zweierübungen jedes Mal meinen Partner zur Seite nehmen und denken, ich höre es nicht, wenn sie fragen, ob es in Ordnung ist, dass er mit mir arbeiten soll. Ich bin es leid, ausgeschlossen zu werden … die Blicke, die Witze. Ich bin es einfach leid.« Anne verstummte.
»War das die ganze Zeit so?«, fragte ich leise. Mir war klar gewesen, dass Anne und Variam nicht beliebt waren, aber ich hatte nicht geahnt, dass es so schlimm war.
»Ich wollte nicht darüber reden«, sagte Anne müde. »Und es ist nicht so schlimm, nicht jeden Tag. Es … summiert sich einfach. Die meisten Weißmagier, also die Lehrer, sind nicht so schlimm. Aber ich bin keine von ihnen. Und das lassen sie mich nie vergessen.«
Einen Moment lang schwieg ich. »Ich weiß, was du meinst.«
Anne erzählte mir da nichts, was ich nicht selbst schon erlebt hatte. Die Weißmagier des Rats sind eng miteinander, eine große Familie – sogar, wenn sie sich untereinander streiten, verstehen sie sich im Grunde immer noch. Für sie sind die Schwarzmagier die anderen, ihre uralten Feinde, und wenn man mit einem Schwarzmagier in Verbindung gebracht wird, dann steht man immer außen vor, und sie vertrauen einem nie ganz. Deshalb hatte ich von Anfang an eine Verbindung zu Anne und Vari empfunden – ich weiß, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. »Brauchst du Hilfe?«
»Ich möchte nicht mehr ins Programm zurück.«
»Das musst du auch nicht.« Ich wählte meine Worte mit Bedacht; jetzt bewegte ich mich auf gefährlichem Terrain. »Du könntest wieder in meinen Laden ziehen.«
Anne schwieg.