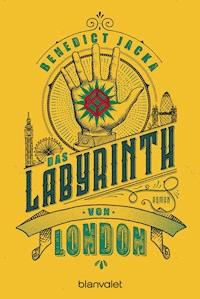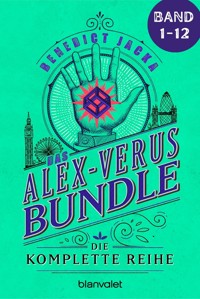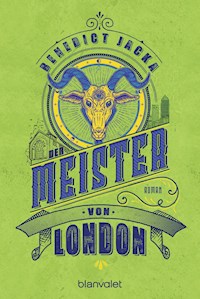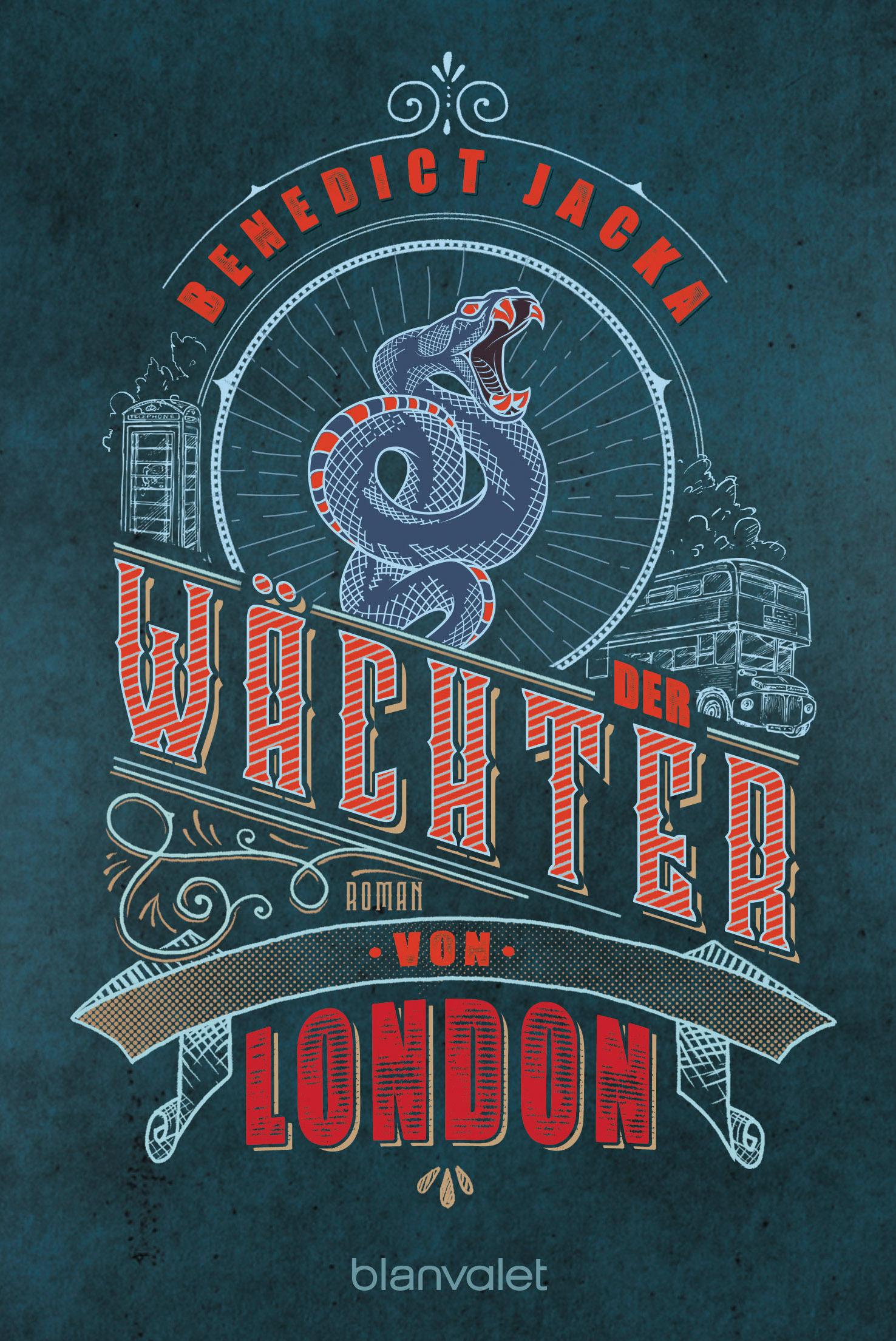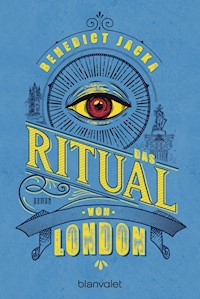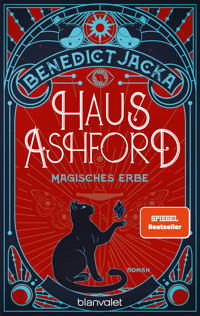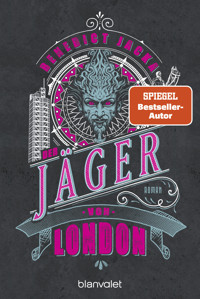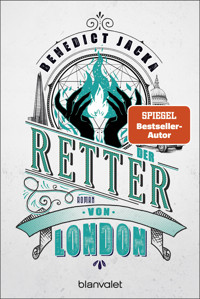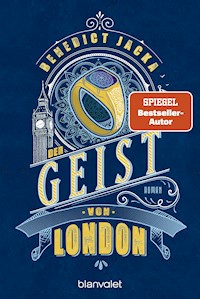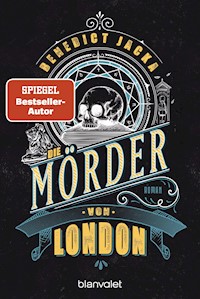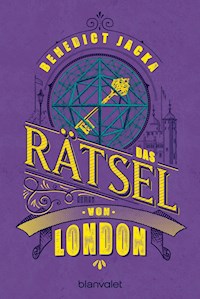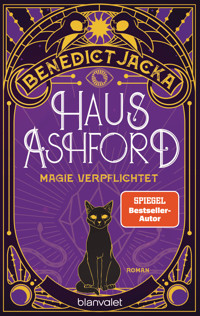
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Stephen Oakwood
- Sprache: Deutsch
Magie verpflichtet! Der Auftakt der neuen Urban-Fantasy-Serie von SPIEGEL-Bestsellerautor Benedict Jacka.
Stephen Oakwood hat ein natürliches Talent für Magie. Doch die Materialien dafür sind teuer, und er stammt aus einfachen Verhältnissen. Zudem hat Stephen keine weiteren Verwandten – glaubt er zumindest, bis seine Cousine auftaucht. Plötzlich ist er verstrickt in die Angelegenheiten von Haus Ashford, einer der mächtigsten Magierfamilien Englands. Stephen will eigentlich nichts mit seiner adeligen Verwandtschaft zu tun haben, doch die zieht ihn immer tiefer in ihre Intrigen hinein. Also muss er selbst Macht und Vermögen aufbauen – und seine magischen Fähigkeiten so schnell es geht verbessern.
Verpassen Sie nicht die 12-bändige Serie um den Hellseher Alex Verus, die mit »Das Labyrinth von London« beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Stephen Oakwood hat ein natürliches Talent für Magie. Doch die Materialien dafür sind teuer, und er stammt aus einfachen Verhältnissen. Zudem hat Stephen keine weiteren Verwandten – glaubt er zumindest, bis seine Cousine auftaucht. Plötzlich ist er verstrickt in die Angelegenheiten von Haus Ashford, einer der mächtigsten Magierfamilien Englands. Stephen will eigentlich nichts mit seiner adligen Verwandtschaft zu tun haben, doch die zieht ihn immer tiefer in ihre Intrigen hinein. Also muss er selbst Macht und Vermögen aufbauen – und seine magischen Fähigkeiten so schnell es geht verbessern.
Autor
Benedict Jacka (geboren 1980) ist halb Australier und halb Armenier, wuchs aber in London auf. Er war 18 Jahre alt, als er an einem regnerischen Tag im November in der Schulbibliothek saß und erstmals, anstatt Hausaufgaben zu machen, Notizen für seinen ersten Roman in sein Schulheft schrieb. Wenig später studierte er in Cambridge Philosophie und arbeitete anschließend als Lehrer, Türsteher und Angestellter im öffentlichen Dienst. Das Schreiben gab er dabei nie auf, doch bis zu seiner ersten Veröffentlichung vergingen noch sieben Jahre. Er betreibt Kampfsport und ist ein guter Tänzer. In seiner Freizeit fährt er außerdem gerne Skateboard und spielt Brettspiele.
Die zwölfbändige Alex-Verus-Serie von Benedict Jacka bei Blanvalet:1. Das Labyrinth von London2. Das Ritual von London3. Der Magier von London4. Der Wächter von London5. Der Meister von London6. Das Rätsel von London7. Die Mörder von London8. Der Gefangene von London9. Der Geist von London10. Die Verdammten von London11. Der Jäger von London12. Der Retter von London
Deutsch von Michelle Gyo
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »An Inheritance of Magic (1)« bei Orbit, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Benedict Jacka
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotive: Shutterstock.com (Peratek; Peratek; Victoria Bat; Evgenia Pichkur; ekosuwandono; Tanya K; Stephanie Muller)
HK · Herstellung: fe
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31496-5V003
www.blanvalet.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Anmerkung des Autors
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Glossar
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Im Gedenken an Cyril Keith Jacka1927–2022
Anmerkung des Autors
Willkommen zu meiner neuen Reihe! Ich hoffe, die nächsten zehn Jahre oder so daran zu schreiben.
Diejenigen, die meine Romane über Alex Verus gelesen haben, möchte ich darauf hinweisen, dass diese Welt eine andere ist und die Magie hier anders funktioniert. Das vorliegende Buch dient der Einführung ins Setting, und für alle, die gern mehr wissen wollen, ist am Ende ein Glossar mit Begriffen angehängt.
Ich hoffe, ihr genießt die Geschichte!
Benedict Jacka, Februar 2023
1
Am Ende meiner Straße stand ein seltsames Auto.
Ich hatte mich nur kurz aus dem Fenster gelehnt, um mich umzusehen, aber als ich das Auto entdeckte, stutzte ich. Die Geräusche und Gerüche eines Londoner Morgens umgaben mich: frische Luft, die noch die Kühle des verklingenden Winters in sich trug, die Feuchtigkeit vom Regen der vergangenen Nacht, Vogelgezwitscher von Dächern und Bäumen. Blassgraue Wolken bedeckten den Himmel, versprachen weitere Schauer. Alles war normal … bis auf das Auto.
Der Frühling war in diesem Jahr zeitig angebrochen, und der Kirschbaum vor meinem Fenster blühte schon so lange, dass die weißen Blüten sich langsam pink und braun verfärbten und herabfielen. Das Auto war gerade so zwischen den Blütenblättern zu sehen, es parkte am Ende der Foxden Road in einem Winkel, der freie Sicht auf meine Haustür bot. Es wirkte schnittig und zugleich bedrohlich, glänzend schwarz mit getönten Scheiben, und sah aus wie ein Minivan. Niemand in unserer Straße besitzt einen Minivan, besonders keinen mit getönten Fensterscheiben.
Ein lautes »Mrauuu« erklang zu meinen Füßen.
Ich sah zu dem grau-schwarz getigerten Kater hinab, der mich aus gelbgrünen Augen beobachtete. »Na schön, Hobbes«, sagte ich und machte ihm Platz. Hobbes sprang aufs Fensterbrett, rieb den Kopf an meiner Schulter, bis ich ihn kraulte, dann hüpfte er hinab auf den Sims, der an der Vorderseite des Gebäudes verlief. Ich warf dem Auto einen letzten Blick zu, beugte mich zurück und schloss das Fenster.
Ich putzte die Zähne, zog mich an, frühstückte – und dachte dabei die ganze Zeit an das Auto.
Vor fast drei Jahren, am Tag nachdem mein Dad verschwunden war, tauchte ein weißer Ford in unserer Straße auf. Mir wäre das vielleicht nicht aufgefallen, aber ein paar Dinge, auf die mein Dad mich in einem hastig dahingekritzelten Brief aufmerksam gemacht hatte, hatten mich misstrauisch gemacht, und als ich darauf zu achten begann, bemerkte ich denselben Ford mit demselben Nummernschild auch an anderen Orten. In der Nähe meines Boxclubs, bei meiner Arbeit … überall.
So lief das über ein Jahr. Ich machte mir Sorgen um meinen Dad und mühte mich ab mit der Arbeit und der Miete, und währenddessen sah ich immer wieder dieses Auto. Sogar nachdem ich aus der Wohnung geworfen worden war und zu meiner Tante hatte ziehen müssen, bis rauf nach Tottenham, sah ich es immer noch. Nach einer Weile hasste ich dieses Auto regelrecht – es wurde zum Symbol all dessen, was falsch gelaufen war –, und nur die Warnung meines Dads hielt mich davon ab, rauszustürmen und zu konfrontieren, wer immer da drinsaß. Manchmal verschwand der Minivan für ein paar Tage, aber er kam immer wieder.
Endlich wurden die Abstände zwischen seinem Auftauchen länger und länger, und schließlich tauchte er gar nicht mehr auf. Als ich bei meiner Tante auszog und hier in der Foxden Road ein Zimmer fand, notierte ich mir als Erstes die Nummernschilder in der Straße sowie eine kurze Beschreibung des jeweiligen Autos, und dann prüfte ich im Verlauf der nächsten Wochen, wer wo einstieg. Doch jedes Auto gehörte jemandem, der hier in der Straße wohnte, und irgendwann ging ich davon aus, dass, wer immer in dem Minivan gewesen war, sich auf und davon gemacht hatte. Das war vor sechs Monaten gewesen, und seither hatte mich nichts denken lassen, dass er zurückkommen würde.
Bis jetzt.
Ich füllte Hobbes’ Wassernapf, dann war es Zeit, zur Arbeit aufzubrechen. Ich zog den Reißverschluss an meinem Fleecepulli hoch und trat vors Haus, schloss die Tür hinter mir. Der schwarze Minivan war immer noch da. Ich ging die Straße hinauf, entfernte mich ohne einen Blick zurück, dann bog ich um die Ecke.
Sobald ich vom Minivan aus nicht mehr zu sehen war, blieb ich stehen. Ich konnte das verschwommene Spiegelbild in den Erdgeschossfenstern unserer Straße erkennen, und ich wartete, wollte überprüfen, ob er sich in Bewegung setzte.
Eine Minute verging, dann zwei. Das Spiegelbild rührte sich nicht.
Falls sie mir folgten, hätten sie mittlerweile losfahren müssen.
Vielleicht war ich zu misstrauisch. Immerhin hatten die Männer vor zwei Jahren immer dasselbe Auto gefahren, und es war nicht dieses gewesen. Ich wandte mich um und lief los in Richtung U-Bahn-Station. Auf dem Weg über die Plaistow Road sah ich immer wieder über die Schulter, hielt im regen Verkehr der Hauptstraße nach dem schwarzen Minivan Ausschau, aber er tauchte nicht auf.
Ich heiße Stephen Oakwood und bin zwanzig Jahre alt. Ich wurde von meinem Dad großgezogen, wuchs in Plaistow auf und ging hier zur Schule, und abgesehen von einem großen Geheimnis, zu dem ich später noch komme, führte ich ein ziemlich normales Leben. Das änderte sich ein paar Monate vor meinem achtzehnten Geburtstag, als mein Dad verschwand.
Die nächsten Monate waren hart. In London ganz auf sich gestellt zu sein, ist schwierig, es sei denn, man hat gute Voraussetzungen, was bei mir nicht der Fall war. Anfangs war mein Plan, darauf zu warten, dass mein Vater zurückkehrte, und vielleicht sogar, ihn zu suchen. Aber ich merkte schnell, wie schwer es war, genug Geld zum Leben zu verdienen; es hielt mich so beschäftigt, dass mir kaum Zeit für anderes blieb. Im ersten Jahr hatte ich einen Job bei einem alten Freund meines Dads, der eine Bar besitzt, aber als die Bar schloss, ging mir das Geld aus. Damals musste ich aus der Wohnung aus- und bei meiner Tante einziehen.
Bei meiner Tante und meinem Onkel zu wohnen, ermöglichte mir, wieder auf die Füße zu kommen, aber es war von Anfang an klar, dass sie mich nur für einen bestimmten Zeitraum bei sich aufnehmen würden. Ich konnte mir keine Wohnung leisten, aber ich konnte gerade so ein Zimmer in Plaistow bezahlen, solange ich Vollzeit arbeitete. Nach einem kurzen Versuch in einem Callcenter (übel) und einem Job in einer anderen Bar (noch übler) landete ich im letzten Jahr bei einer Zeitarbeitsfirma, die Büroangestellte für die öffentliche Verwaltung brauchte. Weshalb ich an diesem Morgen mit der District Line zum Embankment fuhr und dann Richtung Süden an der Themse entlang zum Ministry of Defence lief.
Wenn ich sage, dass ich beim Verteidigungsministerium arbeite, klingt mein Job aufregender, als er in Wirklichkeit ist. Die richtige Bezeichnung lautet »Befristeter Verwaltungsassistent, im Archivbüro, Defence Business Services«, und mein Job besteht hauptsächlich darin, Unterlagen aus dem Keller zu holen. An einer Wand des Archivs steht eine Maschine namens Lektriever, eine Art gigantisches vertikales Laufband, das Fächer mit Archivboxen aus dem Untergeschoss hinauftransportiert. Der Keller ist gewaltig, eine schmucklose dunkle Kaverne mit endlosen Reihen von Metallregalen, auf denen Tausende und Abertausende Akten stehen. Jeden Tag kommen Anweisungen, diese Akten zu tauschen, was heißt, jemand muss dort hinuntergehen, neue Akten hinein- und alte Akten hinausschaffen. Dieser Jemand bin ich. In der Theorie sollte diese Position von einem Festangestellten übernommen werden, aber da Verwaltungsassistent im Archiv so ziemlich die am wenigsten begehrte Position im gesamten MoD ist, hat sich bisher niemand bereit erklärt, den Job zu übernehmen; also heuern sie stattdessen Zeitarbeitskräfte an. Dafür bezahlen sie mir 10,70 Pfund die Stunde.
In letzter Zeit habe ich etwas weniger Zeit im Keller verbracht, dank Pamela. Pamela ist Senior Executive Officer, eine mittlere Position im öffentlichen Dienst, die sie deutlich über allen anderen im Archiv stehen lässt. Sie ist in ihren Vierzigern, trägt gepflegte Businessanzüge, und seit ein oder zwei Wochen scheint sie sich für mich zu interessieren.
Heute kam Pamela nach der Mittagspause zu mir und trug mir auf, Bewerbungen zu sortieren. Das dauerte ziemlich lange, und schließlich war es fast vier Uhr. Als ich endlich damit fertig war, klopfte Pamela den Papierstapel auf ihrem Schreibtisch gerade, legte ihn neben ihre Tastatur, und statt mich zurück ins Archiv zu schicken, wandte sie sich in ihrem Drehstuhl zu mir um. »Du hast hier im Dezember angefangen?«
Pamela musterte mich abschätzend, was mich argwöhnisch machte. Ich nickte.
»Du meintest, du würdest darüber nachdenken, dich an der Universität zu bewerben«, sagte Pamela. »Hast du das gemacht?«
»Nein«, gab ich zu.
»Warum nicht?«
Ich antwortete nicht.
»Es hilft nicht, so etwas zu ignorieren. Du hast die Deadline für die UCAS verpasst, aber über die Liste mit den Nachrückern könntest du es noch schaffen.«
»Okay.«
»Sag nicht einfach ›Okay‹«, erwiderte Pamela. »Dieser Posten wird nicht immer unbesetzt bleiben. Wenn du einen Kurs über drei Jahre machst und dich dann neu bewirbst, könntest du auf derselben Position mit einer Festanstellung einsteigen.«
Ich überlegte, was ich darauf erwidern sollte, aber Pamela hatte sich wieder ihrem Computer zugewandt. »Das ist alles für heute. Am Freitag habe ich eine andere Aufgabe für dich.«
Ich fuhr mit der District Line nach Hause.
Während ich im schwankenden Zug stand, ging mir die Unterhaltung mit Pamela durch den Kopf. Es war das zweite Mal, dass sie eine Festanstellung ansprach, und das zweite Mal, dass ich einer Antwort auswich. Ein Teil von mir wollte ehrlich zu ihr sein und ihr sagen, dass ich mir keine Zukunft im Archiv wünschte. Doch dann würde Pamela mich entweder feuern oder fragen: »Was willst du denn stattdessen tun?«, und darauf hatte ich nur eine Antwort, die ich ihr nicht geben konnte.
Das Traurige daran war, dass der öffentliche Dienst im Vergleich zu meinen anderen Jobs gar nicht so übel war. Während ich bei meiner Tante gewohnt hatte, war ich in diesem Callcenter gewesen, wo ich acht Stunden am Tag Verlängerungen von Autoversicherungen hatte verkaufen müssen. Ihr wisst schon, wenn man bei einer Firma anruft, um den jeweiligen Service zu kündigen, und man dann zu jemandem durchgestellt wird, der einen davon überzeugen soll, doch zu bleiben? Ja, genau, das war mein Job. Ich sage »überzeugen«, aber man folgt eigentlich nur einem Drehbuch, und wenn man so etwas nie gemacht hat, kann man gar nicht verstehen, wie hirnzermürbend das ist. Man geht ans Telefon und sagt seine Sätze, dann legt man wieder auf, und das macht man immer und immer und immer wieder, jeden einzelnen Tag. Im Vergleich dazu war die Arbeit im Archiv leicht. Archivkisten schreien einen wenigstens nicht an, weil man sie in der Warteschleife hängen lässt.
Doch obwohl der öffentliche Dienst nicht so übel war, war er auch nicht gut. Die Arbeitszeiten waren geregelt, und die Bezahlung reichte, um davon zu leben, aber es war bedeutungslos und stupide, und ich zählte jeden Tag die Stunden, bis ich wieder nach Hause konnte.
Mein Blick heftete sich auf die Werbeplakate im Zug. Zwischen den Anzeigen für Vitaminpillen (»Sind Sie es müde, müde zu sein?«) und Kreditunternehmen (»Checken Sie noch heute Ihren Kreditrahmen!«) hing eine für eine Londoner Uni. »TU, WASDULIEBST«, stand in großen weißen Buchstaben über einem Foto von drei ethnisch diversen Studierenden, die mit glückseligen Mienen zum Horizont blickten. Unten rechts entdeckte ich einen Paragrafen mit Kleingedrucktem zum Thema »Finanzierung«.
Ich stieg an der Plaistow aus und ging in den Pub.
Mein Stammpub ist das Admiral Nelson, ein typischer »Alter-Mann-mit-Hund«-Laden. Das Gebäude ist quadratisch und liegt gleich an der Plaistow Road, mit Fenstern auf drei Seiten, die Lichtflecken in den großen Raum mit dem ausgebleichten Teppich und den verteilt stehenden Tischen und Stühlen lassen. Die Gäste sind eine Mischung aus altem East End, der neuen Generation, die hier aufgewachsen ist, einer Handvoll Osteuropäer und ja, einem alten Mann mit einem großen, ungepflegten Airedale Terrier, der zu seinen Füßen liegt und dessen Ohren in Richtung der Leute zucken, die an die Theke treten.
Meine Freunde und ich treffen uns im Nelson, seit wir alt genug sind, so zu tun, als wären wir alt genug, und mittlerweile gehen wir jeden Mittwoch und manchmal auch am Freitag oder Samstag hin, ab und an, um irgendwas zu spielen, aber normalerweise zum Quatschen. Unsere Gruppe hat sich mit den Jahren verändert, neue Leute sind dazugekommen, und andere hat es woandershin verschlagen, aber der Kern ist ziemlich unverändert. Da ist Colin, klug und praktisch veranlagt, in der Schule war er immer der Beste, dann Felix, groß, mit zotteligem Bart und einer zynischen Ader, Kiran, dick und großzügig und fröhlich, und Gabriel, mit ein paar Monaten Abstand der Jüngste, der immer irgendeine persönliche Krise durchzumachen scheint. Wir haben uns in der Mittelschule kennengelernt und sind zusammen aufgewachsen. Manchmal kommen Kirans oder Colins Freundinnen dazu, aber heute Abend waren wir unter uns.
»Ahhhhh«, machte Gabriel zum mindestens fünften Mal. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
»Mach Schluss«, sagte Colin.
»Ich kann nicht einfach Schluss machen.«
»Mach Schluss und sag ihr, sie ist eine Nutte«, schlug Felix vor.
»Das kann ich nicht machen!«
»Na, wenn du zu feige bist, selbst Schluss zu machen«, sagte Colin, »sollte es reichen, wenn du ihr sagst, dass sie eine Nutte ist.«
»Ach Leute«, sagte Gabriel. »Ernsthaft.«
Gabriel hat immer irgendein Problem; als wir noch kleiner waren, ging es entweder um die Schule, seine Eltern oder Mädchen, aber inzwischen sind es immer nur Mädchen. Alle bis auf eine seiner Beziehungen waren grauenhafte Desaster, und mittlerweile sind wir alle davon überzeugt, dass er einfach ein Talent dafür hat. Es läuft immer gleich ab – zu Beginn der Beziehung ist er aufgeregt, nach ein paar Wochen wirkt er gestresst, dann komme ich eines Tages ins Nelson und höre, wie er Kiran erzählt, dass das Mädchen ihn mit einem Messer angreifen oder sein Haus anzünden wollte oder so was.
»Ist das nicht die, die vor zwei Wochen mit dir Schluss gemacht hat?«, fragte ich jetzt.
»Sie stand Freitagabend vor meinem Haus«, erklärte Gabriel.
»Und?«
»Na, du weißt schon. Wenn ein Mädchen vor deinem Haus steht, dann …«
Ich wartete, dass Gabriel den Satz beendete.
»Du weißt schon«, sagte er.
»Ich weiß nicht.«
»Das heißt, sie will ihn flachlegen«, erklärte Felix.
»Nein, tut es nicht«, sagte ich.
»Irgendwie schon«, warf Kiran ein.
»Ach, kommt schon«, sagte ich. »Du meinst, jedes Mädchen, das du zufällig vor deinem Haus triffst …«
»Nach Einbruch der Dunkelheit an einem Freitagabend«, fügte Felix hinzu.
»Wieso ist das wichtig?«
»Das ist total wichtig«, sagte Kiran.
»Okay, okay«, meinte Felix. »Es gibt eine einfache Möglichkeit, das in diesem Fall zu klären, oder?« Er wandte sich an Gabriel. »Hast du sie flachgelegt oder nicht?«
Gabriel sah peinlich berührt drein. »Also …«
»Siehst du?«, sagte Felix selbstgefällig zu mir.
»Nur weil sie da auf der Straße steht …«, setzte ich genervt an.
»Ich denke, was Felix damit meint«, sagte Colin, »ist, dass es hier einen Kontext gibt. Sie ist kein Mädchen, das rein zufällig auf der Straße stand.«
»Und man muss was versuchen«, fügte Gabriel hinzu. »Sonst hält sie dich für einen Deppen.«
»Was?«, fragte Felix und grinste mich an. »Dachtest du etwa, sie war nur zum Reden da?«
Ich verdrehte die Augen.
Felix wollte mir die Haare zerzausen, aber ich wich aus. »Er ist ja so niedlich«, sagte er.
»Geh mir nicht auf den Sack.«
»Also musste ich sie reinlassen, oder?«, brachte Gabriel sich wieder ins Gespräch ein.
»Ich weiß, wieso du sie reingelassen hast«, sagte Colin.
»Was sollte ich denn tun?«
Die Diskussion ging hin und her, drehte sich zu fünfzig Prozent darum, Gabriel ernsthafte Ratschläge zu geben, und zu fünfzig Prozent, ihn aufzuziehen. Wir mögen Gabriel, aber sogar Kiran, der zu nett ist, hat längst begriffen, dass der Grund für Gabriels Probleme Gabriel ist. Trotzdem ist er unser Freund.
Nach einer Weile teilte sich die Gruppe auf, Felix, Kiran und Gabriel diskutierten weiter, während Colin und ich uns auf der Bank zurücklehnten. Der Pub füllte sich langsam mit dem Abendpublikum, obwohl er noch längst nicht überlaufen war. Ich trank immer noch mein zweites Pint – ich kann es mir leisten, in den Pub zu gehen, aber nur, wenn ich nicht zu viel trinke.
»Geht’s dir gut?«, fragte Colin. »Du bist ein bisschen still.«
»Ärger auf der Arbeit«, sagte ich mit einem Seufzen.
»Mit deinem Chef?«
»Mit der Chefin meines Chefs.«
»Ich dachte, sie mag dich.«
»Tut sie«, gab ich zu. »Das ist das Problem. Sie will, dass ich an die Uni und dann in Vollzeit zum öffentlichen Dienst gehe.«
»Ich meine«, sagte Colin, »das könntest du tun.«
»Ja«, sagte ich, dann schwieg ich wieder.
Von unserer Gruppe stand Colin mir am nächsten. Sein Vater stammte aus Hongkong – als die Chinesen 1997 übernahmen, erkannte er frühzeitig, wie der Hase laufen würde, und verließ die Stadt. Er landete in London, wo er eine Engländerin heiratete. Die beiden hatten einige Probleme, und Colins Mum zog für ein paar Jahre lang aus – aber schließlich vertrugen sie sich wieder. Dennoch tat sich Colin schwer damit, und eine Weile war er regelmäßig bei uns. Wir wurden ziemlich gute Freunde, und dabei ist es geblieben.
Inzwischen hatte Colin sein Leben im Griff, und ich war der mit den Problemen. Colin studierte im dritten Jahr Naturwissenschaften am Imperial College, wohnte im Wohnheim in Whitechapel. Felix hatte ein Auslandsjahr gemacht und sollte auch an der Uni sein, doch soweit ich das mitbekam, verbrachte er die meiste Zeit damit, sich mit chinesischen Mädchen auf Dating-Apps zu verabreden. Kiran hatte seine Elektrikerlehre halb hinter sich. Und Gabriel … na ja, ist eben Gabriel. Wir alle wurden erwachsen und fanden unseren Weg.
Bis auf mich. Seit einer Weile hatte ich das Gefühl, als triebe ich herum, würde abgehängt werden. Colin wusste das, und das war die unausgesprochene Bedeutung hinter seinen Worten. Doch er bedrängte mich nicht, und ich schwieg lieber. Wir saßen weitere zehn Minuten herum, dann trank ich aus und ging nach Hause.
Ich öffnete die Haustür und hörte das Plappern und Getöse des Fernsehers. Der Lärm kam aus dem Schlafzimmer im Erdgeschoss, das früher mal das Wohnzimmer war – Ignas und Matis sahen wohl Fußball. Ich trat in die winzige Gemeinschaftsküche, nahm mir etwas zu essen und einen Teller und ging dann rauf.
Ich wohne in einem Reihenendhaus, etwa auf zwei Drittel Höhe der Foxden Road, neben einer zu Wohneinheiten umgebauten alten Schule. Das Haus wird von seinem jamaikanischen Eigentümer pro Zimmer vermietet mit der Absicht, die maximale Anzahl an Menschen hinein- und das Maximum an Geld herauszuquetschen. Die anderen Bewohner sind eine Gruppe Litauer, die lange Schichten bei der örtlichen Autowerkstatt und dem Lebensmittelladen arbeiten. Zuerst fiel es mir schwer, das Eis zu brechen, aber ein Nagerbefall leistete mir unerwartete Hilfe. Denn als Hobbes verstand, welche außergewöhnlich guten Jagdgründe das Haus bot, ging er auf Tour und legte zwei Wochen lang jeden Morgen und Abend Mäuse und Ratten vor die Tür. Die Litauer waren begeistert von Hobbes, und seither sind wir befreundet.
Gerade wartete Hobbes oben an der Treppe auf mich; er miaute, bis ich meine Schlafzimmertür aufschloss, dann trottete er hinein und ging zu seinem Napf. Ich verschloss die Tür hinter uns, gab Hobbes etwas Futter und setzte mich zum Essen aufs Bett. Mein Zimmer ist nicht groß, aber ich habe auch nicht viel Zeug. Ein Bett, ein Schrank, ein Nachttisch, ein Stuhl, auf dem sich normalerweise Kleider stapeln. Alles ist alt und in schlechtem Zustand – angestoßene Möbel, abblätternde Farbe, schiefe Fußleisten. Eine der Fußleisten ist allerdings aus gutem Grund schief.
Nachdem ich fertig gegessen hatte, stellte ich den Teller beiseite, hockte mich in die Ecke, zog die Fußleiste mit einer geübten Bewegung vor und legte so ein staubiges Geheimfach frei, in dem ein verblasster Briefumschlag und eine kleine Holzkiste lagen. Hobbes sah mit leuchtenden Augen zu, wie ich die Kiste öffnete und zwei winzige Kugeln zum Vorschein brachte, jede nicht größer als ein Streichholzkopf. Sie hätten ausgesehen wie Stahlkugeln aus einem Kugellager, wäre die Farbe nicht gewesen – beide waren hellblau, wie sehr blasse Türkise. Eine rollte frei in der Kiste herum, die zweite hatte ich in einen Plastikring geklebt. Es wirkte etwas armselig, aber es funktionierte.
Diese beiden kleinen Kugeln nannte man Sigls. Die meisten würden sie wohl für Spielzeug halten. Doch tatsächlich waren sie vermutlich mehr wert als alles andere in diesem Zimmer zusammen.
Ich schob den Ring auf meinen Finger, setzte mich im Schneidersitz auf den Boden und schloss mit einem leisen Seufzer die Augen. Das war der Teil des Tages, auf den ich mich freute. Morgen würde ich wieder Archivkisten im Keller des MoD herumtragen, aber jetzt konnte ich ein paar kostbare Stunden mit dem verbringen, was mir wirklich wichtig war.
Drucraft.
Die erste Disziplin der Drucraft ist das Spüren. Spüren ist die Grundlage – diese Fähigkeit muss man erlernen, bevor man weitermachen kann, weshalb mich das Training am Anfang wirklich frustrierte, weil ich damals noch richtig schlecht darin war. Wenn ich früher übte, konzentrierte ich mich, fast als würde ich auf einen Ton lauschen, der ein wenig zu schrill war, oder als versuchte ich, etwas zu erkennen, was eigentlich zu weit weg war. Doch je fester ich mich anstrengte, desto mehr entglitt es mir.
Es dauerte lange, bis ich herausfand, dass der Trick nicht darin bestand, sich mehr anzustrengen, sondern die Ablenkungen auszuschalten. Man muss den Geist leeren von all den Dingen, die ihn belagern. Die Melodie, die einem durch den Kopf geht, die Pläne, die man für den nächsten Tag macht. Gespräche, die an einem nagen, wie das mit Pamela, das ich immer noch nicht ganz abgehakt hatte. Ich schaltete sie ab, eine nach der anderen, schrumpfte sie ein, bis sie nicht mehr da waren und einen leeren Kreis in meinem Geist hinterließen, in dem alles still und ruhig war. Früher brauchte ich dafür ein paar Minuten, heute kann ich es beinahe sofort.
In diesen leeren Kreis trat eine Bewusstheit. Es war nicht wirklich ein Ton oder eine Art Druck, mehr eine Präsenz, etwas, dessen man sich halb bewusst war, das man aber nicht ganz erfasste. Die stärkste Präsenz war die der Erde unter mir, weitläufig und diffus und sich bis zum Horizont ausdehnend, ansteigend und abfallend mit dem Verlauf des Geländes. Sie war jedoch recht fern – sehr viel einfacher zu spüren waren die Strömungen innerhalb meines Zimmers, die den Linien der Wände und der Möbel folgten, durch die Luft wirbelten. Und am leichtesten von allen war der Fluss zu spüren, der durch meinen eigenen Körper strömte.
Diese Präsenz, die ich spürte, nannte sich Essentia. Mein Dad hatte mir beigebracht, dass sie alles ausmacht, eine Art universelle Energie. Man kann sie nicht erschaffen, und man kann sie nicht zerstören, aber mit der richtigen Kunstfertigkeit – und den entsprechenden Werkzeugen – kann man sie nutzen.
Als ich lernte, Essentia zu erspüren, kam sie mir vor wie eine große, einheitliche Masse. Heute fühlt sich die Essentia in der Luft anders an als die in den Wänden oder im Boden und völlig anders als die Essentia in Hobbes. Die Essentia, die mich durchfloss, war die klarste von allen – es war meine persönliche Essentia, und sie war angenehm und vertraut, wie ein Paar eingelaufener Schuhe.
Was persönliche Essentia jedoch wirklich auszeichnet, ist, dass man sie kontrollieren kann.
Ich sammelte meine Gedanken und schickte einen schmalen Strom in meinen rechten Arm und in die Sigl auf meinem Finger.
Licht erblühte in dem kleinen Zimmer. Die winzige Sigl leuchtete auf wie ein Stern, warf einen blassblauen Schein auf Wände und Decke. Hobbes sah träge vom Bett aus zu, und das Licht spiegelte sich in seinen halb geschlossenen Augen.
Channeln ist die zweite Disziplin der Drucraft. Die persönliche Essentia ist auf den eigenen Körper und Geist eingestimmt, und mit Übung kann man sie auf die gleiche Art befehligen wie seine Muskeln. Wenn sie in eine Sigl rieselt, ist es seltsam und etwas beunruhigend, so als spürte man, wie einem das Blut aus den Adern fließt, und als ich anfing, hatte ich immer die nagende Angst, dass ich zu viel benutzte und ausbluten könnte. Doch während meine persönliche Essentia aus mir hinausfloss, strömte Essentia aus der Luft in meiner Umgebung in mich herein. Und während sie in meinen Körper eindrang, stimmte sie sich auf mich ein, nahm die Frequenz meiner persönlichen Essentia auf, bis sie nicht mehr von der zu unterscheiden war, die ich verloren hatte. Ein Zustrom und ein Abfluss, in perfektem Gleichgewicht.
Ich skalierte den Essentia-Fluss nach oben und unten, dimmte das Leuchten, bis es fast zu schwach war, um es zu sehen, bevor ich die Helligkeit hochdrehte. Sie auf das Maximum zu stellen, war leicht – die Sigl hatte eine maximale Kapazität, mit der sie zurechtkam, und sobald ich die überschritt, strömte alles, was darüber hinausging, einfach davon, als würde man Wasser in ein bereits volles Waschbecken gießen. Aber es exakt zu füllen, ohne die Grenze zu überschreiten, war ziemlich schwer, und ich übte eine Weile, wollte sehen, wie schnell ich den Fluss von »voll« auf »nichts« und wieder auf »voll« drehen konnte, ohne etwas zu verschwenden.
Ich machte noch ein paar weitere Übungen, um abzuschalten, channelte meine persönliche Essentia in verschiedene Gegenstände und zog sie zurück, bevor sie sich von mir entkoppelte. Dann ließ ich sie endlich in Hobbes fließen, schaltete eine Art Kreislauf, indem meine Essentia in ihn strömte und seine in mich. Hobbes duldete diese Beleidigung mit einem leisen Niesen – er kann es eindeutig spüren und scheint es zu tolerieren. Dann war es an der Zeit für das Formen.
Formen ist die dritte, letzte und schwerste Disziplin. Ich praktiziere Drucraft, seit ich zehn bin, aber erst mit beinahe neunzehn gelang es mir, eine Sigl zu formen. Das ist eineinhalb Jahre her, und die Sigl, die ich damals schuf, war die, die jetzt in der Kiste auf meinem Bett lag. Darauf folgten zwölf Monate des Wartens. Zwölf langsame, langmütige, frustrierende Monate, bis zum letzten September, als ich die Sigl erschuf, die nun an meinem Finger war.
Ich griff nach der Essentia aus der Umgebung, versuchte, sie zu sammeln. Es war sehr viel schwerer, als die Sigl zu aktivieren – die Ströme in der Luft waren nicht auf mich eingestimmt und reagierten deshalb nicht auf meine Gedanken. Ich musste meine eigene Essentia zu einer Art Wirbel formen und Strömungen erschaffen, die die freie Essentia anzogen, bis diese so konzentriert war, dass ich mithilfe meiner eigenen Essentia Fäden damit malen konnte, so als wäre die freie Essentia Tinte und meine eigene Essentia ein Kalligrafiepinsel. Trotz meiner ganzen Erfahrung war es, als wollte ich Rauch einfangen, und es erforderte mehrere Minuten geduldiger Arbeit, bevor ich sie zu einem Konstrukt formen konnte, das über meiner Handfläche schwebte wie ein Knoten aus unsichtbaren Linien.
Ein Essentia-Konstrukt ist der erste Schritt bei der Erschaffung einer Sigl, wie eine Bleistiftskizze, bevor man mit einem Gemälde beginnt. Ich musste mittlerweile Tausende Konstrukte geschaffen haben, aber ich glühte immer noch förmlich vor Zufriedenheit, wenn ich eines gut hinbekam – seit mein Vater mich Schritt für Schritt durch den Prozess begleitet hatte, habe ich viel gelernt. Wollte ich dieses Konstrukt in eine Sigl verwandeln, wäre der nächste Schritt, es zu schrumpfen und dabei mehr und mehr Essentia hineinzuziehen, während es immer noch dichter würde, um den Kern der Sigl zu formen. Würde ich das jetzt versuchen, würde es natürlich nicht klappen. Formt man ernsthaft eine Sigl, erschafft man einen Körper aus purer Energie, und das erfordert eine gewaltige Menge an Essentia. Der einzige Ort, an dem man die findet, ist eine Quelle.
Dieses spezielle Konstrukt war ein Projekt, an dem ich seit Januar arbeitete. Die Sigl sollte, statt Licht zu machen, es umlenken und ein Feld projizieren, um das sich das Licht krümmte. Das Ergebnis sollte eine Art Unsichtbarkeitsfeld ergeben – solange die Sigl aktiv wäre, könnte niemand von außen in die Kugelform hineinsehen.
Zumindest war das der Plan. Ehrlich gesagt hatte ich absolut keine Ahnung, ob es funktionieren würde. Mittlerweile wusste ich ganz gut, wie man eine Licht-Sigl erschuf, aber das hier war etwas ganz anderes und sehr viel komplizierter. Da ich das Konstrukt nicht wirklich sehen konnte, musste ich mich herantasten, was in der Praxis bedeutete, das Konstrukt loszulassen und immer wieder von Neuem anzusetzen.
Ich hatte das Gefühl, dass ich es falsch anging. Bei meinem Vater hatte es sich angehört, als könnte ein professioneller Former diese Sigl ziemlich leicht herstellen, also musste es einen Trick geben, der mir entging. Aber ohne jemanden, der es mir beibrachte, musste ich alles selbst herausfinden, was eine Menge Rätselraten bedeutete. Soweit ich wusste, war es auch möglich, dass diese Sigl gar nichts konnte, wenn ich einfach weitermachte und sie formte.
Das war bei meinem ersten Versuch passiert, vor drei Jahren. Ich hatte geübt und geübt, aber als es an der Zeit gewesen war, die Sigl zu formen, hatte ich trotzdem versagt und die Essentia damit verschwendet. Ich war den Tränen nahe gewesen, aber mein Dad hatte es mit einem Lachen abgetan. Er hatte mir versichert, dass jeder es beim ersten Mal vermasselte und dass ich es besser gemacht hätte als die meisten. Das hatte mich ermuntert, und ich hatte mich in mein Training gestürzt, entschlossen, es beim nächsten Mal richtig zu machen.
Und als es mir endlich gelang, da war er nicht da …
Ich schreckte aus meinen Gedanken auf. In meinem Zimmer war es dunkel; die Sonne war untergegangen während meiner Übungen. Draußen verblassten die letzten Lichtstreifen am Himmel. Hobbes stand auf, streckte sich und tapste zur Tür, sah mich erwartungsvoll an.
Ich ließ das Konstrukt los, das sich daraufhin entwirrte, dann zog ich meine Laufklamotten an und ging runter, trat hinaus und schloss die Tür hinter mir, während Hobbes über die Straße davontrottete. Ich sah mich nach dem Auto vom Morgen um, aber es war weg. Vielleicht war wirklich nichts dran gewesen.
Biegt man an meiner Straße um die Ecke und geht nach links, kommt man in eine kleine Gasse. Zur Linken quellen Geißblatt und Efeu über die Holzlatten der Gartenzäune, während sich rechts die Hintereingänge der Läden befinden, deren Schaufenster auf die Plaistow Road hinausgehen. Kies knirschte unter meinen Füßen, als ich um Mülltonnen herumlief; rot und grau gedeckte Dächer erhoben sich um mich herum, TV-Antennen und Satellitenschüsseln stachen in den tiefblauen Himmel. Rechts über mir ragte ein Wohnblock in die Höhe, auf dessen Metallbalkonen Fahrräder untergebracht waren. Licht drang aus den Fenstern, aber es war ein kalter Märzabend, und niemand war draußen und sah mich vorbeilaufen.
Die Gasse endete an ein paar Schuppen. Ich stieg auf eine Recyclingmülltonne und zog mich hinauf, rostiges Eisen knarzte unter meinen Füßen, als ich über die Flachdächer lief. Die Wolken und der Regen waren mittlerweile verschwunden, und der Himmel war klar bis zum Horizont, verblasste von Azurblau zu einem Graublau, das sich mit den Lichtern der Stadt mischte. Ich erreichte das Ende der Schuppen und ließ mich auf einen kleinen freien Platz hinabfallen, der von Gartenzäunen und einer Ziegelmauer auf der gegenüberliegenden Seite eingeschlossen war. Der Boden war einmal aus Beton gewesen, aber Löwenzahn und Weidelgras hatten sich hindurchgegraben und den Beton mit den Wurzeln ihres wilden Wachstums durchbrochen. Ein Kirschbaum stand in einer Ecke, noch klein, aber mit jungen Blättern, die zum Himmel aufstrebten.
Die meisten Leute, die mein Zimmer in der Foxden Road sahen, dachten wohl, dass ich hier wohnte, weil es billig wäre. Damit hatten sie teilweise recht, aber eben nur teilweise. Hauptsächlich lebte ich wegen dieser Quelle hier.
Quellen sind Sammelpunkte, Orte, an denen Essentia zusammenläuft, und die Essentia hier war so konzentriert, dass ich sie ganz ohne Anstrengung spürte. Es fühlte sich an wie ein Reservoir aus Energie, Leben und Potenzial. Es war verlockend, diese Reserven zu nutzen, sie zu einer neuen Sigl zu formen, aber ich wusste es besser. Vor drei Jahren, nachdem mein erster Versuch, eine Sigl zu erschaffen, fehlgeschlagen war, hatte mein Dad mich ermahnt, nur volle Quellen anzuzapfen; diese hier war schwach, und es würde ein ganzes Jahr dauern, bis sie wieder aufgeladen wäre. Ich war ungeduldig gewesen und hatte versucht, sie früher zu nutzen. Das Formen war misslungen, die Sigl hatte sich nicht ausgebildet, und ich hatte die Ladung von fünf Monaten verschwendet. Es war eine schmerzhafte Lektion gewesen, aber sie hatte Wirkung gezeigt.
Gerade war diese Quelle zu einem Viertel voll, und ich wusste aus Erfahrung, dass sie sich am schnellsten im Frühling und Sommer auflud. Etwa im September würde ich sie nutzen können, um eine Sigl zu formen. Und für die hatte ich eine Menge Ideen. Da war dieses Unsichtbarkeitsfeld, dessen Erschaffung ich übte. Oder ein Verdunklungseffekt. Ich erkannte, dass man ein Dutzend unterschiedliche Richtungen einschlagen konnte, von der Basis der Lichterstellung ausgehend. Ich hatte immer noch kein gutes Gespür dafür, was möglich war und was nicht, aber irgendwie würde ich es herausfinden. Mit ausreichend Zeit und Übung sollte ich im Herbst eine meiner Ideen verwirklichen können, und dann …
… und dann was?
Abrupt kam ich wieder auf die Erde zurück. Ja, ich könnte eine weitere Sigl schaffen. Ich könnte vielleicht sogar eine erschaffen, die funktionierte. Aber was würde ich damit tun? Ich hatte eine Menge Ideen für Sigls, aber keine davon würde mir Essen oder Miete einbringen. Oder meinen Dad finden.
Ich dachte zurück an die Unterhaltungen, die ich mit Pamela und Colin geführt hatte. Meine Freunde gingen alle an die Uni oder machten eine Lehre und bekamen Jobs, während ich … was tat? Fast mein ganzes Leben lang hatte ich Drucraft geübt, und was hatte ich vorzuweisen?
Seit einer Weile schon hatte ich das Gefühl, zwischen zwei Welten hin- und hergerissen zu sein. In der einen Welt waren meine Freunde und meine Arbeit, in der anderen meine Drucraft und meine Sigls und diese Quelle. Ich hatte versucht, in beiden Welten zu bleiben, aber es wurde immer schwerer. Vielleicht sollte ich tun, was meine Lehrer an der Schule gesagt hatten, und den Weg einschlagen, zu dem auch Pamela und Colin mir rieten. Einen Abschluss machen, anfangen, an einer Karriere zu basteln. Es würde schwer werden, und ich müsste mich dafür verschulden, aber ich könnte es schaffen.
Doch wenn ich diesen Weg verfolgte, würde ich einen Preis zahlen müssen. Ich war bereits völlig ausgelastet mit meinem Job, meiner Drucraft, den ganzen Problemen, die mit dem Alleinleben einhergingen, und damit, noch etwas Zeit für meine Freunde zu finden, um nicht durchzudrehen. Käme dazu noch ein Uniabschluss, müsste etwas auf der Strecke bleiben, und ich hatte das Gefühl, ich wusste, was das sein würde.
Es schien die »richtige« Entscheidung – eine, die die Welt von mir erwartete –, meine Drucraft aufzugeben. Als man uns damals Karrieretipps in der Schule gegeben hatte, war mir oft zu Ohren gekommen, man solle seiner Leidenschaft folgen, aber je älter ich wurde, desto mehr schien es, dass darin noch eine weitere Botschaft mitklang, härter und kälter. Als Kind darf man etwas zum Spaß tun, aber je älter man wird, desto mehr wird man in Richtung Erfolg gedrängt – der richtige Schulabschluss, die richtigen Kurse, die richtigen Aktivitäten im Lebenslauf. Alles, um Geld zu machen und zu signalisieren, dass man ein guter Angestellter ist.
Drucraft brachte mir kein Geld ein, und es ließ mich eindeutig nicht wie einen besseren Angestellten wirken. Wäre mir meine Karriere wichtig, könnte ich die Drucraft genauso gut aufgeben.
Aber das wollte ich nicht. Seit ich bei meinem Dad zum ersten Mal genug gequengelt und er mir die Drucraft beigebracht hatte, war sie das große Geheimnis, das ich mit ihm teilte, diese eine Sache, die wir immer zusammen gemacht hatten. Als er mir gesagt hatte, dass ich Talent hätte, hatte ich mich voll hineingestürzt, hatte jeden Tag nach der Schule ohne Pause geübt. Ich denke immer noch an sein Lächeln, wenn ich etwas richtig gemacht und wie sein Gesicht dann geleuchtet hatte. Er war so stolz auf mich gewesen.
In seinem Brief hatte mein Dad mir drei Dinge gesagt, und eins davon war, dass ich weiter meine Drucraft üben solle. Ich hatte getan, worum er mich gebeten hatte, aber seither waren fast drei Jahre vergangen. Ich hatte wirklich lange geübt und gewartet, und es fühlte sich an, als würde ich zurückgelassen werden.
Ich seufzte, dann zog ich mich am Zaun hoch und stieg wieder darüber.
Ich ging laufen, Richtung Norden durch Forest Gate. Als ich noch boxte, lief ich jeden Tag. Ich bin nicht mehr gut im Training – neben der Arbeit und der Drucraft kann ich mir das nicht mehr leisten –, aber ich hasse es, mich unfit zu fühlen, also versuche ich, wann immer es möglich war, eine Joggingrunde einzuschieben.
Beim Laufen dachte ich wieder daran, wie unfair alles war. Als kleines Kind träumte ich davon, magische Kräfte zu besitzen. Als ich herausfand, dass Drucraft real war und dass ich sie nutzen konnte, war ich so begeistert. Aber, Überraschung! Man verfügt über Magie, kann damit aber nur eine Art Taschenlampe herstellen.
Ich wusste, dass mehr daran sein musste. Soweit ich es gehört hatte, konnten die mächtigeren Sigls alle möglichen wundervollen Dinge bewirken – jemanden unsichtbar machen, einem Superkräfte verleihen, den Körper so unnachgiebig wie Stahl machen. Aber um diese Sigls zu erschaffen, brauchte man mächtige Quellen sowie das Wissen, wie man sie nutzte. Dinge, die ich nicht hatte. Was hieß, dass mein großes magisches Talent etwas erschaffen konnte, was ein normales Handy als Standardfeature besitzt.
Ich gelangte auf die rückwärtigen Straßen und umrundete die Nordseite des West Ham Park. Kastanienbäume ragten auf der anderen Seite des Zauns auf, die ersten blassgrünen Triebe sprossen an den nackten Zweigen. Ein Stadtfuchs, der gerade die Straße überquerte, sah mich an, zuckte mit dem Schwanz und verschwand zwischen zwei Autos.
London bei Nacht hatte ich schon immer gemocht. Der Lärm und der rege Betrieb des Tages verblassen, und in der Stille kann man die Präsenz der Stadt spüren. Sie hat ihre eigene Natur, so wie auch ihre eigene Essentia – alt, vielschichtig und komplex, menschengemachte Gebäude auf jahrtausendealter Erde. Generation um Generation von Menschen, Seite an Seite mit den Pflanzen und Tieren des alten Britanniens. Es ist ordentlich und chaotisch und uralt und weitläufig, und es ist mein Zuhause.
Ich kam an Tanner Point vorbei und bog in den Lettsom Walk ab, ein kleiner Fußweg, der entlang der Bahntrasse zwischen Plaistow und Upton Park verläuft. Der Weg führt schnurgerade etwa eine Viertelmeile weit, bevor er sich krümmt und nicht mehr einsehbar ist. Vor mir ragten die weißen Kräne und halb fertigen Türme der Plaistow-Baustelle in den Nachthimmel, rote Lichtpunkte in der Dunkelheit. Von der anderen Seite der Mauer konnte ich das Grollen eines herannahenden Zugs hören.
Leise Schritte ertönten hinter mir.
Ich drehte mich um, wachsam. Plaistow ist nicht gefährlich, aber es ist auch nicht direkt sicher, und ich hatte mich schon zuvor Straßenräubern gegenübergesehen …
Aber da waren keine Straßenräuber. Oder sonst jemand. Der Weg lag da, hell erleuchtet von Straßenlampen. Leer.
Ich sah mich um, runzelte die Stirn.
Die U-Bahn dröhnte auf der anderen Seite der Mauer, das Brüllen hallte um die Häuser. Bis der Zug vorbei war und in der Ferne verschwand, schepper und klapper, schepper und klapper, waren jegliche Schritte längst verklungen. Ich lief wieder los, blickte zu den reglosen Gebäuden auf.
Am Ende des Lettsom Walk gibt es eine Fußgängerbrücke, ein Käfig aus Metall und Ziegeln, der die Wege zu beiden Seiten der Bahnschienen verbindet. Ich stieg die Stufen hinauf, fragte mich, ob ich heute einfach nur nervös war. Eine halbe Meile gen Osten glommen die roten Rücklichter des Zugs in der Dunkelheit, der gerade in Upton Park einfuhr. Die Drähte über den Gleisen sirrten und klirrten, vibrierten noch von der Durchfahrt des Zugs. Ich erreichte die Brücke und wollte hinübergehen.
Da stand ein Mädchen am anderen Ende.
Ich hielt an, spürte das gleiche Echo der Fremdartigkeit, das ich am Morgen gefühlt hatte. Der gerade Teil der Brücke ist etwa zwölf Schritte lang vom einen zum anderen Ende, und das Mädchen stand auf dem gegenüberliegenden Absatz, eine Hand auf dem Geländer. Sie ging nicht über die Brücke, sie stand einfach nur da.
Die meisten Lampen auf der Fußgängerbrücke waren aus, und das Gesicht des Mädchens lag im Schatten. Ich konnte ihre Miene nicht erkennen, aber sie wirkte jung. Sie reagierte nicht auf mein Starren, und etwas an ihrer Reglosigkeit machte mich unruhig. Was war hier los?
Ich rührte mich nicht. Und sie auch nicht.
Ich schüttelte mich und machte mich wieder auf den Weg, und als ich mich bewegte, rührte sich das Mädchen ebenfalls. Als wir uns näherten, sah ich, dass sie wirklich jung war, vielleicht sechzehn, klein und dünn. Sie hatte helle Haut und fein geschnittene Gesichtszüge; auf ihrem Kopf saß eine pelzige Mütze, und sie trug einen elegant wirkenden langen Mantel mit Gürtel. Was mir aber am meisten auffiel, war, dass sie mich beobachtete, mit neugierigem, erwartungsvollem Blick.
Ich lief vorbei, ohne langsamer zu werden. Als wir einander passierten, hörte ich sie ironisch murmeln: »Du musst stärker werden.«
Abrupt blieb ich stehen. Ich drehte mich um und sah ihr hinterher. Sie lief weiter, blickte nicht zurück, erreichte die andere Seite der Brücke und verschwand die Treppe hinab, die ich gerade erst heraufgekommen war. Ihre Schritte hallten, dann verklang das Echo.
Ich starrte weiter hinter ihr her. Was meinte sie mit …?
Ach, scheiß drauf. Ich rannte ihr hinterher.
Ich erreichte das Ende der Brücke und hielt an. Das Mädchen war nicht auf der Treppe. Ich joggte noch etwas weiter hinab und beugte mich über das Geländer. Von hier oben, noch halb auf der Brücke, hatte ich freie Sicht auf den Lettsom Walk, über dreißig Schritt in beide Richtungen.
Er war leer.
Ich starrte hinab auf den nackten Beton. Wo war sie hin?
Es standen Häuser und Autos entlang der anderen Seite des Wegs, auch einige Hecken, alle hoch genug, um ein Mädchen zu verbergen. Aber ich hatte sie kaum zehn Sekunden lang aus den Augen verloren. So schnell hätte sie sich nicht bewegen können.
Oder?
Ich sah mich weiter um, aber nichts rührte sich. Endlich ging ich zurück, überquerte die Brücke ein weiteres Mal und stieg die Treppe auf der anderen Seite hinunter. Der Weg dort führte zur Plaistow Road und nach Hause. Den Rest des Wegs sah ich immer wieder über die Schulter, aber da war niemand.
2
Am nächsten Morgen war das Auto nicht da.
Ich fütterte Hobbes, ließ ihn raus und frühstückte, blickte dabei aus dem Fenster. Keine schwarzen Minivans. Und auch keine mysteriösen sechzehnjährigen Mädchen.
Die Arbeit war wie immer, nur dass ich im Flur ein paarmal Pamela über den Weg lief und dabei den Eindruck hatte, dass sie mich beobachtete. Sie sagte oder tat nichts, aber ich fühlte mich dennoch unbehaglich, und diesmal schien es nichts mit meinen Aufgaben oder der Uni zu tun zu haben, sondern mit etwas ganz anderem: meinem Aussehen.
Die meisten würden wohl sagen, mein Aussehen sei das Auffallendste an mir. Ich habe welliges rabenschwarzes Haar, große braune Augen, lange Wimpern und zarte, leicht weibliche Züge; dazu kommt meine schmale Statur, sodass ich, als ich noch jünger war, regelmäßig gefragt wurde, ob ich ein Junge oder Mädchen sei. Als ich größer wurde, legte ich an Muskeln zu, aber nicht viel, und sogar jetzt mit zwanzig nimmt man mich eher als hübschen Jungen denn als jungen Mann wahr.
Mein Aussehen hat mir in der Schule einiges an Aufmerksamkeit eingebracht. Manchmal von der netten Sorte, wenn Mädchen Interesse an mir hatten oder fragten, ob ich mal Model werden wolle. Manchmal lief es auch weniger nett: Die »Bist du schwul?«-Frage musste ich oft beantworten; sie führte für gewöhnlich zu noch weniger netten Fragen, was dann eskalierte, bis ich etwas dagegen unternahm. Anscheinend hatte ich das von meinem Dad: Als ich ihn dazu fragte, sagte er, dass er in jungen Jahren genauso ausgesehen habe wie ich. (Er erzählte mir auch, dass ich kein Model werden könnte, denn männliche Models müssten mindestens eins achtzig groß sein, während ich vermutlich etwas über eins siebzig bleiben würde, und da würde mir sowieso nichts entgehen, weil Modeln ein schrecklicher Job wäre.)
Es hat positive und negative Seiten. Die Leute sind meist nett zu mir, selbst wenn sie mich nicht besonders gut kennen und ich nichts getan habe, um das zu verdienen. Auf der anderen Seite habe ich ein paar unangenehme Erfahrungen gemacht, wo ich etwas zugestimmt hatte, nur um dann viel später festzustellen, dass ich etwas ganz anderem zugestimmt hatte als dem, was die andere Person gedacht hatte, worauf wir uns geeinigt hätten. Im letzten September, nachdem ich bei meiner Tante ausgezogen und wieder nach Plaistow gegangen war, hatte ich einen Job in einer Bar in Hoxton ergattert. Ich hatte mir nicht allzu genau angesehen, welche Art Bar das war, und rückblickend hätte es mir eine Warnung sein sollen, dass der Typ keinen Altersnachweis verlangt hatte. Aber ich musste die Miete bezahlen und konnte es mir nicht leisten, wählerisch zu sein. Erst nachdem ich dort angefangen hatte, begriff ich, wofür ich eigentlich angestellt worden war – meine Schichten bestanden größtenteils darin, von Männern (und gelegentlich einer Frau) angebaggert zu werden, die doppelt so alt waren wie ich. Die meisten nahmen ein Nein hin, aber ein paar fiese Zwischenfälle lehrten mich, dass etwas an meinem Aussehen die gierigen Typen anzulocken schien. Ich stieg aus, sobald ich konnte.
Ich glaubte nicht wirklich, dass Pamela so war. Und nichts, was sie getan hatte, hatte je eine Grenze überschritten. Trotzdem hielt ich Abstand.
Akten zu holen und herumzutragen, ist eine ziemlich geistlose Tätigkeit, aber eins spricht dafür: Man hat viel Zeit zum Nachdenken.
Den ganzen Donnerstag über, während ich Kisten durch den Keller schleppte, dachte ich an das Mädchen von der Brücke. Ihre Worte hatten bei mir einen Nerv getroffen – ich hatte schon seit einer Weile das Gefühl, dass ich nicht genug tat. Mein Dad hatte mir gesagt, ich solle Drucraft üben, doch während ich darin besser wurde, war ich nicht wirklich stärker geworden.
Als mein Vater verschwunden war, hatte ich nicht nur mein einziges verbliebenes Elternteil verloren; ich verlor auch die einzige Informationsquelle über die Drucraft, der ich vertrauen konnte. Ohne ihn musste ich auf das Internet zurückgreifen, und verlässliche Informationen über Drucraft online zu finden, ist richtig, richtig schwer. Wenn man den Begriff »Drucraft« in die Suchanfrage eintippt, bringt einen das auf Seiten mit Artikeln wie: »Wie man mit Freunden und Familienmitgliedern umgeht, die Verschwörungstheorien verbreiten« und »Unsere Fakten-Checker bringen dir bei, wie man Falschinformationen erkennt«. Jeder Post zum Thema Drucraft in sozialen Netzwerken wie Instagram, YouTube oder Reddit wird gelöscht, und wenn man die Autoren recherchiert, stellt man fest, dass sie wegen »Verstößen gegen unsere Nutzungsbedingungen« gesperrt wurden. Die meisten Seiten bringen gar nichts über das Thema, und wenn man danach fragt, erntet man Ausflüchte oder Schweigen. Es bedeutet viel Arbeit, Leute zu finden, die bereit sind zu reden, und selbst dann gibt es keine Garantie, dass es wahr ist, was sie behaupten. Hier sind ein paar Dinge, die ich in den letzten paar Jahren über Drucraft »gelernt« habe:
Es gibt viele Quellen da draußen, verteilt über das ganze Land. (Urteil: wahr)Unterschiedliche Quellentypen speisen sich aus unterschiedlichen Zweigen der Essentia, und in unterschiedlichen Ländern findet man Quellen spezieller Zweige besser oder schlechter. (Urteil: ungesichert, klingt aber plausibel)Neue Quellen werden mithilfe eines »Findesteins« aufgespürt. (Urteil: falsch. Ich habe meine Quelle ohne gefunden.)Um eine Sigl zu erschaffen, braucht man etwas namens »Begrenzer«, der von Menschenblut versorgt wird. (Urteil: definitiv falsch. Ich habe zwei Sigls allein hergestellt, ohne Blut.)»Du musst stärker werden« – das sagte sich so leicht, dabei ist es ziemlich schwer, wenn man keine Ahnung hat, wie man stärker werden kann. Sicher war ich mir nur, dass es helfen würde, stärkere Sigls zu bekommen. Aber wie?
Die offensichtliche Möglichkeit war, mehr Quellen zu suchen. Im letzten Herbst hatte ich eine Weile damit zugebracht, genau das zu tun, und ich hatte drei gefunden, aber keine hatte zu einer Sigl geführt. Die ersten beiden Quellen, Richtung Upton Park, waren beide schwächer als meine an der Foxden Road, und als ich versuchte, sie zu benutzen, klappte es nicht. Es war dennoch nicht umsonst – die beiden misslungenen Sigls lehrten mich einige nützliche Lektionen. Aber es schien, dass Sigls ein gewisses Mindestmaß an Essentia erforderten, und wenn eine Quelle diese Grenze nicht überstieg, bekam man keine Sigl zusammen.
Die dritte Quelle lag Essentia-mäßig über dieser Grenze, aber sie war bereits besetzt. Sie befand sich in einer alten Kirche in West Ham, und als ich sie im Oktober aufgestöbert hatte, war sie gerade von jemandem benutzt worden, denn sie war größtenteils ihrer Essentia beraubt. Vielleicht hatte sie sich seither wieder gefüllt, aber ich hütete mich davor, ihr zu nahe zu kommen. Mein Dad hatte mich davor gewarnt, dass Drucrafter territorial veranlagt seien und man eine Menge Ärger bekommen könnte, wenn man sich unbefugt einer Quelle näherte, die einem nicht gehörte.
Doch es gab offensichtlich andere Quellen da draußen – viele, wenn ich vier hatte finden können, ohne auch nur mein Viertel zu verlassen –, also sollte ich in der Lage sein, welche aufzuspüren, wenn ich weitersuchte. Das Problem war die Zeit. Ich verbrachte acht Stunden am Tag beim MoD, beinahe zwei Stunden mit der Pendelei, noch eine oder zwei Stunden für das Drucraft-Training. Und dann war da noch der ganze Kleinkram. Ich musste die Agentur anrufen, um den neuesten Fehler in meiner Abrechnung zu beheben. Zur Bank gehen, um ein Dokument zu besorgen. Im Supermarkt herumschleichen auf der Suche nach Sonderangeboten. Zu Hause bleiben, weil wir für den Vermieter jemanden reinlassen mussten. Die eine Person in der Abteilung auftreiben, die meinen Stundenzettel abzeichnete. All diese winzigen, nervigen Kleinigkeiten, um die Leute mit besseren Jobs und besseren Leben sich vermutlich gar nicht kümmern mussten, die aber jegliche Freizeit, die ich übrig hatte, aufzufressen schienen. Quellen zu jagen, war zeitraubende Arbeit, und ich war bereits am Limit.
Es gab noch eine andere Option. Bei meiner Recherche hatte ich gelernt, dass die meisten Leute ihre Sigls nicht herstellten – sie kauften sie. Und wenn sich das Thema dem Kauf von Sigls zuwandte, tauchte immer wieder derselbe Name auf: die Börse.
Die Börse liegt in Belgravia, ein Londoner Stadtteil zwischen Westminster, Kensington und Chelsea, und im letzten Jahr war es mir endlich gelungen, diesen Ort aufzuspüren. Mir war sofort klar gewesen, dass ich mir keine Sigl würde leisten können – mein Guthaben auf dem Bankkonto hatte sich in den vergangenen Monaten zwischen 500 und 1000 Pfund bewegt, was einem in London höchstens einen Monat lang den Lebensunterhalt sichert. Doch selbst wenn ich nichts kaufen könnte, gefiel mir der Gedanke, einen Blick darauf zu werfen, was dort verkauft wurde. Eins der Probleme, das mir im letzten halben Jahr immer wieder begegnete, war, dass ich nicht sicher war, was wirklich möglich war und was nicht. Wenn ich sehen könnte, welche Art Sigls andere Leute herstellten, bekäme ich vielleicht ein Gespür dafür, was ich allein bewerkstelligen könnte.
Doch es stellte sich heraus, dass das nichts zur Sache tat, denn sie ließen mich nicht hinein. Ich hatte es zweimal probiert, und beide Male war ich an der Tür aufgehalten worden. Anscheinend hat die Art Leute, die an diese Orte gehören, ein bestimmtes Aussehen, und ich habe es nicht. Könnte ich diese Unsichtbarkeits-Sigl konstruieren, könnte ich mich vielleicht hineinschleichen – aber ich würde das nur können, wenn sie funktionierte, und um zu wissen, ob sie funktionieren könnte, würde ich ein besseres Gespür brauchen, was Sigls bewirkten, und dafür musste ich dort hinein.
Während das Auftreiben weiterer Quellen wenig realistisch schien, war der Plan, Sigls zu kaufen, noch aussichtsloser. Was blieb also?
Nichts.
Ich hatte länger auf der Arbeit bleiben müssen, und so war es nach sieben, als ich aus dem Bahnhof Plaistow trat, den Hügel hinablief und in die Seitenstraße bog, die zur Foxden Road führte. Die Sonne ging im Westen unter, die Strahlen tauchten die Wolken in flammendes Rot und Gold. Kirschblüten lagen auf dem Bürgersteig, und die Temperatur sank schnell mit dem heraufziehenden Abend, die Kühle durchdrang meinen Fleecepullover und ließ mich zittern. Eine Krähe hockte auf den Telefondrähten, beobachtete mich, wie ich unter ihr vorbeilief.
Ein Mädchen wartete vor dem Tor zu meinem Haus.
Meine Gedanken gingen sofort zu letzter Nacht, aber als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass es nicht diejenige war, die auf der Brücke an mir vorbeigelaufen war. Dieses Mädchen war in etwa so alt wie ich, mit heller Haut und schulterlangem aschblondem Haar. Ihre Bewegungen waren lebendig und souverän, und sie musterte mich selbstbewusst von oben bis unten.
»Na«, sagte sie schließlich. »Du siehst besser aus, als ich dachte.«
»Kann ich dir helfen?«, fragte ich.
»Das ist die Frage, nicht wahr?«
Ich öffnete den Mund und wollte mich erkundigen, was sie vor meinem Haus tat, als mir plötzlich etwas einfiel: Gabriel, der davon sprach, aus welchem Grund ein Mädchen freitagnachts vor seinem Haus gewartet hatte. Gut, heute war erst Donnerstag, und es war im Prinzip Abend, nicht Nacht, aber trotzdem …
»Weißt du, wer ich bin?«, fragte das Mädchen.
»Äh«, sagte ich. »Nein?«
»Rate«, sagte das Mädchen mit einem Lächeln.
»Lieber nicht.«
»Ach, komm schon. Hier, ich geb dir einen Tipp. Es hat mit deiner Familie zu tun. Deiner engeren Familie.«
Das ließ mich aufmerken. Moment. Wusste sie etwas über meinen Vater?
»Wer bist du?«, fragte ich.
»Lucella Ashford«, sagte das Mädchen und blickte erwartungsvoll in meine Richtung.
Ich sah sie an. Das Mädchen – Lucella – sah mich an.
»Okay«, sagte ich schließlich, als klar wurde, dass sie auf eine Reaktion wartete.
»Wie in Haus Ashford.«
»… okay?«
Lucella sah mich stirnrunzelnd an.
»Kommt mir nicht bekannt vor, sorry«, sagte ich. Das kurze Aufflackern der Aufregung verblasste; es sah aus, als ob sie doch nichts wüsste. Trotzdem musste ich nachfragen. »Als du sagtest ›deine Familie‹, meintest du da jemanden namens William Oakwood?«
Lucella sah mich an, als hätte ich nicht alle beisammen. »Natürlich nicht.«
»Klar«, erwiderte ich und versuchte, meine Enttäuschung zu verbergen. Ich wollte um sie herum zum Eingang gehen.
»Wohin willst du?«
»Ich denke, du verwechselst mich mit jemandem.«
»Lass mich nicht so stehen«, erwiderte Lucella mit einem Stirnrunzeln und versperrte mir den Weg.
Innerlich seufzend hielt ich an. Wenn man in London von einem Fremden auf der Straße angesprochen wird, bedeutet das für gewöhnlich eins von drei Dingen. Erstens: Sie wollen eine Wegbeschreibung. Zweitens: Sie wollen Geld. Drittens: Sie sind betrunken, auf Droge, irre oder alles zugleich. Lucella hatte sich offensichtlich nicht verlaufen, und sie erzählte mir keine Geschichte darüber, dass sie nach Hause müsse und drei Pfund für die Busfahrt brauche oder so was, weshalb nur »betrunken/zugedröhnt/irre« blieb. Ich wollte nicht wissen, was genau davon zutraf, aber leider stand sie zwischen mir und meinem Hauseingang, also sah es so aus, als würde ich es wohl herausfinden müssen.
Lucella und ich starrten einander an. Die Verärgerung wich aus Lucellas Gesicht, wurde ersetzt von einer nachdenklichen Miene. »Es ist seltsam, dass du keinem von ihnen ähnlich siehst«, sagte sie.
Jetzt, da wir einander so nah waren, konnte mir nicht entgehen, wie hübsch sie war. Zu blöd war das mit dem »betrunken/zugedröhnt/irre«. »Entschuldige bitte«, sagte ich.
»Du weißt nicht, wovon ich rede, oder?«
»Nicht wirklich, nein.«
Lucella starrte mich eine Sekunde lang an, dann lachte sie auf. »Na, das läuft nicht so, wie ich es erwartet hatte.«
»Sieh mal, ich will nicht unhöflich sein«, sagte ich, »aber kannst du mich bitte vorbeilassen?«
»Was? Oh.« Lucella trat beiseite.
Ich ging an ihr vorbei. Sie beobachtete mich aufmerksam, aber zu meiner Erleichterung unternahm sie nichts. Wenn ich jetzt hineinkam, bevor sie …
»Du bist aber ein Drucrafter, oder?«
Ich hielt überrascht inne und wandte mich um. Lucella hatte eine Hand in die Hüfte gestemmt und beobachtete mich scharf.
»Was?«, brachte ich heraus.
»Du weißt schon, jemand, der Drucraft nutzen kann?«, fragte Lucella. »Ein Channeler oder wenigstens ein Tyro? Denn wenn nicht, habe ich meine Zeit hier wirklich verschwendet.«
Ich antwortete nicht, und ein interessierter Ausdruck trat in Lucellas Augen. »Also weißt du, wovon ich rede.«
»Was machst du hier?«, fragte ich.
Lucella musterte mich noch ein paar Sekunden, dann schien sie einen Entschluss zu fassen. »Weißt du was, wieso nicht? Gehen wir rein.«
Ich sah sie an.
Lucella hob die Augenbrauen. »Willst du mich nicht reinbitten?«
Ich zögerte. Ich wusste nicht, was ich von Lucella halten sollte, und ein Teil von mir fragte sich immer noch, ob das eine Masche war. Aber wenn es eine Masche war, war es die raffinierteste, die ich je erlebt hatte. Lucella war erst die Zweite, der ich je begegnet war und die wusste, was das Wort Drucraft bedeutete. Und ich wollte wirklich dringend herausfinden, was sie sonst noch wusste.
Und selbst wenn sie das alles nur erfand … na, sie war ein hübsches Mädchen in meinem Alter, das an mir interessiert schien und in mein Zimmer wollte.
»In Ordnung«, antwortete ich.
Ich stieß das Tor auf und ging zur Haustür. Lucella winkte etwas oder jemandem zu, den ich nicht sehen konnte, und folgte mir dann.
Ich schloss die Tür hinter uns, atmete die warme Luft ein. Stimmen und Geräusche vom Fernseher drangen aus dem vorderen Schlafzimmer, und Ignas streckte den Kopf heraus. Er ist ein großer Kerl mit ergrauendem Haar und Bartstoppeln, der in einer Werkstatt arbeitet und mit seiner Frau im anderen Schlafzimmer oben wohnt. Als er Lucella sah, hoben sich seine Augenbrauen.
»Da entlang«, sagte ich zu Lucella, die sich mit einem kritischen Blick umsah und dann die Stufen hinaufstieg. Ich folgte ihr, und als ich zurückblickte, sah ich, dass Ignas mich angrinste und die Daumen hochhielt.