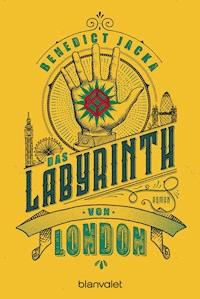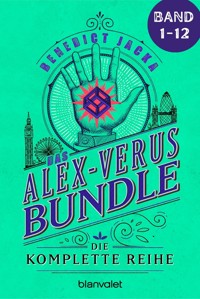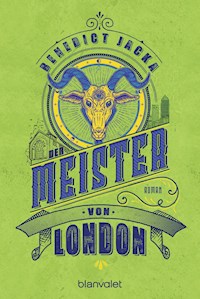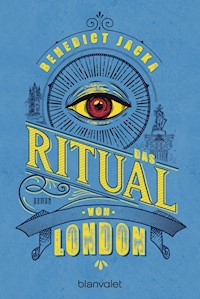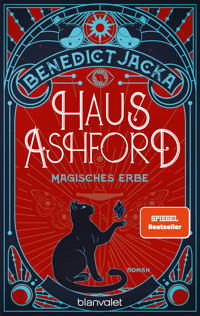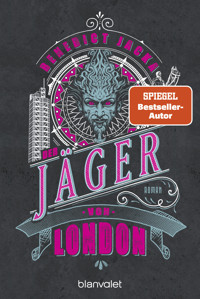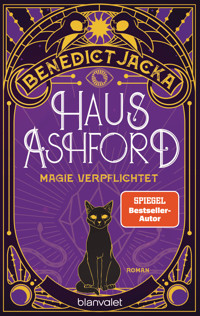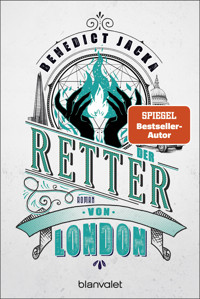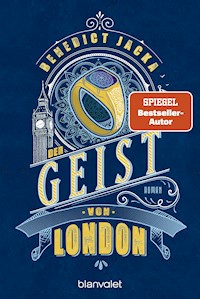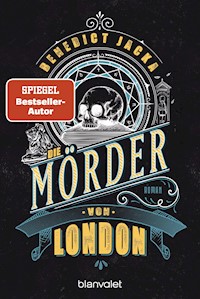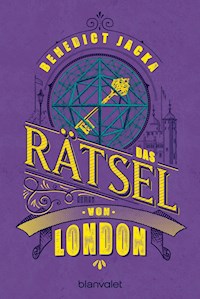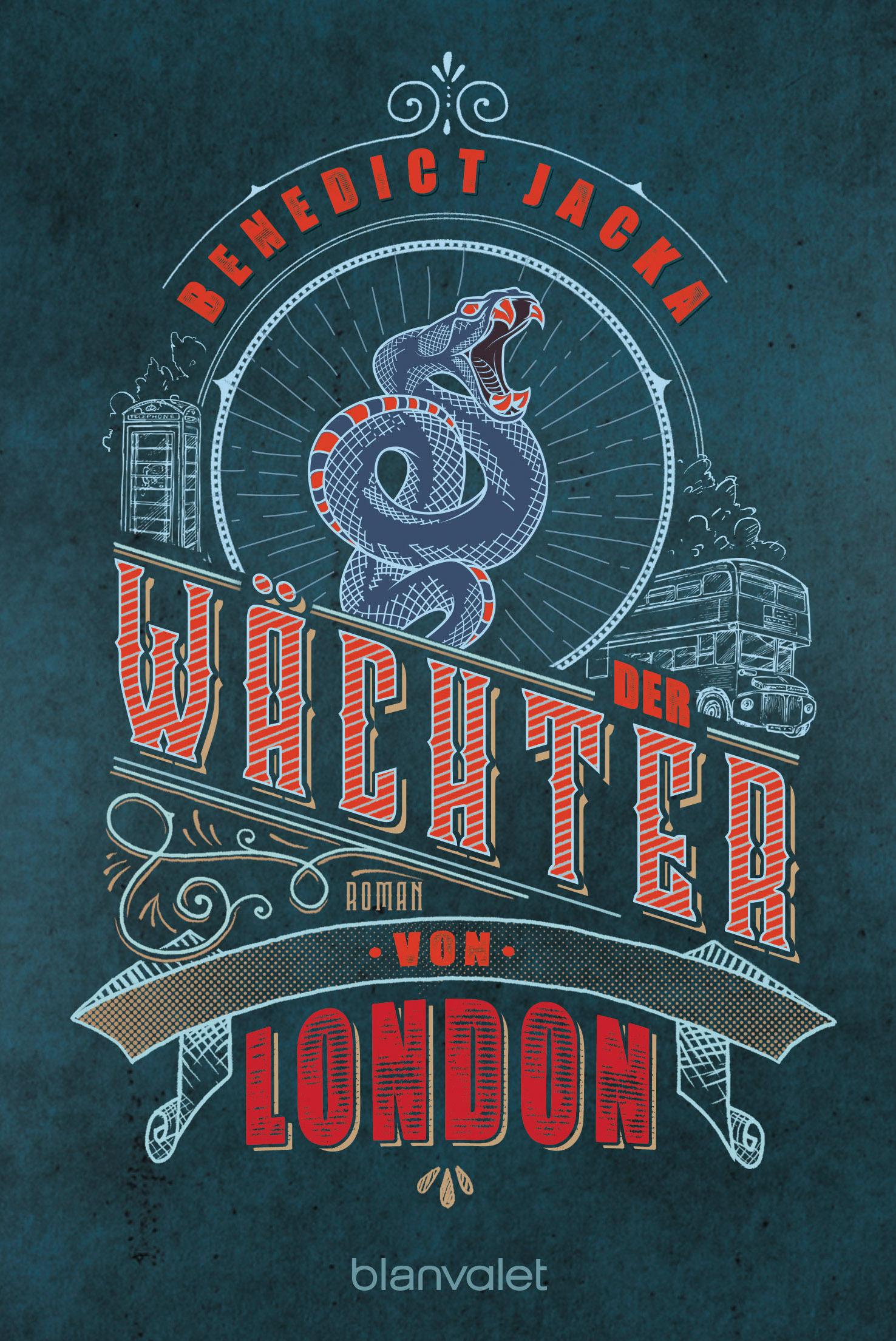
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Alex Verus
- Sprache: Deutsch
Er kann die Zukunft sehen und ahnt doch nicht, dass ihn seine dunkle Vergangenheit einholt ... Der vierte Band der packenden Serie um den Londoner Magier Alex Verus.
London ist aufregend, sehenswert, vielseitig – und tödlich! Nicht einmal der Hellseher Alex Verus hat den Angriff der magisch begabten Bande kommen sehen, die nur eins will: Rache! Denn einst diente Verus einem bösen Magier und tat in dessen Auftrag Dinge, die er erfolgreich verdrängen konnte. Niemals hätte Alex damit gerechnet, dass ihn seine dunkle Vergangenheit einholen würde. Doch nun muss er sich seinen alten Sünden stellen – sonst hat er keine Zukunft mehr, die er voraussehen könnte.
Die Alex-Verus-Romane von Benedict Jacka bei Blanvalet:
1. Das Labyrinth von London
2. Das Ritual von London
3. Der Magier von London
4. Der Wächter von London
5. Der Meister von London
6. Das Rätsel von London
7. Die Mörder von London
8. Der Gefangene von London
9. Der Geist von London
10. Die Verdammten von London
11. Der Jäger von London
12. Der Retter von London
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Buch
London ist aufregend, sehenswert, vielseitig – und tödlich! Nicht einmal der Hellseher Alex Verus hat den Angriff der magisch begabten Bande kommen sehen, die nur eins will: Rache! Denn einst diente Verus einem bösen Magier und tat in dessen Auftrag Dinge, die er erfolgreich verdrängen konnte. Niemals hätte Alex damit gerechnet, dass ihn seine dunkle Vergangenheit einholen würde. Doch nun muss er sich seinen alten Sünden stellen – sonst hat er keine Zukunft mehr, die er voraussehen könnte …
Autor
Benedict Jacka (geboren 1981) ist halb Australier und halb Armenier, wuchs aber in London auf. Er war 18 Jahre alt, als er an einem regnerischen Tag im November in der Schulbibliothek saß und erstmals, anstatt Hausaufgaben zu machen, Notizen für seinen ersten Roman in sein Schulheft schrieb. Wenig später studierte er in Cambridge Philosophie und arbeitete anschließend als Lehrer, Türsteher und Angestellter im öffentlichen Dienst. Das Schreiben gab er dabei nie auf, doch bis zu seiner ersten Veröffentlichung vergingen noch sieben Jahre. Er betreibt Kampfsport und ist ein guter Tänzer. In seiner Freizeit fährt er außerdem gerne Skateboard und spielt Brettspiele.
Die Alex-Verus-Romane von Benedict Jacka bei Blanvalet:1. Das Labyrinth von London2. Das Ritual von London3. Der Magier von London4. Der Wächter von Londonweitere Bände in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Deutsch von Michelle Gyo
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Chosen (Alex Verus 4)« bei Orbit, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2013 by Benedict Jacka
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung und -illustration: © Max Meinzold, www.meinzold.de, unter Verwendung eines Motivs von Sergj/Shutterstock.com
Karte: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24898-7V002www.blanvalet.de
1
Die Nacht war warm und still. Eine sanfte Brise wehte durch die geöffneten Fenster in meine Wohnung und roch schwach nach Asphalt, verbranntem Gummi und Barbecue. Das anhaltende Rauschen des Verkehrs drang von der Straße herauf, Stimmen übertönten kurz die Hintergrundgeräusche, bevor sie wieder damit verschmolzen, und das rhythmische Hämmern von Musik aus einem Club dröhnte von zwei Blocks weiter herüber. Ein Helikopter schwebte am Himmel, folgte dem Heulen der Polizeisirenen; von Zeit zu Zeit flog er mit ratternden Rotorblättern über das Haus.
In meiner Wohnung war es friedlich. Unter der Lampe zogen Mücken träge ihre Bahnen, Vögel und andere Tiere blickten von den Bildern an den Wänden herab. Der Kaffeetisch stand in der Mitte des Raums, er war mit Hexplatten aus Karton und Holzspielfiguren übersät. Vier von uns fünfen hatten darum herum Platz genommen. Sonder und ich saßen auf Stühlen, Luna im Schneidersitz auf einem Sitzsack und Variam am Ende des Sofas, wo er finster auf seine Karten blickte. Am anderen Ende des Sofas und ein wenig vom Spiel abgerückt, hatte Anne sich mit angezogenen Beinen zusammengerollt.
»Äh, Variam?«, sagte Sonder. Sonder hat wuscheliges schwarzes Haar und trägt eine Brille. Er wirkt immer etwas schmuddelig, als hätte er in seinen Kleidern geschlafen. »Du bist dran.«
Variam nahm die Würfel und warf sie, ohne hinzusehen. »Sieben.«
Luna sah nach. »Das ist eine Acht, du Idiot.«
Sonder strahlte. »Hervorragend! Fünf Erz, zwei Getreide.«
Variam ignorierte sie beide. »Wir sollten trainieren«, sagte er an mich gewandt.
»Du trainierst seit Wochen«, erwiderte ich und wartete, dass Sonder seine Karten aufnahm, bevor ich nach meinen griff.
»Das ist besser, als nur hier herumzusitzen.«
»Bist du fertig?«, fragte Sonder Variam.
Variam nickte, und Sonder nahm die Würfel. »Wir könnten mehr Kampftraining machen«, meinte Variam, als Sonder würfelte.
»Du brauchst kein weiteres Kampftraining.«
»Sie schon«, sagte Variam und deutete auf Anne.
Luna sah Variam verärgert an.
»Du gehst morgen zu einer Beratung, nicht zu einem Kampf«, sagte ich, bevor Luna Streit anfangen konnte. »Sie will bloß ein wenig über dich erfahren. Mich würde es überraschen, wenn sie dich auch nur darum bitten würde, einen Zauber zu wirken.«
Sonder sah zwischen uns hin und her.
»Vielleicht sollten wir ihr zeigen, was wir können«, sagte Variam.
»Variam, sie ist eine kleine alte Dame«, erwiderte ich. »Sie lebt in einem Reihenhaus in Brondesbury. Sie wird wohl keine Vorführung verlangen, um zu sehen, wie gut ihr Dinge einäschern könnt.«
Variam lehnte sich mit gereiztem Blick zurück.
»Äh«, sagte Sonder. »Ich bekomm eine Stadt und eine Entwicklungskarte.« Er schob die Würfel zu Luna. »Du bist dran.«
Luna wartete, bis Sonder die Hand zurückgezogen hatte, bevor sie die Würfel nahm und warf. Meiner Magiersicht zufolge erschien Lunas Fluch als silbrige Aura, die sich um ihre Gliedmaßen und ihren Körper wand wie lebendiger Nebel. Silberne Ranken tasteten über die Würfel, während diese hüpften, und verschwanden, sobald sie still dalagen.
»Sieben«, sagte Luna zufrieden. »Lass mal sehen, der Räuber kann …« – sie nahm die schwarze Figur und zog damit einen Kreis über dem Brett – »… dorthin.« Sie platzierte den Räuber auf Variams Siedlungen und hielt die Hand hin, die Finger ausgestreckt. »Gib her.«
Variam sah auf. »Was?«
»Karte, bitte.«
»Warum hast du es auf mich abgesehen? Sie gewinnen doch!«
»Dich zu ärgern macht mehr Spaß. Karte, bitte.«
Variam verzog das Gesicht und hielt ihr schlecht gelaunt seine Karten hin. Luna ließ sich Zeit, eine auszusuchen, und Variams finstere Miene wurde noch finsterer, als sie endlich eine zog. Der silbrige Nebel ihres Fluchs hielt sich dabei dicht an ihren Fingern. Lunas Fluch bringt Pech, und er ist ziemlich gefährlich: Schon eine einzige Strähne dieses Nebels kann Schaden anrichten, und Hautkontakt ist tödlich. Früher einmal hätte Luna niemandem so nahe kommen können, ohne ihn oder sie in Gefahr zu bringen, aber sie trainierte jetzt schon seit beinahe anderthalb Jahren, den Fluch unter Kontrolle zu halten, und das zahlte sich aus. Der silbrige Nebel haftete an ihrer Haut, hell und dicht; nur ein paar schwache Spuren hatten sich auf die Spielfiguren gelegt und umgaben sie mit winzigen silbernen Auren. Die Auren um ihre Figuren waren kein Problem: Ihr Fluch richtet bei Objekten nicht viel aus. Lebende Wesen sind eine andere Sache.
Ich bekam den Würfel, und nachdem die Rohstoffe ausgezählt worden waren, blickte ich auf meine Hand. Wer zuerst zehn Punkte hatte, gewann, und ich hatte jetzt acht. Ich sah in die Zukunft, in der ich die oberste Entwicklungskarte aufdeckte, es wäre ein Siegpunkt. »Siedlung«, sagte ich, legte das Holzspielteil auf die Karte und stand auf. »Ich hole was zu trinken. Möchtet ihr was?«
»Könnte ich ein Wasser bekommen?«, fragte Sonder.
»Ich möchte zwar was trinken, aber ich weiß nicht, was«, sagte Luna.
»Vielleicht ist ja noch was von der Limo übrig, die ich gestern gemacht habe«, meinte Anne mit ihrer leisen Stimme. »Holunderblüte und Limette?«
Luna richtete sich auf. »Oh, die war lecker.«
Ich ging in die Küche, griff nach der Flasche in dem Kühlschrank und goss etwas in ein Glas, als ich spürte, dass jemand hinter mir war. Ohne aufzublicken, hielt ich das Getränk hin, und es wurde mir nach einem Augenblick aus der Hand genommen. »Danke«, sagte Anne.
Anne ist groß und schlank, nur gut zwei Zentimeter kleiner als ich, mit schwarzem Haar, das ihr bis auf die Schultern fällt, und rotbraunen Augen. Sie sticht hervor, aber sie hat dennoch eine ruhige, unauffällige Art, die keine Aufmerksamkeit erregt. »Was ist?«, fragte ich und füllte ein weiteres Glas.
»Du hättest das Spiel gewinnen können, nicht wahr?«, fragte Anne.
Mit einem Lächeln drehte ich mich um. »Ich brauche wohl ein besseres Pokerface.«
Im Wohnzimmer hörte ich erhobene Stimmen: Variam und Luna stritten wieder. »Hast du sie gewinnen lassen?«, fragte Anne neugierig.
»Luna oder Vari hätten ihre Karten mit mir tauschen müssen, damit ich gewinne«, sagte ich. »Vielleicht hätte ich sie überzeugen können, aber dafür hätte ich lügen müssen.«
»Und das ist es dir nicht wert?«
»Ich habe genug zweifelhafte Sachen gemacht«, sagte ich. »Ich behalte lieber meine Freunde, außer es gibt einen wirklich guten Grund.«
Anne schenkte mir ein Lächeln, dann verschwand es rasch wieder. Sie blickte über ihre Schulter zu den Schränken hinauf.
»Stimmt was nicht?«, fragte ich.
»Da ist jemand draußen.«
Wachsam horchte ich auf. »Wo?«
Anne ist eine Lebensmagierin, und zwar eine mächtige. Die meisten Menschen halten Lebensmagier für Heiler, und damit haben sie zum Teil recht, aber Lebensmagie ist sehr viel mehr als das. Sie verleiht einem die Kontrolle über jeden Aspekt eines Lebewesens, mit einer einzigen Berührung kann man es heilen oder ihm Schaden zufügen. Lebensmagier spüren Leben, sie »sehen« Lebewesen, und Anne ist darin besonders gut. Ihre Treffsicherheit ist erstaunlich: Indem sie eine Person einfach nur ansieht, erfährt sie in einer Minute mehr über sie als ein Arzt in vierundzwanzig Stunden mit einer kompletten Krankenhausausrüstung. Ich habe nie herausfinden können, wie sie das anstellt, obwohl sie es mir mehrmals zu erklären versucht hat. Sie scheint einen Körper so zu lesen wie unsereins die Miene eines Menschen.
In der Praxis heißt das, dass Anne wirklich ganz hervorragend darin ist, Menschen aufzuspüren – sie bemerkt sie durch Wände, Böden und sogar massiven Fels, wenn sie das möchte, und hat sie einmal jemanden kennengelernt, erkennt sie ihn mit absoluter Treffsicherheit wieder.
»Er war unten auf der Straße«, sagte Anne. »Zuerst habe ich nicht darauf geachtet, aber … er ging weg und ist dann hoch aufs Dach. Ich habe den Eindruck, er will uns beobachten.«
»Wer ist es?«
»Ich bin ihm noch nie zuvor begegnet«, sagte Anne. »Er ist etwa achtzehn, nicht sehr groß oder stark, aber er ist gesund, und er ist allein.« Sie deutete in einem leichten Winkel nach oben. »Gut zwanzig Meter in die Richtung.«
»Im Moment ist niemand hinter dir oder Vari her, stimmt das?«
»Nicht dass ich wüsste«, sagte Anne.
Ich fragte aus gutem Grund. Anne und Variam könnte man als sehr fortgeschrittene Lehrlinge bezeichnen: Sie sind keine Magier, aber sie sind so erfahren, dass sie es eigentlich sein sollten. Vor vier Jahren hatten sie sich auf einen Magier namens Sagash eingelassen. Die offizielle Geschichte (zumindest die, an die der Rat glaubt) lautet, dass Anne und Variam als Lehrlinge in Sagashs Dienste getreten waren und ihn neun Monate später wieder verließen. Tatsächlich hatte Sagash Anne entführt und sie gefoltert, bis sie seinen Befehlen Folge leistete. Variam spürte sie auf, und es kam zu einem gewaltigen Kampf. Ihre nächste Stelle war bei einem Rakshasa namens Jagadev, der ihnen Zutritt zum Lehrlingsprogramm der Weißmagier verschaffte und sie in seinen Haushalt aufnahm, bis Anne im letzten Winter vom Rat wegen des Verdachts auf Mittäterschaft bei einem Mord festgenommen wurde. In der Folge warf Jagadev sie hinaus, und ich ließ sie bei mir einziehen. Mit einer solchen Geschichte zieht man eine Menge Aufmerksamkeit auf sich, und seit ich Anne und Variam kannte, waren sie von Assassinen, Konstrukten, einem Paar Ratswächter und zwei unterschiedlichen Schwarzmagiern gejagt worden. Sie suchen keinen Ärger, aber er scheint sie dennoch zu verfolgen.
Natürlich sind Anne und Variam nicht die Einzigen mit schlechtem Ruf. Der Rat glaubt, dass auch ich bei den Schwarzmagiern ausgebildet wurde – nur haben sie in meinem Fall recht, und wenn unser mysteriöser Gast nicht hinter Anne oder Variam her war, standen die Chancen gut, dass er es auf mich abgesehen hatte. Während unserer Unterhaltung hatte ich Zeit gehabt, mich zu vergewissern, dass er da war, und genug Informationen gesammelt, um zu schlussfolgern, dass er keine direkte Gefahr darstellte. Meine Fähigkeiten im Erkennen von Lebewesen sind nicht so ausgeprägt wie Annes, aber dafür kann ich Gefahren sehr viel besser spüren, und hiermit würde ich allein klarkommen.
»Ich geh mal raus und unterhalte mich mit ihm«, sagte ich zu Anne.
Sie blickte zum Wohnzimmer hinüber.
»Ich komme klar«, sagte ich. »Sag ihnen, ich bin in fünf Minuten zurück, wenn Vari und Luna fertig sind mit Streiten und Sonder seinen nächsten Zug gewonnen hat.«
Anne wirkte besorgt, aber sie nickte.
»Sei vorsichtig.«
Das Dach meines Hauses bietet eine großartige Aussicht. Es ist nicht besonders hoch, und es steht in dem Teil Camdens, der am dichtesten bebaut ist. Rundherum ragen Mauern, Brücken, Brüstungen, Antennen und Schornsteine auf, inmitten eines Meeres aus Gebäuden, und am Horizont erstreckt sich die Stadt. Die Nacht war klar, einige Sterne schienen verschwommen von oben herab, kämpften gegen die Lichtverschmutzung, und zu meiner Linken stieg die Mondsichel auf. Die warme Luft trug den Duft nach Essen herbei: indisch von den Restaurants am Ende der Straße, italienisch von dem einen Block weiter, Grillgerüche aus den Gärten beim Kanal. Ich trat in den Schatten eines Schornsteins, suchte Deckung in der Dunkelheit.
Der Kerl, der uns auszuspionieren versuchte, war drei Dächer weiter, und als ich genauer hinsah, änderte ich meine Einschätzung von »Kerl« zu »Kleiner«. Ich hätte mich ohne allzu große Probleme an ihn heranschleichen können, aber als ich in die Zukunft blickte, sah ich, dass er bald in meine Richtung kommen würde. Ich machte mich bereit zu warten.
Ein paar Minuten vergingen. Der Helikopter, der um den Wohnblock im Süden geschwirrt war, flog wieder über mir vorbei, und das laute Rattern der Rotoren übertönte alles andere, bis er das Interesse verlor und mit weiß-grün-rot blinkenden Lichtern nach Norden davonflog. Eine Meute Teenager in Hoodies stolzierte die Straße unter uns entlang, besoffen krakeelten sie herum; dann ertönte das Klirren einer zerberstenden Flasche, gefolgt von einer Rangelei und einem Schrei. Als die Straße wieder ruhig war, verließ der Kleine seine Deckung und schlich auf mein Versteck zu.
Divinationsmagie funktioniert, indem sie Wahrscheinlichkeiten erspürt. Für mich sehen mögliche Zukünfte aus wie Linien aus Licht in der Dunkelheit – je heller und lebhafter, desto wahrscheinlicher sind sie. Indem ich mir die Zukünfte ansah, in denen ich hinaus ins Sichtfeld des Kleinen trat, konnte ich ihn trotz der Objekte zwischen uns beobachten, und dabei behielt ich auch die Zukünfte seiner Handlungen im Blick. Die meisten zeigten eine plötzliche Bewegung, wenn er mich erblickte, während er sich in anderen ruhig und ahnungslos weiterbewegte. Ich erkannte, dass die Zukünfte, in denen er mich nicht bemerkte, die waren, in denen ich mich links um den Schornstein herumbewegte, also tat ich genau das: Ich passte mein Handeln an die Zukünfte an, in denen er mich nicht bemerkte. Ich musste mich kaum darauf konzentrieren, da ich so geübt darin war, meine Divination dazu zu nutzen, nicht entdeckt zu werden. Der Kleine ging vorbei und trat auf das Dach meiner Wohnung.
Ich hatte genug Zeit, die Dächer um uns herum verhältnismäßig gründlich zu überprüfen, indem ich in der Zukunft in verschiedenen Richtungen nachsah, und ich war mir ziemlich sicher, dass der Kleine allein war. Ich beobachtete, wie er zu der Leiter ging, die zu meinem Balkon hinabführte, sich hinhockte und über den Rand spähte. Lautlos stand ich hinter dem Schornstein auf und trat leise von hinten an ihn heran, dann blieb ich drei Meter entfernt stehen. »Suchst du jemanden?«, fragte ich seinen Rücken.
Der Kleine zuckte zusammen, versuchte aufzuspringen, sich herumzudrehen und sich nach jeder Richtung gleichzeitig umzusehen. Er stürzte fast über die Kante, und als er mich sah, wühlte er in seiner Jacke herum und zerrte eine Waffe hervor. Es war ein kurzes Kampfmesser, etwa von der Länge seiner Hand, und er ließ es prompt mit einem Scheppern fallen. Hastig beugte er sich herab, um es aufzuheben, fiel dabei wieder fast vom Dach und hielt es dann endlich, schnell atmend, in meine Richtung.
Ich sah mir das Ganze mit mildem Interesse an. »Fertig?«
Der Kleine antwortete nicht, starrte mich nur mit großen Augen an.
»Also suchst du nach mir, nehme ich an?«, fragte ich.
Schweigen. Der Kleine war Chinese, doch als ich in die Zukunft blickte, erkannte ich, dass er mit einem Londoner Akzent sprach: wohl in Großbritannien geboren. Er war klein und drahtig, und er sah schnell aus.
»Weißt du«, sagte ich, »wenn du nur da herumstehen und gaffen willst, wird das eine ziemlich einseitige Unterhaltung.«
Schweigen. Ich öffnete den Mund, um eine weitere bissige Bemerkung loszuwerden, doch ich hielt inne, als ich plötzlich das Gefühl in den Augen des Kleinen erkannte. Er war verängstigt – nicht nur verschreckt, er hatte Todesangst. Und zwar vor mir.
Ich bin wirklich nicht daran gewöhnt, dass Menschen vor mir Angst haben. Versteht mich nicht falsch, eine Menge Magier fühlen sich unwohl in der Nähe eines Wahrsagers, aber das liegt daran, dass sie glauben, man würde ihre Geheimnisse ans Licht bringen – sie wissen, dass ein Wahrsager keine körperliche Bedrohung darstellt. Und Geheimnisse können zwar so tödlich sein wie jede andere Waffe auch in der magischen Welt, aber Angst gründet auf dem Instinkt. Solange man weiß, dass man jemanden zusammenschlagen kann, ist es sehr viel schwerer, Angst vor ihm zu haben.
Offensichtlich hatte der Kleine dieses Memo nicht erhalten. Er war praktisch paralysiert und schien sich nicht mehr rühren zu können. Das Messer bereitete mir keine Sorgen – vermutlich würde er sich eher selbst damit stechen als jemand anders.
»Wer schickt dich?«, fragte ich scharf und herrisch. Ich wollte nicht wissen, wer er war – dieser Typ war ein Bauer, kein König.
Der Tonfall funktionierte, denn der Kleine murmelte unwillkürlich eine Antwort: »Will.«
»Du bist sein Lehrling?«, fragte ich. Der Kleine starrte mich offenkundig verwirrt an, und ich legte den Kopf schief. Er benahm sich nicht wie ein Magier. »Adept also?«
Er zuckte zusammen, und ich nickte. »Okay, was willst du wissen?«
»Hä?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Du bist hier, um etwas herauszufinden, richtig? Lass hören.«
Der Kleine starrte mich weiter an. Anscheinend hatte eine Begegnung wie diese nicht im Drehbuch gestanden.
»Okay«, sagte ich. »Könnten wir das hier vielleicht beschleunigen? Ich hab Besuch, und nimm es nicht persönlich, aber du zeichnest dich gerade nicht als ein besonders faszinierender Gesprächspartner aus.«
»Sind …« Die Stimme des Kleinen brach, und er schluckte. »Sie sind Verus, richtig?«
»Ja. Ich bin der große, böse, furchterregende Verus.«
»Was haben Sie gemacht?«, fragte der Kleine.
Ich starrte ihn kurz an, dann antwortete ich langsam und vorsichtig. »Ich habe ein Brettspiel gespielt.«
Der Kleine zögerte.
»Du hast mein Geheimnis gelüftet«, sagte ich. »Herzlichen Glückwunsch.« Ich nickte zu dem Messer hin. »Und jetzt steck das weg. Du hast ganz offensichtlich keine Ahnung, wie man es gebraucht.«
Übrigens, nur für den Fall, dass einer von euch darüber nachdenkt, das zu Hause auszuprobieren: So sollte man nicht mit einem nervösen Typen umgehen, der ein Messer in der Hand hat. Wenn jemand euch gegenüber eine Waffe zieht, ist die richtige Antwort wegzulaufen – oder, wenn man das nicht kann, ihn umzuhauen, bevor er sie zieht. Aber ich hatte in die Zukünfte gesehen, in denen ich ihn angriff, und es war offensichtlich, dass er absolut keine Ahnung hatte, wie er das Ding benutzen sollte. Wenn ich mich auf ihn stürzte, standen die Chancen drei zu eins, dass er vom Dach fiel und sich dabei vermutlich selbst erstach.
Der Kleine zuckte zusammen und starrte auf die Klinge – er hatte eindeutig vergessen, dass er sie in der Hand hielt –, doch er senkte die Waffe nicht. Ich seufzte, denn mir ging die Geduld aus. Ach, scheiß drauf. Ich trat zur Seite. »Mach, dass du wegkommst.«
Der Kleine sah mich an. »Hau ab«, sagte ich mit einer entsprechenden Geste. Ich ließ ihm freie Bahn, damit er dahin zurückkonnte, woher er gekommen war. »Wenn dein Boss mich ausspionieren will, sag ihm, dass er das selbst machen soll.«
Jetzt wandte der Kleine den Blick von mir ab, sah in die Dunkelheit und ging langsam los, wobei er versuchte, sich zurückzuziehen und mich gleichzeitig im Auge zu behalten. Ich guckte mir noch einmal die Zukünfte an und erkannte, wie leicht es wäre, ihn zu stellen. Vorspringen, packen, drehen, und er würde auf dem Boden liegen. Das Messer wäre nicht mehr in seiner Hand, sondern in meiner, und dann könnten wir eine hübsche, ausführliche Unterhaltung darüber führen, wer genau ihn hergeschickt hatte.
Doch ich tat es nicht. Früher hätte ich anders reagiert. Ein Spion bedeutet für gewöhnlich, dass jemand neugierig ist; es kann aber auch heißen, dass jemand darüber nachdenkt, einem etwas anzutun, und deshalb ist es üblich, dass ein Magier zuerst schießt und dann Fragen stellt, wenn er merkt, dass er ausspioniert wird. Außerdem sehen es die Typen, mit denen ich früher zu tun hatte, als Zeichen der Schwäche an, wenn man auf eine potenzielle Bedrohung nicht sofort mit Gewalt reagiert. Vielleicht war ja alles in Ordnung, aber warum das Risiko eingehen?
Doch wenn man als paranoider Einsiedler lebt, ist es so: Es nervt. Man kann unmöglich erklären, wie müde man von Gewalt werden kann; es kann einen so erschöpfen, wenn man jemanden sieht, der auf Ärger aus ist, dass man nur noch fragen will: »Muss das hier wirklich sein?« Je mehr Zeit ich mit Luna und Sonder und Variam und Anne verbrachte, desto mehr erkannte ich, dass es mir gefiel, nicht jeden wie eine potenzielle Bedrohung zu behandeln. Wenn ich dem Kleinen folgte und ihn befragte, würde ich davon abweichen, und das wollte ich nicht. Also stand ich da und sah nur zu, wie er sich an mir vorbeischob. Sobald er freie Bahn hatte, drehte er sich um und rannte in die Dunkelheit. Das Geräusch seiner Schritte verklang, und ich war allein.
Blicke ich jetzt zurück, frage ich mich, was geschehen wäre, wenn ich diese Situation nicht so gehandhabt hätte. Wenn ich etwas anderes gesagt oder mich anders verhalten hätte, hätte ich dann den ganzen üblen Schlamassel vermeiden können? Oder hätte das alles nur noch schlimmer gemacht? Vielleicht wäre es jemand anderem gelungen. Keine Ahnung.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was kommen würde. Ich wartete, um sicherzugehen, dass der Kleine weg war, dann ging ich zurück in meine Wohnung, um Anne und den anderen die Geschichte zu erzählen.
Am nächsten Morgen erwachte ich von dem angenehmen Gefühl von Licht und Wärme. Aus alter Gewohnheit prüfte ich zuallererst die Zukunft, suchte nach dem verräterischen Aufflackern von Bedrohung und Gewalt. Absolut nichts, also blieb ich entspannt und wandte den Kopf aus dem Licht, bevor ich die Augen öffnete. Die Sonne strömte in mein Schlafzimmer, die Strahlen trafen mein Bett und den Teppich, sodass die Farben leuchteten, und als ich durch das Fenster sah, erblickte ich einen wolkenlosen blauen Himmel. Es würde ein klarer Sommertag werden.
Mein Schlafzimmer hat eine angenehme Größe, mit zwei hohen Fenstern, die die Morgensonne hereinlassen und mir einen Blick über die Dächer von Camden bieten. Die Wände sind weiß und kahl bis auf ein paar Bilder, die ich vom vorherigen Besitzer übernommen habe. Im Zimmer steht ein langer Schreibtisch, auf dem für gewöhnlich die magischen Gegenstände liegen, an denen ich gerade arbeite. Eine Tür führt ins Wohnzimmer. Durch den Spalt unter der Tür zog ein leckerer Duft aus der Küche herbei, und ohne nachzusehen, wusste ich, dass Anne da war. Ich war nicht in Eile, also lag ich in meinem Bett, genoss die Sonne und die Stille, während ich träge die Zukünfte vor mir durchging. Als ich richtig wach war, stand ich auf und machte ein paar Schritte mit bloßen Füßen auf dem Teppich, streckte die Beine, bevor ich mich anzog und die Tür öffnete.
Das Wohnzimmer war ordentlich und sauber bis auf die Ecke mit Variams Feldbett, das aussah, als wäre es das Nest eines mittelgroßen Tornados. Variam hat geradezu lächerlich viel Energie und schläft nur etwa sechs Stunden pro Nacht, was normalerweise heißt, dass er das Haus bereits verlassen hat, wenn ich aufstehe. Ich wusch und rasierte mich und ging dann in die Küche, wo Anne Frühstück machte.
Seit Anne und Variam letzten Winter eingezogen waren, war mein Zuhause von einem ziemlich einsamen Ort zu so etwas wie einer Gemeinschaftsunterkunft geworden. Es war acht Monate her, seit Anne und Variam angekommen waren, und da Luna sich häufig mit ihnen traf und Unterricht bei mir hatte, verbrachte sie so viel Zeit hier, dass sie auch gleich hier hätte einziehen können. Wir alle hatten genug Gelegenheiten, die Eigenheiten der anderen kennenzulernen, und eine der ersten waren die jeweiligen Arten zu kochen. Meine Kochkünste sind bestenfalls als funktional zu bezeichnen. Ich bin einer von denen, die sich nicht viel aus Essen machen – ich mag Essen, sodass ich eine gut zubereitete Mahlzeit genieße, aber ich bin nicht so fanatisch, dass ich selbst lernen würde, richtig gut zu kochen. Das Endresultat ist essbar, aber es besteht wohl kaum die Chance, dass sich jemals einer darüber freuen wird.
Anne ist eine ausgezeichnete Köchin. Sie erzählte uns, dass sie von klein auf zu Hause gekocht habe, und das merkt man – sie kann eine Mahlzeit aus buchstäblich allem zubereiten, und es schmeckt auch noch gut. Luna ist nicht schlecht, aber sie neigt zu Unfällen. Das Pech von ihrem Fluch trifft zwar nicht sie, aber es wirkt sich auf alles andere aus, und in einem Zimmer mit Feuer, scharfen Messern und unter Umständen giftigen Substanzen ist sie einfach eine wirklich miese Idee. Nach ihrem letzten Versuch, etwas zu frittieren, habe ich einen Feuerlöscher an der Wand angebracht. Variam ist schrecklich. Seine Gerichte verfügen über drei Geschmacksrichtungen: verbrannt, verkohlt und knusprig schwarz. Ich habe den Verdacht, dass es Absicht ist, damit er nicht öfter gebeten wird zu kochen, aber das kann ich nicht beweisen.
Anne begrüßte mich mit einem Lächeln und einem Teller mit leckerem gebratenem Essen. »Anne, ich liebe dich«, sagte ich und nahm ihn ihr ab.
Anne lachte. »Das sagst du vermutlich zu jeder Frau, die dich füttert.«
»Zu der letzten Frau, die diese Küche vor dir und Luna benutzt hat, habe ich das nicht gesagt.« Ich setzte mich an den Tisch und begann zu essen. Es schmeckte so gut, wie es roch.
»Wirklich?«
»Ja«, sagte ich zwischen zwei Mund voll. »Hat sich herausgestellt, dass sie für einen Typen arbeitete, der es auf uns abgesehen hatte. Sie hat ihm geholfen, mich und Luna in die Finger zu kriegen, und er wollte uns beide umbringen. War eine meiner dysfunktionaleren Trennungen.«
Anne hielt inne und sah mich an. »Das war kein Witz, oder?«
»Ich erzähl dir die Geschichte irgendwann mal«, sagte ich. »Ist Vari weg?«
»Joggen.« Anne nahm die restlichen Würstchen, Hashbrowns und den Speck aus der Pfanne und teilte sie auf. Die Hälfte kam auf ihren Teller und die andere in eine weitere Pfanne, die sie sorgfältig abdeckte.
Ich nickte zu der Pfanne. »Für Vari?«
»Mh-mh.« Anne nahm ihren Teller und setzte sich mir gegenüber. Ihre Portion war genauso groß wie meine. Anne ist zwar dünn, aber sie isst viel.
»Es ärgert Luna wirklich, dass du immer so nett zu ihm bist.«
»Ich weiß«, sagte Anne mit reumütigem Blick. »Ich sage ihr immer wieder, dass es mir nichts ausmacht.«
Ich lachte. »Dir macht es nie etwas aus, nett zu Menschen zu sein.«
»Na … vielleicht manchmal«, sagte Anne mit einem knappen Lächeln. »Vari kann ganz schön übellaunig sein, aber er ist nicht gemein. Er versucht nie, jemanden zu kontrollieren. Und … im Moment ist er ein wenig nervös.«
Überrascht sah ich Anne an. »Warum denn?«
»Er macht sich Sorgen, dass wir zu lange nach einem Meister suchen«, erwiderte Anne. »Wir sollten nicht wirklich im Lehrlingsprogramm sein, oder? Vari denkt, je länger das so geht, desto größer ist die Chance, dass wir jemandem auffallen.«
Gut, das verdarb ein wenig den Spaß. Ich antwortete nicht, aber Anne beobachtete mich, und ich wusste, sie sah an meiner Reaktion, dass Vari recht hatte.
Einer der Gründe, aus denen ich Anne und Variam letzten Winter eingeladen hatte, bei mir zu wohnen, war ihr Schutz. Sie sind keine anerkannten Mitglieder der magischen Gesellschaft, ich aber schon (zumindest gerade so), und ich wollte versuchen, einen Meister für sie zu finden. Das stellte sich jedoch als wesentlich schwieriger heraus, als ich erwartet hatte. Vergleicht man die Anzahl der Novizenmagier in Britannien, die einen Meister suchen, mit der Anzahl an qualifizierten und respektierten Weißmagiern oder unabhängigen Meistermagiern, die einen Lehrling suchen, stellt man fest, dass es sehr viel mehr Bewerber als Stellen gibt. Und Annes und Variams Akten machten es nur schlimmer – für die meisten weißen und unabhängigen Magier ist eine Verbindung zu einem Schwarzmagier, einem Rakshasa und einer Mordermittlung praktisch das Äquivalent zu einem Terroristen, einem illegalen Einwanderer und einem erfassten Sexualstraftäter in einer Person. Mittlerweile suchte ich seit über einem halben Jahr, und langsam fühlte es sich auf deprimierende Weise an wie eine vergebliche Jobsuche, einschließlich der Briefe, die mit »Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen« beginnen, und einem sich einschleichenden Gefühl von Vergeblichkeit.
Die gute Nachricht war, dass Anne und Variam nach wie vor im Lehrlingsprogramm der Weißmagier eingeschrieben waren, das eine Art Universitätsstruktur besaß, in dem die Lehrlinge in kleinen Klassen unterrichtet wurden, sodass sie selbst ohne Meister immer noch die Möglichkeit hatten zu lernen. Das Problem dabei war, dass man ohne einen Sponsor nicht am Programm teilnehmen sollte. Jagadev hatte Annes und Variams Aufnahme in die Wege geleitet, und als die beiden in meine Wohnung gezogen waren, nahm man an, ich hätte ihr Sponsoring übernommen, was ich offiziell nicht getan hatte. Vielleicht wäre mir das gelungen, wenn ich ein Gesuch eingereicht hätte – vielleicht auch nicht. Doch in beiden Fällen hätte es die falsche Art von Aufmerksamkeit erregt.
»Möchtet ihr die Suche forcieren?«, fragte ich Anne.
»Wie denn?«
»Du weißt, warum ihr so oft abgelehnt worden seid«, sagte ich. »Da ist diese Sache mit Sagash und Jagadev.« Ich zögerte, wählte meine Worte mit Bedacht. »Es gibt Magier, die deshalb weniger besorgt wären.«
»Schwarzmagier?«, fragte Anne leise.
»Nicht nur«, sagte ich. »Es ist bloß … Sieh mal, bisher war ich ziemlich wählerisch bei den Magiern, die ich angefragt habe. Kam mir etwas auch nur ein bisschen komisch vor, habe ich es gelassen. Das könnte ich ändern. Zwar würde ich das nicht gern tun … Denn so, wie die Dinge gerade stehen, habt ihr keine Rechte nach den Gesetzen der Magier. Ihr habt ein wenig Schutz, weil ihr bei mir wohnt, aber nicht viel, und ich habe nicht gerade wenig Feinde. Mir gefällt der Gedanke gar nicht, dass ihr bei einem Magier unterschreibt, dem ich nicht vertraue, aber auf lange Sicht könnte euch das tatsächlich mehr Schutz verschaffen.«
Anne hatte mir ruhig zugehört und mich aufmerksam beobachtet. Sie dachte einen Moment lang nach, während ich meinen Teller leerte, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein.«
»Nicht alle sind schlimm, es sind lediglich welche dabei, bei denen ich nicht ganz sicher bin.«
»Dann möchte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Ich möchte nicht Lehrling bei einem Magier sein, dem ich nicht vertraue. Lieber gar keinen Meister als einen schlechten.«
»Es könnte eine Weile dauern …«
»Dann warte ich«, sagte Anne. »Es ist mir egal, wie lange es dauert. Ich war Sagashs Lehrling, so was mache ich nicht noch einmal, nie wieder.« Ihr Blick war ruhig, und die Wut darin ließ mich aufmerken. »Solange es die Chance gibt, dass sie so sein könnten wie er, schließe ich mich ihnen nicht an.«
Überrascht lehnte ich mich zurück. »Okay. Dann streichen wir den Plan wohl besser.«
Anne starrte durch mich hindurch, und kurz fragte ich mich, wann ich diese Miene bei ihr zuvor schon gesehen hatte. Eine Erinnerung flackerte auf: Grünes Licht blitzte auf Knochen, ein Körper, der fiel …
Anne schien zu merken, was sie tat, und der Moment war vorüber. »Ähm …« Sie strich sich die Haare zurück, wandte das Gesicht ab, plötzlich beschämt. »Tut mir leid, ich wollte nicht … Ist es okay, dass wir noch eine Weile hierbleiben? Ich möchte nicht …«
»Das ist in Ordnung«, sagte ich trotz meiner Neugier. Was hatte das jetzt ausgelöst? »Ihr seid lange genug bei mir und habt mitbekommen, wie aktiv mein Sozialleben für gewöhnlich ist. Es ist nett, mal jemanden zum Reden zu haben.«
»Dir macht es nichts aus, dass es so beengt ist?«, fragte Anne. »Ich meine, die Wohnung ist nicht sehr groß.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich bin genügsam. Solange ihr nicht in meinem Zimmer schlaft, ist alles gut.« Als ich das sagte, fiel mir auf, dass ich früher immer Probleme hatte zu schlafen, solange noch jemand in der Wohnung war. Diesen Reflex lösten Anne und Variam aus irgendeinem Grund nicht aus.
Annes Mundwinkel hoben sich, doch ihr Lächeln verblasste schnell wieder. Es sah aus, als nähme sie all ihren Mut zusammen, um mich etwas zu fragen.
»Was ist?«, fragte ich also.
»Äh …«, sagte Anne. »Es ist nur … dir ist es nicht unangenehm, wenn ich in deiner Nähe bin, oder?«
Ich sah sie überrascht an. »Das ist eine seltsame Frage. Nein, warum?«
Anne sah weg. »Magier … mögen es für gewöhnlich nicht, wenn ich ihnen nahe bin.«
»Warum nicht?«
»Nun …« Anne schwieg, dann setzte sie neu an. »Die Gefühle eines Menschen zeigen sich im Körper. Die Anspannung, wie sie sich bewegen … Wenn sie Angst haben oder sich unbehaglich fühlen, sehe ich es.«
Verwirrt blickte ich Anne an. »Okay.« Ich hatte das Gefühl, dass sie mir etwas zu sagen versuchte, aber ich war nicht sicher, was.
Da hörte ich die Hintertür von unten. »Vari ist zurück«, sagte Anne, bevor ich nachsehen konnte. Sie stand auf und nahm die Teller mit zur Spüle. Ich wollte sie noch etwas fragen, aber da hörte ich Variam auch schon die Stufen hinauflaufen, also beschloss ich, die Fragen für ein anderes Mal aufzuheben. Variam trat ein, und als wir endlich sortiert hatten, wer die Dusche zuerst benutzen sollte, hatte ich es wieder vergessen.
2
Annes und Variams Verabredung sollte um elf Uhr stattfinden. Sie trafen sich mit einer Magierin, die man mir empfohlen hatte, weil sie mir vielleicht bei meinem Problem helfen könnte, einen Meister für die beiden zu finden. Die beiden machten sich auf den Weg, und ich wollte den Abwasch erledigen, stellte aber fest, dass Anne das bereits getan hatte, also ging ich nach unten und schloss den Laden auf.
Setze ich mich nicht gerade mit lebensbedrohlichen Situationen auseinander, führe ich das Arcana Emporium, der langatmige Name für ein »Geschäft für Magie«. Ich mache nicht publik, dass ich ein Magier bin, aber ich vertusche es auch nicht, und im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass man mit vielem durchkommt, solange man nur dreist genug ist. Verbirgt man etwas mit Lug und Trug, reißen einem die Leute die Bude ein, um es zu finden. Hängt man ein Schild dran, auf dem »Magieladen« steht, glaubt einem keiner.
Ich weiß immer noch nicht, wo die meisten meiner Kunden herkommen. Ich mache keine Werbung, der Laden liegt nicht an der Hauptstraße, also muss es über Mundpropaganda laufen. Gelegentlich googel ich meinen Laden, um zu sehen, was über mich so gesagt wird, und ich schwöre, da bekomme ich die schrägsten Treffer. Es gibt Leute da draußen, die glauben, ich wäre alles von einem reinkarnierten Engel aus den Pharaodynastien Ägyptens bis hin zu einem tausend Jahre alten Halbdrachen, der im Geheimen eine Queste durch Zeit und Raum sponsert in dem Versuch, sich selbst umzubringen. (Und nein, ich weiß nicht, warum.) Vermutlich sollte ich froh sein, dass es keine Slash-Fiction gibt. Allerdings schaue ich auch nicht allzu genau hin, nur für den Fall, dass es sie doch gibt.
Auf jeden Fall habe ich einen ziemlich bizarren Mix aus Kunden. Die größte Gruppe besteht aus Touristen und Kuriositätenkäufern, und mit denen komme ich ziemlich gut klar. Für sie ist Magie selbstverständlich nicht real, also tätigen sie nur eine geschäftliche Transaktion. Ich bekomme Geld, und sie bekommen dafür irgendetwas Schräges, das sie mit nach Hause nehmen können, um dort Geschichten über den lustigen Typen zu erzählen, der vorgibt, magische Gegenstände zu verkaufen. Unter diese Leute mischen sich diejenigen, die Bescheid wissen – Sensitive, Adepten, Lehrlinge und hin und wieder ein Magier. Für sie sind meine Waren wirklich gedacht, und ihnen ist klar, wie man sie gebraucht. Mit ihnen unterhalte ich mich gerne.
Die Problemkunden sind diejenigen, die zwischen diesen beiden Gruppen stehen. Sie wissen, dass Magie echt ist, aber sie erwarten, dass sie sich verhält wie … na, wie das, was sie meinen, wenn sie »wie Magie« sagen. Versteht mich jetzt nicht falsch, mit Magie kann man ziemlich beeindruckendes Zeug bewirken, aber es gibt Grenzen und Regeln. Pfuscht man mit ihr herum, ohne zu wissen, was man tut, macht man sich sein Leben sehr wahrscheinlich viel komplizierter, als dass es einem hilft. Magie ist keine Universallösung für die Probleme, die man gerade so hat.
Das hält die Leute dennoch nicht davon ab, hereinzukommen und von mir zu erwarten, dass ich ihre Probleme für sie löse.
Der Mann trat vor und klatschte etwas auf die Ladentheke. Dann starrte er mich böse an. »Und?«
»Hm?«, machte ich.
Er deutete auf sein Mitbringsel. »Wissen Sie, was das ist?«
Ich sah das Ding auf meinem Tresen an. Es war mit silbernen Schuppen bedeckt, und es roch. »Das ist ein Fisch.«
»Wissen Sie, woher der ist?«
»Ich schätze, aus dem Meer.«
»Der war auf meinem Stuhl. Da kam der her.«
»Okay«, sagte ich. »Passiert das oft?«
»Das ist das dritte Mal!«
»Also … haben Sie möglicherweise die Aufmerksamkeit eines zwanghaft spendablen Fischhändlers auf sich gezogen?«
»Was?« Der Mann starrte mich an. »Von was reden Sie da?«
»Tut mir leid. Was ist Ihrer Meinung nach das Problem?«
»Das Problem«, sagte der Mann und sprach langsam und deutlich, »ist, dass es ein Fluch ist.«
»Ah«, sagte ich. »Und das wissen Sie, weil …?«
»Meine Katze es mir gesagt hat.«
»Ihre Katze«, erwiderte ich. »Klar. Das ergibt jetzt langsam Sinn.«
Der Mann verdrehte die Augen. »Wissen Sie was, vergessen Sie’s, ich kümmer mich selbst drum. Wo sind Ihre Zauberzutaten?«
Ich deutete darauf. »Zweites Regal in der Ecke.«
Der Mann drehte sich um und ging davon. »Hey«, rief ich. »Könnten Sie bitte Ihren Fisch mitnehmen?«
Die nächsten drei Kunden wollten ein Messer, eine Auswahl an Kräutern beziehungsweise eine Kristallkugel. Kundin Nummer vier hielt eine ausführliche Tirade darüber ab, dass der Laden gestern geschlossen war, obwohl auf dem Schild stand, er mache erst um fünf zu, und ob ich wüsste, wie viel Reisezeit sie das gekostet hätte. Als sie aufhörte, mir mit der Verbraucherschutzbehörde zu drohen, und davonstürmte, hatte sich hinter ihr eine Schlange gebildet.
Luna kam gerade rein, als ich mit Kunde Nummer … irgendwas dran war, ein bärtiger Typ in einem abgetragenen Lederjackett. Er roch nach Bier und brauchte sehr, sehr viel länger, als normal war, um zu begreifen, dass ich ihm keinen Liebestrank verkaufen würde.
»Hi, Alex!«, rief Luna über den Klang der Ladenglocke hinweg.
»Ich habe dir bereits gesagt, da gibt es keine Formel«, erklärte ich dem Mann. »Wenn es die gäbe, würde Chanel längst ein Parfum damit verkaufen … Wo warst du?«
»Der Duellkurs hat länger gedauert«, sagte Luna und schob sich zwischen den Kunden durch. Ich sah, wie sich der silberne Nebel an ihren Körper schmiegte, wie er in einer dichten, engen Lage an ihren Trainingsklamotten haftete, statt nach den Leuten im Laden zu tasten. Früher einmal hätte Luna niemals so nahe an eine Menge herankommen dürfen – sie wäre am Rand stehen geblieben –, aber sie ist nun seit mehr als einem Jahr mein Lehrling, und seither hat sie es weit gebracht. Nicht nur, was ihre magischen Fähigkeiten angeht, sondern auch ihr Selbstbewusstsein. »Kann ich bei dir duschen?«
»Hm? Ja klar.« Luna verschwand im Flur, der zu der Treppe hinauf in meine Wohnung führte, und ich wandte mich dem Mann am Tresen zu.
»Hör mal, du musst mir helfen«, fing er wieder an.
»Sieh mal«, erwiderte ich. »Selbst wenn ich dir einen Liebestrank mischen könnte – was ich nebenbei bemerkt nicht kann –, hast du irgendeine Ahnung, wie unethisch das wäre? Du pfuschst da mit jemandes Gefühlen herum. So was macht man nicht ohne einen wirklich guten Grund.«
Luna steckte den Kopf wieder in den Laden. »Hey, Alex? Soll hier draußen ein Fisch liegen?«
Ich hielt mir kurz die Augen zu. »Nein. Sollte er nicht.«
»Was soll ich damit machen?«
»Hör mal«, sagte der Mann wieder. »Du musst mir helfen.«
»Nein, muss ich nicht«, sagte ich zu ihm und wandte mich dann an Luna. »Ist mir egal. Leg ihn in den Gefrierschrank oder so.«
»Bist du sicher?«
»Warum?«
»Verdirbt das nicht angeblich den Geschmack?«
»Hör mal, ich brauch ihn wirklich«, sagte der Mann.
»Ist mir egal«, sagte ich zu beiden, dann sah ich Luna an. »Tu ihn dahin, wo auch immer du ihn hintun solltest.«
»Und wo ist das?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Na«, sagte Luna, »essen wir den zu Abend, oder ist der für was anderes gedacht?«
»Ist mir egal! Bring ihn einfach weg!«
Luna verschwand mit dem Fisch. »Äh, Entschuldigung«, sagte ein Junge, der um die zwanzig war. Er wartete seit fünf Minuten hinter dem Liebestrankkerl und wippte mit dem Fuß. »Haben Sie …?«
»Nein«, sagte ich, dann wandte ich mich wieder an den Mann. »Ich kann dir nicht helfen, und ich garantiere dir, dass es nur schlimmer wird, wenn du es auf die Art versuchst. Bring das auf die normale Tour in Ordnung.«
Der Liebestrankkerl starrte mich hoffnungslos an. »Ich kann nicht.«
Mr. Ungeduldig fing wieder an. »Entschuldigen Sie, ich brauche …«
»Die habe ich nicht«, sagte ich.
Luna streckte wieder den Kopf herein. »Hey, Alex?«
»Was ist jetzt?«
»Da sind etwa ein Dutzend weiterer Fische in deinem Schlafzimmer.«
Ich schloss die Augen. »Bitte sag mir, dass du dir das ausgedacht hast.«
»Jap.«
Ich öffnete die Augen und starrte sie an. Luna grinste.
»Konnte nicht widerstehen, tut mir leid. Der erste Fisch war aber echt. Ich hab ihn in den Kühlschrank getan.«
Ich holte tief Luft, berechnete im Kopf die Flugbahnen zwischen den Gegenständen in meiner Nähe und Lunas Kopf, aber sie trat rasch den Rückzug an. »Hör mal«, sagte der Mann da erneut.
»Nein«, entgegnete ich. »Du hast mir die Geschichte zweimal erzählt, und ein drittes Mal wird nicht helfen.«
»Ich brauche …«, setzte Mr. Ungeduld an.
»Ich habe dir bereits gesagt, ich habe sie nicht.«
»Aber Sie haben nicht …«
»Ändert nichts an der Tatsache, dass das hier nicht diese Art von Laden ist.«
»Aber …«
»Die sind echt, kein Fake, und nur weil ich Messer verkaufe, heißt das nicht, dass ich Karten verkaufe.«
»Hör mal«, sagte der Liebestrankkerl.
Ich sah zwischen Liebestrankkerl und Mr. Ungeduld hin und her, beantwortete Fragen, ohne darauf zu warten, dass sie sie stellten. »Nein, nein, ja, nein, es würde nicht helfen, ja, jeden Tag, es ist egal, denn ich würde es trotzdem nicht machen, ich habe das bereits ausprobiert, versuch einfach, mit ihr zu reden, zuerst einmal weil sie nicht gewinnbringend genug sind und zweitens weil es mir egal ist, wenn du es tust, dann, weil sie versuchen, dich reinzulegen, die Magic Box auf der anderen Seite von Camden, und hier ist eine ihrer Karten.« Ich ließ eine Visitenkarte in Mr. Ungedulds Hand fallen und sah zwischen den beiden hin und her. Sie starrten mich an. »Sind wir hier fertig? Da ist nämlich ein Typ hinter euch, der rausfinden will, wie viel Geld ihm in einem Testament überlassen wurde, und auch er wird ein Nein nicht als Antwort akzeptieren.«
Wir waren nicht fertig. Es dauerte fast eine Stunde, die ganze Meute loszuwerden, aber wenigstens gingen die Irren alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit, vermutlich einem seltsamen magnetischen Prinzip folgend. Als Luna zurückkam, war der Laden leer. Ich saß zusammengesunken auf dem Stuhl und sah sie finster an.
»Tut mir leid«, sagte Luna in einem »Tut mir gar nicht leid«-Tonfall.
»Witzig, wie du deine Scherze immer dann machst, wenn ich zu beschäftigt bin, um dich zu jagen.«
»Ach, komm schon«, sagte Luna mit einem Grinsen. »Dein Gesichtsausdruck war zum Schreien.«
»Ich habe eine Vision«, sagte ich. »Das sind meine mystischen Wahrsagerkräfte. Ich sehe, wie ich dir plötzlich sehr viele Schichten mehr im Laden übertrage.«
»Nein, das wirst du nicht«, sagte Luna vollkommen überzeugt.
»Oh, wirklich?«
»Du wirst mich nicht dazu zwingen«, sagte Luna. »Du behältst den Laden nämlich nur, damit du selbst hinter der Theke stehen kannst.«
Ich blinzelte und sah sie an. »Wie kommst du darauf?«
Als ich Luna zum ersten Mal traf, war sie einundzwanzig. Jetzt ist sie dreiundzwanzig, hat blaue Augen, helle Haut und gewelltes Haar und ist halb Engländerin und halb Italienerin. Ihr Leben hat sich in den letzten zwei Jahren trotz gelegentlicher Intermezzi mit Gefahr und Gewalt stetig verbessert. Luna war immer schon fit, aber in letzter Zeit ist sie zu einer echten Athletin geworden. Letzten Winter hatte sie Bekanntschaft mit dem Azimuth-Duell gemacht, und seither trainiert sie hart. »Na, du machst es nicht wegen des Geldes«, sagte Luna. Ihr Haar war feucht, und daher war es nicht hellbraun, sondern dunkler. Während sie sprach, entwirrte sie es mit einer Haarbürste.
»Er bringt Profit.«
»Nicht viel.«
»Woher weißt du das?«
»Weil ich dir deinen Bestand beschafft habe, erinnerst du dich?«, sagte Luna. Sie hatte Teilzeit für mich gearbeitet und magische Gegenstände beschafft, bevor sie mein Lehrling wurde. Ich hatte sie ihr abgekauft und sie aufgeteilt: Die schwächeren stellte ich im abgetrennten Bereich des Ladens zum Verkauf, und die gefährlichen behielt ich für mich. »Du verkaufst kaum je den teuren Kram.«
»Hast du dir meine Bücher angesehen?«
»Du hast keine richtigen, das habe ich überprüft. Auf jeden Fall würdest du feste Zeiten einhalten, wenn es dich so sehr kümmern würde.«
»Ich habe feste Zeiten.«
»Falls nichts dazwischenkommt.«
»Es kommt immer etwas dazwischen.«
»Du könntest einen Assistenten einstellen«, sagte Luna. »Wenn du wirklich die Arbeit auf jemand anders abwälzen wolltest, dann hättest du das schon längst gemacht.«
»Nun, ja.« Seit Jahren hatte ich vage Pläne, jemanden einzustellen, aber ich hatte es immer vor mir hergeschoben. Zum einen gibt es nicht viele Menschen, denen ich den Job zutraue, aber selbst wenn ich jemanden finden könnte, bin ich nicht sicher, ob ich das will. Die Leute in der magischen Gemeinschaft, denen ich mich am nächsten fühle, sind keine etablierten Magier, sondern die Habenichtse – Lehrlinge, Adepten, weniger Talentierte und all die anderen unbedeutenden Praktizierenden da draußen –, und es sind zugleich die, denen ich dank meines Ladens begegne.
Luna band ihre Haare zu einem Pferdeschwanz. »Mit wem treffen Anne und Vari sich diesmal?«
»Ihr Name ist Dr. Shirland«, sagte ich. »Geistmagierin. Sie ist eine Unabhängige.«
»Wie wird sie Anne und Vari unterrichten, wenn sie eine Geistmagierin ist?«
»Das wird sie nicht, aber sie könnte jemanden kennen, der dazu bereit und in der Lage ist. Ich habe gehört, dass sie eine Art Beraterin ist. Ich hoffe, sie verschafft Anne und Vari ein Vorstellungsgespräch mit einem Lebens- oder Feuermagier, der sie unterrichten könnte.«
»Oh, wie der Typ, mit dem sie sich im Frühjahr getroffen haben?«
Ich verdrehte die Augen. »Lass uns hoffen, dass es diesmal etwas besser läuft. Das wäre das Letzte, was wir gebrauchen können …« Ein Zukunftsstrang erregte meine Aufmerksamkeit, und ich hörte auf zu reden und konzentrierte mich darauf.
Luna legte den Kopf schief. »Was ist?«
»Da kommt jemand«, erwiderte ich. Das Muster war anders als das eines normalen Kunden. Ich konzentrierte mich auf die Zukunft, in der sie durch die Tür trat, und sah Auren aufflackern. »Eine Magierin.«
Luna sprang von der Theke, wo sie gesessen hatte, sofort wachsam. »Ärger?«
»Glaube nicht.« Ich hielt Ausschau nach einem Kampf, sah aber nichts. »Hol deinen Fokus, für alle Fälle.«
Luna verschwand. Ich ging zur Tür und drehte das Schild auf Geschlossen, dann kehrte ich zur Theke zurück und sah kurz nach den Waffen, die darunter deponiert waren. Als Luna wieder auftauchte, stand ich hinter dem Tresen und wartete. Ein paar Sekunden später erklang die Glocke, und die Tür schwang auf.
Ich beobachtete die Frau, seit sie die Straße hinabgegangen war, und bis sie in den Laden trat, hatte ich sie mir bereits eingehend angesehen. Sie war groß und kräftig, mit braunem Haar und einem runden Gesicht mit angenehmen Zügen, und sie trug einen weit geschnittenen Anzug.
»Hi«, sagte sie und sah von Luna zu mir. »Verus, ja?«
»Ja«, sagte ich. Und du bist Wächterin Caldera.
»Wächterin Caldera. Schön, Sie kennenzulernen.« Caldera trat vor und schüttelte mir die Hand. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir kurz reden?«
Wächter sind Vollstrecker für den Rat der Weißmagier, eine Mischung aus Soldaten, Polizei und internen Ermittlern. Die meisten Magier begegnen ihnen mit Misstrauen, und das aus gutem Grund: Möchte ein Wächter mit einem reden, steckt man für gewöhnlich in Schwierigkeiten. »Hängt vom Thema ab.«
»Das hier ist keine Ermittlung«, sagte Caldera. »Ich möchte nur ein paar Fragen zu einer Sache stellen, an der ich gerade arbeite.«
Ich zögerte. Ich war nicht erpicht darauf, mit einem Wächter zu reden, aber wenn ich Caldera abwimmelte, würde sie wahrscheinlich einfach wiederkommen.
»In Ordnung«, sagte ich langsam. »Aber nicht hier.« Ich habe andere Magier nicht gern in meinem Laden, und ich wollte nicht, dass Kunden durch das Fenster blickten und uns sahen.
»Klar«, sagte Caldera. »Es gibt einen wirklich netten Pub gleich hier um die Ecke. Ich gebe ein Pint aus.«
»Öh …« Okay, das war nicht die Wächterstandardprozedur, soweit ich wusste. »Ich denke, das geht. Ich mache den Laden dicht, und wir treffen uns draußen.«
Calderas Definition von »um die Ecke« stellte sich als eher optimistisch heraus, wir brauchten rund zwanzig Minuten durch die geschäftigen Straßen Camdens. Luna blieb immer einen halben Schritt hinter mir, damit ich außerhalb des Radius ihres Fluchs war. Caldera hatte sie nicht ausdrücklich eingeladen, aber als ich ihr mit einem Wink bedeutet hatte mitzukommen, hatte Caldera ihr nur einen Blick zugeworfen und nicht widersprochen. Die ganze Zeit über blieb ich wachsam, hielt nach Gefahr Ausschau: Caldera verhielt sich nicht besonders verdächtig, aber meine vergangenen Erfahrungen mit Wächtern waren nicht gerade positiv. Ich sah nichts: Falls ich in Gefahr war, dann zumindest nicht unmittelbar.
Der Pub, den Caldera ausgesucht hatte, sah aus, als wäre er irgendwann während der Eisenzeit erbaut worden, ein altes, schiefes Gebäude mit krummen Böden und niedrigen Decken, voller Ecken und Winkel. Es war offensichtlich nicht für große Menschen gemacht, und ich musste den Kopf einziehen, um Caldera die Treppe hinab in den Steinkeller zu folgen.
»Gut«, sagte sie, nachdem sie uns an den Gästen vorbei in eine abgeschirmte Ecke geführt hatte. »Was nehmen Sie?«
»Nur eine Cola, bitte«, sagte Luna.
»Ernsthaft?«
»Ich trinke nicht.«
»In Ordnung. Sie?«
»Was immer es vom Fass gibt«, erwiderte ich.
Caldera zuckte zusammen. »Okay – ich hol uns was Gutes.« Sie ging zur Bar.
»Ist sie wirklich eine Wächterin?«, fragte Luna, nachdem Caldera weg war.
»Oh ja«, erwiderte ich und betrachtete die Zeichnungen und Fotos an den versifft wirkenden gestrichenen Ziegelwänden. In der Zukunft hatte ich bereits gesehen, wie Caldera mir ihr Wächtersiegel mit dem unverwechselbaren magischen Fingerabdruck zeigte, als ich sie darum bat. »Obwohl mich zum ersten Mal einer in einen Pub einlädt.«
»Na dann«, sagte Caldera, die mit den Drinks zurückkehrte. Sie stellte sie vor uns ab und ließ sich mit einem zufriedenen Seufzen in die Ecke sinken.
Ich warf einen skeptischen Blick auf den Inhalt meines Pintglases. »Was ist das?«
»Porter«, sagte Caldera. »Probieren Sie.«
Ich sah in die Zukunft, um sicherzugehen, dass es mich nicht vergiften würde, dann nahm ich einen Schluck. Ich hob die Brauen. »Hm.«
»Gut?«
»Irgendwie … interessant.« Ich nahm noch einen Schluck. Der Geschmack war fruchtig mit einem seltsamen Nachgeschmack.
»Ziemlich gut, oder?«, fragte Caldera. »Schmecken Sie den gerösteten Kaffee, wenn der rosinenartige Anklang nachlässt? Nicht viele Pubs in London verkaufen das Zeug. Sie brauen es nur in London, in Flaschengärung – man muss es vorsichtig ausschenken, damit die Hefe am Boden bleibt.«
»Mh. Muss ich nächstes Mal wieder trinken.«
»Na dann. Hab ich was Gutes getan heute.«
Ich warf Caldera einen amüsierten Blick zu. »Nicht dass ich Ihre Bierexpertise in Zweifel ziehen möchte, aber Sie wollten mich eigentlich etwas fragen?«
»Richtig.« Caldera blickte zu Luna. »Ist es für Sie in Ordnung, wenn sie dabei ist?«
»Luna ist mein Lehrling«, sagte ich. »Sie können ihr alles erzählen, was Sie mir erzählen würden.«
Luna warf mir einen raschen, warmen Blick zu.
»In Ordnung«, sagte Caldera und sah mich direkt an. »Es geht um Ihren alten Meister, Richard Drakh.«
Ich spürte, wie meine Muskeln sich anspannten. Meine Vergangenheit mit Richard war die eine Sache, über die ich nicht mit Luna sprechen wollte – oder sonst jemandem, wenn wir schon dabei waren. »Was ist los?«
»Es gibt Gerüchte«, sagte Caldera und beobachtete mich aufmerksam. »Dass er zurückkommt.«
Die alten halb verheilten und nie geheilten Erinnerungen blitzten in meinem Kopf auf, Angst und Hilflosigkeit und Schmerz. Ich verbannte sie mit einiger Anstrengung, dann antwortete ich mit ruhiger Stimme: »Es gibt immer Gerüchte.«
»Es ist zehn Jahre her.«
»Na und?«
»Also kommen sie nicht einfach so aus dem Nichts, oder?«, sagte Caldera. »Die Chefs wollen wissen, was da vor sich geht.«
»Weil sie keine eindeutigen Beweise haben?«
»Darf ich nicht sagen.«
Calderas Pokerface war nicht schlecht, aber ich bin ziemlich gut darin, Menschen zu lesen, und ich wusste, dass die Antwort auf meine Frage Ja lautete. Der Rat hatte keinen Beweis, dass Richard zurück war – sie fischten bloß im Trüben. Meine Anspannung legte sich ein wenig. Luna beobachtete uns beide neugierig über ihre Cola hinweg. »Sie hoffen, dass ich etwas weiß«, sagte ich. »Weil ich Richards Lehrling war. Richtig?«
»So ziemlich.«
»Ich habe ihn seit mehr als zehn Jahren nicht gesehen.« Ich begegnete Calderas Blick. »Sie haben sich vermutlich meinen Werdegang angesehen?«
Calderas Miene zeigte keine Regung. »Habe die Geschichte gehört.«
»Dann wissen Sie, warum ich gegangen bin«, sagte ich. »Ich habe nichts über ihn gehört. Nicht, als ich weg bin, und nicht, nachdem ich weg war. Und wissen Sie, was? Das ist in Ordnung für mich.«
Caldera hielt meinen Blick für eine Sekunde fest. »In Ordnung«, sagte sie nach einer Weile. »Was ist dann mit dieser Auserwählten? Deleo. Weiß sie etwas?«
Ich sah weg. »Deleo und mich kann man nicht gerade als Freunde bezeichnen.«
»Sie hatten letztes Jahr Kontakt mit ihr, richtig?«
»Kurz.«
»Irgendwas in Erfahrung gebracht?«
»Ja.« Ich wandte mich wieder Caldera zu. »Dass Deleo verrückter ist als ein Sack tollwütiger Wiesel. Wenn Sie sie befragen möchten, nur zu, aber ich stelle mich währenddessen bestimmt nicht neben Sie.«
Caldera machte eine beschwichtigende Geste. »Gut. Sehen Sie, wir haben nicht viele, die wir fragen können. Schwarzmagier kooperieren nicht mit einer Wächterin.«
»Sie kooperieren mit niemandem. Und ich bin ein Abtrünniger, schon vergessen? Denken Sie, sie würden mir vertrauen?« Ich schüttelte den Kopf. »Was sollte dabei herauskommen?«
»Also gut«, sagte Caldera. »Es sieht so aus: Ich habe Richard nicht aktiv erlebt, aber soweit ich es gehört habe, hat er einer Menge von Leuten Angst gemacht. Einige Wächter glaubten, dass er einen Plan hatte, mit den Schwarzmagiern an etwas Großem arbeitete, keine Ahnung. Dann verschwindet er ganz plötzlich, gerade als er in Bestform ist. Gerüchten zufolge ist er irgendwo hingegangen, aber er tauchte nie wieder auf, und seine beiden Lehrlinge auch nicht. Nach ein paar Jahren haben diejenigen, die mit dem Fall zu tun hatten, Richard und diese beiden Lehrlinge als vermisst-mutmaßlich-tot verbucht und alles vergessen.«
Mit »diese beiden Lehrlinge« waren Tobruk und Shireen gemeint. Deleo und ich waren Nummer drei und vier gewesen. »Hätten sie Richard gekannt, hätten sie ihn nicht als mutmaßlich-irgendwas verbucht.«
»Was denken Sie, wo ist er hin?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Ich dachte, Wahrsager wüssten alles.«
»Richard verschwand im Sommer vor zehn Jahren«, erwiderte ich. Wenn ich recht überlege, dann sind es ziemlich genau auf den Tag zehn Jahre. Damals war August, und jetzt ist August. »Als er verschwand … Nun, sagen wir einfach, er und ich standen nicht gerade gut miteinander.«
»Sie müssen aber doch einen Hinweis haben«, sagte Caldera. Sie hatte sich vorgebeugt, die Hände verschränkt, und wirkte offen und überzeugend. »Kommen Sie schon. Sie wollen mir nicht ernsthaft weismachen, dass Sie absolut nichts wissen.«
»Sie haben keine Ahnung, wie Richard war«, sagte ich leise. Ich hielt Calderas Blick fest, ließ die Erinnerungen ein wenig durchscheinen, damit sie sah, dass ich die Wahrheit sagte. »Diese Magier taten richtig daran, ihn zu fürchten. Glauben Sie, dass er mir von seinen Plänen erzählt hätte? Ich wohnte zwei Jahre in seinem Haus, und am Ende wurde mir nur klar, wie viel ich nicht über ihn wusste. Was man über ihn erfuhr, das erfuhr man nur, weil er es so wollte.«
»Sie sind Wahrsager, richtig? Haben Sie denn niemals hingesehen?«
»Das funktioniert so nicht«, sagte ich und schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Caldera. Ich habe nichts für Sie. Ich habe keine Ahnung, was Richards Plan war. Soweit es mir bekannt ist, wusste das niemand.«
Stille senkte sich über den Tisch. Caldera lehnte sich zurück; mir war klar, dass sie enttäuscht war. Mein Telefon piepte, und ich sah auf das Display. »Ich gehe besser.«
Caldera hielt mir eine Karte hin. »Wenn Ihnen irgendwas einfällt oder wenn etwas passiert, rufen Sie mich an, okay?«
Ich zögerte, dann schob ich sie in meine Tasche. »Danke für das Pint.«
»Von wem war die Nachricht?«, fragte Luna, als wir wieder auf der Straße standen.
»Anne«, sagte ich. »Sie schrieb, sie sind fertig, aber Anne kommt erst spät zurück.« Ich runzelte die Stirn. Die Nachricht klang falsch. Ich blickte in die Zukünfte, in denen ich Anne und Variam anrief, um mich zu vergewissern, dass mit ihnen alles in Ordnung war. Sie gingen an ihre Telefone …
Ich kam wieder in die Gegenwart und begriff, dass Luna mich etwas über Caldera gefragt hatte. »Nicht sicher«, sagte ich. »Hör mal, ich glaube, ich statte unserer Geistmagierberaterin mal einen Besuch ab. Du gehst zurück in den Laden und triffst dich mit Vari.«
»Kann ich nicht mitkommen?«
»Nächstes Mal. Und überhaupt, ich führ dich heute Abend aus, schon vergessen? Mach dich fertig.«
Luna hatte weiterbohren wollen, aber das lenkte sie ab. »Wohin gehen wir?«
»Das ist eine Überraschung.«
»Welche Art von Überraschung?«
»Eine lehrreiche Überraschung.«
Luna warf mir einen misstrauischen Blick zu. »Das wird Spaß machen«, sagte ich. »Zieh was Schönes an.«
»Wie eine Kampfmontur?«
»Das überlasse ich dir. Denk dran, sieben Uhr. Komm nicht zu spät.«
Von Camden nach Brondesbury kommt man am schnellsten mit der oberirdischen Linie, die früher Silverlink Metro hieß, jetzt aber unter dem einfallslosen Namen London Overground geführt wird. Ich sah North Central Londons Dächer und Gärten vorbeiziehen, dann stieg ich aus und lief zu dem Haus, in dem sich Anne und Variam mit Dr. Ruth Shirland getroffen hatten.
Dr. Shirland lebte in einem Reihenhaus in einer kleinen, geschlossenen Straße. Es lag in einem Wohngebiet der soliden Mittelschicht, wo man sehr viel mehr für die Lage als für das Haus an sich bezahlt. Hier rechnet man nicht wirklich mit einer Magierin, aber ich hatte schon Seltsameres gesehen. Ich klingelte und wartete.
Dr. Shirland öffnete die Tür. Sie war um die sechzig, klein und zierlich mit lockigem grauem Haar, einer runden Brille und Lachfältchen. »Oh, hallo«, sagte sie. »Alex Verus, ja? Kommen Sie herein.«
»Danke.«
Sie führte mich in ein gemütliches Wohnzimmer mit einer bescheidenen Anzahl an Stühlen und vielen Bücherregalen. Ich nahm Tee, lehnte Kekse ab und wurde von einem dicken schwarz-weißen Kater in Augenschein genommen, der an meiner Hand schnüffelte, mir dann gestattete, ihn zu streicheln, und sich anschließend auf einem Sessel zusammenrollte, der sichtlich für seinen Gebrauch reserviert war. »Danke, dass Sie mich empfangen«, sagte ich.
»Das ist kein Problem«, sagte Dr. Shirland. »In einer Stunde erwarte ich jedoch einen Patienten.«
»Einen Patienten?«
»Ich bin psychologische Beraterin«, sagte Dr. Shirland. »Ich habe mit Magiern zu tun, aber ich führe auch eine normale Praxis.«
»Gedankenlesen macht Psychologie bestimmt einfacher. Lesen Sie meine?«
Dr. Shirland hob eine Augenbraue. »Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sagte, dass ich es nicht tue?«
»Vermutlich nicht.«
»Warum nicht?«
»Nennen Sie es Vorsichtsmaßnahme«, sagte ich. »Außerdem können die meisten Magier meiner Erfahrung nach nie widerstehen, ihre Mächte einzusetzen.«
»Würden Sie sich selbst in diese Kategorie einordnen?«
»Ich kann keine Gedanken lesen.«
»Aber Sie können sehen, was jemand sagen wird.«
»Sie hingegen können im Kopf von jemandem etwas sehen, selbst wenn er das nicht sagen wird.«
»Es ist eigentlich komplizierter«, sagte Dr. Shirland, »doch die meisten befassen sich nicht mit den technischen Details. Ich nehme an, sie unterscheiden auch nicht groß dazwischen, dass Sie in der Lage sind, einen Teil ihrer Handlungen vorauszusagen, aber nicht alle?«
»Üblicherweise nicht.«