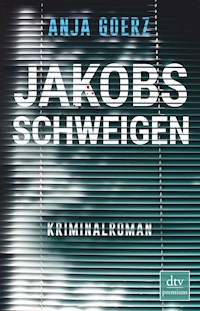9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
30. Jahrestag der Maueröffnung am 9.11.2019 Die Mauer ist in den Köpfen der Menschen noch nicht verschwunden. Warum ist das so? Warum fühlen sich im Osten sozialisierte Menschen oft so ungerecht behandelt? Haben die Wessis einfach alles plattgemacht und nach ihren Regeln umgebaut? Anja Goerz porträtiert ganz unterschiedliche Menschen. Eingeflossen ist viel Biografisches, erzählt wird aber auch von Motivationen und Haltungen, Verletzungen und Chancen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Anja Goerz stellt ganz unterschiedliche Menschen aus der ehemaligen DDR vor. In die Porträts ist viel Biographisches eingeflossen, erzählt wird aber auch von Motivationen und Haltungen, Verletzungen und Chancen. Ein Spitzenkoch hat lange seine Herkunft verschwiegen, um nicht ausgeschlossen zu werden, eine Nancy ändert ihren Vornamen bei ersten Begegnungen gerne in Anna, um nicht gleich als Ossi-Frau abgestempelt zu werden, ein Polizist trauert immer noch um sein verlorenes Land.
Und es gibt auch den umgekehrten Blick von West nach Ost. So berichtet etwa Wolfgang Klein über Erlebnisse als ARD-Korrespondent in Ostberlin oder eine ehemalige Bankauszubildende erzählt, wie es war, als sie das Begrüßungsgeld verteilte.
Mit Fotos, die das »Ostgefühl« widerspiegeln.
ANJA GOERZ
Der Osten ist ein Gefühl
Über die Mauer im Kopf
Vorwort
Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass ›Der Osten ist ein Gefühl‹ zum Besteller wurde. Seitdem habe ich unzählige Gespräche darüber geführt, ob und warum das Thema Ost und West immer noch zu Streit und Uneinigkeit führt und wann das endlich aufhört.
Den Anstoß zu diesem Buch gab damals ein Kollege, mit dem ich beim Rundfunk Berlin-Brandenburg zusammenarbeitete. Knut (dessen Geschichte Sie in diesem Buch finden) war auch fünfundzwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer der Ansicht, dass seine Landsleute aus dem Osten viel zu viele Nachteile erleiden. Seiner Meinung nach war das Interesse der »Ossis« an den »Wessis« immer größer gewesen als umgekehrt.
Der rbb war zu der Zeit das Epizentrum zwischen den »Typisch Ossi« – und »Scheiß Wessi«-Welten, hier prallten und prallen Mentalitäten aufeinander. Knuts These beschäftigte mich, und ich wollte genauer wissen, was die ost-westlichen Befindlichkeiten ausmacht. Deshalb habe ich ganz unterschiedliche Menschen aus der ehemaligen DDR zu ihrem Leben befragt. Manche von ihnen kannte ich bereits durch meine Arbeit beim Radio, von anderen habe ich durch meine Gesprächspartner erfahren, wieder andere habe ich gezielt gesucht, weil mich ein bestimmtes Thema interessiert hat. Während der Recherche habe ich selbst viel darüber nachgedacht: Wie war das eigentlich im Westen, welche Frisuren hat man getragen, welche Vornamen waren populär? So habe ich versucht, einiges auch aus der Westperspektive zu beleuchten. Dieses Buch ist keine historische Aufarbeitung des Lebens in der DDR, keine politische Analyse. Sie werden keine Geschichten über den Abschied von einem System lesen und keine Berichte über das andere Leben nach dem Mauerfall. Ich wollte die Gräben zwischen Ost und West nicht vertiefen, sondern neugierig machen auf ein Land, das es nicht mehr gibt und auf die Menschen, die dort aufgewachsen sind. Mein Ziel war es, zu Neugier anzuregen, denen gegenüber, die den Osten immer noch im Herzen und im Kopf mit sich tragen.
Ich wollte Menschen kennenlernen, die in der DDR geboren und aufgewachsen sind, und begreifen, woher diese Sehnsucht nach den alten Zeiten bei manch einem rührt.
Festzustellen ist, dass das Thema Ost und West auch im Jahr 2019, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, präsent ist. Wir diskutieren weiter über Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, dabei sollten wir nicht vergessen, dass es auch zwischen Bundesländern wie Bayern und Schleswig-Holstein immer schon große Unterschiede gegeben hat – ob bei der demographischen Entwicklung oder dem Einkommen.
Heute stehen gerade die neuen Bundesländer in dem Verdacht, ein Nährboden für rechte Gewalt, Rassismus und Populismus, Neonazis und rechtsradikale Politiker zu sein.
Viele junge Menschen wandern aus den ländlichen und kleinstädtischen ostdeutschen Regionen ab und bringen ihre Kreativität und politischen Ideen im Westen ein.
Ältere erleben aus ihrer Sicht seit der Wende eine Gesellschaft, in der ihre Erfahrungen und Erlebnisse nicht zählen, ihre Biografien geradezu wertlos erscheinen.
Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren auch eine Debatte über genau dieses Thema entwickelt. Gespräche darüber, dass ein Mensch, der in zwei Systemen gelebt hat, ein nützlicher Beobachter sein kann, um politische Entwicklungen aufgrund eigener Erfahrungen zu analysieren, statt diese pauschal abzuwerten oder gar komplett zu ignorieren. Dieses Buch soll eine Einladung zu weiteren Diskussionen sein, dazu, sich für die andere Perspektive zu öffnen und Vorurteile zu hinterfragen.
Die persönlichen Eindrücke, die ich aufgeschrieben habe, lassen sich nicht verallgemeinern, einige meiner Gesprächspartner sind inzwischen an neuen Stationen in ihrem Leben angekommen, manche erleben 30 Jahre Mauerfall nicht mehr, verschiedene werden sicherlich anders über einiges denken, was sie vor fünf Jahren gesagt haben.
Eines aber zeigen alle Gespräche: Wir sollten endlich damit beginnen, denen Tribut zu zollen, die im Osten geblieben sind, um neu aufzubauen. Wir sollten Anerkennung und Wertschätzung für diejenigen entwickeln, die sich Pegida-Demonstranten entgegenstellen und für die Demokratie eintreten.
In zwanzig Jahren, wenn wir fünfzig Jahre deutsche Einheit feiern, werden mehr als die Hälfte der Deutschen nach der Wiedervereinigung geboren sein. Forscher sagen, dann haben wir ein neues Deutschland.
23 Jahre nach der staatlichen Einheit hat die Große Koalition einen Ostbeauftragten ernannt, um das Verfassungsversprechen nach gleichen Lebenschancen zu erreichen. Es wird auch Zeit! Ein Glück ist, dass Anja Goerz, eine westdeutsche Moderatorin, an der Nahtstelle des RBB kundige Menschen zusammengebracht hat, die erlebt und geschrieben haben, was an unterschiedlichem Denken und Empfinden noch immer geblieben ist. Das ist für Ost- wie Westdeutsche zum Teil aufregend, jedenfalls von gleichem Interesse. Dem Buch ist große Verbreitung zu wünschen.
Egon Bahr,
im Januar 2014
(Vorbemerkung zur ersten Auflage)
Egon Bahr, SPD-Politiker und Vertrauter Willy Brandts, war maßgeblich an der Entspannungspolitik mit dem Osten beteiligt und prägte den Begriff »Wandel durch Annäherung«.
»Mein Vater hat mich zum Willy-Brandt-Fan gemacht«
Sebastian Krumbiegel, Sänger
Soldaten sind vorbeimarschiert
In gleichem Schritt und Tritt.
Wir Pioniere kennen sie
Und laufen fröhlich mit.
Gute Freunde, gute Freunde,
Gute Freunde in der Volksarmee.
Sie schützen uns’re Heimat
Zu Land, zur Luft und auf der See – juch-he.«1
Sebastian Krumbiegel muss nicht überlegen, bevor er das Pionierlied seiner Kindheit anstimmt. »Das kannten alle meiner Generation.«
Es ist noch nicht lange her, da hat der Musiker sich intensiv mit seiner Kindheit und Jugend im Osten beschäftigt. Sein Sohn wollte für ein Schulprojekt Informationen darüber, wie in den DDR-Schulen politische Meinung vorgegeben wurde. Schon in den Kindergärten hingen Porträts von Walter Ulbricht, in der Schule begannen die Lehrer den Tag mit dem Pioniergruß »Seid bereit«, die Antwort der Schüler lautete »Immer bereit«, ab der achten Klasse hieß es zur Begrüßung »Freundschaft!«. Es gab Fahnenappelle auf dem Schulhof, politische Lieder wurden gesungen, und jeder Pionier hatte eine Aufgabe, zum Beispiel Altstoffe sammeln. Sebastian Krumbiegel grinst, als er sich daran erinnert, dass in seinem Geografie-Atlas die BRD und Westberlin weiße Flecken waren. »Natürlich wurde vermittelt, dass die BRD als Klassenfeind ein kapitalistischer Unrechtsstaat war und die DDR ein freiheitlich-fortschrittlicher. Grotesk wurde es, wenn ein Gedicht von Goethe oder Schiller so lange umgedeutet wurde, bis etwa aus einem Vogel, der in die Lüfte steigt, eine kommunistische Grundhaltung des Dichters abgelesen werden konnte.«
Die Eltern standen dieser Art der Wertevermittlung sehr skeptisch gegenüber. Sein Vater machte sich große Sorgen, dass seine Kinder in der Schule womöglich »auf Linie« gebracht würden. Selbst nie Parteimitglied, versuchte er seinem Nachwuchs zu vermitteln, dass beides möglich ist: ein kritischer Blick auf das System und das Leben in der DDR. »Mein Vater war mit sich im Reinen, aber will man verurteilen, wenn andere anders gehandelt haben?« Sebastian Krumbiegel erzählt von einem Freund des Vaters, der auf der Buchmesse in Leipzig ein Buch gesehen hatte, das ihn als Wissenschaftler interessierte. Die Frau am Stand durfte es ihm nicht verkaufen, bot aber an, »mal kurz wegzusehen«. »Am Ausgang haben ihn dann zwei Typen festgehalten und meinten: ›Oh, Sie haben gestohlen und auch noch Westliteratur, das sieht aber nicht gut für Sie aus. Aber wir könnten Ihnen ein Angebot machen.‹ Was soll man denn tun, wenn es darum geht, seinen Job zu behalten?«
Politik war Thema in der Familie Krumbiegel, so lange Sebastian sich zurückerinnern kann. Man schaute die ›Tagesschau‹, den ›Weltspiegel‹, hörte ›Deutschlandfunk‹ und sprach über die BRD und das System, in dem man selbst lebte. »Mein Vater hat mich zum Willy-Brandt-Fan gemacht. Ich bin also auch ein wenig sozialdemokratisch sozialisiert. Mein Vater hat immer gesagt, die ARD tendiert zur SPD, ZDF eher zur CDU. Meine Mutter hat mir geraten: ›Sag immer deine Meinung, aber versuch vorher bis zehn zu zählen und dir zu überlegen, was du willst, damit du keinen Unsinn quatschst.‹ Für meine Eltern war das eine Gratwanderung, sie haben mir zwar empfohlen: ›Setz dich nicht in die Nesseln‹, aber auch: ›Bewahr dir eine Haltung.‹«
Man hört Sebastian Krumbiegel an, wie stolz er darauf ist, dass seine Eltern zu diesem System Distanz bewahrt haben. Er erzählt begeistert von den Eingaben, die sein Vater schrieb, als 1968 die Unikirche in Leipzig gesprengt wurde, in der seine Eltern geheiratet hatten. »Ulbricht sagte, ein sozialistischer Platz braucht keine Kirche. Mein Vater hat später seine Stasiakte eingesehen und festgestellt, dass er wegen dieser Eingaben als Wissenschaftler, als Forscher nicht weiterkam.«
Krumbiegel ist vorsichtig, wenn es darum geht, über Ost und West zu sprechen. Er will keine Gräben vertiefen, die möglicherweise noch bestehen, und betont immer wieder, dass es ihm als Mitglied des Leipziger Thomanerchors wesentlich besser ging als vielen anderen Menschen im Osten. »Unter einer Glasglocke, weitgehend von der Rotlichtbestrahlung verschont«, nennt er das Leben von damals heute. Die internationalen Gastspiele erweiterten seinen Horizont. »Als man uns in der Schule erzählt hat, dass in Tokio alle mit Mundschutz oder Atemmaske rumrennen müssen, weil die Luft so schlecht ist, haben wir gesagt: Das stimmt nicht – wir waren gerade dort und haben nichts dergleichen gesehen. Auch die vielen Reisen in die Bundesrepublik und nach Westberlin haben uns ein anderes Bild vom Westen gezeigt, als die Propaganda in der Schule uns vermitteln wollte.«
Der allgegenwärtige Sozialismus, Losungen, die in Betrieben hingen wie »Der Sozialismus siegt« und »Es lebe die Deutsche Demokratische Republik«, sorgten bei Sebastian und seinen Freunden nicht für Linientreue, sondern für Opposition aus Prinzip. »Wir haben uns darüber lustig gemacht. An der Leipziger Baumwollspinnerei stand mal: ›Jeder Spinner ein Genosse‹ – das hatten die wirklich ernst gemeint. ›Lenin ist in – aber ich Lenin ab‹ hab ich auf die Schulbank geschrieben. Durch die Reisen mit dem Chor hatte ich ja immer den Vergleich, schon Westberlin war eine andere Welt. In meinen Augen war der Osten nicht das bessere Deutschland, wir hatten nicht das bessere System, auf dem Papier war vielleicht alles sozialer, aber doch nur auf dem Papier.«
Auch wenn er Anordnungen kritisch hinterfragte, war auszureisen oder abzuhauen kein Thema für den Musiker. Immer wenn er heute in Berlin an der Philharmonie vorbeifährt, erinnert er sich an das letzte Chorkonzert, das er hier Weihnachten 1984 gegeben hat, im ehemaligen Westen der Stadt. In der zwölften Klasse war er damals, im Abschlussjahr. »Mit meinen Klassenkameraden stand ich am Hinterausgang und wir haben gesagt: Das nächste Mal kommen wir erst wieder in den Westen, wenn wir 65 sind, als Rentner. Wir hätten einfach in Westberlin bleiben können. Uns war klar: Wir könnten es tun. Aber wir haben es nicht gemacht. Vielleicht war der Leidensdruck nicht groß genug. Natürlich hatte man auch immer die Familie im Kopf, die Angst, dass unsere Geschwister nicht studieren können, dass die Eltern leiden müssen, wenn wir abhauen.«
Die Frage, warum er nicht geflohen ist aus der DDR, bringt ihn dennoch auf die Palme, aber er bemüht sich, an die Regel seiner Mutter zu denken und bis zehn zu zählen, bevor er seine Meinung dazu äußert. »Ich hatte nie Stress mit der Stasi. Ich weiß, dass viele Menschen Schreckliches erlebt haben. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das Leben in der DDR als nicht so schlimm empfunden, dann würde ich genau diese Leute brüskieren, die so unendlich unter diesem System gelitten haben. Es gab eine Mauer, einen Schießbefehl, die Stasi und Spitzelei und Willkür. Es war ein Scheißsystem!«
Sebastian Krumbiegel lebt bis heute in seiner Lieblingsstadt Leipzig. »Was da in den vergangenen 25 Jahren passiert ist, ist der Hammer.« Leipzig ist für ihn auch deshalb etwas Besonderes, weil es immer eine Bürgerstadt war. Nicht von ungefähr, so meint er, haben die Proteste in der DDR hier ihren Anfang genommen. Die Montagsdemonstrationen haben ihn »politisch angeknipst«. Noch heute ärgert er sich, dass er ausgerechnet am 9. Oktober 1989 bei der größten Massendemonstration mit rund 70000 Teilnehmern nicht dabei war. »Ich war einfach zu feige! Wir waren gewarnt worden, dass es gefährlich werden könnte, deshalb bin ich nicht hingegangen. Eine Weile habe ich das nicht erzählt, weil es mir so peinlich war. Aber dann habe ich gedacht, ich muss darüber sprechen, damit klar wird, dass diese Demos kein Spaß waren. Dass es wirklich brenzlige Situationen gab. Es hatte sich damals herumgesprochen, dass die Leipziger Krankenhäuser die Blutkonserven aufgefüllt hatten. Und dass überall Polizei und Armee und Kampftruppen bereitstanden. Ich hatte vorher schon erlebt, mit welcher Brutalität vorgegangen wurde. Die Demos waren keine Volksfeste. Ich hatte echt Angst. Unser Trommler Ali sagt aber heute noch: ›Ich war dabei, du nicht.‹«
Für seine Band ›Herzbuben‹ hat Sebastian Krumbiegel Texte geschrieben, die sich über die DDR lustig machten, das System in Frage stellten oder zum kritischen Blick auf das System anregen sollten. »Wir konnten Ende der Achtziger nicht singen: ›Honecker ist doof und die Mauer muss weg.‹ Aber wir konnten ein Lied über Gorbatschow schreiben: ›Guten Tag, lieber Michael, sag uns, was spielst du hier für ein neues Spiel, bring uns doch mal die Spielregeln bei, es hat wirklich Stil, dein Gesellschaftsspiel, wir sind ja nicht dumm, die Regeln sprechen sich rum, auch wir werden sie bald verstehen.‹ Das ist eine klare Ansage gewesen. Wir dachten, alles wird offener.«
Der Sozialismus ist an den Leuten gescheitert, sagt Sebastian Krumbiegel. Extremsituationen sorgen seiner Ansicht nach dafür, dass jeder aus der Not heraus das Beste für sich und seine Familie erreichen will, da bleibt der soziale Gedanke schnell auf der Strecke. Die Parteien heute unterscheiden sich seiner Meinung nach in dem Stellenwert, den sie dem Solidaritätsprinzip einräumen. »Der Idee, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, kann ich nichts abgewinnen.«
Mit der Wende für das Land kam auch die Wende für seine neue Band, die damals seit gut zwei Jahren bestand. Die »Prinzen« wurden als erste Ostband in den deutschen Charts gefeiert. Vier Jungs aus Sachsen, die im Kinderchor gesungen hatten und mit frechen Texten den A-capella-Gesang in die Popmusik brachten. Das wollten alle hören. »Wir hatten nicht den Makel einer etablierten Ostband, das hat uns geholfen. Außerdem haben wir eine ganz andere Art von Musik gemacht, da entscheiden die Leute, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Medial hat uns die Ostschiene damals geholfen, die Leute haben gesagt: ›Guck mal, die Ossis, wenn sie sich Mühe geben, dann geht’s doch.‹«
Er erinnert sich an die ersten Reisen mit den Prinzen zu Konzerten in den Westen und an die Begegnungen mit Fans, anderen Musikern und Veranstaltern. »Ob wir im Osten alle Russisch können, wollten die wissen, und ob durch Sachsen eine Autobahn führt. Wir haben uns darüber lustig gemacht und gesagt: Wir können verständlich Deutsch sprechen, mit Messer und Gabel essen, und auch in der DDR gab es fließend Wasser, Strom und Licht.«
Allein die Musik, das wilde Partyleben, Star zu sein, war ihm irgendwann nicht mehr genug. Sebastian Krumbiegel wollte mehr, wollte sich engagieren. Politik ist nach wie vor ein wichtiges Thema für den Musiker. Im Kleinen, bei Essen mit der Familie und mit Freunden, und im Großen, wenn er sich stark macht für Benachteiligte oder gegen rechte Gewalt. Was in Ägypten und der Türkei passiert, stimmt ihn sehr nachdenklich. »Die Gesellschaft bewegt sich in Sinuskurven, immer hoch und runter. Auch die Demokratie kann wieder kippen. Natürlich ist man in Deutschland durch viele Gesetze gut abgesichert, aber einen absoluten Schutz gibt es nie.«
Bescheiden ist er, wenn es um sein soziales Engagement geht. Das Bundesverdienstkreuz ist ihm verliehen worden und der Preis für Humanismus. »Andere machen das doch auch«, wehrt er ab. Lieber will er darüber sprechen, dass man bei Begegnungen mit Fremden oder Unbekannten einfach nur nach Gemeinsamkeiten suchen muss, um mehr Miteinander zu erreichen. »Habt im Blick, was uns verbindet, sucht nicht, was uns trennt. Ich bin ein großer Fan einer multikulturellen Gesellschaft. Wenn ich verreise, möchte ich auch mit offenen Armen empfangen werden.« Er wünscht sich das, was er von seinen Eltern gelernt hat, für die heutige Gesellschaft: Haltung. Und lacht über sich selbst, als er diesen Gedanken ausspricht. »Ach, jetzt rede ich schon wie ein Alter, von wegen ›wir damals‹, aber es ist ja wahr, wir haben früher Texte geschrieben wie ›Der Betriebsdirektor‹, das war zwar nicht mutig, aber unsere Art, sich mit der DDR auseinanderzusetzen. Man musste die Worte sehr sorgfältig wählen. Zwischen dem, was kritisch denkende Fans verstanden haben, und dem, was der Staat erlaubte, war nicht viel Spielraum. Heute kann man sagen, was man will, vielleicht kann man mit dem Thema ›Juden und deutsche Geschichte‹ noch jemanden verstören, aber sonst? Ich mag die neue deutsche Musik, Kraftklub zum Beispiel. Ich weiß, wo die stehen und wie die das meinen, aber manchmal denke ich, man kann noch so wichtige Dinge rausposaunen und es hört doch keiner mehr hin.«
Aus dem persönlichen Fotoalbum der Krumbiegels. Aufgenommen in Weißenfels beim Regimentsfotografen, der eigentlich für die Passbilder in den Wehrpässen zuständig war. »Damals habe ich unter das Foto geschrieben: DAS HABEN 11/2 JAHRE AUS MIR GEMACHT.«
Foto: privat
»Wenn die DDR das Paradies der Werktätigen gewesen wäre, dann wären die Unzufriedenen doch alle hergekommen«
Regine Sylvester, Autorin
Hansi Schmidt vom VfL Gummersbach war von 1967 bis 1971 Torschützenkönig in der Handball-Bundesliga. Das weiß ich. Ich bin super informiert über den Westen! Man kann mit mir ein Quiz veranstalten über Schlager, Bücher, Politik, Politikernamen, aber umgekehrt? Was wissen denn die Wessis vom Osten? Unglaublich ist das!«
Regine Sylvester sitzt in einer grob gestrickten weißen Jacke, weißem Rock und weißem Top am Tisch, die blonden Locken wie vom Wind zerzaust, die Haut leicht gebräunt, als würde sie viel im Garten arbeiten. Die schmucklosen Finger sind mal ineinandergelegt, mal verstärken sie das Gesagte mit heftigen Bewegungen.
»Das Interesse des Ostens am Westen war immer größer als umgekehrt. Und wieso sollte das auch anders sein. Wieso hat sich denn der Arbeitslose aus dem Ruhrpott nicht im Osten niedergelassen, sondern lieber vor die S-Bahn geschmissen? Wenn die DDR das Paradies der Werktätigen gewesen wäre, dann wären die doch alle hergekommen, die Unzufriedenen! Aber so war es nicht. Sondern andersherum.«
Regine Sylvester ist 1946 in Ostberlin geboren. Sie war 15, als die Mauer gebaut wurde, und 44, als sie wieder fiel. »Meine Eltern lehnten die DDR ab, sie sind nur deshalb nicht in den Westen gegangen, weil sie im Haus meines Großvaters wohnten und mein Vater dessen Brunnenbau-Firma aus dem Jahr 1864 geerbt hatte. Sie fühlten sich diesem Erbe verpflichtet. Die meisten meiner Verwandten lebten im Westen. Ich war immer ein Außenseiter: nicht in der Partei, keine Jugendweihe, kein junger Pionier. Beim Studium war mein Grundgefühl: Ich gehöre nicht dazu. Für die letzten zwei Jahre des Studiums bin ich dann doch noch in die FDJ eingetreten, um weniger am Rand zu stehen. Fast alle Kommilitonen waren Parteimitglieder und haben bei ihren Versammlungen auch Studienbelange besprochen. Ich hatte sehr gute Leistungen, da konnten sie mir nichts anhaben, aber meine soziale Herkunft haben mir die Systemtreuen wie einen Makel vorgeworfen.«
Dienstreiseanträge der Journalistin in den Westen blieben lange erfolglos. Sie durfte auch nicht 1986 zur Berlinale reisen, obwohl beim Forum des jungen Films der Dokumentarfilm ›Die Zeit die bleibt‹ über Konrad Wolf gezeigt wurde, an dem sie als Autorin mitgearbeitet hatte.
1987 kam es in der DDR zu Reiseerleichterungen. Regine Sylvester fuhr nach München zum 60. Geburtstag eines Cousins und nach Westberlin für Recherchen zu einem Buch über Dokumentarfilme.
Zwei Jahre später fiel die Mauer. »Ich bin an der Invalidenstraße rüber, da, wo Diepgen und Momper standen und verblüfft winkten. Mir fiel gleich eine Freundin in den Arm, die in den Westen geheiratet hatte. Wir Ostler riefen: ›Wir gehen zurück! Wir kommen nur mal gucken! Nur mal gucken!‹ Ja, wirklich. Am Savignyplatz bin ich im ›Zwiebelfisch‹ gelandet und habe mir einen ›Stern‹ mitgenommen. Den habe ich auf meinen Nachttisch gelegt, um morgens beim Aufwachen einen Beweis dafür zu haben, dass ich das nicht geträumt hatte mit dem Mauerfall. Es war eine völlig unwirkliche, ganz unerwartete Nacht. Mir war klar, jetzt passiert etwas, das man nicht zurückdrehen kann. Nichts wird mehr, wie es war, es wird die DDR nicht mehr geben.«
Sie erinnert sich an die Freude über den Mauerfall, aber auch an für sie nicht nachvollziehbare Entwicklungen danach. »Die DDR-Produkte verschwanden aus den Kaufhallen. Nahezu alles, was in der DDR hergestellt worden war, Autos, Bekleidung, Design, verlor seinen Wert. Bücher auf Müllhalden. Zeit der Entsorgung. Auf dem Gelände des Fernsehstudios in Adlershof sah ich, wie ein weißer Flügel in den Schredder geschoben wurde. Bald nach der Wende existierte in der langen Oranienburger Straße kein einziges Geschäft aus Ostzeiten mehr. Und überall Unsicherheit. Die Briefe mit Klarsichtfenster, die mir ins Haus flatterten, habe ich nicht verstanden – freiwillige Pflichtversicherung, was sollte das denn bedeuten? Freiwillig? Oder Pflicht? Mein Mann war weg, der Job war weg, das Ersparte war durch den Umtausch halbiert und das Kind erst zwölf. Nachts lag ich im Bett, es ratterte in meinem Kopf, was wird werden? Die DEFA, bei der ich zu dem Zeitpunkt als Autorin angestellt war, wurde aufgelöst. Du musst wieder Geld verdienen. Aber wo und wie und für wie viel? Als Nutte an der Oranienburger Straße war ich zu alt, für zwei fuffzich wäre es vielleicht noch gegangen.«
Wenn Regine Sylvester lacht, dann von Herzen. Ohne ihren Humor hätte sie die neue Situation nicht so leicht bewältigt, die Schwierigkeiten, die sich vor ihr auftürmten, weniger leichtgenommen. Nach der Wende arbeitete sie drei Jahre als Stellvertretende Chefredakteurin bei der ›Wochenpost‹, einer im Osten sehr beliebten Wochenzeitung. Für sie wird es die spannendste Zeit – alte Ostler, neue Ostler, ganz neue Westler unter der Leitung von Matthias Greffrath sind eine Redaktion. »Ich gehörte zu den Neuen aus dem Osten und hatte viel nachzuholen. Was zum Teufel war das Godesberger Programm? Wir arbeiteten alle für eine Zeitung, aber manchmal waren wir uns auch sehr fremd. Ich denke heute, dass wir aus dem Vorteil, Verschiedenes zu wissen, noch mehr Kapital hätten schlagen können.«
Regine Sylvester hat nie so ausgesehen, wie sich Westler »den Ossi« vorstellen. »Schon früher nicht, da hatte ich immer Ehrgeiz. ›An- und Verkauf‹ hieß meine Quelle am Hackeschen Markt, es gab da Restposten vom Intershop und Exquisit. Als gelernte Schneiderin habe ich außerdem selber viel genäht. Wenn man gut angezogen ist, dann macht das etwas aus. Man wird besser behandelt.«
Die Journalistin hat es genossen, nach der Wende schreiben zu können, wie und worüber sie wollte. Ohne kalkulieren zu müssen, was nicht durch die Zensur geht. »Früher habe ich in meine Texte immer eine kleine Frechheit reingeschrieben und eine große Frechheit daneben. Und dann haben sie die große Frechheit rausgestrichen und die kleine drinnen gelassen. Ein permanentes Jonglieren. Aber ich kann jeden Text, den ich zu DDR-Zeiten geschrieben habe, noch heute mit gutem Gewissen lesen. Immerhin.«
Es ärgert sie, wenn sie als Ostautorin bezeichnet oder aus Gründen der Ausgewogenheit in eine Talksendung eingeladen wird. Sie wünscht sich Gleichbehandlung. »Lange Zeit habe ich aufgepasst, ob die Ostler angemessen vertreten sind. Als mal in einem vierseitigen, mit Fotos illustrierten Magazinartikel über ein allgemeines Thema niemand aus dem Osten abgebildet war, empfand ich das als ungerecht. Dieses Gefühl war am Anfang ganz stark. Sind wir dabei, werden wir wahrgenommen? Bei Feiern frage ich die Gastgeber: ›Ist eigentlich noch jemand aus dem Osten da?‹ Die drehen sich suchend um, zucken mit den Achseln, keine Ahnung, kein Thema. Mein eigener Freundeskreis ist gemischt. Zu meinem sechzigsten Geburtstag kamen, ohne dass ich es geplant hätte, 30 aus dem Osten und 30 aus dem Westen. Nur weil jemand aus dem Osten stammt, habe ich ihn nicht lieber. Da gibt es genauso viele Arschlöcher. Man muss offen sein und seine Vorurteile immer wieder überprüfen. Manchmal sage ich auch ›typisch West‹, wenn ich mich über jemanden ärgere. Aber eigentlich hat meine Wut nichts mit der Herkunft dieses Menschen zu tun, sondern mit dessen schlechtem Benehmen.«
Immer noch sagt sie »drüben« und »ihr«, wenn sie von Westdeutschen spricht. Immer noch verbringt sie freie Tage am liebsten an der Ostsee, immer noch wohnt sie in dem Teil von Berlin, in dem sie aufgewachsen ist. »Jeder fünfte Westler, so habe ich gelesen, war noch nie im Osten. Neulich habe ich in Hamburg einen Taxifahrer gefragt, ob er nicht mal das Brandenburger Tor sehen will. Nö, hat der gesagt, was soll ich denn da? Der Osten gilt vielen als uninteressant und erledigt. Und immer noch fühle ich mich dann verpflichtet, für mein untergegangenes Land zu werben.
Als hauptberufliche »Aufschnapperin« hat sich die Journalistin einmal bezeichnet. Sie belauscht Leute, schreibt auf, was sie hört, sie spricht mit vielen und fragt sie aus. Egal ob Ost oder West, sie will verstehen, warum Leute so leben, wie sie leben. Ihr Cousin aus dem Westen glaubt ihr bis heute nicht, dass sie ebenfalls Solidaritätszuschlag zahlt. »Eigentlich ist der nett, aber eben schon alt, manche Sachen versteht er nicht mehr. ›Ich bezahle auch für dich, Regine‹, sagt er.«
Es wäre beflügelnd und herausfordernd gewesen, nun auch für Leser aus dem Westen zu schreiben, sagt sie. »Nur bei Gedanken zur Lage der Frauen gab es erstaunlich aggressive Reaktionen. Ich bediene keine feministischen Ansichten, ich möchte eine Menschenfreundin sein. Aber klar, jeder macht sich seine Gedanken. Ich zum Beispiel reagiere auf einen bestimmten Typ Westfrau: erfolgreich, gut gekleidet, distanziert, taxierend. Sie schweigt und lächelt manchmal, aber Tränen lachen? Sehr selten. Vielleicht weil man nicht so offen sein sollte. Nach dem Motto: Gib nicht so viel von dir zu erkennen. Halte dir Optionen offen.«
Nach dem Mauerfall begann Regine Sylvester, sich die Welt anzusehen. »Dass sie mich so kleingehalten haben, was das Reisen anging, halte ich dem Osten ewig vor. Dass sie mir Bücher, Filme, Landschaften vorenthalten und über meinen Horizont bestimmt haben. In der DDR habe ich gesagt: Lasst doch alle gehen, die raus wollen, und dann machen wir hier unser Ding. Aber seit 1961 hatte ich mehrmals im Jahr einen Traum, immer denselben: Durch Zufall fand ich eine Lücke in der Wand. Ich fuhr mit der U-Bahn nach Berlin-Wedding zu Tante Lisa. Bekam eine Apfelsine, wurde unruhig, wollte zurück nach Hause. Ich stieg über die Mauer, war zurück im Osten und weinte und weinte. Aus der Traum. Doch manchmal stellte ich mich selber in Gedanken vor die Wahl: Bleiben oder Gehen.«
Regine Sylvester ist nicht gegangen, sie hat sich um ihre Tochter gekümmert, gearbeitet und versucht, sich zu engagieren, um das Leben in der DDR zu verbessern. »Wahrscheinlich hänge ich an der DDR, weil ich an meiner Jugend hänge, am Leben. Tanzen gehen, knutschen, Erfahrungen mit Jungs, Ausflüge, mit Freunden feiern, das hat ja alles in diesem Land stattgefunden. Und ich darf doch nicht für alle Krisen Erich Honecker verantwortlich machen. Für mein Privates bin ich allein verantwortlich.«
Tatsächlich ist der Osten heute für Regine Sylvester vor allem ein Gefühl. »So eine Mischung aus prima und schrecklich, aber sehr eigen. Sehr, sehr eigen. Schlecht war das Gefühl der Ohnmacht, auch der Rechtlosigkeit. Ich hatte den Eindruck, nicht genehm zu sein, fühlte mich nicht akzeptiert. Einige Kollegen aus dem Osten verstehen das nicht, aber die durften zu Festivals reisen, sie waren nicht so eingesperrt. Die Mauer symbolisiert für mich bis heute eine verlorene Zeit.«
Auf der anderen Seite ist sie der Meinung, dass die DDR für Frauen »das beste von allen Ländern« war. »Kostenlose Pille, man durfte Schwangerschaften unterbrechen, konnte die Kinder problemlos unterbringen, mit 63 in Rente gehen, zwei Jahre vor den Männern. Wir hatten einen Haushaltstag im Monat, einen freien Tag für die Haushaltsarbeit. Natürlich sind wir da alle auch zum Friseur gegangen. Wann geht eigentlich die berufstätige Westfrau zum Friseur? Das Selbstbewusstsein der Frauen in der DDR war stark, weil sie eigenes Geld verdienten. Meine Scheidung zum Beispiel hat 140 Ostmark gekostet, also eigentlich 70, aber ich habe für meinen Mann, damals ein armer Schlucker, mitbezahlt. Meine Rede war: Auch als Frau von Rockefeller würde ich arbeiten gehen. Im großen DDR-Freundeskreis waren nur zwei Hausfrauen. Die wollten das so. Bei denen gab es immer selbstgebackene Kuchen, ich genoss die. Und ich war für sie wie ein Wesen vom anderen Stern, das immer Neuigkeiten berichten konnte und sehr unterhaltsam war.«
Dass die Frauen in der DDR ein gesichertes Leben hatten, kann die Erinnerung an die schlechten Seiten des politischen Systems aber nicht verdrängen. »Wie anmaßend waren diejenigen, die über unsere Kultur bestimmt haben. Die Zuständigen, die Druckgenehmigungen für Bücher nicht erteilten, Theaterpremieren missbilligend verließen und öffentlich Künstler zurechtwiesen. Die verheerenden Folgen der Zensur waren denen egal. Und die vollkommene Unfähigkeit der DDR-Mächtigen, Kritik zuzulassen! Zu begreifen, dass jemand, der etwas Kritisches äußert, kein Feind sein muss. Vielleicht ist er es. Aber vielleicht will er ja nur, dass sich irgendetwas bessert. Ich könnte immer noch kotzen vor Wut. Wie viele gute Köpfe haben das Land verlassen! Andererseits bin ich heute, im Westen, irgendwie heimatlos.« Regine Sylvester schaut konzentriert an die Wand, als würde sich dort ablesen lassen, wie ihr Leben weitergehen wird. Wie sich die langen Jahre hinter der Mauer weiter auswirken werden.
»Je weniger die Menschen im Westen ihre Chance hatten, umso mehr hängen sie am Osten. Unter meinen Freunden ist Wolfgang Kohlhaase der Einzige, der ohne Verluste, Kompromisse und Verzug im Westen weitergearbeitet hat. Mit über 80 Jahren ist er immer noch ein wunderbarer, mit Anfragen überhäufter Filmautor. Ein Glücksmann. Übrigens halte ich es für einen Gewinn, auch für mich, in zwei Systemen Erfahrungen gemacht zu haben.« Trotz dieser inneren Zerrissenheit wirkt Regine Sylvester zufrieden. Eine Frau, die mit sich im Reinen ist und viel darüber nachdenkt, was Familie, Freunde und Arbeit heute für sie bedeuten.
»Zu Hause habe ich Material aufbewahrt, darüber, was in der DDR falsch gelaufen ist: bestellte Kritiken, Aufstellung von Sturmgeschützen gegen Gedanken, Herrscherreden, bizarre Sprachschöpfungen wie ›antifaschistischer Schutzwall‹, allein deshalb hätte man die DDR verlassen können. Jetzt sammele ich im Westen die Dummheiten über die DDR: lächerliche Behauptungen über das verschwundene Land, eine nachteilige Beurteilung sämtlicher Lebensumstände. Und die Flachzangen plappern immer wieder alles nach. Vielleicht wird mal ein Buch daraus. Solange ich noch krauchen kann, möchte ich mich an einer gerechteren Sicht beteiligen. Es geht ja auch um mein Leben.«
Regine Sylvester an ihrem Lieblingsplatz in Berlin Mitte. Hier trifft sie sich mit Leuten, hier kauft sie ein, geht ins Kino oder ins Café und sammelt neue Ideen für ihre Kolumnen. Seit 1992 heißt der Platz zwischen Alexanderplatz und Friedrichstraße wieder »Hackescher Markt«, aufgrund der Nähe zur Berliner Börse hieß die Haltestelle Ende des 19. Jahrhunderts »Börse«, ab 1951 »Marx-Engels-Platz«. Heute befinden sich rund um den Hackeschen Markt viele kleine Geschäfte, Designer und Künstler haben sich hier niedergelassen. Tag und Nacht herrscht Trubel, Touristen und Berliner genießen die besondere Atmosphäre.
Foto: Anna Laura Sylvester
»Mir war klar, ich würde hier mein ganzes Leben verbringen«
Niels Sönnichsen, ehemaliger Direktor der Charité Berlin
E