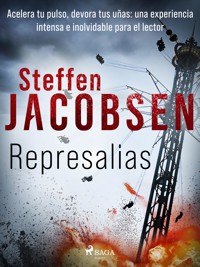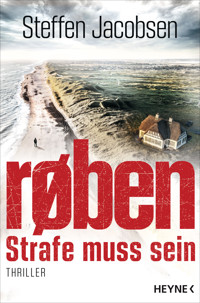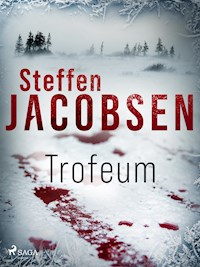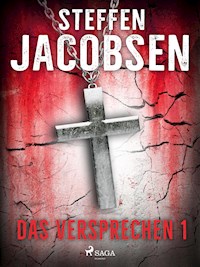6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Schwarze, zerklüftete Klippen türmten sich über der jungen Frau auf. Sie lag in einem zerstörten Rettungsfloß, angespült in einer steinigen Bucht an der Ostküste Bjørnøyas, mitten in der eisigen Kälte des Nordpolarmeers. Der nächste Sturm würde jedes Anzeichen des Verbrechens, das sich auf der Hochseeyacht Nadir zugetragen hatte, vernichten – kein leichter Fall für Kommissar Robin Hansen … Der Passagier von Steffen Jacobsen: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Ähnliche
Steffen Jacobsen
Der Passagier
Thriller
Aus dem Dänischen von Frank Zuber
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für die Töchter und ihre Mütter.Für Christian, Lars, Thommie, Stig und PeterUnd für Johannes.
Prolog
Schwarze, zerklüftete Klippen türmten sich über der jungen Frau auf. Sie öffnete die Augen und betrachtete den grauen Himmel und die Seevögel. Kleine, weiße Winkel, die sich aufs Meer hinausstürzten, mit Futter für ihre Jungen zurückkamen oder über der Felskante im Aufwind schwebten. Ein Gewirr von Vogelschreien hallte unaufhörlich von den Klippen wider.
Sie lag auf dem Rücken in einem zerstörten Rettungsfloß, angespült in einer steinigen Bucht, die sich zur Barentssee öffnete. Was sie geweckt hatte, wusste sie nicht. Der Schmerz, die Kälte, die Vögel oder die Steine, die unablässig in der Brandung klackerten.
Bestimmt das Bein. Sie fühlte keinen Hunger mehr, aber sie hatte großen Durst. Doch in ihrer kleinen, dreieckigen Welt gab es nur die Klippen, den Himmel, die Vögel und das Meer. Am Tag zuvor hatte sich ein Häuflein schmutziger Schnee hinter dem Floß angesammelt, mit dem sie ihren Durst gestillt hatte.
Als sie zum ersten Mal aufgewacht war, hatte sie Rauhreif von den Steinen geleckt, die sie erreichen konnte.
Die Frau wusste genau, wo sie war: am Fuß des Miseryfjell an der Ostküste Bjørnøyas. Mitten in der Barentssee, sechshundert Seemeilen nördlich des Polarkreises. Sie wusste auch, dass Norwegen an der Nordküste der Insel eine bemannte meteorologische Station unterhielt, sechzehn Kilometer entfernt. Luftlinie. Hinter der hundertunddreißig Meter hohen Klippenwand und der Tundra mit ihren Moorseen und sumpfigen Permafrostböden.
Plötzlich klatschte direkt neben ihr etwas auf den Boden. Es war lebendig und schrie kläglich. Die Frau stemmte sich auf die Ellbogen. Ein hässliches, graues Möwenküken watschelte verstört über die glatten Steine. Es öffnete den weichen Schnabel und klagte laut. Dann streckte es die Flügelstummel aus, ahmte verzweifelt ein Flattern nach und tappte in Richtung Wasser, ohne sie zu bemerken.
»Du kannst nicht fliegen, ich kann nicht gehen«, flüsterte sie.
Sie hob den Kopf und betrachtete teilnahmslos ihren Körper. Sie trug graue Segelkleidung, die speziell für hohe Breitengrade gefertigt war. Der Anorak war von den bunten Logos der Sponsorenfirmen übersät. Es waren die einzigen Farben in der Bucht.
Sie roch sich selbst. Am Boden des Floßes hatte sich Urin gesammelt. Sie hatte es versucht, aber seit dem letzten Abend konnte sie kein Wasser mehr lassen. Ihr linkes Hosenbein war bis zum Knie aufgeschnitten, der Seglerstiefel lag ein paar Meter entfernt. Ihr Unterschenkel war bleich und blutleer. Unter dem Knie klaffte eine schwarze Wunde, aus der ein weißer Knochen ragte. Der Fuß war unnatürlich verdreht. Sie hatte eine Rettungsweste unter das Bein gelegt und die Schlaufen um den Schenkel gebunden, um den Bruch notdürftig zu schienen, aber bei jeder Bewegung, auch wenn sie vor Kälte zitterte, stach der Schmerz bis zur Hüfte.
Das Wasser war zehn Meter entfernt. In der Brandung schwammen die Griffe gebrauchter Notfackeln zwischen kleinen Eisschollen. Eine halbe Seemeile südlich lag ihre zerschellte Open-60-Segeljacht »Nadir«, eingekeilt zwischen einer Felssäule und den Klippen. Von der alten Pracht war nicht viel übrig. Der Carbonfaser-Mast schaukelte auf den Wellen, durch verdrehte Wanten, Stage und Fallen noch immer mit dem Wrack verbunden. Neben dem Rumpf, am Fuß der hohen Klippe, bewegte sich etwas im Wasser. Es war rund, schwarz und sah aus wie ein neugieriger Seehund, der den merkwürdigen Fremdkörper erkundete.
Ihr wurde schwarz vor Augen, sie ließ den Kopf zurück auf die Steine fallen. Mit geschlossenen Augen tastete sie über den Gummiboden des Floßes, zog einen wasserdichten Leinensack zu sich heran, legte ihn auf die Brust und umklammerte ihn fest. Es war das Einzige, was sie in jener Nacht von der Nadir gerettet und durch Sturm und Brandung bis zu diesem gottverlassenen Ort mitgenommen hatte. In dem Sack waren ihre Brieftasche, ihr Pass, die Schiffspapiere und ein GPS-Empfänger, dessen Batterien längst leer waren.
Außerdem hatte sie eine kleine Digitalkamera, ein Handfunkgerät und ihr Tagebuch am Rücken unter die Thermo-Unterwäsche gesteckt.
Schatten huschten über die Bucht, auf der anschwellenden Dünung bildeten sich Katzenpfoten.
Die junge Frau schob sich auf Ellbogen und wunden Händen von dem platten Floß auf die Klippe zu. Weg vom Meer. Sie rang nach Luft, biss die Zähne zusammen und winselte wie ein Tier, als die Knochenenden aneinanderscheuerten. Sie wusste, dass der nächste Sturm diesen Ort leerfegen und jedes Anzeichen menschlicher Existenz vernichten würde. Auch ihre geliebte Nadir würde verschwinden. Schwarze Kumuluswolken türmten sich am östlichen Himmel auf.
1
Der letzte Morgen in Jacob Nellemanns Leben war vollkommen.
Fast vollkommen.
Um halb sieben riss ihn der Wecker aus einem kalten Traum von Klippen und alles zertrümmernden Wellen. Er blieb liegen und studierte die pastoralen Szenen am Betthimmel. Zum ersten Mal schlief er in der chambre provençale des Schlosses. Auf dem goldenen Seidenbrokat verfolgte ein mit einer Flöte bewaffneter Satyr spärlich bekleidete Nymphen. Seine amourösen Bemühungen waren von weißen Camargue-Pferden sowie der Brücke und dem Papstpalast von Avignon flankiert.
Er drehte sich auf die Seite und betrachtete ein Stillleben von Cézanne, das zwischen zwei hohen Fensternischen hing. Jeder Zweifel über die Echtheit des Gemäldes war in der Nacht zuvor ausgeräumt worden.
Nellemann verzog das Gesicht. Er war im Nachbarzimmer einquartiert gewesen, aber nach schlaflosen Stunden und einer Nachtwanderung hatte er sich in der Tür geirrt. Obwohl er es schnell bemerkte, blieb er still im Mondlicht stehen und bewunderte das Bild. Fand Ruhe in der Komposition. Dadurch hatte er eine druckempfindliche Alarmplatte unter dem Teppich aktiviert.
Er hatte nichts gehört. Hatte nicht den leisesten Lufthauch, nicht den geringsten Temperaturunterschied gespürt. Kein einziges Haar hatte sich ahnungsvoll gesträubt, bevor sich eine große Hand um seinen Mund legte. Er konnte sich nicht wehren, wurde auf die Knie gezwungen. Jemand drückte einen kalten Gegenstand in sein Ohr. In der Dunkelheit hörte er die leise, aber strenge Stimme seines Gastgebers, die ihm versicherte, dass es sich dabei keineswegs um ein Hörgerät handle, sondern um eine 9‑Millimeter Glock, und dass er nur eine Fingerkrümmung von einer besseren Welt entfernt sei. Vor Angst zitternd stammelte er einen schwachen Protest, und zögernd – fast widerstrebend, kam es ihm vor – wurde die Pistole zurückgezogen. Seine Hosen waren warm und nass. Der Hausherr schaltete den Kronleuchter ein. Ließ die Hand mit der Pistole hängen. Nackt. Lauernd.
Jacob Nellemann sah seinen alten Freund an. Versuchte den Axel wiederzuerkennen, mit dem er zur Schule gegangen war. Den Jungen, der im Regen auf dem Fußballplatz blieb, lange nachdem die anderen hinter den angelaufenen Scheiben des Umkleideraumes verschwunden waren. Der Junge am Ball, instinktiv wie ein Welpe, atemlos ins Spiel vertieft, bis der Sportlehrer ihn zum dritten Mal hereinrief.
»Vergiss es«, hatte der dunkle Mann gesagt und ihm ein Handtuch gereicht.
Was genau, wusste Jacob Nellemann in jenem Moment nicht. Die Schule? Das Ganze?
Der komplexe Geschmack des 90er Châteauneuf-du-Pape, den sie zu Lamm am Spieß getrunken hatten, lag ihm noch auf der Zunge, vermischt mit dem Graham’s 57 Port, den man zum Trifle genossen hatte, und dem kräftigen Grappa, der zum Kaffee in der Bibliothek gereicht worden war.
Nellemann schlug die Bettdecke zur Seite, schwang die Füße auf die Marmorplatten und stand auf, erfüllt von jener urzeitlichen Erregung vor der Jagd.
Im Badezimmer stand die einzige Badewanne mit Treppe, die er je gesehen hatte. Er zog eine Kniebundhose an, streifte einen dicken, grünen Wollpullover über das Unterhemd, steckte die Füße in lange Wollstrümpfe und schlich hinunter in die Küche. Es war Sommer in Dänemark, aber Jacob Nellemann war im Lauf der Jahre dünn und verfroren geworden. Das Haus war still, er traf niemanden auf den Gängen.
Er hatte Kopfschmerzen, fühlte sich ausgetrocknet. Er trank mehrere Gläser Leitungswasser, machte sich eine Tasse Nescafé und aß gründlich kauend eine Schüssel Hafergrütze mit Milch und Zucker.
Im Kühlschrank lag die rote Proviantdose, die er vor dem Schlafengehen mit belegten Broten, einem Snickers und einem Müsliriegel gefüllt hatte. Ihre Kanten waren rostig, er hatte sie zum ersten Schultag von seiner Mutter bekommen. Auf dem Deckel stand in zierlicher, weißer Schrägschrift Guten Appetit. Es war kaum noch zu erkennen, aber er wusste, dass es dort stand. Er steckte die Dose und eine Flasche Wasser in seine Jagdtasche. Es würde ein heißer Tag werden, ein sehr heißer, langer Tag.
Als er die breite Eingangstreppe hinunterging, stand die Sonne schon über den Hecken am Ende der Felder. Wie immer gab er dem letzten Granitlöwen einen festen Klaps auf den Hintern. Der Löwe warf ihm einen wütenden, versteinerten Blick hinterher.
Nellemann ging über den weißen Kies zum Feldweg bei den Garagen. Die Sonnenstrahlen bündelten sich zwischen den Ästen der uralten Linden, die das Schloss umgaben und den gepflegten Park schützten. Feiner Dunst stieg aus dem Gras, der Tag roch frisch. Im Vorbeigehen betrachtete er respektvoll den spiegelblanken Jaguar XK150, der mit seinen aristokratischen Geschwistern in einem ehemaligen Pferdestall stand, den der Schlossherr für seine englischen Sportwagen hatte umbauen lassen. Die Sonne blitzte in den verchromten Drahtfelgen.
Im Westen grenzte das Schloss an hundert Hektar alten Laubwald. Der Besitzer ging nie zur Jagd, die Dickichte und Lichtungen wimmelten von Wild.
Die Fassade des Hauptgebäudes lag im Schatten, und hätte Jacob Nellemann sich umgedreht, hätte er vielleicht die Silhouette seines Gastgebers in einem der hohen Fenster im ersten Stock sehen können. Doch Jacob Nellemann drehte sich nicht um. Er ging weiter und schlug den Weg zum Verwaltungsgebäude ein.
Der Schlossherr sah seinen alten Freund hinter den Garagen verschwinden. Er steckte die Hände in die Taschen seines Schlafrocks und lehnte die Stirn an das kalte Fenster.
Nach einer Weile drehte er sich um und betrachtete seine Frau. Ihr Gesicht war von der blonden Mähne halb verdeckt, sie atmete ruhig. Sie würde so schnell nicht aufwachen. Auf dem Nachttisch lag eine Schachtel Schlaftabletten neben einem leeren Wasserglas. Seit er sie kannte, nahm sie jeden Abend eine Tablette. Er sah auf seine Rolex, drehte aus alter Gewohnheit ihre gezackte Lünette eine halbe Umdrehung vor und dann nochmals eine halbe. Dann setzte er sich auf die Bettkante.
Das Verwalterpaar saß beim Morgenkaffee auf der Terrasse. Die jungen Leute winkten Jacob zu, wünschten ihm Weidmannsheil und sich selber eine Seite des Bocks, falls er Glück haben sollte. Er lächelte zurück und erklärte, dass Glück bei der Jagd keine Rolle spielte.
Die Bedingungen waren optimal. Die Blätter der Buchen leuchteten hellgrün, der feuchte Boden dämpfte seine Schritte. In der Nacht hatte es zum ersten Mal seit zwei Wochen geregnet. Jacob Nellemann spürte, wie seine Sinne erwachten. Erstmals seit vielen Monaten fühlte er sich lebendig und ausgeglichen. Er wünschte, Heidi wäre bei ihm. Sie war in der Natur zu Hause.
Nellemann und sein Gastgeber hatten eine heftige Diskussion gehabt. In den letzten Monaten hatte er es immer wieder versucht, aber Axel war unnachgiebig. Er hatte die Sache heruntergespielt und mit rücksichtsloser Logik an Nellemanns Verzweiflung vorbeiargumentiert.
Hinter den geschlossenen Türflügeln der Bibliothek hatten sie sich angeschrien. Jacob Nellemann hatte fast gebrüllt, in Tränen aufgelöst. Er schämte sich dafür. Es wäre nicht nötig gewesen, denn am Ende waren sie sich mehr oder weniger einig geworden. Ein stillschweigendes, aber solides Einverständnis.
Plötzlich drückte ihn ein dumpfer Schmerz unter dem Brustbein, den er nur allzu gut kannte. Nellemann blieb stehen und hielt sich den Bauch, bis das Schlimmste vorüber war. Seine Stiefel sanken in den weichen Waldboden. Er fischte ein Tramadol aus der Emailledose, die er immer in der Hosentasche hatte, und spülte es mit einem Schluck Wasser hinunter. Dann atmete er tief ein und hielt die Luft an. Langsam verschwand der Schmerz. Es dauerte von Mal zu Mal länger.
Der Schütze öffnete die Hecktür des Landrovers, nahm den Compound-Bogen aus dem Etui, setzte ihn mit geübten Handgriffen zusammen, testete die Spannung der Dakron-Sehne, wählte zwei schwarze Jagdpfeile aus, leckte über die Kanten der Steuerfedern und kontrollierte, ob die Spitzen gut festgeschraubt waren. Er versicherte sich, dass die Pfeile vollkommen identisch waren, und klickte sie in die Halterung am Bogenschaft ein. Einen kurzen Moment betrachtete er kritisch die Radspuren und Stiefelabdrücke in der feuchten Erde, dann verschwand er im Wald.
Der Schütze war es gewohnt, sich im Gelände zu bewegen. Er ging mit festen Schritten zwischen den Bäumen durch. Alle hundert Schritte blieb er stehen und studierte das Display eines GPS-Empfängers. Ein kleines schwarzes Kreuz markierte seine Position.
Sein Orientierungssinn war ausgezeichnet. Auf der linken Seite glitzerte ein kleiner See. Er hielt sich sorgsam im Schatten oder im dichten Unterholz, wo er in seinem Tarnanzug schon aus wenigen Metern Entfernung unsichtbar wurde. Er wusste, dass er unmittelbar vor der Lichtung war, die sich nach Südwesten öffnete. Kein Blatt raschelte unter den Füßen des Jägers, kein Zweig knackte. In einer Baumkrone klopfte ein Specht.
Jacob Nellemann schwang seine Holland & Holland .300 von der Schulter, schob den Bolzen zurück und kontrollierte das Magazin. Er liebte dieses Gewehr. Vor zwanzig Jahren hatte er es in London für ein Vermögen gekauft, was er nie bereut hatte. Es war gut ausbalanciert und duftete streng nach Waffenöl. Der sinnlich glatte Schaft war aus feingemustertem Walnussholz. Im Grunde wurde die Waffe Jahr für Jahr schöner. Jacob Nellemann mochte schöne, außergewöhnliche Dinge. Dinge, um die ihn andere Männer beneideten.
Er hatte es auf hundert Meter eingeschossen, benutzte nie ein Zielfernrohr. Bei seiner ersten Safari im Krüger-Park war ihm aufgefallen, dass weder die weißen Jäger noch die Parkbediensteten Zielfernrohre gebrauchten. Seitdem fand er alle Zielhilfen feige und unsportlich.
Er ging in nördliche Richtung. Überall lag Windbruch in verschiedenen Verfallsstadien. Der Wald war sich selbst überlassen, war zu einem üppig wuchernden, schwer durchdringlichen Refugium für Wild und Vögel geworden. Rechts glitzerte der Gyrstinge Sø. Am nördlichen Ende des Sees lag eine längliche Lichtung. Meistens graste dort frühmorgens das Wild.
Eine leichte Sommerbrise streifte sein Gesicht. Hundert Meter vor ihm lichtete sich der Wald. Jacob Nellemann schlich sich lautlos an. Eine Waldtaube gurrte. Weit weg, auf der anderen Seite der Lichtung, hörte er einen Specht klopfen. Er näherte sich den letzten Bäumen, kontrollierte die Windrichtung, seinen Atem und die Sicherung unter seinem Daumen. Ließ eine Patrone in die Kammer gleiten.
Das Licht flirrte im hohen Gras, Insekten schwärmten zwischen Blumen und Gräsern. Löwenzahnsamen tanzten ein diesiges Menuett in der Morgensonne. Er ging in die Hocke, bog vorsichtig die Zweige auseinander. Er hob das kleine Fernglas, das um seinen Hals hing, vor die Augen und schirmte es bedachtsam ab, um jede Reflexion zu vermeiden.
Er brauchte es nicht.
Direkt vor ihm, fünfzig Meter entfernt, grasten zwei Rehböcke. Hin und wieder hoben sie die anmutigen Köpfe und drehten die Ohren in alle Richtungen, aber sonst waren sie überraschend unachtsam. Jacob Nellemann kroch einen Meter nach vorn. Jetzt hatte er freies Schussfeld. Er zielte auf den größeren der beiden Böcke, der still wie eine Statue stand. Es würde ein perfekter Blattschuss werden. Er richtete sich halb auf, presste den glatten Schaft ans Kinn und entsicherte das Gewehr. Korn über Kimme, direkt hinter dem rechten Schulterblatt des Bocks. Er legte den Finger an den Abzug, atmete langsam aus.
Plötzlich hoben beide Böcke die Köpfe und erstarrten. Aber sie sahen nicht in seine Richtung, sondern zum Waldrand auf der anderen Seite. Der Specht hatte aufgehört zu klopfen.
Der Schütze lehnte sich gegen einen Baumstamm. Auf der Wiese, keine dreißig Meter entfernt, grasten zwei Böcke. Irgendetwas ließ sie erstarren. Der Jäger spähte über ihren Rücken, legte einen Pfeil in den Bogen und zog die Sehne bis zum Kinn an.
Jacob Nellemann runzelte die Stirn und starrte über das Ziel hinweg. Die Böcke ließen die Köpfe erhoben, bereit zur Flucht. Ihre Aufmerksamkeit war auf den Waldrand gegenüber gerichtet. Dort erkannte Jacob Nellemann die Andeutung einer Bewegung. Er nahm die linke Hand vom Gewehr und griff nach dem Fernglas.
Auf der anderen Seite teilten sich wie von selbst die Äste, nahmen Gestalt an. Sekunden bevor er sich sicher war, erkannte er im Unterbewusstsein den Umriss eines Menschen. Die Böcke wirbelten eine Wolke aus Blütenstaub auf und sprengten davon.
Jacob Nellemann stand auf, öffnete den Mund zum Protest. Der Mensch auf der anderen Seite trug dunkle Tarnkleidung. Einen Augenblick sah Jacob Nellemann das Gesicht im Schatten der Kapuze.
Der Jagdpfeil traf Jacob Nellemann mit der Kraft eines Vorschlaghammers mitten in die Brust. Die Spitze schlug in den Brustkorb, durchbohrte das Herz und kam unter dem linken Schulterblatt wieder hervor.
Er fiel auf den Rücken, wobei er einen harmlosen Schuss in die Baumkronen auslöste. Innerhalb weniger Sekunden pumpte sein Herz den gesamten Kreislauf leer. Schäumendes Arterienblut füllte seine Brusthöhle.
Jacob Nellemann dachte: Nein! Dann durchströmte ihn unendliche Gnade, die Baumkronen stürzten auf ihn ein, Himmel und Licht verschwanden.
Der Schütze lehnte ruhig den Bogen an den Stamm, blieb eine Weile still stehen und lauschte in den Wald. Nichts. Als ob der Wald auch lauschte und nach dem Schuss den Atem anhielt. Bis der Specht wieder begann. Der Schütze ging über die Wiese. Er ließ die Hände über die Grasähren gleiten, drehte das Gesicht zur Sonne und schloss die Augen. Blütenstaub puderte seine schwarzen Handschuhe.
Er erreichte Jacob Nellemann, ging in die Hocke und betrachtete lange das Gesicht des Toten. Dann griff er unter die linke Schulter der Leiche, drehte den Oberkörper auf die Seite und hielt ihn zwischen den Beinen fest. Er schraubte die Pfeilspitze vom Schaft, klopfte mit einem Zweig die Erde von den Widerhaken, zog den Schaft aus der Brust des Opfers und wischte das Blut mit Küchenpapier ab. Er legte das Papier in eine verschließbare Plastiktüte und steckte sie in die Brusttasche seines Anoraks.
Die Leiche sank wieder auf den Rücken. Der Schütze fand das Handy und die Schlüssel des Toten in dessen Jagdtasche, öffnete das Telefon, entfernte den Akku und holte mit einer Uhrmacherpinzette einen kleinen, flachen GPS-Chip aus dem Innern des Gerätes. Er war nicht größer als eine Büroklammer und hatte mit Hilfe des Akkus und der Handy-Antenne jede Bewegung des Opfers übertragen.
Der Schütze schloss den Deckel und schaltete das Handy ein. Bearbeitete ein paar Minuten lang die Tasten und legte es in die Jagdtasche zurück. Dann zog er eine flache Metalldose aus der Anoraktasche und drückte Jacob Nellemanns Schlüssel fest auf die Wachsplatte, die in der Dose lag.
Es hatte nur zwanzig Sekunden gedauert und nicht die geringste Mühe gemacht, Jacob Nellemann das Handy aus der Tasche zu ziehen. Sie hatten sich in einem Café in Kopenhagen getroffen. Nellemann hatte seine Jacke über einen Stuhl gehängt. Der Schütze hatte sich entschuldigt und die Operation auf der Toilette vorgenommen. Zum Abschied hatte Nellemann ihn spontan umarmt, und der Schütze hatte das Handy in die Jacke zurückgleiten lassen. Es hatte ihn übermenschliche Anstrengung gekostet, Nellemanns Umarmung zu erwidern, anstatt ihm das Knie in die Eier zu rammen.
2
Das Wasser war sauber und kalt gewesen. Er legte den Heimweg auf dem Fahrrad in Rekordzeit zurück und notierte sie auf einem Block, der neben der Küchentür hing. Nach einer kurzen Dusche betrachtete der große Mann seinen Körper im Spiegel. Er war zufrieden. Er zog ein weißes Hemd an, band sich einen graugestreiften Schlips um und schlüpfte in einen leichten, dunklen Anzug.
Er trank im Stehen Kaffee, während er die Zeitungen durchblätterte. Der große Mann hatte alle wichtigen Morgenzeitungen, mehrere englischsprachige Wirtschaftsblätter sowie politische Zeitschriften abonniert.
Eine Titelseite berichtete über den Fund von Nellemanns Leiche. Er las den Artikel, dann durchsuchte er die anderen Zeitungen.
Als der Toaster klickte, zuckte er nervös zusammen.
Er aß langsam, kaute jeden Bissen sorgfältig.
Es war drei Uhr früh geworden, bis er ins Bett gekommen war. Alles war genau nach Plan gelaufen. Im Flur hob er ein Paar dunkelgraue Hosen und einen dunkelgrauen Pullover vom Boden auf. Es war ein weitverbreiteter Irrtum, dass schwarze Sachen am besten geeignet seien, um nachts nicht gesehen zu werden. Er faltete die Kleider ordentlich zusammen und legte sie in einen Schrank. Dann ging er in die Waschküche, wo er seine Stiefel in einem Stahlbecken reinigte, bis alle Spuren von Erde und Pflanzen entfernt waren.
Der große Mann betätigte die Fernbedienung der Garagentür, kontrollierte den Motorraum und kniete sich auf den Boden, um die Unterseite des Wagens zu inspizieren. Alte Gewohnheiten starben nicht so schnell, und dies war eine gute Gewohnheit. Er setzte sich ans Steuer und betrachtete seine Hände. Starke, sonnengebräunte Hände mit dicken, hellen Haaren. Dann zog er sein Handy aus der Tasche. Eine neue Nachricht. Er drückte auf »Antworten«.
»Ich habe den Bogen gefunden«, sagte er, als er die Stimme am anderen Ende der Leitung hörte.
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher. Und den Landrover.«
Stille.
»Aufenthaltsort?«
»Das finde ich heraus.«
»Tu jetzt nichts … Radikales. Nicht bevor wir uns einig sind. Vielleicht sollten wir das lieber der Polizei überlassen.«
Der große Mann schnaubte. »Die Polizei? Die finden doch nicht mal ihren eigenen Arsch in einem Spiegelkabinett! Wir haben keine Zeit!«
»Das stimmt nicht. Gewohnheitsdenken. Finde heraus, wo er sich aufhält, dann reden wir weiter.«
Er kannte den scharfen Ton, die Offiziersstimme, die keine Widerrede duldete.
»Jawohl, Herr Hauptmann«, antwortete der große Mann ironisch, aber der andere hatte schon aufgelegt.
3
Er war der Infanterist Wassili Iwanowitsch Koslow. Es war ein bitterkalter Januartag im Jahr 1943. Er rückte mit seiner dezimierten Abteilung auf das Rathaus von Stalingrad zu, Straße für Straße, Haus für Haus, Zimmer für Zimmer, durch ausgebombte Ruinen. Sie kämpften gegen eine der berüchtigtsten und erfahrensten Einheiten des Dritten Reiches. Trotz der Übermacht der Deutschen eroberte die Rote Armee die Stadt zurück, Meter für blutigen Meter. Gerade lag er hinter einer improvisierten Straßensperre auf dem Bauch und spähte über das Korn seiner Maschinenpistole. Das letzte Magazin, die letzten vierundfünfzig Patronen, dann würde der Krieg alle Pforten zur Hölle öffnen. Die Kugeln pfiffen ihm um die Ohren, Handgranaten explodierten inmitten seiner Kameraden. Am anderen Ende der zerstörten Straße hatte sich ein MG24 auf seine Stellung eingeschossen. Leuchtspurmunition zeichnete blitzschnelle Streifen im Halbdunkel und schlug mit lautem Knall direkt vor ihm in Mauerreste und Ölfässer. Da hörte Wassili das charakteristische Klicken einer Stabhandgranate, die einen Meter neben ihm landete – der sichere Tod in einem Radius von zehn Metern. Wenn er aufsprang, würde das Maschinengewehr ihn erwischen, wenn er liegen blieb, würde sein Körper in wenigen Sekunden zerfetzt in den grauen Himmel wirbeln.
Kommissar Robin Hansen von der Dänischen Reichspolizei fuhr zusammen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte und ihn aus seinem tranceähnlichen Zustand riss. Eine Explosion ertönte, ein Handgranatensymbol blinkte lakonisch: You have been killed by a grenade, watch out for …
Er schüttelte die Hand ab, sah seine Frau verärgert an.
»Schau, was du gemacht hast!«
»Du bist ja verrückt«, sagte sie. »Dein Chef ist am Telefon. Philipsen.«
Der Kommissar blieb geistesabwesend, der Cursor bewegte sich wie von selbst zur Schaltfläche Continue mission, aber sie legte die Hand erneut auf seine Schulter, diesmal fester.
»Philipsen?«
»Dein Chef«, betonte sie.
Er lächelte. Er liebte sie.
Robin Hansen fischte eine Camel aus einem zerknautschten Päckchen, zündete sie an, warf das Feuerzeug auf den Schreibtisch und nahm widerwillig das kabellose Telefon entgegen. Durch den Zigarettenrauch betrachtete er den Bildschirm. Trompeten und Streicher stimmten die dramatische Erkennungsmusik von Call of Duty an. Es klang elegisch.
»Ja?«
»Philipsen. Wer ist gestorben?«
Robin schaltete den Computer aus.
»Danke. Ich möchte, dass du dir einen Fall ansiehst. Einen neuen. Ich weiß, du müsstest das nicht mit deiner neuen Regelung, aber Torsten liegt mit Gallenentzündung im Krankenhaus, Kim ist in den USA auf einem Sicherheitsseminar des FBI, und der Rest ist mit dem neuen Rockermord in Jütland beschäftigt.«
»Haben die schon wieder angefangen?«
»Hoffentlich nicht«, sagte Philipsen.
»FBI? Hört sich interessant an.«
»Ja, verdammt interessant. Und jetzt auch noch das. In Ringsted. Sie haben nach dir gefragt. Der lokale Sheriff, Karsten Quist. Ihr kennt euch?«
»Wir sind zusammen gesegelt.«
»Gut.«
Robin nahm einen tiefen Zug. »Worum geht es?«
»Liest du keine Zeitungen?«
»Wir sind erst gestern Abend aus Kreta heimgekommen.«
»Ach so, Urlaub«, sagte Philipsen zynisch. Dieser Umstand war für ihn nur ein weiterer Beweis für Robin Hansens Dekadenz.
»Komm her, dann erzähle ich dir alles.«
»Jetzt?«
»Wenn du die Güte hättest. Soviel ich weiß, bist du immer noch hier angestellt. Außerdem ist dieser Fall genau das Richtige für dich.«
Er nieste laut ins Telefon. Robin hielt den Hörer vom Ohr weg.
Philipsen beendete das Gespräch. Robin sah das stumme Telefon an. Er warf den Zigarettenstummel in eine Kaffeetasse und stand auf.
Ellen saß in der Küche über die Sudokus in Politiken gebeugt, die Lesebrille auf der Nasenspitze. Sie murmelte wie ein keltischer Druide. Sie war überzeugt, dass Sudokusdas logische Denken stärkten, und hatte vergeblich versucht, ihn ebenfalls dafür zu begeistern. Ihr Gehirn sei viel größer geworden, seit sie damit begonnen hatte, meinte sie. Robin Hansen war nicht der Meinung, dass sein Gehirn größer werden müsse. Im Grunde hätte er es vorgezogen, ein bisschen dümmer zu sein. Es hätte sein Leben auf barmherzige Weise friedlicher gemacht.
Fernsehen, hatte sie vorgeschlagen. Eine schonende Lobotomie. So könne er relativ schnell das Nirwana erreichen.
Er konnte seine Frau nicht ohne Ehrfurcht vor ihrer Schönheit ansehen. Oft fragte er sich, warum sie gerade ihn gewählt hatte. Sie war klein. Gebaut wie eine William-Fife-Jacht. Die meisten schätzten sie zehn Jahre jünger als ihre achtundvierzig, und er kannte nur wenige Menschen, die von Natur aus so athletisch veranlagt waren wie Ellen. Sie setzte sich völlig unbekümmert in ein Kajak oder zog Inlineskates an und sah nach zehn Minuten aus, als hätte sie nie etwas anderes getan.
Ellen ignorierte ihn. Er fischte den Zigarettenstummel aus der Kaffeetasse und warf ihn in eine Plastiktüte unter der Spüle.
»Ich muss zu Philipsen.«
»Verdammt, du hast diese Woche noch Urlaub. Kann er keinen anderen finden?«
»Die anderen sind krank oder in Jütland. Oder Virginia.«
»Ich lasse das Essen für dich stehen. Wenn du bis dahin nicht zurück bist.«
Sie vertiefte sich wieder in das Sudoku. Begann zu murmeln.
»Bin ich aber.«
Robin Hansen war 2002 im Kosovo stationiert gewesen. In der Stadt Gjakova am Ufer des Flusses Erenik. Serben, Albaner, Bosnier, Soldaten wie Zivilisten, Lager voller Waisenkinder, Hilfsorganisationen, UN- und KFOR-Truppen aus aller Welt in einem dynamischen Durcheinander. Es war wie eine Filiale von Sodom und Gomorrha gewesen. Eigentlich war er dorthingegangen, um Kurse zu halten und die theoretische Ausbildung einer neuen, nicht durch Korruption verdorbenen Polizei zu unterstützen. Aber letztendlich verbrachte er seine Zeit damit, die Ausgrabungen neuentdeckter Massengräber zu überwachen, Waffen zu beschlagnahmen und den Schwarzmarkthandel mit Medizin aus den Beständen der Friedenstruppen zu untersuchen.
Er wusste nicht, wen er schlimmer fand: die Ärzte, die die Medizin verschacherten, oder die mörderischen albanischen Schieber. Der Krieg hatte in einem Vakuum geendet, in dem wahnsinnige, schwerbewaffnete Propheten, heimatlose Milizen, Druglords und Schmuggler das Sagen hatten.
Nach zehn Monaten kam er physisch und seelisch erschöpft nach Dänemark zurück. Er hatte zu viel getrunken, vierzig Zigaretten am Tag geraucht. Auf einer Sauftour mit italienischen Carabinieri hatte er sich die Schulter tätowieren lassen. Leider hatte er keine Ahnung, was die Tätowierung darstellen sollte.
Robin Hansen hatte nach fünfzehn Jahren Ehe seine erste Frau verlassen und Ellen in der psychiatrischen Ambulanz der Universitätsklinik kennengelernt, wo er sich behandeln ließ. Sie arbeitete dort als Krankenpflegerin.
Er wusste nicht, ob es der kluge Arzt, die Medizin oder Ellen gewesen war, die ihn aus dem Dunkel gerettet hatte.
Ellen hatte mindestens vier besondere Eigenschaften: Sie war undogmatisch, hatte Sinn für Humor, war überaus intelligent und, wie sich zu ihrer eigenen Überraschung herausgestellt hatte, ziemlich wohlhabend. Sie hatte die Gewinne einer Immobilienfirma geerbt. Plötzlich konnten sie sich ein Boot und eine Villenwohnung in Frederiksberg leisten, und sie konnte halbtags arbeiten.
Nach vielen Monaten Überredung war er ihrem Beispiel gefolgt und als erster Polizist seines Dienstgrades auf eine halbe Stelle umgestiegen.
Es war wunderbar. Und sündhaft. Er war einundfünfzig Jahre alt. Hatte wieder begonnen zu joggen, ging wieder zum Boxtraining oder fuhr mit Ellen Seekajak. Robin Hansen war ein großer, agiler Mann. Sein Haar war hellbraun, stellenweise grau, aber immer noch dicht. Er trug eine ungebändigte Teenagerfrisur. Sein Gesicht war markant gefurcht, die Nase lang und ebenmäßig. Unter der hohen Stirn saßen dichte Augenbrauen mit einer tiefen, permanenten Falte in der Mitte. Die eigentümlich blaugrünen, tiefliegenden Augen blickten zum ersten Mal seit vielen Jahren optimistisch auf das Leben.
Robin stammte aus einer Familie, die seit Generationen fleißige, genügsame Arbeiter und Handwerker hervorgebracht hatte. Er war der Erste mit einer akademischen Ausbildung. Sein Vater hatte ihm zum Examen ein Ronson-Feuerzeug und ein silbernes Zigarettenetui geschenkt. Nach dem Dienst in der Königlichen Leibgarde hatte er ein paar Jahre lang Theologie, dann Astronomie studiert, das Studium abgebrochen, und aus Ursachen, die ihm heute nicht mehr ganz klar waren, war er schließlich auf der Polizeischule gelandet. Sechsundzwanzig Jahre waren seitdem vergangen.
Als Robin Hansen am Zimmer der drei zusammengebrachten Töchter vorbeiging, schoss ein Sibirischer Zwerghamster in einer paillettenbesetzten Puppenjacke durch den Türspalt, rannte ihm über die Füße und wie auf Schienen weiter in die Küche. Robin stieß einen Schrei aus, verfolgte den Hamster und schnappte ihn Sekunden, bevor er unter dem Kühlschrank verschwinden konnte. Die drei Zwerghamster Smut, Dongedik und John-John Hugo konnten sich platt wie Pfannkuchen drücken. Sie krochen unter Küchenschränke und hinter Paneele. Oft hatte er sie gerade noch herausgezogen, bevor sie sich unter den Bodendielen eingerichtet hatten. Der Zoohändler hatte damals versprochen, dass die Tiere höchstens anderthalb Jahre alt werden würden. Das war vor drei Jahren gewesen.
Er hob Dongedik auf und trug das fauchende Tier zurück ins Kinderzimmer, wo niemand dessen Abwesenheit bemerkt hatte, wahrscheinlich weil die Bewohnerinnen wieder einmal mit Zanken beschäftigt waren. Tatsächlich befanden sich die Kinder in einem einzigen, langen Streit, der nur unter Vorbehalt durch Perioden der Waffenruhe unterbrochen wurde. Er hatte schon lange vor, ein Schild an die Tür zu hängen, auf dem »Westjordanland« stand. Diesmal ging es um den Besitz eines geschnitzten Esels, den sie auf Kreta gekauft hatten. Die großen Mädchen waren beide elf. Sie trugen lange, zottelige Haare, ausgefranste Palästinensertücher, Nietenarmbänder und schwarze Converse-Stiefel. Johnny Rotten trifft Jassir Arafat.
Das kleine, abwechselnd engelgleiche oder rotzfreche Mädchen war erst sieben; es trug noch unschuldiges Blau oder Pink. Aber es wusste schon, wie der Hase lief. Mit der Zunge im Mundwinkel war es voller Hingabe dabei, ein Bild zu malen, das mindestens eine Enthauptung darstellte.
Er sperrte Dongedik in den Käfig, warf den Mädchen, die nichts bemerkten, einen scheelen Blick zu und drehte auf dem Absatz um.
Dann schwang er sich auf sein Fahrrad und radelte hinaus auf die ruhige, sonnige Villenallee.
Die Maschine des Trawlers vibrierte gleichmäßig unter den Sohlen der Gummistiefel. Auf der Ladeluke kauerte ein junger Mann und stützte das Kinn auf die Knie. Die äußere Mole des Fischereihafens glitt vorbei, vor ihnen lag die offene Nordsee. Der Motor drehte auf, das Wasser zischte um den Bug. Er döste in der Sonne, rauchte eine Zigarette nach der anderen und genoss den Fahrtwind auf der nackten Haut seines Oberkörpers. Am Horizont schaukelte die Stadt. Er warf eine Zeitung ins Wasser und beobachtete, wie sie sich auffaltete, ihre Seiten entlang der Heckwelle verteilte und verschwand.
Hinter dem Steuerhaus klapperte Jens mit Töpfen und Mülleimern. Möwen schwebten auf weißen Flügeln aus dem Sonnenlicht. Jonas lächelte beim Anblick ihrer kontrollierten Raufereien um den Kombüsenabfall. Er wollte noch eine Zigarette rauchen, bevor er Niels am Ruder ablöste. Der langsame Rhythmus des Meeres würde den Trawler Rita mit seinen drei Besatzungsmitgliedern allmählich vereinnahmen. Es würde mehrere Wochen dauern, bis sie wieder heimkamen.
4
Robin Hansen lag mehr in dem Wegner-Stuhl, als dass er darin saß. Seine alles andere als sauberen Wüstenstiefel wippten auf dem Jette-Nevers-Teppich des Chefinspektors hin und her. Apathisch betrachtete er die martialische Aufstellung antiker Zinnsoldaten in der Vitrine am Fenster. Philipsen hatte eine Kompanie wellingtonscher Grenadiere in Kampfformation auf einem Schlachtfeld aus Pappmaché aufgestellt.
Im Polizeihauptquartier war es still und heiß. Robin bezweifelte, dass außer Philipsen und dessen Sekretärin Frau Cerberus irgendjemand auf der Etage anwesend war.
Die Luft stand still. Die Fenster zum berühmten Runden Hof waren hermetisch verschlossen, in der Ecke summte ein elektrischer Staubfilter. Philipsen war Multiallergiker, der Sommer war sein Feind. Jedes Jahr entwickelte er neue Allergien.
Er war korpulent, sein dünnes, rotes Haar hatte er über die fleckige Halbglatze zurückgekämmt. Philipsen war energisch und hochbegabt. Er besaß unglaubliches Sprachtalent, sprach fließend Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Akzentfrei.
Unbeirrbar. Ein durchtriebener Politiker. Philipsen verfügte über ein beneidenswertes Netz internationaler Kontakte aus seiner Zeit im Geheimdienst. Er pflegte diese Verbindungen wie ein Levantiner seinen Schnurrbart.
Philipsen war ein Mann, den jeder Grundbesitzerverein oder Brieftaubenclub zum Vorsitzenden gewählt hätte – und er hätte den Job gut gemacht. Er kannte nur ein Motto: den gesunden Menschenverstand. Er glaubte fest an den vernünftigen Menschen. Und er konnte äußerst rigoros sein, wenn ein Sünder nicht für die klare Stimme der Vernunft zugänglich war.
Die Brille ließ seine wässrigen, braunen Augen unnatürlich groß aussehen. Sein Gesichtsausdruck war entweder gleichgültig oder missbilligend.
In diesem Augenblick war er missbilligend. Philipsen musterte Robin Hansen von unten nach oben: ausgelatschte Schuhe, heruntergerutschte Strümpfe, die nicht zusammenpassten, Kettenöl auf dem rechten Unterschenkel. Lange, braune Beine in khakifarbenen Shorts, die ein alter Militärgürtel auf der Hüfte hielt. Ein verwaschenes T-Shirt mit der Aufschrift »You can run, but you will only die tired«. Philipsen hielt es für ein Souvenir aus dem Kosovo, tatsächlich aber war es ein Andenken an die Scharfschützenausbildung in Fort Benning. Eine zerzauste Teenagerfrisur, die die blaugrünen Augen des Kommissars fast verdeckte.
Philipsen war korrekt gekleidet. Sein hellblaues Baumwollhemd war bis zum Kragen zugeknöpft und hatte große Schweißflecken unter den Armen. Der Schlips war diskret gestreift, der Gürtel an der dunklen Anzughose schwarz. Die Schuhspitzen glänzten spiegelblank. Seine Augen tränten unaufhörlich wie die eines überzüchteten Schoßhundes. Alle paar Minuten putzte er sich mit balsamisch duftenden Papiertaschentüchern die rote Nase. Es war die Saison für Beifußpollen. Warum zum Teufel wuchs Beifuß mitten in Kopenhagen, konnte ihm das jemand erklären?
Die beiden Männer hatten nicht viel füreinander übrig. Seit Robin Hansen auf Teilzeit umgestiegen war, war ihr Verhältnis dauerhaft angeschlagen. Philipsen konnte diese lächerliche Regelung nur als fehlendes Engagement auffassen – womit er gewissermaßen recht hatte. Es war eine Untergrabung des Teamgeistes, ein eklatanter Verrat am Vorgesetzten, also an ihm. Für Philipsen war es eine Frage der Ehre, morgens der Erste und abends der Letzte im Büro zu sein.
Philipsen kam direkt zur Sache: »Quist möchte die Verantwortung für den Fall am liebsten teilen.«
»Klar.«
Robin Hansen wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Hitze war unerträglich, er atmete kurz und flach, als hätte er einen Malariaanfall.
Philipsen nieste dreimal hintereinander. Ein dicker Zeigefinger durchstach das nasse Papiertaschentuch.
»Es gibt natürlich gewisse Umstände zu berücksichtigen«, räumte er ein, während er wütend seinen feuchten Finger betrachtete.
»Nobel?«
»Ja, und Nellemann selbst. Die Illustrierten. Alle Bosse kannten ihn, er hielt jedes Jahr einen Vortrag über Branding an der Börse.«
Der Jagdunfall auf Schloss Gyrstinge dominierte die Morgenzeitungen. Jacob Nellemann war Mitinhaber einer bekannten Werbeagentur in der Hauptstadt und hatte in einer beliebten Lifestyle-Serie von TV2 mitgewirkt, eine Sendung nach dem Motto Sag mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist, die ursprünglich von der BBC entwickelt worden war. Die Medien stellten ihn als Großwildjäger, Segelflieger und Sportsegler dar. Die eigentliche Hauptperson war jedoch der Schlossherr, Axel Nobel. Die Journalisten hingen ihm wie Bluthunde an den Fersen, weil sie einen waschechten High-Society-Skandal witterten.
Axel Nobel spielte eine zentrale Rolle in der dänischen Aristokratie. Vorstandsvorsitzender einer enormen – und enorm alten – Familienreederei, Titel eines Hofjägermeisters, Gastgeber des Prinzgemahls sowie der übrigen korpulenten Jägerelite Dänemarks beim jährlichen Massenmord auf der Privatinsel der Familie im Großen Belt. Vergangenheit als Elitesoldat, Sponsor der dänischen Mannschaft im America’s Cup und schließlich Eigentümer einer Reihe geklonter, blonder Models, die einander in den Betten des Schlosses, der Villa in Hørsholm, der Insel, des Hauses in St. Tropez und des Châtelets in Gstaad ablösten.
Axel Nobel war nicht einmal fünfzig. Seine militärische Ausbildung in Sandhurst und Westpoint entsprach ganz der Familientradition für jüngere Brüder, aber ein bösartiges Lymphom bei seinem älteren Bruder, der bereits ausgebildeter Reeder war, legte alle persönlichen Zukunftspläne auf Eis.
Erst zögernd, aber dann mit fester Hand hatte Axel Nobel die Firma übernommen.
Die Geschichte war ein Geschenk des Himmels für viele Illustrierte.
»Kennst du ihn?«, fragte Robin.
Es war kein Geheimnis, dass Philipsen, besonders nach seiner Ernennung zum Kommandeur des Dannebrog-Ordens, Umgang mit den einflussreichsten Personen des Landes pflegte.
»Nein. Sehe ich so aus, als wäre ich in Herlufsholm zur Schule gegangen? Jagd!« Philipsen schnaubte das Wort. Robin wusste, dass sein Chef neben all seinen unbestreitbar guten Eigenschaften ein großer Tierfreund war.
»Wer zum Teufel geht heutzutage mit einem Flitzebogen auf die Jagd, wenn es Gewehre mit Zielfernrohren, Laserzielgeräten und was weiß ich alles gibt?« Der Chefinspektor öffnete die Schreibtischschublade und holte ein Nasenspray heraus. Er sprühte einmal in jedes Nasenloch, worauf er gewaltig schnaufte und nieste. Dann warf er das Nasenspray in die Schublade zurück und knallte sie zu.
»Moderne Compound-Bögen sind extrem präzise und schlagkräftig. Hast du nicht Deliverance gesehen?«, fragte Robin. »Zweihundert Pfund, Reichweite über mehrere hundert Meter. Es passiert zwar öfter, dass man das Wild nur anschießt, und Pfeile haben nicht dieselbe Schockwirkung wie eine Kugel, aber es drückt auch eine gewisse Überlegenheit aus.«
Philipsen sah ihn interessiert an. »Es gibt also Leute, die so etwas tun?«
»Ja. Ein Bock auf einer Lichtung zwischen zwei Männern. Der eine mit Gewehr, der andere mit Pfeil und Bogen. Der Bock flüchtet, beide schießen.«
Robin Hansen schob die rote Mappe auf Philipsens blankpoliertem Mahagonischreibtisch von sich, als wolle er signalisieren »Empfänger unbekannt«. Er hatte auf den ersten Blick erkannt, dass die Digitalbilder des Unfallortes ihre eigene Sprache sprachen.
»Axel Nobel hat Quist erzählt, dass sie eine Woche zuvor einen Rehbock gefunden hätten, der mit einem Pfeil angeschossen war. Er war offenbar noch mehrere hundert Meter gelaufen, bevor er umfiel«, sagte Philipsen.
Er sah Robin Hansens zerknitterte Kleidung an und richtete unbewusst seine Krawatte. »Eine verdammte Schweinerei!«
»Wo liegt das Problem?« Robin Hansen knetete ein Päckchen Camel in der Hosentasche wie ein Hummer, der sein Frühstück inspiziert. Er hatte große Lust zu rauchen, aber er wusste, dass Philipsen sofort die Dienstpistole aus der Schublade ziehen und ihn erschießen würde, wenn er nur das Päckchen aus der Tasche zog.
»Das Problem ist, dass wir über Nobel und Nellemann reden. Und die Presse. Und Quist, der so große Angst hat, Fehler zu machen, dass er lieber gar nichts tut. Außerdem haben sie den Pfeil nicht gefunden.«
»Was haben sie überhaupt getan?«
»Nichts. Den Tatort untersucht, natürlich. Gute Arbeit übrigens, aber sonst nichts. Niemand wurde befragt. Ich habe sie gebeten zu warten. So magst du es am liebsten. Jungfräulich.«
»Danke.«
Robin Hansen nahm die rote Mappe, rollte sie fest zusammen und schlug sie auf die Armlehne. Philipsen schaute wütend zu. Wenn es etwas wie eine Schule intuitiver Ermittlung gegeben hätte, wäre Kommissar Robin Hansen ihr eifrigster Verfechter gewesen. Kaum Bedarf an technischer Hilfe. Und, nein danke, bitte keine Einmischung. Philipsen nannte diese Taktik »Hansens Mönchsmethode«.
Philipsen, der selbst jede Form von Einmischung hasste, respektierte Hansens Arbeitsweise. Hansen hatte die seltene Gabe, abwegige Möglichkeiten in greifbare Wahrscheinlichkeiten zu verwandeln. Das war ein Grund. Der zweite Grund war Robin Hansens ungewöhnlich hohe Aufklärungsquote.
Doch dies alles war gewesen, bevor der Kommissar – ehemals Philipsens rechte Hand – ihn verraten hatte. Sie alle. Mit dieser weibischen Halbtagsregelung.
»Glaub mir«, sagte Philipsen theatralisch, »wenn es jemand anderen gäbe, den ich dort hinschicken könnte, würde ich es tun. Ich kenne dich.«
»Wie meinst du das?«
Philipsen sah ihn an.
»Du weißt genau, was ich meine. Du schaffst es garantiert, die Sache kompliziert zu machen.«
»Ich mache nur Dinge kompliziert, die kompliziert sind. Fahr doch selbst hin.«
Robin Hansen sah seinen Vorgesetzten herausfordernd an.
Plötzlich lachte Philipsen. Entkrampfte die Stimmung mit einer Handbewegung.
»Ich auf einer Wiese, mitten im Wald? Jetzt? Ich würde innerhalb von zehn Sekunden einen anaphylaktischen Schock erleiden!«
Robin Hansen unterdrückte ein Lächeln. Er sah es lebhaft vor sich. Ein herrliches Bild, fand er.
5
Der Assistent öffnete eine Kühlzelle, hob das Laken an und kontrollierte den Namenszettel am rechten großen Zeh der Leiche. Er zog die Stahlbahre heraus und ließ sie rasselnd auf die mit Gummi verkleideten Rollen des Hubwagens gleiten. Dann schob er den Wagen zum Sektionstisch, senkte ihn auf die Höhe der Tischkante ab und zerrte die Leiche unfeierlich auf die Stahlplatte, die mit mehreren Abläufen versehen war.
Der Staatsobduzent nickte ihm zu.
»Danke, Johnny. Wir kommen allein zurecht.«
Staatsobduzent Tollund war ein drahtiger, buckliger Mann. Er war fast siebzig, im Herbst würden sie ihn endgültig in Pension schicken. Er war wie ein Chirurg gekleidet: ein grüner Papierkittel, grüne Überschuhe, ein Plastikvisier vor der halbrunden Lesebrille, weiße Latexhandschuhe. Hinter ihm stand in respektvollem Abstand eine junge Ärztin in einem gewöhnlichen Arztkittel und mit einem weißen Kopftuch. Sie hielt die Hände hinter dem Rücken verschränkt und musterte Robin.
Der Kommissar erwiderte ausdruckslos ihren Blick. Er fand, dass sie viel zu jung für den Job aussah und lieber daheim über den Matheaufgaben sitzen oder in MySpace surfen sollte.
Er schüttelte sich, verschränkte die Arme und starrte ins Leere. Er hasste diesen Ort. Die Kälte, den Gestank, das Bewusstsein, dass hinter jeder quadratischen Kühltür eine Leiche lag. Die Stille.
Tollund schlug mit einer geübten Handbewegung das Laken zur Seite, wie ein Bildhauer, der sein Werk enthüllt. In einer Plastikkiste neben der Leiche lag der Herz-Lungen-Block: Leber, Milz, Herz, Nieren und Darm in einem unförmigen Haufen. Jedes Organ war mit einem gelben Etikett versehen.
Robin betrachtete Jacob Nellemanns bleichen, entseelten Körper. Der Tote war groß und mager, hatte einen gepflegten Vollbart und graue, halblange Haare. Seine Arme lagen steif am Oberkörper, an den Fingern konnte man noch erkennen, wo er Ringe getragen hatte. Durch den halboffenen Mund schimmerten mehrere Goldkronen. Die unteren Augenlider waren eingesunken, die Ränder der Hornhaut lagen frei, und die ursprüngliche Farbe der Iris war einem undefinierbaren Grauton gewichen. Vom Hals bis zum Schambein zog sich ein langer Schnitt. Er war mit einem groben Nylonfaden zugenäht, die Bauchdecke sackte unnatürlich tief nach innen. Auf der Höhe des Herzens klaffte eine sternförmige Wunde.
Tollund blätterte in einem Bericht und ließ die Hälfte der Blätter auf den gefliesten Boden fallen. Robin half der Assistenzärztin, sie aufzuheben. Die Fliesen waren klinisch rein.
»Mmm, Jacob Nellemann, 50 Jahre. Geboren am 12.9. 1955. Europid. Größe 184 Zentimeter, Gewicht 76 Kilo und 788 Gramm.«
»Minus 21 Gramm«, murmelte Robin.
Das Mädchen lächelte. Tollund sah ihn über seine Halbbrille hinweg fragend an.
»Ach, nichts«, sagte Robin.
Tollund schaute demonstrativ auf die Uhr über dem Sektionstisch.
»Kerntemperatur 28,3 Grad Celsius, als sie gemessen wurde. Die relative Luftfeuchtigkeit am Fundort war 44 Prozent, die Temperatur des Waldbodens 15 Grad Celsius. Er war warm angezogen, also hat er nicht länger als fünf Stunden dort gelegen. Keine Kratzer oder andere Kampfspuren, natürlich. Narbe nach Entfernung eines Muttermals auf der rechten Wange, zwei Zentimeter.« Tollund las aus einem weiteren Bericht in einer grauen Mappe. »Hmm, ja, hier in der Klinik, in der Plastischen Chirurgie. Ein Basalzellkarzinom, vollkommen harmlos. Acht Zentimeter lange Narbe an der rechten Leiste, Hernia inguinalis, also Leistenbruch.«
Robin hielt zwei Meter Abstand und trat von einem Fuß auf den anderen. Er atmete durch den Mund.
»Zur Sache: Läsion links vom Brustbein.« Tollund zeigte unnötigerweise mit dem Kugelschreiber auf das Loch im Brustkorb. »Austrittsläsion unter dem linken Schulterblatt. Vorne sind die vierte und fünfte Rippe glatt durchschossen, der Brustkorb war voll Blut, beide Lungen eingeklappt und atelektatisch. Pericardium perforiert, linke Herzkammer lazeriert. Die Aorta descendens wurde getroffen.«
Der Kommissar sah ihn an: »Mit anderen Worten: ein Pfeil mitten durchs Herz?«
Tollund lächelte mild und klickte rhythmisch mit dem Kugelschreiber. Er gab die Berichte der Assistenzärztin und drehte die Leiche mühevoll auf die Seite. Dann schob er einen Gummiblock unter ihr Becken, um sie zu stabilisieren. Rücken, Gesäß und Beine waren voller blauschwarzer Leichenflecken. Das Gesäß war mager und faltig, wie nach einem raschen, ungeplanten Gewichtsverlust. Er steckte einen behandschuhten Finger in die Austrittswunde unter dem Schulterblatt.
»Hier ist der Pfeil herausgekommen. Genau dasselbe Muster und dieselbe Größe wie auf der Vorderseite. Die Spitze wurde also nicht deformiert. Gehärteter Stahl.«