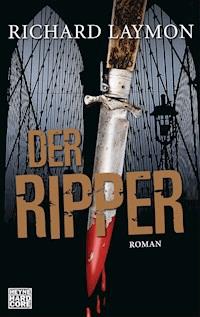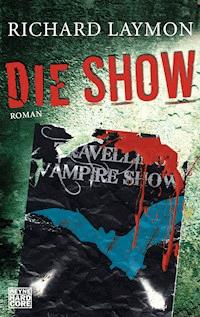2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Verstörend, aufregend und provozierend
Ein seltsamer, schwarzer Regen fällt auf die Kleinstadt Bixby. Er kommt in Schauern und ist warm und irgendwie unnatürlich und er verändert die Stadt. Die Bewohner werden erfüllt von Hass und Wut – und dem Wunsch zu töten. Und als der Regen weiter fällt, mischt sich das Wasser mit dem Blut der Opfer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Zum Buch
Kurz nach einem rassistisch motivierten Mord fällt ein seltsamer, schwarzer Regen auf die Kleinstadt Bixby. Seine warmen Schauer versetzen jeden, der sie auf der Haut spürt, in ekstatische Verzückung. Doch der Regen weckt auch die pure Mordlust. Polizisten erschießen diejenigen, die sie beschützen sollen, harmlose Passanten fallen über ihre Mitmenschen her. Immer mehr Einwohner werden Opfer dieses unheimlichen Phänomens – erfüllt von Hass und Wut ziehen sie aus, um diejenigen, die den schwarzen Tropfen entkommen sind, zu töten. Aus ehemals freundlichen Nachbarn werden unbarmherzige Psychopathen, und schon bald senkt sich der finstere Regen wie ein Leichentuch über die Stadt.
Zum Autor
Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und studierte in Kalifornien englische Literatur. Er arbeitete als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete und zu einem der bestverkauften Spannungsautoren aller Zeiten wurde. 2001 gestorben, gilt Laymon heute in den USA und Großbritannien als Horror-Kultautor, der von Schriftstellerkollegen wie Stephen King und Dean Koontz hoch geschätzt wird. Richard Laymon im Internet: www.rlk.cjb.net
Lieferbare Titel
Rache – Die Insel – Das Spiel – Nacht – Das Treffen – Der Keller – Die Show – Die Jagd
Inhaltsverzeichnis
Für Wren und Ida Marshall,zwei der besten Menschen, die ich kenne.Möge das Glück der Irenimmer mit euch sein.
Der Tatort
Das ist wirklich verdammt bescheuert, dachte Hanson. Trotzdem kletterte er nicht wieder hinunter.
Der Maschendrahtzaun, der das Footballstadion der Lincoln-Highschool umgab, wackelte, als er daran hochkletterte. Das Drahtgeflecht gab metallisch klirrende Geräusche von sich, die in der Stille des Novemberabends entsetzlich laut klangen. Doch Hanson bezweifelte, dass irgendwer den Lärm hörte.
Die nächstgelegenen Häuser jenseits der Tribünen auf der gegenüberliegenden Seite des Stadions waren außer Sichtweite. Hinter ihm erstreckte sich ein leeres Feld bis zu den Schulgebäuden in der Ferne. Das Stadion selbst schien verlassen.
Niemand würde das Klirren des Zauns hören, da war sich Hanson sicher. Doch es zerrte an seinen Nerven, so wie das Rascheln von trockenen Blättern unter den Füßen einen Mann nervös macht, der nachts allein über einen Friedhof geht. Sein Herz hämmerte. Schweiß lief aus allen Poren. Seine Arme und Beine zitterten.
Den Zaun hochzuklettern war leicht. An diesem Ort zu sein jedoch nicht.
Oben angelangt stemmte er sich vorsichtig balancierend über den Rand. Er ließ sich die drei Meter hinunter ins Gras fallen und landete mit gebeugten Knien, um den Aufprall abzufedern. Er spürte den Stoß vor allem in den Hüften, wo die Schwerkraft heftig an seinem Revolvergurt zerrte. Das strapazierte Leder ächzte und knarrte. Die Handschellen und die Reservemunition klirrten in seinen Taschen. Hanson richtete sich auf und zog den Gurt hoch.
Er wischte sich die schweißnassen Hände an seinem Hemd ab.
Okay, dachte er, jetzt bist du hier.
Er ging langsam über das Gras, die Augen auf den nördlichen Torpfosten direkt vor ihm gerichtet.
Er machte sich was vor, wenn er glaubte, er würde irgendwas Neues finden. Die Jungs hatten den Tatort letzte Nacht genau in Augenschein genommen. Und bei Tageslicht noch einmal. Sie hatten alles fotografiert, eingesammelt, mit Zetteln versehen und mitgenommen: den armen Teufel selbst, seine Klamotten, Streichhölzer und Zigarettenstummel, den Benzinkanister, Schokoriegelverpackungen, Bonbonpapiere und all den anderen Müll, der mit dem Verbrechen wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun hatte – selbst die Rasenfläche um den Hauptpfosten herum, an den der Junge gefesselt gewesen war. Es war sogar die Rede davon gewesen, den Torpfosten selbst mitzunehmen, aber der Chief hatte sich dagegen entschieden. Zumindest hatten sie die verkohlten Überreste des Schutzpolsters vom Pfosten gelöst und als Beweismittel eingepackt.
Himmel – hier gab es nichts Interessantes mehr zu entdecken.
Doch Hanson, der heute Nacht im Viertel auf Streife war, hatte sich dabei ertappt, wie er immer wieder um die Highschool fuhr und jedes Mal, wenn in der Ferne die Torstange in Sicht kam, langsamer wurde und wie gebannt zu diesem verdammten Ding hinüberstarrte. Schließlich hatte er vor dem Stadion angehalten.
Und den Wagen verlassen, ohne der Zentrale per Funk Bescheid zu geben.
Bescheuert.
Als seine Schritte über die Aschenbahn knirschten, wünschte Hanson, er hätte Lucy angefunkt. Er hätte ihr irgendeinen falschen, x-beliebigen Standort angeben können und behaupten, er würde heute etwas früher Pause machen, um was zwischen die Zähne zu bekommen.
Andererseits wäre es noch schlimmer gewesen, sie anzulügen.
Er hatte vor, diese Frau zu heiraten. Man belügt niemanden, den man liebt.
Besser so, dachte er. Außerdem würde sie mich wahrscheinlich decken, falls es irgendwelche Probleme gibt.
Das Gras fühlte sich weich und elastisch unter seinen Schuhen an. Er durchquerte die Endzone, den Blick auf die Torstange gerichtet. Vor der kreisförmigen Fläche, wo das Gras entfernt worden war, blieb er stehen und starrte darauf.
Erneut fragte er sich, was ihn hierhergebracht hatte.
Mordopfer hatte er schon zuvor gesehen, wenn auch nicht viele. Und nur eines von ihnen – Jennifer Sayers – hatte ein derart brutales Ende gefunden. Sie war zwar nicht verbrannt wie dieser Junge, aber gefoltert und vergewaltigt worden. Ihre verstümmelte Leiche hatte Hanson eine Menge Albträume beschert, doch er war nie heimlich zu dem Wald hinausgefahren, wo es passiert war.
Irgendwie war das hier anders.
Ja, dachte er. Irgendwie. Maxwell Chidi war ein farbiger Junge. Das war der Unterschied, das und nichts anderes.
Wann wird aus einem Schwarzen ein Nigger? Sobald er den Raum verlässt.
Hanson hatte früher über so etwas gelacht. Verdammt, früher hatte er solche Witze erzählt.
Deshalb bin ich hier, begriff er.
Schuldgefühle.
Sie haben das mit dem Jungen angestellt, weil er schwarz war. Weiße, die sich einen Nigger vorknöpfen.
Aber das ist nur eine Vermutung, dachte er. Himmel, möglicherweise hatte es überhaupt nichts damit zu tun. Wir sind hier schließlich nicht in Alabama. Es könnte auch ein vollkommen gewöhnliches Motiv gewesen sein. Eifersucht, Gier. Vielleicht war der Junge ein Dealer, der zu viel für sich selber abgezwackt hatte und …
Ja, genau. Er war ein Schwarzer, und deshalb automatisch ein Dealer.
Das ist genau die Einstellung, die …
Die Stadionlichter flammten auf.
Hanson fuhr zusammen und schnappte erschreckt nach Luft. Oh Herr im Himmel! Er wirbelte herum und ließ den Blick suchend über die Tribünen auf beiden Seiten des Spielfelds schweifen. Es war niemand zu sehen. Doch er wusste, dass man ihn entdeckt hatte.
Bleib ganz ruhig, ermahnte er sich.
Wahrscheinlich nur der Platzwart. Hat vielleicht gar nicht mitgekriegt, dass ich hier bin. Trotzdem …
Verflucht, ich bin ein Cop. Ich mache hier nur meinen Job.
Noch immer war niemand zu sehen.
Aber jemand hatte das Flutlicht eingeschaltet.
Maxwell …
Ja klar. Ganz bestimmt.
Trotzdem lief ihm ein Schauer über den Rücken, und er bekam Gänsehaut, als er sich den toten Jungen vorstellte, wie er aus einem der Durchgänge unter den Tribünen in Richtung des Spielfelds taumelte. Eine schwarze Gestalt, die sich durch die Dunkelheit schleppte. Steif wie in Totenstarre, die Arme ausgestreckt, die Fingerstummel zu Klauen gekrümmt. Ohne Gesicht. Nur ein schwarzes, ohrloses Knäuel über den Schultern. Mit Zähnen darin.
Er glaubte, das langsame Schlurfen von Maxwells verkohlten Füßen auf dem Beton zu hören, das Knistern, mit dem seine verbrannte, ausgedörrte Haut beim Gehen aufplatzte, glaubte zu sehen, wie sie sich schuppte und in schwarzen Flocken von ihm abfiel wie totes, trockenes Laub.
Ich krieg dich, weißer Mann.
Hör auf damit!, ermahnte sich Hanson.
Obwohl er wusste, dass seine Fantasie mit ihm durchging, sah er sich panisch um, und seine Augen huschten zu den Durchgängen in den Haupttribünen. Drei auf jeder Seite. Dunkle Löcher. Tunnels, die nach draußen führten, zu den Erfrischungskiosken, Umkleidekabinen und den Ausgängen.
Hör auf damit! Du machst dich nur selber verrückt. Maxwell liegt tot im Leichenschauhaus und kann nicht …
Auf der anderen Seite des Spielfelds tauchte aus einem der Durchgänge eine Gestalt auf.
Ein Weißer in einem dunkelgrünen Overall. Der Platzwart? Hanson seufzte erleichtert. Er fühlte sich völlig erschöpft. Auch nur aufrecht zu stehen war so anstrengend, dass er zitterte.
Der Mann hob grüßend einen Arm, dann kletterte er über die Brüstung und sprang auf den schmalen Grasrand am anderen Ende der Aschenbahn. Er landete auf dem linken Fuß und spreizte dabei das rechte Bein ab. Dann kam er hinkend auf Hanson zu. »Abend, Officer«, rief er.
Hanson erwiderte den Gruß mit einem Nicken.
Der Schädel des Mannes glänzte im Licht der Scheinwerfer. Das Haar um seine Ohren herum war grau, und sein hageres Gesicht wettergegerbt. Er wirkte drahtig und kräftig. Als er näherhumpelte, klirrte an seiner Hüfte ein Schlüsselbund.
»Toby Barnes«, sagte er und streckte seine Hand aus.
Hanson schüttelte sie. »Bob Hanson.«
»Bin eben erst gekommen, Bob. Hab Ihren Wagen draußen vor dem Tor gesehen. Was dagegen, wenn ich frage, wie Sie hier reingekommen sind?«
»Ich bin über den Zaun geklettert.«
Toby schien erleichtert. »Das beruhigt mich. Ich dachte schon, irgendein Idiot hat das Tor offen gelassen. Tut mir leid, dass ich nicht hier war, um Sie reinzulassen.«
»Kein Problem.«
»Wie auch immer, ich dachte, Sie würden sich die Sache vielleicht gern bei Licht besehen. Ich war auf dem Weg rüber zur Schule. Als Oberhausmeister muss ich nämlich ständig ein Auge auf die Putzkolonne haben. Das ist eine Bande von arbeitsscheuen Faulpelzen, die meisten zumindest.« Toby wandte den Blick von Hanson ab und sah mit gerunzelter Stirn zum Torpfosten hinüber. »Schrecklich«, sagte er. »Schon irgendeine Ahnung, wer es getan hat?«
»Wir arbeiten daran. Ich dachte nur, ich seh mich mal um, um mich mit dem Tatort vertraut zu machen.«
»Ich nehme an, Sie waren vergangene Nacht auch hier?«
»Ja.«
»Muss ziemlich übel gewesen sein. Ich hab mehr von diesen Brathähnchen gesehen, als mir lieb ist. Ich war bei der Feuerwehr in Bakersfield, bis ein Dach unter mir eingebrochen ist.« Er schlug mit der flachen Hand gegen sein rechtes Bein. Es klang nicht nach Haut und Muskeln. »So was ist kein schöner Anblick. Das ist eine Seite des Jobs, die ich ganz bestimmt nicht vermisse.«
Hanson, dem der Mann auf Anhieb sympathisch gewesen war, empfand ihm gegenüber nun so etwas wie neidische Bewunderung. »Für kein Geld der Welt würde ich zur Feuerwehr gehen«, sagte er.
Toby nickte, ohne den Blick vom Torpfosten zu nehmen. »Glauben Sie, es waren Jugendliche?«
»Keine Ahnung. Schon möglich.«
»Den Ku-Klux-Klan gibt’s hier nicht, soweit ich weiß.«
»Nein.«
»Obwohl das genau die Handschrift des Klans ist. Das wirft ein schlechtes Licht auf unsere Stadt.«
»Kannten Sie den Jungen?«, fragte Hanson.
»Ich hab ihn ab und an in der Schule gesehen.« Toby wandte sich ihm wieder zu und runzelte die Stirn. »Wir haben nur eine Handvoll farbige Schüler, wissen Sie. Dieser Chidi – er war überhaupt nicht wie die anderen. Ein großer Kerl, ziemlich gut aussehend und mit ’ner komischen Art zu reden. Ich glaube, er kam von einer dieser Inseln. Jamaika, Haiti, irgendwo in der Gegend. Er hatte nicht diesen ›Hey, Bruder, Motherfucker‹-Jargon drauf. Er redete, als hätte er ’ne gute Erziehung genossen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Wie ist er mit den anderen Schülern ausgekommen?«
»Soweit ich das mitbekommen hab, hatte er nicht viel mit den anderen farbigen Kids zu tun. Die hängen nämlich immer zusammen rum. Ich schätze, das ist nur natürlich. Aber Chidi hab ich, glaube ich, nie bei ihnen gesehen. Wenn ich ihn gesehen habe, dann immer nur mit weißen Kids. Mit weißen Mädchen meistens. Anscheinend standen die Mädels auf ihn.«
Hanson fühlte, wie sein Herz schneller schlug. »Jemand Bestimmtes?«
»Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, wie das Mädchen heißt, aber ich könnte es für Sie rausfinden. In den letzten paar Wochen waren die beiden ständig zusammen. Würde mich nicht wundern, wenn sie’s miteinander getrieben haben. «
»Nun, äh …«, murmelte Hanson.
»Tja, da kann ich durchaus verstehen, dass manchen Leute so was nicht gefällt.«
»Das ist …«
Der Himmel schien zu explodieren. Sie zuckten beide zusammen und warfen die Köpfe in den Nacken. Einen Augenblick lang glaubte Hanson, über dem Stadion seien zwei Flugzeuge zusammengestoßen. Doch was er sah, war ein gleißend heller, sich wie ein gigantischer Baum verästelnder Blitz, der durch die dunklen, sich auftürmenden Wolken zuckte.
Der Donner verhallte rollend in der Ferne. Ihm dröhnten die Ohren.
»Gütiger Himmel«, ächzte Toby.
Dann öffnete der Himmel seine Schleusen.
Der Regen fiel in so dichten Schleiern, dass der Schein der Flutlichter nur noch als fahler, gelber Schimmer zu erkennen war.
Einen Sekundenbruchteil nachdem sich die Lichter verdunkelten, prasselte der Platzregen auf Hanson herab. Große, warme Tropfen klatschten auf sein Gesicht und seine Schultern. Sie prickelten auf seiner Haut, schienen in ihn einzudringen. Sie wärmten ihn. Plötzlich fühlte er eine seltsame, wilde Erregung in sich aufsteigen.
»Heilige Scheiße«, sagte Toby.
Hanson und Toby sahen sich durch das leicht gelbliche Licht an. Dunst waberte im dämmrigen Halbdunkel des Wolkenbruchs – wahrscheinlich von dem warmen Regen verursacht, der durch die kalte Novemberluft niederprasselte.
Toby sah aus, als hätte ihm jemand einen Eimer Tinte über den Kopf gegossen. Nur seine Augen und Zähne waren weiß. Als sich seine Lippen zu einem Grinsen verzogen, waren noch mehr Zähne zu sehen.
Hanson löste den Riemen der Holstersicherung und zog seinen Revolver, als Toby sich auf ihn stürzte. Die Finger des Mannes krallten sich um Hansons Hals. Die Daumen drückten gegen seine Kehle. Er rammte den Lauf seiner .38er in Tobys Bauch und drückte den Abzug dreimal durch; das Krachen der Schüsse war ohrenbetäubend.
Toby taumelte rückwärts und klappte zusammen.
Die vierte Kugel durchschlug seinen kahlen, schwarzen Schädel. Er fiel hart auf sein Hinterteil, rutschte ein Stück über das nasse Gras und verharrte einen Augenblick in aufrecht sitzender Position. Dann kippte sein Oberkörper langsam über seine ausgestreckten Beine nach vorn.
Hanson nahm einen kurzen Anlauf und versetzte Tobys Kopf einen Fußtritt, als wollte er ihn wie einen Football in hohem Bogen zwischen den Torstangen hindurchschießen. Trotz der Wucht, die in dem Tritt lag, bewirkte er lediglich, dass der Oberkörper des Mannes nach hinten kippte und flach auf den Boden krachte.
Als Hansons rechtes Bein den höchsten Punkt erreicht hatte, rutschte er mit dem linken Fuß auf dem Gras aus. Keuchend ruderte er mit den Armen und landete neben Toby auf dem Rücken. Benommen von dem Sturz blieb er eine Weile reglos liegen. Der Regen fühlte sich herrlich an. Es war, als würde er zu Hause in seiner Badewanne liegen und das Wasser aus der Dusche auf sich herabprasseln lassen – nur viel besser. Er schob den Revolver in das Holster zurück und spreizte Arme und Beine. Vor Wonne stöhnend, räkelte er sich im Gras.
Als er den Kopf zur Seite drehte, sah er, dass Tobys Leiche direkt neben ihm lag.
Wow, dachte er. Dem Hurensohn hab ich’s ordentlich gegeben.
Er lachte. Als er den Regen in seinem Mund spürte, riss er ihn weit auf und streckte die Zunge heraus. Der Regen war dicker als Wasser. Er schmeckt fast ein bisschen wie Blut, dachte er.
Nur ein bisschen. Ein leicht kupfriger Geschmack. Kaum wahrzunehmen.
Trotzdem genug, um in ihm das Verlangen zu erwecken, seinen Mund mit dem echten Stoff zu füllen.
Hanson wälzte sich herum, stemmte sich hoch und kroch vorwärts. Er ließ sich auf den Bauch sinken und streckte die Arme aus. Die Ellbogen in das nasse Gras gestützt, packte er Toby an den Ohren. Er hob den Kopf des Mannes hoch, presste den Mund auf das Einschussloch und fing an zu saugen.
Ein schwarzer Regen wird fallen
1
Früher an diesem Abend, während der Streifenpolizist Bob Hanson noch durch die Gegend um die Lincoln High kurvte, und über eine Stunde, bevor seine Kugeln Toby Barnes das Licht ausbliesen, ließ sich Francine Walters auf das Sofa in ihrem Wohnzimmer sinken. Sie zog das Tablett mit dem Essen näher zu sich heran, als im Fernseher die Sechs-Uhr-Ausgabe von Eyewitness News begann. Während die Erkennungsmelodie lief, kippte sie den Rest Scotch hinunter, der noch den Boden ihres Glases bedeckte.
»Guten Abend allerseits«, sagte die Nachrichtensprecherin Chris Donner. »Zum Top-Thema des Tages: Die Polizei untersucht weiterhin den grauenvollen Mord von gestern Nacht an Maxwell Chidi, einem siebzehnjährigen Schüler der Lincoln High in Bixby. Die Leiche des farbigen Jugendlichen wurde in dem erst kürzlich fertiggestellten Memorial Stadion entdeckt, als …«
»Merk dir meine Worte«, sagte Francine, »dieser Bursche hat nichts Gutes im Schilde geführt. Er hat es wahrscheinlich nicht anders verdient.«
»So ein Schwachsinn«, murmelte Lisa.
Francine fuhr zu dem Mädchen herum. »Was? Was hast du gesagt?«
Lisa funkelte sie aus dem Schaukelstuhl trotzig an. »Ich hab gesagt, das ist Schwachsinn. Du weißt doch gar nicht, wovon du redest.«
»Ich weiß sehr wohl, wovon ich rede, junge Dame, und was fällt dir überhaupt ein, so mit mir zu reden? Was ist in dich gefahren? Du bist unausstehlich, seitdem du heute Morgen aus dem Bett gekrochen bist.«
Der Zorn in Lisas Augen schien sich ein wenig zu mildern. Sie öffnete den Mund, als wollte sie etwas sagen, schloss ihn dann jedoch wieder. Sie presste die Lippen aufeinander. Ihre Mundwinkel zuckten. Ihr Kinn, weiß und voller Grübchen von der Anstrengung, ihre Unterlippe hochzuschieben, begann zu zittern. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Lisa?«
»Lass mich in Ruhe.« Sie schob ihren Schaukelstuhl ein Stück zurück, doch nicht weit genug. Als sie aufstand, stieß sie mit dem Oberschenkel gegen ihr Tablett. Nicht heftig, aber der Stoß reichte, ihr Glas umkippen zu lassen. Wasser und Eiswürfel schwappten über das Tablett, und das Glas landete mit einem leisen Poltern auf dem Teppich.
»Sieh dir an, was du angerichtet hast!«, zischte Francine.
Das Mädchen schluchzte gequält und lief aus dem Zimmer.
Was zum Teufel ist nur los mit ihr?, fragte sich Francine. Verdammt noch mal!
Vorsichtig schob sie ihr eigenes Tablett zur Seite. Als sie aufstand, hörte sie, wie eine Tür zuschlug. Es klang zu nah, um Lisas Zimmertür zu sein. Wahrscheinlich die Badezimmertür, gleich draußen im Flur.
Sie schob sich an Lisas Tablett vorbei und hob das Glas auf. Sie ließ sich in die Hocke sinken und sammelte die Eiswürfel von dem beigefarbenen Teppich auf. Gott sei Dank war es nur Wasser, dachte sie. Sie ließ die Würfel in das Glas klirren. Hätte Lisa Milch oder Pepsi getrunken … Und sie konnte von Glück reden, dass ihre Lasagne nicht ebenfalls auf dem Teppich gelandet war.
Francine stellte das Glas auf das Tablett, dann ging sie, um nach Lisa zu sehen. Sie war wütend und aufgewühlt. Gott, wie sie solche Auftritte hasste.
Doch dieser Auftritt von eben sah gar nicht nach dem normalen übellaunigen Verhalten ihrer Tochter aus. Es musste was Ernsteres sein. Vielleicht etwas, das mit dem Tod dieses schwarzen Jungen zu tun hatte.
Ich hätte nicht so über ihn herziehen sollen, dachte sie.
Wie sie vermutet hatte, war die Badezimmertür abgeschlossen.
»Schatz?«
»Lass mich in Ruhe.« An der schrillen, zitternden Stimme des Mädchens erkannte Francine, dass sie noch immer weinte.
»Bist du okay?«
»Nein.«
»Es tut mir leid, dass ich das eben gesagt habe. Komm jetzt raus, okay? Du musst in weniger als einer Stunde bei den Foxworthes sein.«
»Ich kann nicht.«
»Sie rechnen mit dir. Jetzt komm raus, und iss deine Lasagne auf.«
Kurz darauf drehte sich der Schlüssel im Schloss, und die Tür schwang auf. Lisas Gesicht war gerötet, ihre Augen verschwollen, die Wangen ganz nass von Tränen. Schluchzend wischte sie sich mit einem Kleenex die Nase ab.
Ihre Tochter in dieser Verfassung zu sehen schnürte Francine die Kehle zusammen. Ihre Augen brannten, als sie sich mit Tränen füllten. »Was ist denn nur los?«, fragte sie. »Oh, Mom!« Lisa taumelte durch die Tür, schlang ihre Arme um Francine und umarmte sie fest. Schluchzend rang sie nach Atem. Ihre Schultern bebten. »Ich hab ihn geliebt«, stieß sie hervor. »Ich hab ihn so schrecklich geliebt, und sie haben ihn umgebracht.«
2
Als Denise Gunderson mit ihrem Cheeseburger fertig war, faltete sie den Papierteller in der Mitte zusammen und warf ihn in den Abfalleimer. Sie öffnete den Kühlschrank, nahm sich einen Schokoladenkeks aus dem Tiefkühlfach und biss genussvoll hinein. Eine Hand unter ihr Kinn haltend, für den Fall, dass Krümel herabfielen, wanderte sie ins vordere Zimmer.
»Und was haben wir da?«, fragte sie, ihre Stimme von den Keksbröseln in ihrem Mund ganz undeutlich.
Sie wusste, was sie da hatte: die Plastiktüte mit den drei Videos, die sie sich am Nachmittag ausgeliehen hatte. Aber wenn sie alleine im Haus war, sprach sie gerne mit sich selbst. Es brach die Stille.
Sie setzte sich auf den Boden, schlug die Beine übereinander, schob sich den Rest vom Schokoladenkeks in den Mund und wischte sich dann die Finger an ihrer Trainingshose ab. Das Geräusch, mit dem ihre Zähne den gefrorenen Keks zermalmten, übertönte das Rascheln der Tüte, als sie sie öffnete. Sie nahm die Videos heraus und sah sich die Titel an. Sie hatte Watchers, Near Dark und Das Kettensägenmassaker von Texas besorgt.
Sie schüttelte den Kopf und murmelte mit einem leisen Lachen: »Nette, erbauliche Unterhaltung für die ganze Familie. «
Aber Tom würden sie gefallen. Wahrscheinlich hatte er sie schon gesehen, aber das würde ihn nicht im Geringsten stören.
»Falls du den Mut hast, ihn anzurufen.«
Auf der Uhr des Videorekorders war es 18 Uhr 11.
Wenn du ihn anrufen willst, dachte Denise, solltest du es besser gleich tun. Bevor er was anderes vorhat.
Sie versuchte das unangenehme Hämmern ihres Herzens zu ignorieren und stand auf. Sie ging in die Küche zurück und starrte das Wandtelefon an.
Sie fühlte sich wackelig auf den Beinen. Schweißtropfen rannen an ihren Seiten hinab.
»Oh, Mann«, murmelte sie.
Wenn Mom und Dad dahinterkommen, dass er hier war …
Sie hatten eine klare und strikte Regel: Keine Jungs im Haus, wenn wir nicht daheim sind. Bis jetzt hatte Denise diese Regel nie gebrochen. Sie war zwar in Versuchung geraten, doch die Angst, erwischt zu werden – selbst wenn sie ganz unschuldig mit dem Typen vor dem Fernseher säße –, war immer stärker gewesen.
Heute Nacht allerdings bestand keine Gefahr, dass ihre Eltern plötzlich auftauchten. Sie verbrachten die Nacht bei Freunden in Tiburon, das zwei Stunden Fahrt von Bixby entfernt war. Sie hatten um halb sechs angerufen, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Und Dad, der nachts nur sehr ungern fuhr, würde sich nicht ans Steuer setzen, bevor es hell wurde. Tatsächlich hatten sie vor, erst irgendwann am Nachmittag loszufahren.
Trotzdem – irgendwas könnte schiefgehen. Ein Nachbar könnte Tom kommen oder wegfahren sehen. Sein Auto könnte in der Einfahrt den Geist aufgeben und nicht wegzukriegen sein, bis Mom und Dad auftauchten. Ein Erdbeben könnte sich ereignen und Tom und sie im Haus einschließen. »Oder unser Bohnenfeld verschlucken«, sagte sie mit einem Kichern. »Scheißegal, ruf ihn an.«
Sie rieb sich die verschwitzten Hände an ihrer Trainingshose ab und holte tief Luft. Dann griff sie nach dem Telefon, das plötzlich klingelte. Ihr stockte der Atem.
Das ist Tom, dachte sie. Er muss übersinnliche Fähigkeiten haben.
Sie nahm den Hörer ab. »Hallo?«
»Spreche ich mit Denise?«
Doch nicht Tom. Eine Frauenstimme, die ihr irgendwie bekannt vorkam. »Ja.«
»Ich bin Lynn Foxworth. Du hast vor ein paar Monaten auf unsere Tochter aufgepasst; erinnerst du dich?«
»Klar.« Oh, nein, dachte sie. Doch sie zwang sich, freundlich zu klingen, als sie sagte: »Karas Mutter.«
»Ich hab wirklich ein schlechtes Gewissen, dich so Knall auf Fall zu belästigen. Ich fühle mich schrecklich, dich auch nur zu fragen. Und bitte, wenn du für heute Abend schon was vorhast, dann ist das natürlich okay. Vielleicht kannst du ja jemand anders empfehlen. Aber wir stecken in einer scheußlichen Klemme. Wir haben um sieben einen Tisch reserviert, und ich hab gerade mit Francine Walters telefoniert. Lisa sollte heute Abend auf Kara aufpassen, es war fest ausgemacht, aber Francine war furchtbar aufgeregt und ganz durcheinander. So wie es aussieht, hat sie gerade herausgefunden, dass Lisa gestern Nacht mit dem Jungen zusammen war, der ermordet wurde. Nach dem Spiel wurde wohl noch getanzt … Wie auch immer, Lisa offenbar einen Verdacht, wer es getan hat, und Francine fährt mit ihr gerade rüber zur Polizei. Offenbar hat sie Angst, jemand könnte versuchen, Lisa was anzutun. Vielleicht um zu verhindern, dass sie redet? Da kann man es schon mit der Angst kriegen. Ich denke, es ist besser, wenn sie nicht hierherkommt. Nicht, wenn vielleicht Killer hinter ihr her sind oder was. Kannst du dir das vorstellen? Wie auch immer, jetzt stehen wir ohne einen Babysitter da, und ich weiß wirklich nicht mehr weiter, aber ich dachte, wenn du nicht schon was anderes vorhast, könntest du uns vielleicht helfen. Kara mag dich wirklich sehr, und ich weiß, dass du es das letzte Mal nur deinen Eltern zuliebe gemacht hast, aber … könntest du uns nicht aushelfen?«
Denise wünschte, sie hätte das Telefon klingeln lassen.
»Ich hatte eigentlich eine Verabredung«, sagte sie.
»Er kann ja mit hierherkommen. Du lieber Himmel, was sage ich da? Ich würde so etwas nie jemandem wie Lisa vorschlagen, aber … ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Es wäre für deinen Freund vielleicht nicht gerade der Riesenspaß, aber für uns wäre es ganz bestimmt in Ordnung. Wir haben alle möglichen leckeren Sachen zum Knabbern und jede Menge Softdrinks.«
So klingt eine verzweifelte Frau, dachte Denise.
»Wir kommen auch nicht allzu spät nach Hause. Vielleicht zehn oder elf?«
»Okay, ich weiß nicht, ob ich meinen Freund mitbringe, aber ich komme rüber. Wann soll ich da sein?«
»Wir müssen spätestens zehn vor sieben aus dem Haus, irgendwann davor also.«
Denise sah auf die Küchenuhr. Vierzehn Minuten nach sechs.
»Falls du noch nicht gegessen hast …«
»Nein, ich hab gerade gegessen.«
»Ich wollte sagen, du könntest auch hier essen, aber … Oh, Denise, du bist unsere Rettung. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Das ist echt super von dir.«
»Ich helfe Ihnen gern. Bis gleich also.«
»Soll John dich abholen?«
»Nein, ist nicht nötig. Aber vielen Dank.«
»Oh, kein Grund, dich zu bedanken. Du hast uns gerettet. «
»Ich sollte allmählich los und muss mich noch umziehen, bevor ich gehe.«
»Ja, richtig. Wir sehen uns in ein paar Minuten.«
»Okay. Bis gleich.«
Denise legte auf.
Sie dachte an die Filme, die sie ausgeliehen hatte. Sie dachte an Tom. Sie fühlte sich betrogen und traurig.
»Es ist nicht das Ende der Welt«, murmelte sie.
Vielleicht ist es ja Glück im Unglück, dachte sie, als sie in ihr Zimmer ging, um sich umzuziehen. Es bewahrt mich davor, die ›Hausregel‹ zu brechen. Bewahrt mich und Tom davor, stundenlang zusammen zu sein, allein im Haus, und vielleicht wären die Dinge außer Kontrolle geraten.
Vielleicht will ich ja, dass die Dinge außer Kontrolle geraten.
Gottes Weg, mich vor der Versuchung zu bewahren.
Oder mich zu martern.
3
Patterson, der hinter dem Empfangsschalter Dienst schob, beugte sich vor und grinste, als Trevor Hudson das Revier betrat. »Wann fängst du eigentlich an zu leben, Hudson?«
»Ich hab’s nicht übers Herz gebracht, dich allein zu lassen«, erwiderte Trev. »Ich weiß doch, wie sehr ich dir fehle.«
»Spinn ich, oder hast du ’ne Schraube locker, Kumpel?«
»Wenn du es sagst.« Trev ging um das Ende des Schalters herum, lächelte Lucy grüßend zu und hatte fast seinen Schreibtisch erreicht, als Patterson sich mit einem Stirnrunzeln umdrehte und sagte:
»Ich hab das andersrum gemeint.«
»Oh? Okay.« Er zog seinen Drehstuhl hervor und setzte sich.
»Aber es war trotzdem mein Ernst. Es ist Samstagabend, Mann. Der Abend, an dem man sich verabredet, falls du weißt, was ich meine. Du solltest mal ein bisschen um die Häuser ziehen und ’ne Braut aufreißen.«
»Ich bin lieber hier bei dir«, sagte er und zwinkerte dem untersetzten Sergeant zu.
Lucy, die in der hinteren Ecke in der Telefonzentrale saß, sah über ihre Schulter und grinste. »Pass besser auf, was du sagst, Trev, oder Patty sitzt schneller auf deinem Schoß als du schauen kannst.«
»Setz dich auf meinen, Süße«, entgegnete Patterson. »Oder noch besser – auf mein Gesicht.«
»Wünsch dir das lieber nicht«, sagte sie und drehte sich wieder um, als ein Anruf reinkam.
Trev zog die oberste Schublade auf. Er nahm einen Ein-Dollar-Coupon für eine Familienpizza bei O’Casey’s heraus, fischte seinen Geldbeutel aus der Gesäßtasche seiner Jeans und faltete den Coupon. Als er ihn ins Portemonnaie steckte, schüttelte er den Kopf über die absurde Idee, wegen eines Ein-Dollar-Rabatts hier vorbeizukommen.
Da ist nichts Absurdes dran, beruhigte er sich. Er kam auf seinem Weg zu O’Casey’s ohnehin am Revier vorbei. Und ein Dollar ist schließlich ein Dollar.
Doch sein Magen flatterte ein bisschen, als er den Geldbeutel wieder einsteckte, und ihm war klar, dass der eigentliche Grund, warum er den Coupon abholte, weniger mit Sparsamkeit zu tun hatte als damit, dass er etwas hinausschieben wollte.
Eine Verzögerungstaktik.
Vielleicht arbeitete Maureen heute gar nicht. Heute war Samstag, und sie war jedes Mal da gewesen, wenn Trev in der letzten Woche in der Pizzeria gegessen hatte. Es war ja wohl anzunehmen, dass sie nicht jeden Abend arbeitete.
Andererseits kamen an den Samstagabenden wahrscheinlich die meisten Gäste. Und es war ein Familienbetrieb. Maureen war vor drei Wochen zu Marys Beerdigung in die Stadt gekommen und hatte, als die Pizzeria wieder aufmachte, dort als Bedienung angefangen. Ihrem Bruder zufolge wohnte sie bei Liam und hatte vor, dauerhaft zu bleiben, um sich um ihren Vater zu kümmern und im Restaurant mitzuhelfen.
Es machte also wenig Sinn für Maureen, Samstagabend freizunehmen.
Sie würde da sein.
Und Trev hatte dieses Mal mehr vor, als nur ein paar freundliche Worte mit ihr zu wechseln und sie anzugaffen, während sie an den anderen Tischen bediente. Er hatte sich vorgenommen, sie zu fragen, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Und er war sich alles andere als sicher, dass er den Mut dazu aufbringen würde.
Sie mag mich, dachte er. Ich weiß, dass sie mich mag.
Es war mehr als nur ihre scherzhaft-neckische Art, mit ihm zu plaudern. Sie redete mit allen Gästen so. Doch sie sah die anderen nicht so an wie sie ihn ansah. Wenn ihre Augen sich trafen, schien ihr Blick in ihm zu versinken, als suchte sie tief in ihm nach irgendetwas, als fragte sie sich, was er wohl für ein Typ sei, und Trev hatte das Gefühl, in ihren Augen den Hauch einer Herausforderung ausmachen zu können.
Sie möchte, dass ich sie um ein Date bitte. Und sie fragt sich, warum ich es noch nicht getan habe. Fragt sich, was nicht stimmt.
Ich muss es tun, dachte Trev. Heute Abend. Jetzt gleich.
Doch er blieb sitzen und starrte über die verlassenen Schreibtische hinweg auf die Tür zum Vernehmungsraum.
Komm schon, sagte er sich. Steh auf und geh. Tu es.
»Hast du neuerdings mit Meditation angefangen?«, erkundigte sich Patterson.
Trev drehte sich zu ihm um. »Hab nur so vor mich hin gedacht«, sagte er. »Solltest du auch mal versuchen.«
»Versuch mal, Dreck zu essen«, brummte Patterson. Er wollte gerade noch etwas hinzufügen, aber genau in dem Augenblick betrat jemand das Revier, und er drehte den Kopf wieder nach vorn.
Trev warf einen Blick auf die Wanduhr. Fünf vor halb sieben.
Er war immer erst um acht, nach der Hälfte seiner Schicht, zu O’Casey’s gegangen. Wenn er so früh auftauchte, hatte Maureen vielleicht noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Vielleicht sollte er noch ein paar Stunden warten.
Sei nicht so ein verdammter Angsthase!
Er rollte seinen Stuhl zurück. Als er gerade im Begriff war aufzustehen, hörte er Schritte hinter sich. Er stemmte sich aus dem Stuhl und drehte sich um. Patterson kam mit ernster Miene auf ihn zu. Mit gedämpfter Stimme sagte er: »Weil du gerade hier bist, vielleicht möchtest du das gerne übernehmen. «
Trev sah zwei Frauen, eine Erwachsene und ein Mädchen im Teenageralter, auf der anderen Seite des Schalterfensters stehen. »Ich wollte gerade gehen.«
»Es geht um den Chidi-Fall. Du weißt darüber besser Bescheid als ich.«
»Na ja … Ich war letzte Nacht dort.«
»Das Mädchen kannte Chidi. Klingt, als wären sie miteinander gegangen.«
»Okay. Ich rede mit ihnen.«
Ach, was soll’s, dachte er. Ich hab nach einem Vorwand gesucht. Und das hier war vielleicht die Gelegenheit, ein wenig auf Zeit zu spielen. Würde nicht lange dauern, und Maureen war wahrscheinlich sowieso noch gar nicht da.
»Du wirst es nicht bereuen«, sagte Patterson, dann verdrehte er die Augen und spitzte die Lippen. »Das sind zwei scharfe Bräute. Vielleicht hast du Glück bei ihnen.« Wieder sein offizielles Gesicht aufsetzend, drehte er sich um. Er ging zu den beiden Frauen zurück und sagte: »Officer Hudson wird mit Ihnen reden. Wenn Sie bitte reinkommen wollen.« Er nickte in Richtung des Durchgangs am Ende des Empfangsschalters.
Trev holte sie dort ab. Er taxierte sie mit einem raschen Blick, kam zu dem Schluss, dass ihm nicht besonders gefiel, was er sah, und schenkte ihnen ein Lächeln, das, wie er hoffte, beruhigend wirkte. »Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Mein Name ist Trevor Hudson.«
Die ältere Frau, wahrscheinlich die Mutter des Mädchens, kniff die Augen zusammen, als erwartete sie von Trev irgendeine linke Tour und hoffte geradezu, er würde es versuchen. »Francine Walters«, sagte sie. Ihre heisere Stimme war so hart wie ihr Gesichtsausdruck. Sie schien um die vierzig zu sein, doch Trev hatte diesen Typ von Frau schon öfter gesehen, und er wirkte immer älter als er tatsächlich war. Ihre Haare waren hellblond gebleicht, wuchsen aber deutlich sichtbar dunkel nach. Zu viel Augen-Make-up. Der Lippenstift zu grell. Ein schmales, sorgenvolles Gesicht mit Falten an den falschen Stellen. Es war ein Gesicht, das nicht viel lachte, das zu viel Zeit mit düsterem Stirnrunzeln oder mit sarkastischem Grinsen verbrachte. »Das ist Lisa«, sagte sie.
»Hi, Lisa.«
Das Mädchen sah ihn nicht an. Sie stand mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern da. Ihr Haar hatte denselben silbern schimmernden Blondton wie das ihrer Mutter, brauchte aber noch keine Nachbehandlung.
»Kommen Sie mit nach hinten«, sagte Trev, »dort können wir uns in Ruhe unterhalten.«
Er ging den beiden zum Vernehmungsraum voran. »Wir wollen nicht in den Nachrichten landen«, sagte Francine zu seinem Rücken. »Wir wollen nicht, dass es die ganze Stadt weiß.«
Er öffnete die Tür und hielt sie für sie auf.
»Haben Sie das verstanden?«, fragte Francine.
»Wir werden versuchen, dass es unter uns bleibt«, sagte Trev.
Das Mädchen streifte ihn mit einem wachsamen Blick, als sie an ihm vorbei über die Schwelle trat. Sie hatte geweint, und ihr Gesicht sah frisch geschrubbt aus. Trev glaubte, dass sie eine sehr hübsche junge Frau sein könnte, wenn sie nur jemals lächeln würde. Sie war kleiner als ihre Mutter, hatte jedoch denselben Körperbau – Hüften und Brüste, die zu üppig wirkten für ihre sonst schlanke Figur. Vermutlich war sie Zielscheibe des Neids der anderen Mädchen an der Highschool und Objekt der lüsternen Fantasien aller Jungs.
Sie trug einen Pullover, der ihr vielleicht vor ein paar Jahren gepasst hätte. Wahrscheinlich hatte sie ihn mit Absicht zu eng gekauft, so wie ihre Jeans bereits ab Werk ausgewaschen und verschlissen waren. Die Hosenbeine, modisch ausgefranst und rissig, sahen aus, als sei sie von einem messerschwingenden Zwerg überfallen worden.
Der schwere, süßliche Duft von Parfüm wehte vorüber, als sie an Trev vorbeiging.
Francine folgte der Duft eines exotischeren Parfüms. Nicht so süß, eher dunkel und sinnlich, vermischt mit den Gerüchen von Whiskey und kaltem Rauch.
Trev trat hinter ihnen in den Raum. »Bitte nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen einen Kaffee bringen? Wir haben einen Getränkeautomaten, Lisa. Möchten Sie ein Pepsi oder …«
»Können wir gleich anfangen?«, fragte Francine.
Er nickte und zog die Tür hinter sich zu. Durch die Glasscheibe konnte er sehen, wie Patterson mit einem lüsternen Grinsen die Faust ballte und etwas sagte, das wahrscheinlich so etwas wie »Ran an den Speck« bedeutete.
Glaubt, er tut mir einen Gefallen, mich mit den beiden hier reinzuschicken. Scharfe Bräute. Genau.
Ich könnte jetzt im O’Casey’s sitzen. Ich könnte mit Maureen reden.
Trev drehte sich zu den beiden Frauen um. Sie saßen mit dem Rücken zu ihm am Tisch. Er ging hinter ihnen vorbei, nahm einen Notizblock von dem Stoß am Ende des Tisches, zog einen Stuhl um die Ecke und setzte sich. Er wollte das Ganze möglichst zwanglos halten. Er wollte nicht, dass der Tisch im Weg war. Er sagte sich, dass das nichts damit zu tun hatte, einen besseren Blick auf Pattersons scharfe Bräute haben zu wollen. Er schlug ein Bein über das andere, legte den Notizblock auf seinen Oberschenkel und sagte zu Lisa gewandt, »Ich nehme an, Sie kannten Maxwell Chidi.«
»Ja«, sagte sie. Sie streifte ihn mit einem Blick und sah dann unsicher zu ihrer Mutter, die links von ihr saß, für Trev nur halb zu sehen. Dann machte sie genau das, was er erwartet hatte. Sie schob ihren Stuhl vom Tisch weg, bis er fast das Fensterbrett berührte und sie Trev nicht mehr den Blick auf ihre Mutter versperrte.
Dann drehten beide Frauen ihre Stühle zu ihm herum.
»Sie gingen miteinander«, sagte Francine. »Ich hatte keine Ahnung davon. Soweit ich wusste, ging sie noch immer mit Buddy Gilbert.«
Trev pflückte einen Kugelschreiber aus seiner Hemdtasche und notierte den Namen. »Wie lange gingen Sie schon mit Maxwell?«, fragte er das Mädchen.
»Seit ein paar Wochen«, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Ihr Blick war auf das Knie ihrer Jeans gerichtet, wo sie durch einen ausgefransten Riss mit einem Finger über ihre Haut rieb. Weiter oben waren noch mehr Risse.
»Sie hat mir kein Wort davon gesagt«, fügte Francine hinzu, während sie eine Schachtel Zigaretten aus ihrer Handtasche kramte. »Hätte ich’s gewusst, ich hätte dem ein schnelles Ende bereitet. Das können Sie mir glauben.« Sie schüttelte eine Zigarette heraus und klopfte den Filter ein paar Mal auf die Tischplatte. »Nicht, dass ich bigott wäre oder so.«
»Na klar. Du doch nicht«, maulte Lisa.
»Genau. Ich bin es nicht.« Mit einem ärgerlichen Blick auf den Hinterkopf ihrer Tochter steckte sie sich die Zigarette in den Mundwinkel und zündete sie mit einem Plastikfeuerzeug an. »Aber ich denke, ich bin schon eine Weile länger als du unterwegs, junge Dame, und ich denke, ich weiß ein paar Dinge, die du nicht weißt.« Die Zigarette hüpfte auf und ab, während sie redete. Lisa fummelte nach wie vor in dem Schlitz an ihrem Knie herum. »Und eines weiß ich genau: Wenn ein Mädchen wie du anfängt, mit schwarzen Jungs zu gehen, gibt das Probleme. Und ich hatte recht, oder etwa nicht?«
»Ich glaub schon, ja«, murmelte Lisa.
»Du glaubst es? Der Junge ist tot, oder?«
Lisa nickte.
»Glaubst du, er wäre tot, wenn er nicht mit dir gegangen wäre?«
»Lisa«, sagte Trev, »wissen Sie, wer ihn umgebracht hat?«
»Nicht sicher.«
»Erzähl dem Mann, was du mir erzählt hast.«
Lisa hob den Blick und sah Trev an, dann starrte sie wieder mit gerunzelter Stirn auf den Riss in ihrer Jeans hinab. »Ich denke, Buddy und seine Freunde könnten es gewesen sein.«
»Buddy Gilbert«, sagte Trev.
»Ja. Er war nämlich total sauer, weil ich mit ihm Schluss gemacht habe. Und dann gab’s gestern Abend nach dem Spiel noch’ne Party. In der Turnhalle. Buddy kam mit seinen Kumpels rein. Sie waren alle betrunken. Buddy hat sich zwischen uns gedrängt und wollte mit mir tanzen, und ich hab zu ihm gesagt, er soll abziehen. Und er fing an … Er wurde richtig fies. Er nannte Maxwell … er warf ihm alle Schimpfwörter an den Kopf, die man sich nur vorstellen kann. Falls Sie wissen, was ich meine.« Sie hob den Blick und sah Trev an, als sei sie neugierig darauf, wie er reagierte. »Nigger, Bimbo, Tintenkopf, Dschungelaffe, Zulukaffer. Solche Sachen. Und er wurde richtig ordinär und fing davon an, dass Schwarze angeblich größere Schwänze haben.«
»Du lieber Himmel, Lisa!«, stöhnte ihre Mutter.
»Genau das hat er aber gesagt. Als wär das exakt der Grund, warum ich ihm wegen Maxwell den Laufpass gegeben habe.«
»Du musst es ja nicht gleich in die ganze Welt hinausposaunen! «
»Ist schon in Ordnung«, beruhigte Trev das Mädchen. »Was ist dann passiert?«
»Na ja … Maxwell stand nur da und sagte nichts, und Mr. Sherman – er ist der stellvertretende Direktor – kam dazu und warf Buddy und seine Kumpels raus.«
»Kennen Sie die Namen von Buddys Freunden?«
»Klar. Doug Haines und Lou Nicholson.«
4
Lou wollte nicht hier sein. Er wünschte, er wäre bei sich zu Hause, in seinem Bett, mit einem Kissen auf seinem Gesicht. Doch wenn Buddy anruft und sagt, komm rüber, dann kommt man eben rüber.
Verdammt, vielleicht war es ja auch besser, nicht zu Hause zu sein. Hier war er wenigstens nicht allein. Es würde sicherlich wieder eine wilde Fete werden, wie fast immer, wenn sie alle fünf zusammen waren und Dougs Eltern drüben im Club. Und den Alk nicht zu vergessen. Auf die ein oder andere Weise würde er die letzte Nacht vielleicht vergessen können. Zumindest für eine Weile.
Und dann, als sollten seine Hoffnungen in Erfüllung gehen, vergaß er die letzte Nacht tatsächlich. Weil Sheila, sein Mädchen, sich ausgerechnet diesen Augenblick aussuchte, um sich mit gespreizten Beinen auf Buddys Schoß zu setzen. Sie wippte neckisch auf und ab und fingerte an seinem linken Ohr herum. »Wie sollen wir denn’ne Party feiern, wenn du kein Mädchen hast?«
»Wer sagt denn, dass ich kein Mädchen habe?« Buddy rieb mit den Händen über den Rücken ihres Sweatshirts.
Sie blödeln nur so rum, beruhigte sich Lou. Doch mit einem Mal fand er das alles gar nicht mehr so lustig und fühlte, wie er langsam wütend wurde.
Sheila lächelte ihm über die Schulter hinweg zu. »Ich glaube, mein Typ wird eifersüchtig.«
Lou zuckte mit den Schultern. »Wer? Ich?« Quatsch! Am liebsten hätte er sie an der Gurgel gepackt und von Buddys Schoß runtergezerrt.
Sie drehte das Gesicht wieder Buddy zu und fuhr ihm mit den Fingern durchs Haar. »Ich glaube, Lou macht das nichts aus.«
»Wer redet denn von dir?« Buddy packte mit zwei Händen den Rücken ihres Sweatshirts und zog daran. Als er es wieder losließ, hörte Lou, wie der Gummigurt ihres BHs auf ihren Rücken schnalzte. Sie zuckte zusammen und schrie auf.
»Hey!«
Doug und Cyndi, die in der anderen Ecke der Couch saßen, lachten, und Lou fühlte einen Anflug von Erleichterung.
Sheila rutschte rückwärts von Buddys Schoß, wobei sie darauf achtete, nichts von ihrem Coke zu verschütten. »Wirklich sehr nett von dir«, zischte sie. »Ich wollte dich nur ein bisschen aufheitern.«
Er grinste sie an, als sie sich rückwärts von ihm wegschob. »Es hat mich aufgeheitert.« Er sah Lou an und zog die Augenbrauen hoch. »Hat es dich auch aufgeheitert, Louie?«
Lou konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. »Ja, und wie.«
»Was für ein Haufen von Arschlöchern«, sagte sie und schüttelte, ihren Mittelfinger in die Höhe streckend, lachend den Kopf. Dann setzte sie sich vor Lous Sessel auf den Boden. Er beugte sich vor und rieb ihren Rücken. »Auf jeden Fall müssen wir ein Mädchen für Buddy finden und es herschaffen. «
»Ich hab ein Mädchen«, sagte Buddy.
»Wen? Lisa?«
»Genau.«
Doug, der auf der anderen Seite von Cyndi saß, eine Hand hinter ihrem Rücken, in der anderen ein Glas Wodka Tonic, beugte sich vor, um Buddy anzusehen. »Schätze, sie gehört jetzt wieder allein dir, was?«
»Jep. Jetzt, wo dieser Maxi-Arsch in den großen Dschungel im Himmel eingegangen ist.«
Cyndi lachte und sagte, »Eine schreckliche Geschichte.«
»Krank«, fügte Sheila hinzu.
Lou fragte sich, was die Mädels sagen würden, wenn sie wüssten, wer Maxwell in den großen Dschungel im Himmel geschickt hatte.
»Genau«, sagte Doug. »Wir sollten uns schämen, über eine solche Tragödie Witze zu reißen.«
»Ich weiß zufällig, dass Lisa heute Abend einen Babysitterjob hat«, sagte Cyndi. »Sie könnte gar nicht rüberkommen, selbst wenn sie wollte.«
Sie würde nicht wollen, dachte Lou. Lisa musste wissen, dass es Buddy und wir waren, oder es zumindest annehmen.
»Du solltest sie einfach vergessen, Buddy«, sagte Sheila. »Ich meine, ich weiß, wie sehr du sie gemocht hast und alles, aber Scheiße, Mann, sie hat dich abserviert …«
»Für einen Nigger«, fügte Doug hinzu.
»Ja, aber ich bin noch nicht fertig mit ihr.«
Ach du Scheiße, dachte Lou. Niemand sagte etwas. Die plötzliche Stille schien sich wie ein schweres Tuch über sie zu legen.
Buddy stellte sein leeres Glas auf den Tisch. »Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hab Hunger.«
»Jetzt, wo du’s sagst«, brummte Doug.
»Was hast du denn da?«, erkundigte sich Sheila.
»Glaubst du etwa, ich koche für euch faulen Säcke?«
»Jemand könnte zu McDonald’s rüberlatschen«, sagte Lou, »und was holen. Sheila und ich könnten gehen.«
»Ich sitze viel zu bequem, um mich jetzt aufzuraffen und rauszugehen.« Sie lehnte sich mit dem Rücken an die gepolsterte Front von Lous Sessel, hob einen Arm und legte ihn auf seinen Schenkel. Sie beugte den Ellbogen und wölbte ihre Hand um sein Knie. Er spürte, wie die Seite ihrer Brust gegen sein Bein drückte.
»Ja, genau«, sagte Cyndi. »Warum lassen wir uns nicht was bringen?«
»Vom Chinesen?«, schlug Doug vor.
»Igitt!«, stöhnte Cyndi.
»Wie wär’s mit ’ner Pizza?«, fragte Buddy.
»Pizza wär super!«, rief Cyndi.
»Ja!« Sheila war ebenfalls dafür.
»Pizza? Warum nicht?«, sagte Lou, der jetzt, wo Sheila sich an ihn schmiegte, gar nicht mehr so versessen darauf war, zu McDonald’s zu gehen. Er bewegte ganz leicht sein Bein und rieb damit gegen ihre Brust. Sie tat nichts, ihn daran zu hindern. Im Gegenteil: Sie drückte sein Knie fester.
Plötzlich war Lou froh, hier zu sein.
Er begann, die Seite ihres Halses zu streicheln.
Seine Gedanken und Sinne waren ganz auf Sheila gerichtet, während die anderen diskutierten, wie viele Pizzas welcher Größe und mit was drauf sie bestellen sollten. Er bekam nur am Rande mit, dass Buddy aufstand und am Telefon im Flur die Bestellung durchgab.
Sheilas Hals fühlte sich an wie warmer Samt. Er wünschte, es wären nicht so viele Kleidungsstücke zwischen ihrer Brust und seinem Bein – der Kordsamt seiner Hose, ihr Sweatshirt, der ziemlich steife Stoff ihres BHs. Trotzdem konnte er durch all das die dralle Festigkeit ihrer Brust fühlen.
Und sie gab ihm keinerlei Signal, dass er es sein lassen solle.
Das könnte noch richtig interessant werden, dachte er.
Dann kehrte Buddy wieder auf seinen Platz auf der Couch zurück. »Alles klar«, sagte er. »Die Pizzas sind in ’ner halben Stunde da.«
Doug warf einen Blick auf seine Uhr. »Dann ist es zehn nach sieben«, sagte er. »Ich weiß nicht, ob das mein Magen noch so lange aushält.«
»Noch ’n paar Drinks werden uns dabei helfen«, sagte Buddy.
5
Denise parkte ihren Wagen an einem freien Stück Bordstein direkt vor dem Haus der Foxworthes. Sie machte die Scheinwerfer aus. Nachdem sie die Schlüssel in ihre Handtasche geworfen hatte, hob sie ihre linke Hand und drehte das Gelenk, bis das matte Licht, das durch die Windschutzscheibe fiel, das Zifferblatt ihrer Uhr erhellte.
Zwanzig vor sieben.
Sie war ziemlich schnell gewesen, fand sie, vor allem wenn man bedachte, dass sie sich noch hatte umziehen und ihre Haare bürsten müssen, bevor sie aus dem Haus ging.
Wenn Lynn und John nicht rumtrödelten, würden sie es ohne Probleme bis um sieben ins Restaurant schaffen.
Sie stieg aus dem Wagen, schloss ab, eilte auf das Haus zu und dachte währenddessen, dass sie doch besser eine Jacke hätte anziehen sollen.
So kalt ist es auch wieder nicht, sagte sie sich. Sie löste ihre Zähne, die sie wegen der Kälte aufeinandergepresst hatte, und bemühte sich, mit dem Zittern aufzuhören, doch die Abendluft kroch unter die offenen Schöße ihres Wildlederhemds und fühlte sich auf ihrer Haut wie kaltes Wasser an. Wenn sie schon keine Jacke anhatte und auch nicht das Hemd in die Hose stecken konnte (wer, um alles in der Welt, käme auf die Idee, ein Wildlederhemd in die Hose zu stecken?), hätte sie wenigstens ein T-Shirt drunter anziehen sollen. Zu spät, dachte sie.
Sie klingelte, dann presste sie das schwere Hemd gegen ihren Bauch, um wenigstens etwas von der Kälte abzuhalten. Sie stand steif und reglos an der Tür und wartete.
Warum brauchen sie so lang? Angeblich haben sie es doch so furchtbar eilig.
Sie presste die Beine aneinander. Sie rieb sie gegeneinander, und der Kordsamt ihre Hose machte leise, flüsternde Geräusche.
Endlich öffnete Lynn die Tür. »Komm rein, komm rein. Oh, du hast uns gerettet, Denise! Das kannst du mir glauben. «
Denise trat in die Diele. Es gelang ihr, nicht wohlig zu seufzen, als die warme Luft im Haus sie umfing.
»Wir sind fast fertig, so dass wir gleich gehen können«, erklärte Lynn. »Ich zeige dir nur noch ganz schnell ein paar Sachen.« Zu Kara gewandt, rief sie: »Schau mal, wer da ist!«, als sie an ihr vorbeihastete.
»Hallo, Kara«, sagte Denise.
Das neunjährige Mädchen saß mit überkreuzten Beinen auf dem Fußboden und war mit einem Videospiel beschäftigt. Sie sah über die Schulter und formte mit den Lippen ein stummes »Hi«. Sie hatte eine amüsierte Miene aufgesetzt, die zu sagen schien: »Ich geh Mom lieber aus dem Weg, wenn sie in Fahrt ist.«
»Wir sind im Edgewood, hab ich dir das schon gesagt?«, erklärte Lynn weiter, während Denise ihr in Richtung der Küche folgte. »Es wird nicht sehr spät werden. Wenn du willst, kannst du Kara aufbleiben lassen. Das ist schon okay. Wie du magst. Wenn du sie loshaben willst, schick sie ins Bett. Und wenn du deinen Freund einladen möchtest, ist das auch in Ordnung. Der Kühlschrank ist bis oben hin voll, und im Küchenschrank gibt’s jede Menge Knabberzeug. Kara kann dir zeigen, wo alles ist.« Sie erreichten die Küche. Lynn blieb in der Tür stehen und legte eine Hand auf das Wandtelefon. »Hier ist das Telefon«, sagte sie. »Wenn irgendwas ist, kannst du uns im Restaurant erreichen. Die Nummer steht hier.« Sie tippte mit einem langen, gewölbten Fingernagel auf einen Notizblock neben dem Telefon. »Und hier sind die Nummern von Polizei und Feuerwehr, nur für den Fall. Der Himmel weiß, du wirst sie nicht brauchen.« Sie sah Denise an und lächelte. »Noch irgendwelche Fragen? Ich hab das Gefühl, ich hab irgendwas vergessen.«
Sie vergessen, die Ruhe zu bewahren, dachte Denise. Doch sie schüttelte den Kopf. »Ich wüsste nicht, was.«
»Prima. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du hier bist. Das ist heute ein sehr wichtiger Termin, und … Findest du, ich sehe okay aus?«
»Sie sehen fantastisch aus«, versicherte ihr Denise.
Mit vertraulich gesenkter Stimme sagte Lynn: »Nur zwischen dir und mir, John denkt, dieses Kleid ist zu …« Sie verzog das Gesicht und verdrehte die Augen. »Wie soll ich sagen … freizügig?« Sie drehte sich einmal um sich selbst.
Das glänzend königsblaue Kleid besaß nur eine Schulter und einen Ärmel. Der Ausschnitt verlief schräg von der linken Schulter bis unterhalb der anderen Achsel und verdeckte nicht eben viel von ihrer rechten Brust. Auf dem Rücken war es genauso geschnitten. Auch der Saum fiel in einer schrägen Linie von oberhalb des linken Knies bis unterhalb des rechten ab. Sie trug zum Kleid passende hochhackige Schuhe. Keine Nylons, doch ihre Beine waren schön gebräunt.
So wie der Stoff ihren Körper umspannte, war sich Denise sicher, dass sie keinen Faden Unterwäsche darunter trug.
»Hoffentlich ist es im Restaurant warm«, sagte sie.
Lynn zog eine Grimasse. »Du lieber Himmel, bin ich etwa zu verrucht?«
»Sie sehen fantastisch aus. Wirklich.«
Lynn senkte den Kopf und blickte an sich hinab. »Es ist furchtbar … Ich habe einen hübschen Häkelschal. Ich habe sogar eine Stola für solche Fälle. Eine Nerzstola. Sie ist umwerfend, aber John hat was dagegen, dass ich sie trage.«
»Hat er was gegen Pelze?«
»Er hat was gegen ›zur Schau getragene Statussymbole‹. Er glaubt, wenn ich den Nerz trage, wird mir jemand eins über den Schädel ziehen, sich den Nerz schnappen und damit abhauen. Aber was hat man davon, schöne Sachen zu besitzen, wenn man sie nicht tragen kann?« Sie packte Denise am Oberarm und sah ihr in die Augen. »Ich hole meinen Schal. Ich hätte selber drauf kommen müssen. Er ist genau das, was gefehlt hat. Du bist ein Juwel, Denise.«
»Danke. Sie sollten vielleicht auch einen Mantel anziehen. Es ist ziemlich kühl draußen.«
»Oh, das mach ich. Klar.« Sie lachte. »Ich bin ja schließlich kein Vamp oder so was in der Art.«
Sie ließ Denises Arm los und lief aus der Küche.
Denise sah ihr nach, als sie in Richtung des Schlafzimmers eilte.
Sie konnte John verstehen, wenn er wegen dieses Kleids Bedenken hatte.
Herr im Himmel! Lynn sah darin wirklich umwerfend aus. Tom würde sabbernd die Wände hochgehen, wenn er mich je in einem solchen Outfit sehen könnte. Aber er würde nicht die Gelegenheit dazu bekommen. Mom und Dad würden mich vorher beide gemeinsam umbringen.
Sie ging ins Wohnzimmer und setzte sich neben Kara auf den Boden. Das Mädchen drückte einen Knopf auf der Spielkonsole, die sie auf ihrem Schoß hielt. Auf dem Bildschirm des Fernsehers erstarrte der kleine Mario auf der Flucht, und Bowser, der Drache, gefror mitten in der Luft, ebenso die Flammenzungen, die aus seinem Maul zuckten.
»Ist schon okay. Lass dich nicht stören«, sagte Denise.
»Oh, ich hab auf Pause gedrückt.«
»Schön, dich wiederzusehen«, sagte Denise und drückte sanft Karas Schulter. »Ist ’ne Weile her, oder?«
»Seit dem 1. Mai. Seitdem hast du nicht mehr auf mich aufgepasst.«
Sie zweifelte nicht einen Augenblick daran, dass Kara das genaue Datum im Kopf hatte. »Ja – aber ich bin zu deiner Geburtstagsparty gekommen, stimmt’s?«
»Möchtest du das Video anschauen? Es ist echt super. Wir können es jetzt gleich angucken. Ich bring mich schon mal um.«
»Wie bitte?«
»Ich begehe Selbstmord. Ich knipse Mario aus. Ich hab sowieso nur noch zwei Leben übrig. Es ist wie verhext. Es ist furchtbar schwer, sich zu konzentrieren, wenn Mom hektisch durch die Wohnung rennt und sich benimmt, als wär sie verrückt. Sie ist immer so, wenn sie ausgeht.« Kara beugte sich vertrauensvoll näher und sagte mit flüsternder Stimme: »Dad möchte gar nicht weggehen. Er will natürlich nie irgendwohin gehen, aber zu der Sache heute Abend geht er ganz besonders ungern. Ich würde dir die ganze Geschichte erzählen, aber ich kenne sie selber nicht. Manchmal verbergen sie Sachen vor mir. Das ist ziemlich nervig. Ich bin wirklich froh, dass du statt Lisa hier bist. Sie ist okay, finde ich. Aber sie ist manchmal ein bisschen überkandidelt, wenn du weißt, was ich meine, und sie telefoniert ständig mit ihrem Freund. Ständig. Man kann sich mit ihr gar nicht unterhalten. Ich glaube, dass sie nicht besonders viel im Kopf hat.«
Denise musste lachen und schüttelte den Kopf. »Mann, du hast dich nicht verändert.«
Kara strahlte und zog die Augenbrauen hoch. Die feinen blonden Härchen ihrer Brauen waren kaum auszumachen, doch die Muskeln über ihren Augen gruben tiefe Furchen in ihre Stirn. »Das ist gut, oder?«, fragte sie.
»Das ist super.«
»Also dann, ihr beiden … Wir sind schon weg«, rief Lynn.
Denise drehte sich um. Lynn hatte einen knielangen Kamelhaarmantel angezogen; in der einen Hand hielt sie eine blaue Couverttasche und in der anderen einen weißen Schal mit Fransen.
»Wie geht’s dir, Denise?«, fragte John, der hinter seiner Frau ins Zimmer kam.
»Danke, mir geht es ganz gut.«
»Schön, dich wieder mal zu sehen. Ich dachte, du hättest mit dem Babysitten aufgehört.«
»Sie macht das heute Abend nur aus Gefälligkeit«, klärte Lynn ihn auf.
Er schüttelte lächelnd den Kopf. Er war ein großer, massiger Mann, der stets freundlich wirkte. Denise freute sich, ihn wieder einmal zu sehen. Er trug einen blauen Blazer und eine graue Hose. Seine Krawatte war nicht ganz gerade. Sie rutschte aus seinem Blazer und baumelte herab, als er sich nach vorn beugte und Denises Unterarme inspizierte. »Welchen hat Lynn dir auf den Rücken gedreht?«
»Den.« Sie hob ihren rechten Arm und ließ die Hand kraftlos herabhängen.
»Lass das unbedingt von ’nem Arzt ansehen«, sagte er mit einem Grinsen.
»Wir müssen los.« Lynn machte einen Schritt an Denise vorbei, kauerte sich nieder und gab Kara einen Kuss. »Du benimmst dich, okay?«, sagte sie.
»Ja, Mom.«
John gab ihr ebenfalls einen Kuss. »Ja«, sagte er. »Und lass dir bloß nicht einfallen, Denise mit Zahnstochern zu foltern, hast du gehört?«
Kara lachte und verdrehte die Augen zur Decke. »Oh, Dad, du bist echt ulkig.«
»Viel Spaß, ihr beiden«, sagte er und folgte Lynn zur Tür. »Wir kommen nicht allzu spät.«
Kara sah den beiden nach. Als sie in der Diele waren, winkte sie ihnen.
»Ihr solltet vielleicht die Kette vorlegen, wenn wir weg sind«, rief John. Er machte die Tür auf, ließ Lynn den Vortritt und folgte ihr nach draußen.
Als die Tür langsam hinter ihnen zuschwang, schrie Kara, »SIE SIND WEG! JETZT MACHEN WIR PARTY!«
Denise hörte, wie John glucksend auflachte. Dann fiel die Tür ins Schloss.
»Ich mach schon mal das Videospiel aus, dann können wir uns den Film ansehen. Oder möchtest du ein bisschen Mario spielen?«
»Vielleicht später. Ich geh und leg die Kette vor.«
Als sie Anstalten machte, aufzustehen, sagte Kara, »Ich mach das«, sprang auf die Beine und rannte zur Tür.
6
»Ich bin froh, dass sich deine Laune gebessert hat«, sagte Lynn, als John den Wagen rückwärts aus der Einfahrt fuhr.
»Ich freue mich auf ein gutes Essen.« Er lenkte den Wagen auf die Straße und legte den ersten Gang ein. »Wir hätten das natürlich auch zu Hause machen können und ohne den ganzen Stress. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kara und Denise eine Menge Spaß haben werden.«
»Genau wie wir auch.«
»Wir werden sehen.«
»Das ist doch eine wunderbare Sache. Ich weiß gar nicht, warum du dich so dagegen sträubst. Eines weiß ich allerdings genau – wenn man mir anbieten würde, über mich in einer der wichtigsten Illustrierten des Landes einen großen Artikel zu bringen, würde ich mir die Chance ganz bestimmt nicht entgehen lassen. Kannst du dir das vorstellen? Sie wollen dich vielleicht sogar aufs Titelblatt setzen.«
»Na toll.«
Es würde kein Foto von ihm in der People Today geben – weder auf dem Titelblatt noch in der Zeitschrift. John hatte vor, das rechtzeitig klarzustellen, doch er spielte mit dem Gedanken, mit der Verkündung seiner Entscheidung noch etwas zu warten. Lass die Schreiberlinge ihr Angebot auf den Tisch legen. Lass Lynn noch eine Weile länger ihr Vergnügen haben. Genieß das Essen, und lass die Bombe danach platzen. Sie würde ausflippen.
Was meinst du damit, du machst es nicht!
»Weißt du, was ich glaube, was passieren könnte?«, fragte Lynn. »Ich glaube, wenn die Leute den Bericht lesen, werden alle deine Bilder haben wollen. Du bekommst vielleicht sogar Angebote, Ausstellungen zu machen. Wäre das nicht fantastisch? Stell dir vor, du gehst in eine Galerie in Beverly Hills oder San Francisco – vielleicht sogar in New York – und da hängen deine Bilder!«
»Meine Bilder verkaufen sich im Augenblick doch gar nicht schlecht«, sagte John.
»Eine blauäugige Übertreibung, wenn du mich fragst.«
»Und wenn Leute meine Bilder kaufen wollen, wär’s mir lieber, sie kaufen sie, weil sie ihnen gefallen, und nicht weil sie von dem Typen gemalt wurden, der irgendeinen Verrückten daran gehindert hat, Velma eine Kugel in den Kopf zu jagen.«
»Veronica.«
»Wie auch immer. Hätte ich gewusst, dass das passieren würde, hätte ich vielleicht in die andere Richtung geschaut.«
»Sag so was nicht, John – nicht einmal im Scherz. Du hast etwas Wunderbares und Heldenhaftes getan, und du verdienst Anerkennung dafür. Mein Gott, die Frau hat mehrere Platin-Platten gemacht. Sie ist eine Legende. Und du hast ihr das Leben gerettet.« Lynn schwieg eine Weile. »Ich kann immer noch nicht verstehen, warum du mir nichts davon gesagt hast.«
»Weil ich wusste, dass du eine Menge Aufhebens davon machen würdest.«
»Du bist einen Tag allein in San Francisco und rettest einer Rock-Legende das Leben, und du erzählst deiner Frau kein Wort davon. Ich muss es von Fremden erfahren.«
»Die es ebenfalls nicht erfahren sollten.«