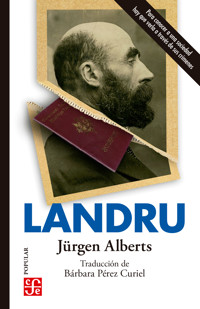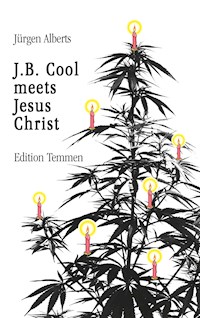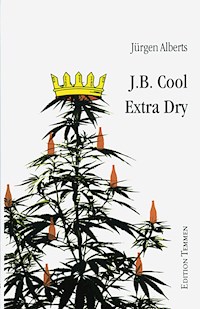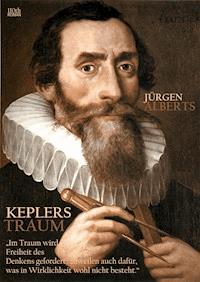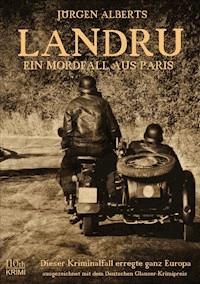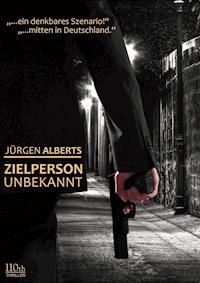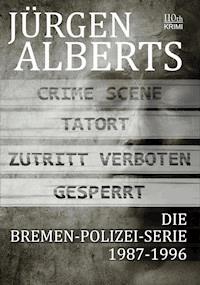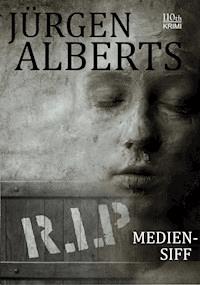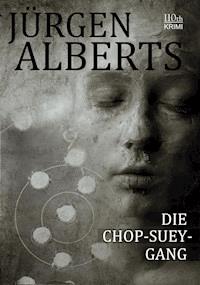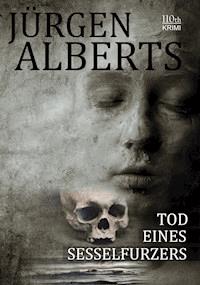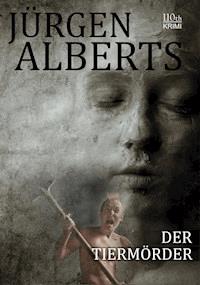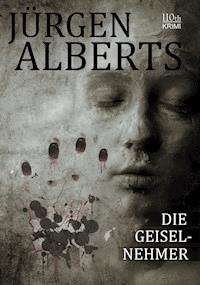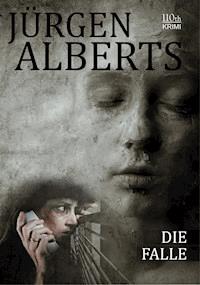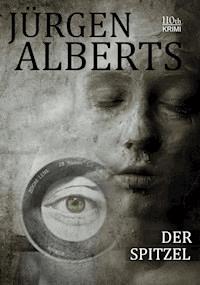
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Nach einer großen Demonstration wird eine Leiche gefunden, verkohlt in einer Feuerstelle. Selbstmord eines Dreißigjährigen, der ein Zeichen setzen wollte? Fritz Pinneberger übernimmt den Fall, der keiner zu sein scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Spitzel
Kriminalroman
von
Jürgen Alberts
Impressum:
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: fotolia.de
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-049-7
MOBI ISBN 978-3-95865-050-3
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Kurzinhalt
Nach einer großen Demonstration wird eine Leiche gefunden, verkohlt in einer Feuerstelle. Selbstmord eines Dreißigjährigen, der ein Zeichen setzen wollte? Fritz Pinneberger übernimmt den Fall, der keiner zu sein scheint.
1
Ein langer Fußmarsch und kein Ende abzusehen.
Von einer kleinen Anhöhe konnten sie die eingezäunte Wiese betrachten, doppelter NATO-Draht, zwei Meter hohe Betonmauer, davor ein zwei Meter breiter Wassergraben, dahinter nichts als grüne Wiese. Kein Baum. Gräben durchzogen das mehrere Hektar große Areal. Ein paar Lastwagen, ein hoher Kran. Und jede Menge Hundertschaften.
Seitdem der Kampf um Symbole der Macht ging, um Demonstration des Herr-im-eigenen-Land-Standpunktes, um die Frage: Wer hat das Sagen in einer Volksherrschaft, die man mit einem Fremdwort auch Demokratie nannte, seit dieser Zeit kam es zu massenhaften Auseinandersetzungen. Mal waren es fünfzigtausend, die sich an einem Wochenende in Bussen zum Protest in Bewegung setzten, mal waren es hunderttausend. Ziel: die Bauplätze der Atomkraftwerke, die aussahen wie militärische Stellungen.
Über ihnen kreisten Groß-Hubschrauber, die gelegentlich auf dem freien Feld landeten und fünfzig Polizisten mobil einsetzten; der ganze Platz vor den endlosen Zäunen war in geblichen Nebel der Tränengasbomben gehüllt. Überall husteten Demonstranten und Polizisten.
Schon dreißig Kilometer vor dem Ort der Demonstration hatten die Polizeitaktiker eine Sperre errichten lassen, so dass dort die Fußmärsche begannen; schon im Umkreis von zweihundert Kilometern wurden auf den Autobahnen alle Fahrzeuge angehalten, die mit der Nein-Danke-Sonne beklebt waren, die Fahrer überprüft und alle Waffen gegen Bescheinigung sichergestellt. So kam die Polizei 1 zu einer großen Menge von Scheren, Messern, Zitronen, - Motorradhelmen; Motorradbrillen. Seltener fanden sie 1 Bolzenschneider; Stemmeisen, Hämmer, Zwillen oder andere Wurfgeschosse. Viele Busse aus der weiteren Entfernung des Demonstrationszieles wurden gar nicht erst durchgelassen. Eine Möglichkeit, den Teilnehmerkreis zu begrenzen.
Immer wieder versuchten kleinere Gruppen von vermummten Demonstranten, den Graben im Sprung zu überwinden, aber dann standen sie vor dem messerscharfen Stacheldraht, einigen gelang es, dieses Hindernis durchzuknipsen, manche saßen auf der hohen Betonmauer. Aber meistens konnten sie sich dort nicht lange halten, denn sie wurden vom Strahl eines Wasserwerfers von der Mauer, gespritzt.
Sie wollten es wissen, sie wollten ausprobieren, ob durch den massenhaften Protest die. Pläne der Bundesregierung, das Land mit einem Netz von Atomkraftwerken zu überziehen, nicht gestoppt werden konnten. Die Unterschriftenlisten erreichten die Länge von mehreren Kilometern, die anhängigen Einspruchsverfahren vor Gerichten beschäftigten Tausende von Juristen, aber die Regierung bewegte sich nicht. Zwar wurden die Stimmen immer lauter, die ein neues Nachdenken über die Gefährlichkeit der Kerntechnik forderten, aber die Technokraten fanden, dass hier ein Exempel statuiert werden müsse. Für sie stand der Fortschritt auf dem Spiel, das nächste Jahrtausend, der Anschluss an den Weltmarkt, die globale Perspektive gegen die Ängste von ein paar hunderttausend Bürgern, so sahen sie diese symbolische Auseinandersetzung.
Die eingesetzten Polizisten sahen das anders. Sie zählten die Überstunden, trockneten ihre Uniformen und versuchten, den Gestank des Angstschweißes herauszuwaschen. Einige meldeten sich verletzt, weil ihnen übel geworden war, einige wurden tatsächlich verletzt vom Wurfhagel der mitgebrachten Gegenstände. Und sie waren sauer. Einerseits mussten sie stundenlang in Reih und Glied stehen; durften sich nur bewegen, um ihre Plastikschilde über den Köpf zu halten, andererseits hatten sie selbst auf diese sehr eingeschränkte Aktivität oft schon tagelang warten müssen.
Die Einsatzleiter hatten meist gegen Abend ein Einsehen und ließen die Hunde von der Kette.
So war es auch an diesem Tag, im September.
Die Demonstranten befanden sich schon auf dem Rückweg zu den Bussen, erschöpft von den langen Märschen und der erfahrenen Ohnmacht, ihre Gespräche drehten sich um diejenigen, die in vorderster Front der Wasserschlacht standen und in der Abendkühle eine Lungenentzündung riskierten.
»Knüppel frei!«
Die Parole schallte über das Gelände.
Die meisten rannten los, stolperten über den Acker, fielen in Gräben. Ein Demonstrant hieb mit einer Schaufel auf einen Polizisten ein, der im Schlamm steckte.
Die Hundertschaften, die aus dem großen Tor des Baugeländes strömten, verteilten sich in alle Richtungen.
Gejohle.
Geschrei.
Wie Hasenjagen.
Kaum hatten sie einen erwischt, wurde er, noch am Boden liegend, verprügelt. Die aufgestaute Aggression musste sich entladen. Dazu ließ der Einsatzleiter ausrücken.
Außerdem braucht jeder Krieg Gefangene.
Die in der Eile zurückgelassenen Gegenstände wurden von Polizisten zu großen Scheiterhaufen aufgetürmt und verbrannt. In der Abenddämmerung sahen die Demonstranten, die in ihren eingeklemmten Bussen auf die Abfahrt warteten, wie zertrampelt die Äcker waren.
Die eingezäunte Wiese war unbeschädigt.'
In den abendlichen Nachrichten wurde von einem weitgehend ruhigen Verlauf des Tages gesprochen, und dann wurden ein paar bewegte, Bilder von der Hasenjagd gezeigt. Die verantwortlichen Politiker sahen sich die Auseinandersetzungen im Fernsehen an und waren ganz zufrieden.
Gegen dreiundzwanzig Uhr wurde ein Mann gefunden.
Verbrannt.
In einer Feuerstelle.
Das Gesicht verkohlt, der Parka bis auf den Reißverschluss weggebrannt, die schwarzen Reste der Turnschuhe an die Füße geschmort.
Die Leiche wurde durch Zufall von einem Bauern entdeckt, der in Gedanken zusammenrechnete, wie hoch der Verlust der Ernte war.
Die Spätnachrichten meldeten nichts über dieses Ende eines symbolischen Tages.
2
»Passe«, sagte Fritz Pinneberger und sah Marianne an. Er schüttelte den Kopf. So einen Skatspieler hatte er noch nie erlebt.
Sie saßen im >Eck< und versuchten, ihre Vierer-Runde zu komplettieren. Obwohl Skat von drei Personen gespielt wurde, hatte, Fritz Pinneberger, darauf beständen, dass ein vierter Mann her müsse.
Wen hatten sie in den zwei Jahren nicht alles ausprobiert. Kollegen aus allen Dezernaten; die bereit waren, sich mit Lindow an einen Tisch zu setzen. Das waren zwar nicht sehr viele, aber unter denen gab es eine ganze Reihe, von Skatspielern. Joe Davids, mit dem Pinneberger täglich auf dem Kommissariat zu tun hatte, war ihnen zu überlegen. Der spielte Skat mit Messern, da mussten sie sich vorsehen. Ein Kollege von der Wirtschaft, mit dem Lindow gelegentlich arbeitete, brachte es fertig, den ganzen Abend kein Spiel zu machen. Auch der wurde nicht wieder eingeladen.
»Kontra«, sagte Pinneberger, der sich darauf freute, dass er mit einem der nächsten Stiche Horst zur Strecke brachte.
»Re«, erwiderte Horst, »das Blatt wird verteidigt.«
Marianne lächelte. Sie hatte ihn angeschleppt. Obwohl sie mitten in ihrem Sozialpädagogik-Examen stand, durfte der wöchentliche Skatabend nicht ausfallen. Das hätte ihr Fritz Pinneberger nicht verziehen. Außerdem war es eine schöne Ablenkung. Sie hatte sich mit Horst auf die mündliche Prüfung vorbereitet. Thema: >Die Ideologeme im Bewusstsein der westdeutschen Arbeiterschaft<. Horst kannte all die Titel, die zum Standardwissen gehörten.
Auch er war, über den zweiten Bildungsweg an, die Universität gekommen. Und als er gesagt hatte, dass er Skat spielen könne, lud ihn Marianne ein. Aber was sie nicht sagte, war, dass sie mit zwei Polizisten spielte.
So war die erste Bemerkung, die Horst machte; als sie sich begrüßten, auch sehr unpassend: »Eigentlich hätt' ich auf der Demo sein müssen.«
»Da haben wir unsere Hundertschaften hingeschickt:« Lindow lachte. Horst erschrak.
Fritz Pinneberger hatte schon mit dem Gedanken gespielt, mal einen Demonstrationsausflug als Beobachter mitzumachen. Ihm war zwar bei der Aussicht auf eine strahlenverseuchte. Zukunft nicht gerade wohl; aber deswegen würde er nicht dagegen demonstrieren
Es reizte ihn nur, sich mit den Teilnehmern zu unterhalten. Denn anders als die meisten Presseerzeugnisse, hielt er sie nicht für Chaoten und Dummköpfe, Spinner und Altfrustrierte. Einmal hätte er 'sich' sogar mit seinem Vorgesetzten, dem Kriminaldirektor Matthies, gestritten, der behauptete, diese Wanderdemonstranten würden den Staat unterminieren wollen. Pinneberger sah das nicht so und hielt dagegen.
Horst spielte die erste Karte, und sie sollte gleich seine schwierige Lage aufzeigen. Die Herz-Sieben, damit würde er keinen Stich machen, aber er hatte noch eine Herz-Zehn.
Wolfgang Lindow nahm mit der Dame. Dieser, Null-Ouvert deni. Horst, der angekündigt hatte, war ein Gespenst. Was konnten sie mit einem vierten Mann anfangen, der aggressiv versuchte, jedes Spiel zu machen; und dabei, fast immer verlor? Lindow rechnete in Gedanken schon die Verluste zusammen, die Horst zusammengespielt hatte. Hoffentlich traf es keinen Bafög-Studenten.
»Das war's dann wohl«, sagte Fritz Pinneberger, als Horst die Karten auf den Eichentisch legte. Er spielte die Herz-Acht, Horst musste übernehmen; Lindow war blank.
»46; verloren g2, Kontra 184, Re 368«, Lindow notierte mit seinem spitzen Bleistift, addierte und subtrahierte. Die Zahlen waren beeindruckend.
Horst blieb stumm, als würde ihn das gar nichts angehen. Er nahm die Karten, mischte sie und teilte aus. Dann stand er auf und ging zur Toilette.
Marianne steckte sich ihr Blatt: »Tut mir leid. Das konnte ich nicht wissen.«
»Ach was«, sagte Lindow, »ist doch ganz amüsant. Hoffentlich kann er zahlen.«
»Der spielt aber nicht mehr mit«, Pinneberger war verärgert. Er nahm einen großen Schluck Bier. »Wär er besser demonstrieren gegangen und hätte für uns gebetet.«
»Fritz, lass das.« Marianne legte das Blatt hin. »Ich finde es nicht gut, darüber Witze zu machen. Diese Leute sitzen nicht, wie wir, faul auf dem Hintern.«
»Bitte, keine politischen Parolen, Marianne. Wir spielen .Skat!« Wolfgang Lindow sah sie strafend an. »Wer ist vorne?«
Das Ritual begann.
»Geben, hören, sagen. Fritz, los geht's.«
»Aber man kann doch nicht zusehen, wie die mit der Bombe spielen.« Marianne ließ nicht locker.
»Kernkraftwerke sind sicher«, sagte Lindow, »willst du 'ne Mark zahlen?« Er nahm den Bleistift in die Hand. Dem Skat abträgliche Gespräche, ob sie nun über die Arbeit oder seit neuestem über Politik gingen, waren verboten.
Eine Mark in die gemeinsame Kasse war bei Zuwiderhandlungen zu entrichten. Lindow sagte immer, Skat sei ein ernstes Spiel, nicht so was Lächerliches wie Würfeln.
»Wenn ihr wütend seid auf den Horst, dann doch nur; weil er, das gesagt hat, mit dem Demonstrieren, oder?« Marianne hatte ihr. Blatt wieder aufgenommen, sie wollte- keinen Streit provozieren, immerhin war Horst auf ihre Einladung gekommen.
»Das hat damit gar nichts zu tun«, sagte Pinneberger, »der ist mir so lieb wie jeder andere auch. Wir haben eben noch nicht den Richtigen gefunden.«
Horst kam zurück und war ganz grün im Gesicht.
Er hielt zwei Zehnmarkscheine in der Hand, warf sie auf den Tisch, murmelte, das müsse wohl genügen, nahm seine Jacke und ging.
Einen Moment war es im >Eck< ganz leise, die Gespräche an den anderen Tischen verstummten.
Horst stand an der Theke, zahlte. seine Zeche. Marianne sprang auf. »Was ist los mit dir?«
»Ich muss kotzen«, sagte Horst.
»Du verträgst nicht viel«, Marianne fasste ihn an der Schulter.
»Das ist es nicht«, erwiderte Horst ziemlich laut. Er nahm das Wechselgeld.
»Wir sehen uns in der Uni«, sagte er; dann ging er mit schnellen Schritten zum Ausgang.
Fritz Pinneberger und Wolfgang Lindow waren völlig verdattert. »Nicht mal in, Ruhe ein Spielchen kann man mehr machen«, Pinneberger fand als erster seine Worte wieder: Da hatte er diesen Studenten falsch eingeschätzt.
Wolfgang Lindow bohrte in der Nase. »Diese dämliche Politik, und dabei hab' ich so ein gutes Blatt.«
Marianne kam an den Tisch zurück. »Ich hab' keine Lust mehr, trinken wir aus und machen Schluss. Außerdem muss ich morgen wieder ...«
Lindow, der als Ältester von ihnen meist den Ton angab, war gar nicht damit einverstanden, wenigstens noch diese Runde wolle er zu Ende spielen. Und die drei Bockrunden würden auch noch gespielt.
Pinneberger machte einen Kompromiss-Vorschlag. Dann stimmten sie ab.
Immerhin ging es demokratisch bei ihnen zu.
Zur gleichen Zeit saßen vier Herren in fast gleichen Anzügen in einem alten Weinfass und sprachen leise miteinander: Sie hatten den Kellner gebeten, sie in den nächsten beiden Stunden nicht zu stören. In diesem Séparée des Ratskellers waren die Geräusche der großen Halle sehr gedämpft. Die vertraute Atmosphäre für vertrauliche Gespräche.
»Ich denke, es wäre an der Zeit, zu überlegen, ob man nicht jeden Tag einen von diesen Terroristen öffentlich erschießt. Ich weiß, meine Herren, das sind starke Worte, aber ich sehe keinen anderen Ausweg.« Der Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz sah in die Runde.
»Ist es nicht etwas zu früh für diesen Gedanken«, meinte der Innensenator, an dessen Jackett ein kleines goldenes Parteiabzeichen prangte.
Sie hatten in den letzten fünfzig Minuten die Lage in der Stadt diskutiert: die Durchsuchung der Wohnungen, kurz kw genannt, was für konspirative Wohnungen stand, das Abhören von rund hundert Personen, die Überprüfung fast sämtlicher Arztpraxen und Rechtsanwaltsbüros, denn seit das Bundeskriminalamt vermutete, dass der entführte Industrielle in der Nähe eines Büros gefangen gehalten wurde, waren entsprechende Anweisungen erfolgt;
»Es ist gar nicht so schwer, wie Sie denken, meine Herren«, der oberste Verfassungsschützer der Stadt nahm seinen Gedanken wieder auf, »der Bundestag ändert unverzüglich Artikel 102, des Grundgesetzes und hebt die Abschaffung der Todesstrafe auf. Danach können Menschen erschossen werden; die durch menschenerpresserische Geiselnahme befreit werden sollen, also Terroristen in diesem Fall. Das Urteil wird durch höchstrichterlichen Spruch gefällt, keine Rechtsmittel möglich.«
Polizeipräsident Mantz stopfte seine Pfeife, umständlich. Wenn er zu viel Tabak hineinpfropfte, dann brannte sie nicht, wenn er zu wenig nahm, gab es ein Strohfeuer. »Ich weiß nicht, Müller, ob wir damit auf dem richtigen Weg sind.«
»Aber wir hätten die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite«, gab der Verfassungsschützer zu bedenken.
Die Ausbeute der großangelegten Fahndung; die seit vierzehn Tagen auf Hochtouren lief; war, gleich Null. Auch der Hinweis, der entführte Industrielle sei auf einem Schiff, weil man im Hintergrund des Videofilmes einen Motor zu hören glaubte, löste nur einen neuen Fehlschlag aus. Sämtliche Boote, die im Hafen lagen, mussten überprüft werden. Alle Häfen wurden unter ständige Beobachtung genommen, NATO-Flugzeuge kontrollierten die: Nordsee und das Ijsselmeer und spähten nach einem verdächtigen Boot. >Den Tatort zum Reden bringen<, hatte der Chef des BKA als Parole ausgegeben, durch >Einsatz der Kriminaltechnik und durch Informationsverdichtung< hoffte er, den Entführern auf die Spur zu kommen.
Matthies, der die ganze Zeit geschwiegen hatte, meldete sich zu Wort. Als Kriminaldirektor war er zu dieser vertraulichen Sitzung nur eingeladen worden, weil er sich ständig über die doppelten Einsätze seiner Beamten beschwerte.
»Ich denke, man müsste das Problem ganz anders anpacken: Warum tut man nicht so, als ginge man auf die Forderungen der Entführer °ein, erreicht den Austausch, und dann schlägt man zu. Es kann doch nicht so schwer sein, ein paar Terroristen in einem fremden Land zu erledigen. Schließlich wissen wir doch lange zuvor, wo sie sich hinbringen lassen. Sagen wir mal: Kuba oder, ist ja egal wohin, ein paar rechtzeitig eingeschleuste Touristen und dann haben wir das Problem vom Hals ...«
»Der Kanzler wird dem niemals zustimmen.« Der Innensenator war erstaunt, dass ein Kriminaldirektor solche Vorschläge machte. »Ein Austausch darf auf keinen Fall stattfinden. Das leistet nur weiteren Verbrechen Vorschub. Was jetzt zählt, ist: Härte!«
Die Tür ging auf.
»Wünschen die Herrschaften noch etwas zu trinken?« Der Kellner hielt die runde Öffnung des Weinfasses nur einen Spaltbreit auf.
»Raus!« Der Verfassungsschützer wurde laut. Sofort schloss der Kellner die Tür.
»Es wäre immer noch das Beste«, der Innensenator sah den Verfassungsschützer wütend an, sprach ganz leise, »wir stöbern das Versteck der Entführer auf, auch wenn das den Tod für Geisel und Bewacher bedeutet.' Das wäre die Lösung, denke ich. Und so wird der Kanzler auch denken.« Sie waren eben in der gleichen Partei.
Mantz, dem der bestellte Wein zu sauer war, er hatte dem Innensenator bei der Bestellung den Vortritt gelassen, nickte zustimmend: »Sicher; das wäre die beste Lösung.«
»Aber, wir wissen nicht, wo sie sich aufhalten«, Matthies hatte keine Lust, Traumschlösser zu bauen. »Härte zeigen, gut, aber wir können nicht überall, in jedem Augenblick, zugleich sein. Als ich hörte, dass vom BKA die Überlegung kam, an jeder Telefonzelle einen Polizisten zu postieren; weil die Anrufe der Entführer meist von Telefonzellen kommen, da hab' ich einen .Lachanfall gekriegt. Wissen Sie, wie viele Telefonzellen es in diesem Land gibt?«
»Dann müssen wir eben die Zahl der Telefonzellen künstlich verknappen. Ein paar Schilder >Außer Betrieb< können doch nicht soviel kosten.« Der Verfassungsschützer Müller war dafür bekannt, dass er schnelle Problemlösungen liebte. Oder man konnte auch sagen: einfache Lösungen. Oder unproblematische Problemlösungen.
Matthies, der seit mehr als fünfundzwanzig Jahren bei der Kripo war, hasste diesen jungen Vorlaut, er sprach ihm jede polizeitechnische Kompetenz ab. Aber er sagte: »Alles ganz einfach. Klar. Morgen schnappen wir die Entführer, die sagen uns, wo sie die Geisel versteckt halten, wir nehmen sie in Empfang und stellen uns auf den Balkon, um ein paar flotte Reden zu halten. Ich nenne das Fahndungs-Illusionen. Sie wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben.«
Der Innensenator bat um Mäßigung. Sie könnten auf keinen Fall jetzt auch noch Kompetenzstreitigkeiten gebrauchen. Er fasste das bisherige Ergebnis ihrer Besprechung zusammen und stellte fest, dass sie nicht einen Schritt weitergekommen waren.
Dann erhob er sein Glas und prostete den anderen Herren zu.
Sie tranken gemeinsam.
Mantz konnte sich nicht an den sauren Wein gewöhnen.
»Ich habe eine interessante Zahl gelesen«, sagte der Innensenator, »bei der Lorenz-Entführung waren damals, und das liegt erst zwei Jahre zurück, 75 Prozent dafür, dass er gegen die sechs Häftlinge ausgetauscht würde, in unserem Fall sind 71 Prozent dagegen. So sehen die Zahlen aus.«
Daher weht der Wind, dachte Matthies, das ist die Grundlage der Entscheidung. Das Gesicht nicht verlieren, Härte zeigen, Wählerstimmen sammeln, auch wenn dabei jemand geopfert wird.
»Das kann nur damit zusammenhängen«, gab Mantz zu bedenken, seine Pfeife war schon wieder erloschen, »dass diesmal eine Symbolfigur entführt wurde, so jedenfalls hat es ein Frankfurter Journalist gesagt, eine Symbolfigur für Faschismus, Kapitalismus und Restauration, jemand, der auch Auschwitz mit auf dem Gewissen hat. Also, das sagt dieser Frankfurter ...«
»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen.« Der Innensenator zupfte an seiner Krawatte, das rotleuchtende Emblem mit dem Stadtwappen hatte einen kleinen Fleck.
»Ich wollte eine Erklärung geben, warum so viele diesen Mann nicht wiederhaben wollen«, Mantz versuchte sich zu vergewissern, dann sagte er, »schließlich beliebt ist der nicht.«
»Ach so«, der Innensenator nickte. Er öffnete den schmalen Hefter, den er mitgebracht hätte. »In der FAZ schreibt Golo Mann, und der ist ja nicht gerade ein Niemand, wir lebten in einem Ausnahmezustand, weil Bürgerkrieg herrsche. Man müsse den Terroristen die Grundrechte aberkennen und sie für vogelfrei erklären. >Wir befinden uns in einem Krieg, wir stehen zum Töten entschlossenen Feinden gegenüber<; schreibt er. Was meinen Sie dazu, meine Herren?«
»Quatsch«, gab Matthies von sich, »das sind gewöhnliche Verbrecher. Da hätten wir schon häufiger den Ausnahmezustand erklären müssen.«
»Das sehe ich nicht so«; sagte der Verfassungsschützer, »wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Wenn wir jetzt einen Fehler machen, dann kann uns das alles um die Ohren fliegen.«
Mantz schwieg. Er war früher Polizeipsychologe gewesen und hatte in seiner Ausbildung gelernt, dass der Innensenator mit diesem Zitat seine Leute nur testen wollte. Da war Schweigen besser, als sich zu verraten.
Zum zweiten Mal ging die Tür des Weinfasses auf. Diesmal stand ein Mann davor, den sie alle kannten: Harms, der Pressesprecher der Polizei. Er war völlig außer Atem.
»Entschuldigen Sie, aber ich wusste — ich meinte, es wäre besser.«
»Kommen Sie rein«; sagte Mantz und rückte dichter an den Innensenator heran. Der seinerseits wiederum rückte ein wenig zur Seite und brachte den Verfassungsschützer in Bedrängnis, der dann sehr energisch Matthies zur, Seite schob. So saß der Kriminaldirektor an die Tür gequetscht.
»Es hat einen Toten gegeben, kam gerade durch«, Harms griff sich ins schüttere Haar, versuchte mit den Fingern die aufstehenden Strähnen zu legen, »bei der Demonstration. Jetzt wird es Ernst. Ich dachte, Sie sollten es so schnell wie möglich erfahren. Morgen wird noch nichts in der Zeitung stehen, aber ich denke, im Rundfunk, in den Frühnachrichten wird's kommen.«
Sie sahen sich an.
Das hatte gerade noch gefehlt.
Mitten in der größten Fahndungswelle, die durch diese Republik schwappte, ein Toter bei einer Demonstration!
Am nächsten Morgen erlebte Marianne ihr grünes Wunder. Sie fuhr die Humboldtstraße entlang, um vor der Uni noch schnell ein paar Besorgungen zu machen.
An der Ecke St. Jürgen-Straße war eine Polizeisperre.
Sie hielt an.
Ein junger Polizist riss die Tür auf.
»Aussteigen!« Seine Stimme war laut: »Arme aufs Wagendach, Beine auseinander.«
Marianne gehorchte nicht sofort.
Ein zweiter Polizist, der eine Maschinenpistole im Anschlag hielt, trat ihr zwischen die Beine.
»Keinen Widerstand.«
Sie wurde nach Waffen durchsucht.
Der Kofferraum des Wagens, in dem sich eine Menge Altpapier und leere Flaschen befanden, versetzte die Beamten in höchste Alarmbereitschaft.
Ein dicker, älterer Beamte nahm den Benzinkanister in die Hand.
»Alles da«, rief er, »damit macht man Flaschenbomben.«
»Papiere«, schrie ein vierter Beamter in diesem Moment geriet Marianne in Panik.
Sie drehte sich um.
Lief los.
Mit zwei Sprüngen war sie auf dem Bürgersteig.
Rannte.
Auf ein Baugrundstück.
Die Kugeln schlugen neben ihr ein.
In einem kleinen Mäuerchen.
Marianne blieb stehen.
Es hatte keinen Zweck.
Die Beamten kamen keuchend hinter ihr her. In ihrer schweren Uniform war nicht gut laufen.
Marianne dachte an ihren Freund, den sie vor zwei Jahren kennengelernt hatte, der würde ihr helfen müssen. Aber Fritz Pinneberger sollte an diesem Morgen ganz andere Arbeit übernehmen müssen.
3
Obwohl es elf Uhr morgens war, konnte Klaus Grünenberg im Cinema nur noch einen Stehplatz ergattern. Er sah alle Kollegen von der lokalen Presse in den vordersten Reihen sitzen, sogar die >Nordschau< hatte Lampen aufgebaut, was dem in trübem Grau gehaltenen Raum wenigstens Helligkeit verlieh. In den nächsten Wochen sollte dieses umgebaute Kino wieder eröffnet werden. Klaus Grünenberg fragte sich, wer für die ausrangierten Flugzeugsitze und die umgestülpten Topflampen verantwortlich war. Auch der Eingang war zu einem einzigen Schlauch geworden, keine schöne Begrüßung für Cineasten.
»Es verlief eigentlich den ganzen Tag friedlich, wir hatten keine Probleme mit der Polizei.« Das war Christian Zorn, einer der Sprecher der örtlichen Bürgerinitiative gegen Atomenergieanlagen; er war Hochschullehrer und hatte die Gabe, die wunderschönsten Reden zu halten. »Und spazieren gegangen sind wir auch genug. Gelegentlich gab es kleinere Zusammenstöße, aber die sind nicht der Rede wert. Es war ein friedlicher Tag. Wir waren rund achtzigtausend Demonstranten.«
Grünenberg hatte in der morgendlichen Redaktionskonferenz gehört, dass die Polizei von nicht mehr als zehntausend Demonstranten sprach. Aber das gehörte zum Gewerbe, Zahlen waren geduldig. Seitdem bekannt war, dass eine verkohlte Leiche am Ort der Auseinandersetzung gefunden wurde, gab es eine merkwürdige Zurückhaltung in der Redaktion. Der Lokalchef fragte, wer sich der Sache annehmen wolle. Außer Grünenberg hob niemand die Hand. Der Lokalchef mahnte: »Aber nicht nur die eine Seite anhören.«
Auch die andere, ergänzte Grünenberg in Gedanken. Es würde schwer werden, von der Polizei jetzt schon eine Stellungnahme zu dem Fall zu bekommen.
Im Cinema wurde es unruhig.
Einige der Zuhörer; die offensichtlich selbst an der gestrigen Demonstration teilgenommen hatten, widersprachen Christian Zorn, der geduldig jeden von ihnen ausreden ließ. Sie sprachen von den Behinderungen im Vorfeld der Demonstration, von den Einsätzen der Großhubschrauber. »Ich habe mich viermal geduscht, die gelbe Brühe lief nur so runter«, sagte eine der Frauen, »die hatten chemische Zusatzmittel im Wasserwerfer. Überhaupt will ich mal sagen, da kann man doch nicht mehr friedlich sein, wenn man so ein KZ sieht. Die Bullen haben doch wild drauflos geprügelt, als sie aus dem Tor sind. Das war Krieg. Anders kann ich das nicht sagen.«
Christian Zorn sprach mit einigen Pressevertretern leise, weil die schon anfingen zu drängeln, sie müssten zum nächsten Termin.
»Was heißt denn hier friedlich?!«, rief einer aus der letzten Reihe; »waren die Bullen friedlich? Die haben riskiert, dass unsere Leute vom Wasserwerfer zu Boden geworfen wurden. Ist das friedlich? Ich kann nur sagen, scheiß auf friedliche Demonstranten. Beim nächsten Mal bin ich bewaffnet.«.
Er bekam Beifall.
Olaf Blume nahm das Wort, er stand neben Zorn, direkt vor; der Leinwand. Auch er gehörte zu den Wortführern der Bürgerinitiative, er nannte sich gerne >Rädelsführer<, wenn die Polizei ihn nach seinem Beruf fragte: Tatsächlich war er Architekt.
»Wir haben Fotos hier, wie die Bullerei vorgegangen ist. An einer Stelle hat es bereits gegen vier Uhr nachmittags einen berittenen Einsatz gegeben.«
Er holte die Abzüge hervor und verteilte sie an die Presse.
»Moment«, rief der Kameramann, »die wollen wir auch sehen.«
»Ich weiß nicht, was diese Medienfritzen hier für Vorrechte haben, was ist mit dem Toten?« Eine dunkelhaarige Frau, die eine große Anti-Atom-Sonne als Umhang trug, war aufgesprungen.
»Langsam, beruhigt euch, dazu kommen wir noch!« Olaf Blume versuchte, die Gemüter zu beruhigen.
Klaus Grünenberg atmete tief durch. Das konnte ein langer Vormittag werden und nur wenig zum Schreiben. Aber es war nicht das erste Mal; dass er bei einer solchen Veranstaltung der Initiative war. Die konnten Stunden reden, Pläne in aller Öffentlichkeit diskutieren, sie trafen sich jede Woche zu einem Plenum, und mehrmals die Woche in ihren Stadtteilen. Grünenberg war sogar zweimal mitmarschiert, als es nach Brokdorf ging; aber dieses Gerede konnte er nicht leiden. Jeder wollte etwas sagen, auch wenn alles längst gesagt war.
Er hätte sich gerne eine Zigarette angesteckt.
Die Fotos sahen schlimm aus.
Vier, fünf schwerbewaffnete Polizisten, die auf eine Frau einschlugen. Ein Polizist, der mit seinem Knüppel einen Mann vertrimmte, auf dessen Schultern ein Kind saß. Berittene Polizisten, die vom Pferd mit langen Stöcken hantierten.
Grünenberg wusste, dass er keins dieser Fotos in seiner Zeitung unterkriegen würde, die sah der Verleger nicht gern; er wollte es dennoch versuchen.
»Macht mal den Vorhang auf«, Olaf Blume gab dem jungen Vorführer ein Zeichen. Aber die Lampen des Fernsehteams reflektierten nur das Licht auf der Leinwand, und so konnten die Besucher der Pressekonferenz kaum etwas von den Dias sehen, die Blume kommentierte.
»Was ist mit dem Toten?«
»Ich komme noch dazu«, sagte Blume, der erst seine Dias zeigen wollte: »Hab' ich extra heute Nacht noch entwickeln lassen.«
Als seien es Urlaubserinnerungen, seltene Beweisstücke des Daseins an entfernten Orten, so präsentierte Blume sein Bildmaterial. Die Gesichter der Demonstranten, mal wütend verzerrt, mal fröhlich mitsingend, mal skeptisch, mal auffordernd, und dazwischen immer wieder der Blick über die Betonmauer auf die grüne Wiese: die Schlachtreihen der Polizei.
»Die Aufforderung zum Ausrücken kam genau um neunzehn Uhr. Ohne jeglichen Hinweis, den Platz zu räumen.«
Christian Zorn sagte: »Wir haben damit gerechnet, aber wir konnten schließlich nicht alle warnen. Einige haben den Polizeifunk geknackt, da gab es schon eine X-Zeit. Wir wussten nur nicht, wann das genau sein sollte.«
Klaus Grünenberg' notierte sich die Uhrzeit. '
»Ich habe den Verdacht«, Blume hob die Stimme, »und damit können. Sie mich zitieren, dass der Tote ein Opfer der Polizei geworden ist. Vielleicht war es nur ein Unglücksfall, vielleicht geschah es absichtlich, aber wir gehen davon aus, dass dieser Tote auf das Konto der Polizei geht.«
»Moment«, rief Grünenberg, »wieso sind Sie da, so sicher?«
Er wurde niedergepfiffen.
Als sich der Tumult gelegt hatte, wiederholte er seine Frage.
»Es gibt keine andere Erklärung«, sagte Olaf Blume.
»Wissen Sie denn, wie der Mann heißt?«, fragte Grünenberg.
Olaf Blume zuckte mit den Schultern.
Grünenberg machte sich Notizen.
Er sah, wie die Fernsehleute die Lichter ausschalteten. Im gleichen Moment war es stockdunkel im Kino. Alle rieben sich die Augen.'
»Licht einschalten«, rief Gerd.
Als die Pressekonferenz beendet war; blieb Klaus Grünenberg in der verschandelten Eingangshalle stehen. Die Eisenrohr-Konstruktion, die in das obere Geschoss führte, nahm den Kino-Besuchern 'eine Menge Platz weg.
Er erwischte Blume, der seinen Kasten mit Dias unterm Arm trug und schnell die Pressekonferenz verlassen wollte.
»Wie könnt ihr so was behaupten?«, fragte Grünenberg, »das schadet doch nur. Ich werde nichts darüber schreiben.«
»Schreib es nur«, sagte Blume. »Ich bin ganz sicher, dass die Polizei das zu verantworten hat. Kein Zweifel.«
Grünenberg konnte es nicht fassen. Obwohl er die Bilder von dem Polizeieinsatz gesehen hatte, gab es für ihn keine logische Folge, die zu einer verkohlten Leiche führte.
»Wie gefällt dir das Kino?«, fragte er Blume, um ihn nicht gleich gehen zu lassen.
»Wieso?«
»Ich fand es früher schöner und bequemer.«
»Ich hab, es umgebaut«, sagte Blume, »wusstest du das nicht?«
»Na dann«, erwiderte Grünenberg, der, sich an die freundlichen Beziehungen zwischen, dem Kino-Besitzer und Blume erinnerte, schließlich waren sie im gleichen Ortsverein.
»Aber es ist nicht gerade besucherfreundlich geworden, finde ich.«
Olaf Blume grinste: »Ich gehe sowieso nie ins Kino. Aber der Raum hat jetzt Stil. Nicht nur, weil ich ihn gebaut habe.«
Klaus Grünenberg stand an der Glastür, die ebenfalls mit Stahlrohren eingefasst war.
»Mal sehen, was ich schreibe«, sagte er zögernd. »Über die neue Kinoeinrichtung?«, fragte Blume.
Fritz Pinneberger ließ sich nicht einschüchtern.
Er wusste; dass Matthies eckig sein konnte, er wusste, dass sein Chef nicht immer den schnellsten Weg nahm und seine Devise oft >mal abwarten< hieß, aber jetzt war er ihm zu voreilig.
»Ich arbeite seit fünf Jahren mit Davids zusammen, und ich denke; das ist ein übler Vertrauensbruch, wenn er hier rausgeschickt wird.«
Matthies stand am Fenster und sah in die Wallanlagen. »Das ist eine dienstliche Aufforderung, Herr Pinneberger.«
Joe Davids hätte längst das geräumige Büro verlassen, wenn Pinneberger ihn nicht am Arm festhielte.
»Mit, welcher Begründung?«
Eigentlich hatte Pinneberger, einen guten Ruf bei seinem Chef, auch wenn er sich damals als einziger aus dem ersten Kommissariat auf die Seite von Lindow geschlagen hatte.
Der Oberkommissar war kurz vor der Beförderung, die nach seinen fünfzehn Dienstjahren längst angestanden hätte, wenn nicht dieser >immer enger werdende Kegel der Hierarchie<, wie es in der Ausbildung hieß, dagegenstünde.
»Ich gehe dann«, sagte Davids leise.
Pinneberger wollte ihn nicht halten.
Als Davids die Tür hinter sich geschlossen hatte, fragte Pinneberger nach: »Die Begründung, ich warte.«
»Ich habe gar nichts zu begründen, Herr Pinneberger.« Matthies drehte sich um.
Er trug einen für den Dienst zu vornehmen Anzug, gedecktes Blaugrau, dazu einen silbernen Binder.
»Ich werde in ein paar Jahren pensioniert, Herr Kollege, dann können Sie meinen Job machen.« Das sagte er mit -zusammengekniffenem Mund.
»So weit bin ich noch nicht«, erwiderte Pinneberger und setzte sich ohne weitere Aufforderung vor den Schreibtisch.
»Sie haben von dem Toten gehört, den es heute Nacht bei der Demonstration gegeben hat?«
Pinneberger nickte.
»Wie ich erfahren habe, wird dieser Tote uns in die Schuhe geschoben.« Matthies stand wie ein Feldherr hinter seinem Schreibtisch.
»Wer behauptet das?«
»Das tut jetzt nichts zur Sache.«
Pinneberger hatte zwar die Morgennachrichten gehört, aber da der Tote nicht im Stadtgebiet gefunden wurde, hatte er sich keine weiteren Gedanken darüber gemacht.
»Also, was ich Ihnen jetzt sage, ist vertraulich. Sie werden sich um diesen Toten kümmern. Das ist Ihre Leiche.«
Matthies setzte sich. Sein Äußeres passte eher zu einem Standesbeamten als zu einem Kriminaldirektor ... Sein kurzgeschnittenes graues Haar mit den dekorativen silbernen Streifen, die eckige Brille, das war der höhere Dienst.
»Ich verstehe nicht ganz.« Pinneberger wollte sich vergewissern.
Matthies ließ sich nicht beirren: »Sie werden den Fall aufklären. Ich habe alles Nötige in die Wege geleitet. Die Kollegen aus Niedersachsen sind damit einverstanden.«
»Aber wir haben hier genügend zu tun …«
»Ich weiß, ich weiß. Aber das ist Ihr Fall.«
Matthies trommelte auf den Tisch.
»Und Davids?«
»Was ist mit dem?«
»Soll er ebenfalls ...«
»Wenn Sie es für richtig halten, Kollege Pinneberger. Er ist Ihr Assistent.«
Fritz Pinneberger verstand nun gar nicht mehr, warum sein Chef Davids wie einen kleinen Jungen vor die Tür geschickt hatte.
»Wer, behauptet, dass der Tote mit der Polizei in Verbindung gebracht wird?«
Matthies antwortete: »Gut unterrichtete Kreise.«
»Der Verfassungsschutz, was?«
Pinneberger konnte diese Schnüffler nicht ausstehen, ständig lieferten sie Gerüchte als Informationen, unterbreiteten wertvolle Hinweise, die sich dann: ins Nichts auflösten.
»Kein, Kommentar«, sagte Matthies.
»Also kann ich nun Davids einweihen?« Pinneberger hasste diese abwartende Haltung seines Chefs. Immer wenn er Verantwortung übernehmen sollte, begann er sich zu winden.