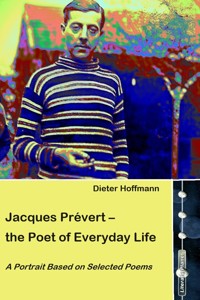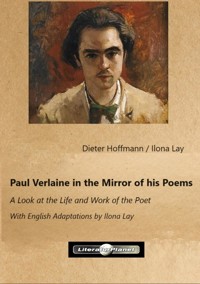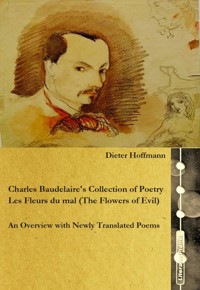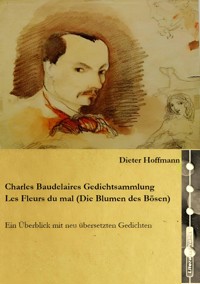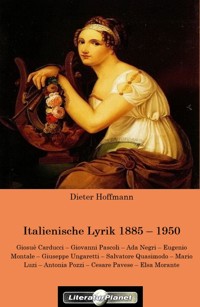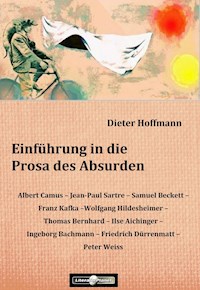Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Militzke
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Neue Diskussionsansätze - Zur Verantwortung Deutschlands für den Ersten Weltkrieg Ein Jahrhundert nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges ist sich die Forschung weiterhin uneins darüber, welchen Anteil an Verantwortung Deutschland tatsächlich bei der Entstehung dieses folgenschweren Konflikts hatte. Ist Deutschland in den Krieg "hineingeschlittert" oder hat es ihn von langer Hand vorbereitet, um das Kräftegleichgewicht in Europa zu seinen Gunsten zu verschieben? Dieter Hoffmann stellt dieses Thema neu zur Diskussion, indem er Hauptakteure und Beteiligte des politischen und gesellschaftlichen Treibens wie Helmuth von Moltke oder Theodor Wolff zu Wort kommen lässt und deren Standpunkte und Verhalten analysiert. Unterschiedliche Perspektiven ergeben ein Gesamtbild der Motive und führen zu einer detaillierten Darstellung der Ereignisse. Die letzte große Debatte über Deutschlands Rolle im Ersten Weltkrieg führte vor einem halben Jahrhundert der Historiker Fritz Fischer mit seiner These vom planmäßig vorbereiteten deutschen Hegemonialkrieg. Diese endete nicht in einem Grundkonsens, sondern erstarrte. Hoffmanns Buch lädt nicht nur dazu ein, die Debatte noch einmal zu eröffnen, es bietet auch die Chance ein beträchtliches Stück voranzukommen in der Verständigung darüber, was wir über die deutsche Politik in der Julikrise und den Jahren davor wirklich verlässlich wissen. Dieses Buch lädt zum Weiterdenken ein. Mit einer ausführlichen Einführung von Peter Graf von Kielmansegg, Politikwissenschaftler und Prof. em. für politische Wissenschaften der Uni Mannheim, Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 827
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Hoffmann
DER SPRUNG INS DUNKLE
ODER WIE DER 1. WELTKRIEGENTFESSELT WURDE
MILITZKE
Die im Text genannten Zitate, sowie Angaben zu den Quellen finden sich im Anhang nach Seiten geordnet.
Bildverzeichnis
S. 161 Le Matin, 04.01.1914; S. 234 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes
Karten: Europa 1914 und 1920 mit freundlicher Genehmigung von Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH (©westerman 410623).
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Originalausgabe: © Militzke Verlag GmbH, Leipzig 2010, Alle Rechte vorbehalten
Ausgabe eBook: © Militzke Verlag GmbH, Leipzig 2015
Lektorat: Christin Bomann, Julia Lössl, Johanna Müller
Umschlaggestaltung: Ralf Thielicke
Umschlagfoto: © Gary Blakeley / istockphoto
Layout und Satz: Thomas Butsch
ISBN 978-3-86989-974-7 (eBook)
ISBN 978-3-86989-827-6 (Hardcover)
http://www.militzke.de
Würde der Krieg in Europa ausbrechen, so wäre das ein entsetzliches Unglück für jedermann, außer für Japan und die Vereinigten Staaten, und die Nachwelt würde uns alle miteinander als Narren behandeln, wenn es uns nicht gelänge, ihn zu vermeiden.
Theobald von Bethmann Hollweg (Reichskanzler) zu Jules Cambon (Französischer Botschafter in Berlin), Januar 1913
Die deutsche Regierung war weniger kriminell und unendlich viel dümmer als man glaubte.
Alberto Pansa (Italienischer Botschafter in Berlin 1906 bis 1913)
Es wird niemals so viel gelogen wie vor einem Krieg, während einer Wahl und nach einer Jagd.
Otto von Bismarck
Meinen Eltern
Hans und Anna Hoffmann
sowie
Ruth Plainfield
geborene Oppenheimer
und ihrer Generation
Inhalt
Vorwort
Der Untergang des alten Europa
1. KapitelDie Entscheidung
2. KapitelDie Ahnung
3. KapitelDer Plan
4. KapitelDie Antwort
5. KapitelDer Weg
6. KapitelDie Krise
7. KapitelDie Gelegenheit
8. KapitelDer Sprung
9. KapitelDer Krieg
10. KapitelDie Macht
Die Debatte um den Krieg
Forderungen zum Präventivkrieg und Sorgen um Russlands Rüstung (Übersicht)
Anhang
Anmerkungen
Bibliografie
Personenregister
Vorwort
Peter Graf Kielmansegg
Wenn es ein Großthema der Neueren Geschichte gibt, das bis auf den Grund erforscht ist, dann ist es der Ausbruch des Ersten Weltkrieges – sollte man meinen. Wenn es ein Großthema der Neueren Geschichte gibt, an dem sich zeigen lässt, dass die bedeutenden historischen Fragen nie endgültig beantwortet sind, dann ist es der Ausbruch des Ersten Weltkrieges – kann man antworten. Zwei Aussagen, die sich zu widersprechen scheinen und die doch beide richtig sind. Als mir vor zwei Jahren der Autor des nun vorliegenden Buches mit dem sprechenden Bethmann Hollweg-Titel Der Sprung ins Dunkle die Frage stellte, ob ich bereit sei, ein Manuskript zur Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges, an dem er arbeite, zu lesen und zu kommentieren, war ich denn auch neugierig und skeptisch zugleich. Skeptisch, weil die Frage »Gibt es denn noch etwas Neues zu sagen?« sich angesichts der Bibliotheken voller Weltkriegsliteratur aufdrängt. Wohl auch, weil die Wissenschaft dem, der nicht zur Zunft gehört, immer mit einem gewissen Vorbehalt entgegentritt. Neugierig, weil jeder Kenner der Geschichte der Forschungen zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges weiß, dass die Einschätzung, nun sei doch wohl das abschließende Wort gesagt, bisher noch immer getrogen hat. Zudem reizte es mich, noch einmal zu den Anfangsjahren meines wissenschaftlichen Lebens zurückzukehren, in denen der Erste Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ich sagte zu. Und mit dieser Zusage begann ein zweijähriges, teils mündlich, teils schriftlich geführtes Gespräch. Ich habe in keiner Minute bereut, mich darauf eingelassen zu haben. Dieter Hoffmann hat, dessen bin ich mir sicher, ein wichtiges Buch geschrieben; ein Buch, das durchaus das Zeug hat, eine neue Runde in der nicht endenden Diskussion über Deutschlands Rolle in der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges zu eröffnen. Es wäre keineswegs das erste Mal, dass ein Außenseiter (freilich einer, der das Handwerk gelernt hat) einen solchen Anstoß gibt. Und jedenfalls ist es an der Zeit.
Die heftigen Auseinandersetzungen, die Fritz Fischer mit seinen beiden epochemachenden Büchern Griff nach der Weltmacht (1961) und Krieg der Illusionen (1969) auslöste, liegen nun mehr als vier Jahrzehnte zurück. Schlüsselfragen sind damals gleichsam in der Schwebe geblieben. Nach Fischer war es nicht länger möglich, sich auf die alte, bequeme Formel Lloyd Georges zurückzuziehen, man sei in den Krieg hineingeschlittert; will sagen, alle Mächte des europäischen Konzerts hätten ihren Anteil daran gehabt, dass es zur Katastrophe gekommen sei, aber keine habe ihn wirklich gewollt. Fischers Gegenthese freilich, Deutschland habe den Krieg von langer Hand vorbereitet und planmäßig herbeigeführt, um Europa seiner Hegemonialherrschaft zu unterwerfen, hat sich auch nicht durchgesetzt. Die Mängel der Beweisführung, die Verengung der Perspektive waren und sind zu offensichtlich. Was aber ist dann der Stand der Debatte; anspruchsvoller formuliert: der Stand der Erkenntnis? Worüber ist man sich einig, wenn man sich darüber einig ist, dass die deutsche Politik der Vorkriegsjahre nicht mehr ohne Fischer, aber auch nicht nach seiner Anweisung dechiffriert werden kann?
In anderen Ländern, England insbesondere, hat die Wissenschaft das klassische Thema durchaus im Visier behalten, unaufgeregt, so wie es in Deutschland nie hat diskutiert werden können, schon gar nicht im Jahrzehnt der Fischer-Kontroverse. In Deutschland hingegen wandte man sich – gewissermaßen erschöpft von dieser Kontroverse – bevorzugt sozial- oder mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen zu und ließ die Kernfragen der politischen Geschichte und insbesondere der Vorgeschichte des Krieges erst einmal auf sich beruhen.
Nun also gibt es einen neuen Impuls. Dieter Hoffmanns Buch ist die Explikation einer These, einer These, die nicht weniger scharf konturiert, nicht weniger zugespitzt ist, als die Fischers, nach der Quellenlage aber sehr viel plausibler. Dies ist die These: Deutschland hat den Ersten Weltkrieg als einen Präventivkrieg »entfesselt« – so die sehr bewusste Wortwahl des Untertitels. Näherhin: Die hohen Militärs, an ihrer Spitze der Chef des Generalstabes, der jüngere von Moltke, der bei Hoffmann zu einer Schlüsselfigur wird, eindringlich beschrieben als rätselhafte Person, »die den Untergang voraussah und gleichzeitig forderte«, haben Deutschland in den präventiv verstandenen Krieg hineingedrängt, gegen den hinhaltenden Widerstand der politischen Führung, den zu überwinden in der Julikrise schließlich gelang. Ihr Hauptmotiv war die Furcht vor der wachsenden Macht Russlands; genauer: die Sorge, dass Deutschland einen Zweifrontenkrieg nicht mehr erfolgreich werde führen können, sobald Russland sich durch die fortschreitende Vergrößerung seines Heeres und den strategischen Ausbau der Eisenbahnlinien im polnisch-litauischen Grenzraum in die Lage versetzt haben würde, sein volles militärisches Gewicht ohne Verzug in die Waagschale der Entscheidung zu werfen. Dem glaubte man zuvorkommen zu müssen. Soweit die These.
Sie wird ergänzt durch ein zweites argumentatives Leitmotiv: Die politisch-militärische Führung des Reiches habe die deutsche Öffentlichkeit systematisch irregeführt, zuerst in der Julikrise, in der sie Deutschland als Opfer eines Angriffs darstellte, dann im Krieg, in dem sie vom ersten großen Rückschlag in der Marneschlacht an die Wahrheit über Deutschlands militärische Lage konsequent verschwieg. Nur als Ahnungslose, Getäuschte hätten sich die Menschen so willig in den Krieg führen lassen und ihn bis zum bitteren Ende durchgekämpft. Wenn auch in den Mechanismen der Entscheidung nicht förmlich an das Volk gebunden, hätte eben auch eine Nicht-Demokratie wie Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts keinen großen Krieg mehr gegen den Willen des Volkes führen können und musste sich darum die Unterstützung der Massen manipulativ sichern.
Die Präventivkriegsthese ist natürlich nicht völlig neu. Das Stichwort Präventivkrieg ist auch in der älteren Literatur zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs da und dort bereits präsent, gelegentlich wurde es auch schon ins Zentrum gerückt. Aber noch nie, wenn ich recht sehe, ist die verhängnisvolle Rolle, die die Überzeugung, man müsse einer drohenden Gefahr zuvorkommen, auf dem Weg des Wilhelminischen Deutschlands in den Ersten Weltkrieg gespielt hat, so konsequent herausgearbeitet, so dicht und breit aus den Quellen belegt, so schlüssig zur Deutung der deutschen Politik vor allem in der Julikrise selbst, die die alles entscheidende Kapitulation des Reichskanzlers von Bethmann Hollweg vor dem Drängen der Militärs brachte, herangezogen worden. Hoffmann hat tatsächlich ein neues Gesamtbild entworfen, so bekannt (fast) alle Einzelheiten, aus denen es zusammengefügt ist, auch sein mögen. Seine Interpretation des Geschehens wird nun zu diskutieren sein.
Zwei kritische Argumente könnten in dieser Diskussion eine besondere Rolle spielen. Das eine: Geschichtsschreibung, die, um es noch einmal so zu formulieren, als Explikation einer These angelegt ist, zieht leicht den Verdacht auf sich, bei der Sammlung des Beweismaterials für die These könne manches übersehen worden sein, was gegen die These spricht. Auch Hoffmanns Darstellung wird sich fragen lassen müssen, ob sie aus den vielen Zeugnissen, die das militärische Drängen auf einen Präventivkrieg belegen, nicht ein etwas zu stimmiges Bild der Politik des Wilhelminischen Deutschlands in den letzten Vorkriegsjahren zusammenfügt. Verliert nicht das Bild an Eindeutigkeit der Konturen, wenn man die in der Außenpolitik des Reiches einflussreichen politischen Kräfte insgesamt in ihren Worten und in ihrem Handeln ins Auge fasst? Ist nicht gerade das Fehlen einer klaren, entschiedenen außenpolitischen Strategie ein problematisches Charakteristikum der deutschen Politik nach Bismarck? Und sind nicht gerade die beiden führenden Figuren dieser Jahre, der Reichskanzler von Bethmann Hollweg und der Kaiser selbst, Repräsentanten dieser Unentschiedenheit? Das sind notwendige Fragen. Aber man kann ihnen entgegenhalten: Am Ende, in der Julikrise 1914, hat sich, so wenig klar ausgerichtet der politische Kurs bis dahin gewesen sein mag, eben doch das Drängen der Militärs loszuschlagen, solange die Chancen noch einigermaßen günstig stünden, durchgesetzt. Hoffmanns Darstellung, lässt sich dem Einwand entgegenhalten, hat nicht die deutsche Politik zum Gegenstand, sie zeigt, wie es zu diesem Ende kam.
Das zweite kritische Argument: Ist es nicht eine unangemessene Einengung des Untersuchungsfeldes, wenn Hoffmann wieder einmal, von einigen Seitenblicken abgesehen, nur Deutschland ins Visier nimmt? Wird damit nicht eine problematische, wenn auch erklärliche Tradition fortgeführt, eine Tradition der Fixierung auf einen der Beteiligten, die das Ergebnis in gewissem Sinne vorwegnimmt?
Es ist richtig: Die Diskussion über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist von ihren Anfängen an – das hat natürlich mit Versailles zu tun – auf Deutschland fokussiert gewesen; und ist es auf andere Weise auch geblieben, als Versailles kein Thema mehr war. An Fritz Fischers Büchern kann man die Problematik dieser Einseitigkeit studieren. Man kann durchaus einräumen, dass die Deutschland-Fixierung der Forschung und der Publizistik ihre Gründe hat, von denen mindestens einer völlig unanfechtbar ist: Deutschland war, was immer über seine Politik im Übrigen zu sagen sein mag, unter den fünf europäischen Großmächten die, die mit dem berühmten an Österreich-Ungarn ausgestellten »Blankoscheck« vom 5. Juli in der Krise den schlechthin entscheidenden ersten Schritt tat; jenen Schritt, der den Eskalationsprozess in Gang setzte. Aber das ändert nichts daran, dass die Folgen der Asymmetrie der Aufmerksamkeit ungut sind. Bis heute wissen wir viel weniger über die Pariser und die Petersburger Kalküle als über die Berliner; das gilt für die Wochen zwischen dem 28. Juni und dem 1. August 1914, es gilt aber auch für die Jahre vor dem Krieg. Und nehmen, was Deutschland selbst angeht, den Kontext, in dem die Berliner Politik agierte, auf den sie reagierte, oft nicht deutlich genug wahr. Ja gelegentlich gerät aus dem Blick, dass sie überhaupt in einem Kontext agierte.
Was folgt daraus? Natürlich nicht, dass Deutschland erst einmal Anspruch auf eine Art von Schonzeit hätte. Wohl aber, dass jede auf einen einzelnen Krisenakteur, etwa Deutschland, ausgerichtete Studie gut daran tut, den Leser mindestens andeutungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass die krisenhafte Zuspitzung der Lage in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und dann im Juli 1914 nur verstanden werden kann, wenn sie als Sequenz von Interaktionen in einem Machtspiel, an dem fünf Großmächte beteiligt waren, gesehen wird. Niemand, um es sehr banal zu sagen, war da mit sich, seinen Ambitionen und Ängsten allein – Deutschland schon gar nicht. Es gehört zu den Qualitäten von Hoffmanns Darstellung, dass, mag es auch um Deutschland gehen, das Mächtesystem, in das Deutschland eingespannt war, in den Blick kommt. Paris und St. Petersburg sind, wenn natürlich nur am Rande, präsent. Der Autor folgt damit der Logik seiner eigenen Deutung der deutschen Politik. Die These, Deutschland habe im Juli 1914 den Weltkrieg »entfesselt«, weil die Verantwortlichen meinten, einer drohenden Gefahr zuvorkommen zu müssen, führt ja notwendig zu der Frage: War Deutschland denn wirklich bedroht? Und wenn ja, von welcher Art war die Bedrohung? Oder war die wahrgenommene Gefahr nur ein Hirngespinst, die Furcht unbegründet? War sie gar eine Erfindung der Militärs, die ganz anderes im Sinn hatten? Wer vom Motiv, von der Strategie der Prävention spricht, muss auch von der europäischen Mächtekonstellation sprechen.
Hoffmann analysiert die Position Deutschlands in dieser Mächtekonstellation, die Ziele der Gegner Deutschlands, nicht systematisch. Aber doch so weit, dass sichtbar wird: Deutsche Bedrohungsängste hatten einen Bezug zur Wirklichkeit. Zu dem, was sich im russisch-französischen Bündnis tatsächlich tat. Zu der Art auch, in der das Bündnis sich öffentlich darstellte. Es lässt sich nachvollziehen, dass die englisch-russische Marinekonvention vom Frühjahr 1914, die ein englisch-russisches militärisches Zusammenwirken in der Ostsee als möglich erscheinen ließ, als Vollendung einer planmäßigen »Einkreisung« wahrgenommen wurde.
Darauf hinzuweisen, dass Deutschland 1914 – und nicht erst 1914 – in einer Mächtekonstellation agierte, die zur Beunruhigung Anlass geben konnte, heißt natürlich nicht, den Verzweiflungsschritt, so muss man ihn wohl nennen, vom Juli 1914 zu rechtfertigen. Ernsthafte Anzeichen für Angriffsabsichten des gegnerischen Bündnisses gab es 1914 nicht. Und alle Spekulationen über einen zukünftigen Ernstfall, 1916 oder 1917, waren nichts als eben Spekulationen. Auch wenn wir bis heute nicht sicher wissen, welche politisch-strategischen Optionen die Regierungen in Paris und St. Petersburg auf mittlere Frist ins Kalkül zogen: Es steht außer jedem vernünftigen Zweifel, dass der Berliner Entschluss zum »Prävenire« im Juli 1914 (wenn dies denn die zutreffende Deutung ist) ein politisches Hazardspiel war, wie man es sich leichtfertiger und törichter kaum denken kann.
Das ist ebenso ein politisches wie ein moralisches Urteil. Selbst wenn man sich, wozu kein Anlass besteht, auf die Bedrohungsanalyse einließe, die von Bethmanns und von Moltkes Handeln im Juli 1914 bestimmt hat, wäre festzustellen: Sich in einer Mächtekonstellation wiederzufinden, gegen die das eigene Überleben nur noch durch einen hoch riskanten Präventivkrieg gerettet werden kann, bedeutet, politisch auf der ganzen Linie versagt zu haben. In der Tat hat die deutsche Politik am Zustandekommen der Konfiguration von 1914 ja ihren sehr erheblichen Anteil.
So hart und so eindeutig das Urteil ausfällt, anders als für den Krieg, den Hitler ein Vierteljahrhundert später entfesselte, gilt für den Ersten Weltkrieg: Das Deutsche Reich von 1914 war ein Staat unter anderen Staaten seinesgleichen. Es stand nicht außerhalb des Zivilisationshorizontes der Staatengemeinschaft, der es angehörte. In den Motiven, die sein politisches Handeln bestimmten, den Maximen, denen es folgte, den Kriterien der Legitimität, an denen es sich orientierte, unterschied es sich nicht prinzipiell von den anderen europäischen Großmächten seiner Zeit. Keine von ihnen hielt das Kalkül mit dem Krieg für prinzipiell illegitim. Für jede von ihnen hatten bestimmte nationale Interessen Vorrang vor der Bewahrung des Friedens. Man braucht für die Julikrise 1914 die Frage: »Wer wollte den Krieg?«, nur durch die Frage zu ersetzen: »Wer wollte wirklich den Frieden?«, um zu erkennen, wie groß die Verwandtschaft unter den Mächten des europäischen Konzerts war. Einzig England hat, was die Bemühung um die Erhaltung des Friedens angeht, eine gewisse Sonderrolle gespielt, jedenfalls in den kritischen Sommerwochen 1914. Aber auch für England war der Punkt rasch erreicht, an dem das Friedensziel hinter höherrangige Interessen zurücktreten musste.
Wodurch aber unterscheidet sich Deutschland von den übrigen Großmächten, wenn nicht durch die Prinzipien seiner Politik? Gibt es strukturelle Erklärungen für das Verhalten Deutschlands in der kritischen Zuspitzung der Lage im Jahr 1914? Die Antwort könnte lauten: Deutschland unterschied sich von den übrigen Großmächten durch seine Lage in der Mitte des Kontinents, durch seine Stärke, durch seine Verfassung. Das Zusammenspiel dieser drei Faktoren hat seine Krisenpolitik entscheidend bestimmt.
Deutschlands Lage in der Mitte des Kontinents: Geopolitische Argumente hatten in Deutschland eine Zeit lang keinen guten Ruf. Aber es wäre töricht, solcher Stimmungen wegen diesen Faktor zu ignorieren. Deutschland war unter den europäischen Großmächten die einzige, die von zwei anderen potentiell feindlichen Großmächten unmittelbar flankiert wurde. Von 1871 bis 1914 hat das Deutsche Reich die Möglichkeit eines seinen Großmachtstatus bedrohenden Zwei-Fronten-Krieges in jedem Augenblick in Rechnung stellen müssen und politisch wie militärisch auch tatsächlich in Rechnung gestellt. Deutschland hatte dies zu tun, weil es lag, wo es lag, im Schatten einer mindestens potenziellen Gefahr zu leben, die so für keine der anderen Hauptmächte Europas bestand. Es gibt nur wenige Hinweise darauf, dass die anderen Mächte sich Rechenschaft darüber abgelegt hätten, was das bedeutete.
Deutschlands Stärke: Deutschland war militärisch wie wirtschaftlich die stärkste Macht auf dem Kontinent. Es war sich dieser Stärke durchaus bewusst – die Ära Wilhelms II. wurde zur Ära eines vom Kaiser selbst inszenierten, entschieden übersteigerten Selbstbewusstseins. Zumal das Offizierkorps von der Überzeugung geprägt war, Deutschland habe die stärkste und beste Armee der Welt. Das naive Vertrauen in die eigene Unüberwindlichkeit ging bei vielen führenden Militärs, wohl auch beim Kaiser, eine höchst gefährliche Verbindung mit den aus der Mittellage entspringenden Bedrohungsängsten ein. Dieses Gemisch, das sich so in keinem anderen Land zusammenbrauen konnte, hat die deutsche Krisenpolitik maßgeblich bestimmt.
Schließlich Deutschlands Verfassung: Von den fünf Großmächten des europäischen Konzerts wurden 1914 zwei parlamentarisch-demokratisch regiert, zwei waren konstitutionelle Monarchien, eine war eine Autokratie. Die Frage, welchen Einfluss die Verfassungsform auf die Krisenpolitik der fünf Mächte hatte, hat, wenn ich recht sehe, die Geschichtswissenschaft noch nicht systematisch beschäftigt. Es könnte sein, dass die außerordentliche Bedeutung, die der »öffentlichen Meinung« überall zugemessen wurde, konstitutionelle Unterschiede abgeflacht, wenn auch keineswegs eingeebnet hat. Eine Besonderheit Deutschlands bleibt aber in jedem Fall bestehen: die ungewöhnlich einflussreiche Rolle des Militärs.
Weder das Reich noch Preußen kannten einen verfassungsrechtlich abgesicherten Primat der Politik; es lief verfassungsrechtlich auf ein nicht genau definiertes Nebeneinander von politischer und militärischer Sphäre hinaus. Nur der Kaiser hätte einen Primat der Politik gewährleisten können. Aber dem stand die preußische Militärtradition entgegen, zu der gerade Wilhelm II. sich ostentativ, theatralisch bekannte. So konnte in einem Staatswesen, das grundsätzlich allem Militärischen, Soldatischen den ersten Rang einräumte, das labile Verfassungsungleichgewicht leicht in einen Primat des Militärischen umschlagen. In der Julikrise 1914 geschah das – die Politik gab den Weg zur Flucht in eine militärische Lösung frei.
Hoffmanns Beschreibung des deutschen Weges in den Ersten Weltkrieg stellt Personen in den Mittelpunkt – wenige Personen. Sie geht also davon aus, dass im konstitutionellen Deutschland existentielle Entscheidungen in einem sehr kleinen Zirkel der Macht fielen – und stützt sich dementsprechend stark auf persönliche Zeugnisse. Aber in den Mustern der Argumentation, in den Motiven des Handelns dieser Personen scheinen die strukturellen Faktoren, von denen hier die Rede ist, deutlich durch: die Mittellage – eine mit Ängsten explosiv gemischte Hybris bei den wilhelminischen Eliten, zumal den militärischen – die durch die Verfassung vorgegebene Schwäche der Stellung des Reichskanzlers und damit die Schwäche des politischen Argumentes in den entscheidenden Disputen überhaupt. Vor allem der Primat militärischen Denkens tritt auch und gerade in der personenorientierten Darstellung Hoffmanns hervor. Damit knüpft der Autor an Gerhard Ritters großes Alterswerk Staatskunst und Kriegshandwerk an, das in der Verkehrung des Primats der Politik in den Primat des Militärischen, in dem Weg von Bismarck zu Ludendorff, wenn man es in Namen sagen will, das eigentliche Verhängnis des Deutschen Reiches von 1871 sieht. In den sechziger Jahren beherrschte Fritz Fischer die Bühne. Gerhard Ritter kam zwar als Fischer-Kritiker zu Wort, fand aber mit Staatskunst und Kriegshandwerk – die einschlägigen Bände erschienen 1954 und 1968 – nicht die Beachtung, die das Werk verdient hätte. Es wäre gut, wenn Dieter Hoffmanns These auch Gerhard Ritter wieder ins Gespräch brächte.
Dieter Hoffmanns Buch stellt ein altes Thema neu zur Diskussion. Es führt vor Augen, wie fruchtbar es sein kann bekannte Quellen – ganz überwiegend arbeitet Hoffmann ja mit veröffentlichtem Material – neu durchzumustern. Die letzte große Debatte über Deutschlands Anteil an der Verantwortung für den Ersten Weltkrieg, die vor einem halben Jahrhundert Fritz Fischers These vom planmäßig vorbereiteten deutschen Hegemonialkrieg zum Gegenstand hatte, endete nicht in einem Grundkonsens auf einem neuen Niveau der Erkenntnis, sondern eher in erstarrenden Fronten. Hoffmanns Buch lädt nicht nur dazu ein, die Debatte noch einmal zu eröffnen, ohne die Hitzigkeiten und Erbitterungen der sechziger Jahre, es bietet auch die Chance auf dem neuen Diskussionsplateau in der Verständigung darüber, was wir über die deutsche Politik in der Julikrise und den Jahren davor wirklich verlässlich wissen, ein beträchtliches Stück weiterzukommen. Wenn die Faktenfrage, wer was aus welchen Gründen getan hat, nicht mehr im Zentrum steht, weil sie beantwortet ist, könnten andere, analytische Fragen in den Vordergrund treten. Zwei seien noch genannt, um anzudeuten, dass dieses Buch zum Weiterdenken einlädt.
Da ist zum einen das Thema der Wechselwirkung zwischen System und Akteur. Das europäische Mächtesystem des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war als solches kriegsgeneigt: 1. durch seine Machtgeografie, die sich 1871 radikal verändert hatte – nicht mehr die schwächste Macht des Konzerts, Preußen, sondern die stärkste, das neue Deutsche Reich, hatte nun die kritische Mittelposition inne; 2. durch seine politische Struktur – zwei Bündnisse standen sich feindlich gegenüber, von denen jedes in sich und beide in Wechselwirkung im Krisenfall eher eskalierend als bremsend wirken mussten und im Juli 1914 ja auch gewirkt haben – tatsächlich hat jede Macht ihre Bündnisverpflichtungen und ihre Bündnisinteressen konfliktverschärfend ausgelegt; 3. durch politische Instabilität im Innern der Staaten – die Donaumonarchie war in ihrem Bestand bedroht und über Russland lag seit 1905 der Schatten der drohenden Revolution; 4. durch die ganz unumstrittene Geltung von Maximen politischen Handelns, die den Krieg als legitimes Mittel der Politik voraussetzten; 5. schließlich durch eine politische Kultur extremer nationaler Egozentrik bei gleichzeitiger nationalistisch eingefärbter Heroisierung kriegerischen Handelns. Ein kriegsgeneigtes Mächtesystem, um es noch einmal zu sagen, das aber das Verhalten der Staaten nicht determinierte, sondern nur konditionierte. Wie wirkten die systemischen Bedingungen auf die verschiedenen Akteure, die unterschiedlich positionierten, unterschiedlich verfassten, unterschiedliche Interessen verfolgenden Mächte des europäischen Konzerts ein? Darum geht es.
Eine andere Frage: Ist die Unterscheidung zwischen offensiver und defensiver Kriegsmotivation möglich und sinnvoll? Ein von den Mittelmächten gewonnener europäischer Krieg hätte notwendigerweise eine kontinentale Hegemonie Deutschlands zur Folge gehabt. Wenn aber auch der um der Selbstbehauptung willen begonnene Präventivkrieg unvermeidlich zum Hegemonialkrieg werden musste, wozu dann noch das eine vom andern unterscheiden? Andererseits: Wie können wir den Handelnden gerecht werden, wenn wir die Unterscheidung zwischen Motiven und Folgen des Handelns aufgeben?
Zu bedenken ist dabei auch, dass nicht Staaten Motive haben, sondern Menschen, die für Staaten handeln. Und wenn es mehrere sind, die eine Entscheidung gemeinsam treffen und zu verantworten haben, müssen ihre Gründe keineswegs die gleichen sein. Der »Alptraum Russland« hat nach den Zeugnissen, die wir haben, bei Bethmann Hollweg und Moltke wohl tatsächlich die Entscheidung bestimmt; er muss deshalb im inneren Zirkel der Macht in Berlin aber nicht das einzige starke Motiv gewesen sein.
Fragen, die über die alten Dispute hinausweisen. Von ihnen gibt es mehr. Aber die Debatte, die Hoffmanns Buch hoffentlich auslösen wird, ist ja nicht in diesem Vorwort zu führen. Das Vorwort soll vor allem neugierig machen, soll dem Leser sagen: Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich.
Der Untergang des alten Europa
Dieser Krieg veränderte den Kontinent und das Leben seiner Bewohner, und er betraf alle Länder Europas. Selbst die Unbeteiligten litten unter dem Zusammenbruch von Handel und Politik. Der Kampf war länger und härter, als es sich die meisten Menschen hatten vorstellen können. Die Anstrengungen, ihn zu bestehen, wirkten so tiefgreifend, dass jede einzelne Krieg führende Nation einen grundlegenden Wandel durchmachte – politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, mental. Selten war dieser Satz in solchem Maße zutreffend wie nach der Selbstzerfleischung Europas: Die Welt war eine andere geworden. Die europäische Ordnung, die jahrhundertelang bestanden hatte, löste sich auf. Die über einen sehr langen Zeitraum aufgebaute globale Stellung des Kontinents ging verloren. Dessen Bewohner erlebten erstmals, dass seine Staaten nicht mehr in der Lage waren, die eigenen Probleme zu lösen. Der Niedergang des einst stolzen Erdteils, der 1914 begann, bestimmte den Verlauf des 20. Jahrhunderts.
Der Erste Weltkrieg stellte die Weichen für unser Land und unseren ganzen Kontinent. Er bedeutete nie erlebte Zerstörung, zertrümmerte einen für stark und stabil gehaltenen Staat und beendete Deutschlands Stellung als unbestrittene Vormacht in Mitteleuropa. Er führte dazu, dass an die Stelle einer von den meisten Menschen erwarteten Zukunft des weiteren Fortschritts und Wohlergehens eine der Gewalt und des Wahnsinns trat. Das Jahr 1914 stand für den Beginn einer Zeit, die Europa nicht nur den Verlust seiner Macht, sondern auch seiner Selbstbestimmung brachte. Dies führte soweit, dass über die Geschicke des Kontinents schließlich in Hauptstädten bestimmt wurde, die außerhalb und an seinem Rand lagen. Wer hätte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts für möglich gehalten, dass die Hauptfragen Europas in Washington und Moskau entschieden würden? Was Generationen geschaffen hatten, wurde in wenigen Jahren zerschlagen, und dies nicht nur in materieller Hinsicht. Der Entschluss, den Krieg zu wagen, zermalmte das Leben vieler Millionen Europäer. Dies galt natürlich in erster Linie für die Soldaten, die an die Front geschickt wurden und fielen oder als Krüppel zurückkamen. Doch es betraf ebenso die Lebenspläne einer ganzen Generation, die in Armut abglitt und sich Chaos und Verwirrung ausgesetzt sah, wie sie seit Jahrhunderten nicht mehr geherrscht hatten. Europa hatte besser dagestanden als jemals zuvor bis sein für unmöglich gehaltener Absturz begann.
Dennoch war vielen Zeitgenossen im Voraus bewusst, wie verheerend ein Krieg der modernen Staaten werden musste. Friedrich Engels machte bereits im Jahr 1887 eine Vorhersage, die sich vollständig erfüllen sollte. Es sei »kein anderer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich«, erkannte der in Militärfragen kundige Philosoph im Hinblick auf die Lage des Landes als Großmacht zwischen den europäischen Mächten, »als ein Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie gekannten Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen«. Zu den Folgen eines solchen Konflikts sah Engels voraus: »Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, allgemeine, durch akute Not hervorgerufene Verwilderung der Heere wie der Volksmassen; rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Getriebes in Handel, Industrie und Kredit, endend im allgemeinen Bankrott; Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer traditionellen Staatsweisheit derart, daß die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sich findet, der sie aufhebt; absolute Unmöglichkeit, vorherzusehen, wie das alles enden und wer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird.«
Der Ausbruch dieses Krieges hat die Schicksale von Individuen und ganzen Völkern in einem Maße beeinflusst wie nur wenige Entscheidungen, die Menschen trafen. Schätzungsweise zehn Millionen Soldaten starben, die Zahl der zivilen Opfer ging allein in Deutschland in die Hunderttausende. Der Krieg bedeutete nicht nur den Verlust von Millionen Menschenleben, nahezu die Auslöschung einer Generation, menschliches und materielles Elend und den Ruin bis 1914 blühender Volkswirtschaften, sondern zog auch Hass und Gewalt nach sich, wie sie zuvor in Europa nur in der Krisenregion des Balkan bekannt waren. Ohne diesen Konflikt hätte es die Umbrüche nicht gegeben, die Hitler zur Schreckensherrschaft brachten, hätte Lenin keine Gelegenheit zur Revolution bekommen, wäre den Völkern Russlands der Terror Stalins erspart geblieben. Der Erste Weltkrieg ist der Ausgangspunkt des Übels, das Europa im 20. Jahrhundert erlebte, was die damals Handelnden natürlich nicht wissen konnten und dennoch manche ahnten. Viele befürchteten, dass die Auslösung eines europäischen Krieges unabsehbare Folgen hätte. Der Konflikt traf nicht nur die europäische Zivilisation, er war auch ökonomisch unsinnig. Die Zerstörung, die er in Handel und Wirtschaft verursachte, zeigt seine Wirkung auf den damals bestehenden Grad der Verflechtung zwischen den Nationen. Vor seinem Ausbruch betrug der Anteil des Außenhandels ein Drittel des deutschen Volkseinkommens. Dieser Wert wurde erst ein halbes Jahrhundert später wieder von der Bundesrepublik erreicht. Der Krieg war katastrophal, weil er die großen Handelsnationen schwer schädigte und fast die gesamten ökonomischen Verbindungen zerstörte, die Europa überzogen – und die seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 erst wieder das Ausmaß erreichen können, das bis 1914 bestanden hatte. Albert Ballin, der von Anfang an beobachtete, wie der Weltkrieg die gesamte Volkswirtschaft, die Existenzen der einfachen Leute und die von ihm aufgebaute Schifffahrtslinie Hapag ruinierte, fasste diese schmerzliche Einsicht in den Worten zusammen, »daß man in diesem dümmsten Kriege, den die Weltgeschichte je gesehen hat, die erfahrenen Kaufleute so wenig beachtete«. Damit sprach der Reeder eine der Ursachen an in einer von militärischem Denken geprägten Welt.
Friedrich Engels war bei Weitem nicht der Einzige, dem mit großer Klarheit die Folgen einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Nationen Europas vor Augen standen. Ähnlich dachten Reichskanzler Otto von Bismarck und Ge neral stabschef Helmuth von Moltke, die vor der Unberechenbarkeit eines europäischen Konflikts warnten. Kurz nachdem Engels jene Prophezeiung niedergeschrieben hatte, hielt der Reichsgründer eine Rede, in der er sich ganz ähnlich äußerte. Im Februar 1888 erklärte Bismarck vor dem Reichstag, es dürfe nicht geschehen wegen eines »Ländchens« wie Bulgarien, »Europa von Moskau bis an die Pyrenäen und von der Nordsee bis Palermo hin in einen Krieg zu stürzen«. Offenbar hielt der Staatsmann einen solchen Konflikt nicht für begrenzbar, was sich zeigen sollte, als er wegen eines anderen kleinen Staates auf dem Balkan begann. Auf seine Feststellung, »man würde am Ende nach dem Kriege kaum mehr wissen, warum man sich geschlagen hat«, reagierten laut Protokoll des Parlaments die Abgeordneten mit »Heiterkeit«. Die war jedem vergangen, als der gut ein Vierteljahrhundert später ausgebrochene Krieg dies ebenso bestätigte wie Engels’ Vorhersage zu den Folgen. Auch 1914, als es soweit war, erwartete der britische Außenminister Sir Edward Grey eine unbeschreibliche Katastrophe, der deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg die Umstürzung der bekannten Welt und Generalstabschef Helmuth von Moltke, ein Neffe seines gleichnamigen Vorgängers, gar das Ende der europäischen Kultur. Es gab wenig Illusionen, wohin der Krieg führen würde. Dennoch begann er.
Doch ließ sich ein Krieg nicht mehr so herbeiführen wie in den Verhältnissen des Feudalismus, als der Entschluss eines Monarchen genügt hatte. Die moderne Welt hatte sich bereits so weit entwickelt, dass der Macht einige Beschränkungen auferlegt worden waren. Es war mit einer kritischen Öffentlichkeit zu rechnen, mit unabhängigen Zeitungen, freien Parteien und einer starken Arbeiterbewegung sowie einem Parlament, das auf jeden Fall die Möglichkeit besaß, Fragen zu stellen. Keiner dieser Faktoren war 1914 imstande, den Weg in den Krieg zu blockieren oder auch nur in Zweifel zu ziehen. Das Gewicht der öffentlichen Meinung und deren Beeinflussung zeigte bereits eine der großen literarischen Auseinandersetzungen mit den Ereignissen. Deren Absurdität enthüllte Karl Kraus in seinem Drama Die letzten Tage der Menschheit. Bereits in der ersten Szene ließ er zwei Reporter auftreten, die »dem Publikum Appetit machen auf den Krieg«. Die Presse trug dazu bei, dass das Verrückte nicht nur als notwendig, sondern als normal hingenommen wurde.
Die Gründe, die für den Konflikt genannt wurden und die Art und Weise, wie er begann, ähneln dem, was immer wieder zu beobachten ist. Dabei ist eines gewiss: In keinem der Staaten, die im letzten Sommer des alten Europa den Krieg begannen, gab es dafür eine Mehrheit in der Öffentlichkeit. Die Frage, wie der Konflikt entstand, hängt zusammen mit der, wie die Völker von seiner Notwendigkeit überzeugt wurden. Alle Nationen gingen in diesen Kampf im Glauben, sich verteidigen zu müssen – in den Worten des Lehrers in Kraus’ Theaterstück hatte sich sein Monarch genötigt gesehen, »einen mutwillig heraufbeschworenen Verteidigungskrieg zu beginnen«. Offenbar ging dieser von den Staatsleitungen aus, die sich als nicht fähig oder nicht willens erwiesen, die große europäische Katastrophe, die viele voraussahen, zu vermeiden. Nicht nur das, er wurde weitergeführt und auf seinem Höhepunkt vollends zum Weltkrieg ausgeweitet. Es gelang nicht, den Konflikt zu beenden, obwohl sein Andauern alle Beteiligten, ob Nationen oder Individuen, immer tiefer in den Abgrund trieb und die Schäden wie der Hass unaufhörlich anwuchsen. Schließlich gelang es auch nicht, nach der Entscheidung einen allseits akzeptierten Frieden zu schaffen, wie dies die europäische Diplomatie jahrhundertelang geleistet hatte. Es ist keine Übertreibung, dass der Erste Weltkrieg die Zukunft unseres Kontinents und die seiner Bewohner ruinierte.
Die Auswirkungen des ersten großen Krieges in der modernen Zeit sind noch heute vielfach zu spüren. Er beendete die Herrschaft monarchisch regierter Großmächte und schuf ein Machtvakuum, das zwischen den neu entstandenen Staaten wie auch in deren Innerem zu Instabilität führte. Dies bereitete den Grund für die nachfolgenden, noch größeren Katastrophen. In besonderem Maße galt dies für das besiegte Deutschland, wo Gewalt und Hass, Enttäuschung und der Traum von verspielter Größe eine Unheil bergende Mischung eingingen. Zwischen den europäischen Völkern schuf der große Krieg ein Maß an Misstrauen, dessen Spuren noch immer zu beobachten sind. Selbst seriöse Fachleute können in unseren Tagen noch zu Urteilen kommen wie das eines britischen Historikers über die Wirkung der von August 1914 bis Juli 1919 bestehenden Blockade der Alliierten auf die Zivilbevölkerung des Gegners. Die »offizielle britische Geschichtsschreibung« ordne »772 736 Tote in Deutschland der Blockade während des Krieges zu«, was etwa den Verlusten an britischen Soldaten entspreche. Doch dann folgt die Erklärung, die Deutschen »litten in der Tat auch deshalb Hunger, weil sie aus der Vorkriegszeit an abwechslungsreiche Nahrung mit viel Fett und Fleisch gewöhnt waren und mindestens fünfzehn Prozent mehr Kalorien zu sich nahmen als medizinisch notwendig«. Dem Verfasser dieser Zeilen dürfte selbst entgangen sein, wie seltsam diese Erläuterung zur Wirkung der fünf Jahre lang aufrechterhaltenen Blockade eines ganzen Landes anmutet. Doch wäre ihm im Hinblick auf die eigene Nation vermutlich kaum in den Sinn gekommen, eine solche Zahl von Toten durch Unterernährung auf deren Wohlleben vor Beginn des Krieges zurückzuführen. Auch in dieser nüchternen, 90 Jahre nach jenem Krieg entstandenen Darstellung schimmert noch, ohne jeden Zweifel unbeabsichtigt, die einstmals vorhandene Frontstellung durch.
Der Erste Weltkrieg war der Auftakt zum 20. Jahrhundert, das als bisher blutigstes in die Geschichte der gesamten Menschheit eingegangen ist. Wohl für jede Generation wird es eine Frage sein, wie es im scheinbar so friedlichen Europa des Jahres 1914 soweit kommen konnte.
Eines ist vorauszuschicken: Dies ist keine Geschichte des Ersten Weltkrieges; dazu gibt es eine Reihe von Darstellungen, sowohl wegweisende ältere als auch empfehlenswerte neuere, wie sie grundlegend für dieses Buch waren. Es geht um die Entstehung jenes Konflikts. Da er von Menschen gemacht wurde und nicht wie eine Naturkatastrophe über sie hereinbrach, auch wenn sich die meisten Europäer ihm auf eine ähnliche Weise ausgeliefert sahen, geht es um die Entscheidungen, die ihn herbeiführten. Es wird die Frage zu verfolgen sein, wie dieser Konflikt beginnen konnte, obwohl Kabinettskriege nicht mehr möglich schienen. Welche Entscheidungen lagen dem zugrunde? Welche Personen hatten daran Anteil? Im Fokus stehen die beiden deutschsprachigen Hauptstädte, weil dort die wichtigsten Schritte gemacht wurden, die den Krieg herbeiführten – von Österreich-Ungarns Ultimatum an Serbien bis zu den Kriegserklärungen. Doch ist zu berücksichtigen, welche Lage 1914 in Europa herrschte. Sind Entwicklungen feststellbar, die eine gewaltsame Auseinandersetzung förderten? Lässt sich nachweisen, dass dies einen Einfluss auf die Entscheidungen hatte, die zum Konflikt führten? Welche Motive lassen sich erkennen, die Differenzen zwischen den Mächten nicht mehr mit friedlichen Mitteln beizulegen?
Den Rahmen für die Schritte, die den Krieg näher brachten, setzten das Staatensystem und die Außenpolitik. Auf beides wird einzugehen sein, soweit es zum Verständnis des Handelns und Unterlassens der Regierungen erforderlich ist. Doch kann hier keine Geschichte dieser beiden Themenkomplexe gegeben werden. Es wäre eine äußerst wichtige Aufgabe, übergreifend die Verhältnisse in der europäischen Politik und Diplomatie aufzuzeigen, die alle Entscheidungen von 1914 und der darauffolgenden Jahre trugen. Dafür wären Recherchen in den Hauptstädten der Bündnisse erforderlich, die damals den Kampf gegeneinander aufnahmen, in Paris, St. Petersburg und London wie in Berlin und Wien. Doch die Weichen wurden in Berlin gestellt, wie sich zeigen wird. Wien sicherte sich die Unterstützung der Regierung Wilhelms II., bevor der Weg der Konfrontation beschritten wurde. Wenn es um Beschlüsse geht, die getroffen und durchgesetzt wurden, so ist die zentrale Frage die nach der Macht – wie wurde sie ausgeübt, welche Einflüsse lassen sich in der Staatsführung erkennen? Gab es Diskussionen oder gar Auseinandersetzungen zwischen den Verantwortlichen, welche Linie zu verfolgen sei? Nicht nur die Verteilung der Macht, auch ihre Kontrolle gilt es im Auge zu behalten, wie und ob sie funktionierte. Nicht aus Zufall bauen parlamentarische Systeme Hürden auf für den Entschluss, ein Land in einen Krieg zu führen. Auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Staatsgewalten ist von großer Bedeutung; Rivalitäten und Machtverteilung lassen sich zum Teil aus neuen, oft auch aus bekannten Dokumenten erschließen, wenn diese daraufhin analysiert werden. Es wird auch auf Vorstellungen und Ziele der einflussreichen Personen einzugehen sein, die besonders in der deutschen Führung allzu oft die Form von Illusionen annahmen. Über diese Frage ließe sich ein eigenes Buch schreiben, zumal das Mittel der Irreführung von den Handelnden auch untereinander eingesetzt wurde. Die Staatsleitung unter Wilhelm II. war viel weniger monolithisch als sie sich nach außen zeigte und heute noch in manchen Darstellungen erscheint. Man kann sich im Gegenteil kaum eine zerklüftetere, stärker von Gegensätzen und Widersprüchen geprägte Führung vorstellen als die unter dem letzten Kaiser des Hauses Hohenzollern, in der, um dies vorwegzunehmen, manche Bereiche nur nebeneinanderher arbeiteten, wie etwa der zivile und der militärische.
Große Bedeutung für die Darstellung des Geschehens hat die Öffentlichkeit. Es ist zu fragen, ob den Anfang des 20. Jahrhunderts Herrschenden deren Gewicht bewusst war und welche Mühe sie auf ihre Beeinflussung verwendeten. Welches Bild besaßen die führenden Personen von der Rolle der Bevölkerung? Gab es ein Kalkül, mit der öffentlichen Meinung zu arbeiten? Wenn es zutrifft, dass zumindest Teile der Staatsführungen in Berlin und Wien sich für einen Krieg entschieden, so erscheint es wahrscheinlich, dass ihrer gewachsenen Bedeutung Rechnung getragen wurde. Auch hier ist die Frage, ob sich dies in den Quellen zeigt und es vielleicht sogar Überlegungen und Handlungen gab, die darauf abzielten, getroffene Entschlüsse in der Bevölkerung durchzusetzen. Das Spiel mit der Öffentlichkeit kann unter zwei Voraussetzungen ablaufen. Zum einen gibt es die kalkulierte Manipulation, die kühl mit einer bestimmten Absicht verfolgt wird, zum anderen die Selbsttäuschung, die sich auf die allgemeine Wahrnehmung überträgt. Beides war bei Ausbruch und im Verlauf des Krieges zu beobachten, und es trug dazu bei, dass nur wenige der damals Lebenden illusionslos auf eine Wirklichkeit blickten, die für Deutschland von Beginn an einer Belagerung durch eine übermächtige Koalition gleichkam. Was den Einsatz der öffentlichen Meinung und deren Beeinflussung betrifft, erwies sich der feudal geprägte Regierungsapparat als modern und effizient.
Die Entfesselung des Krieges zeigt sich in den Ereignissen des Jahres 1914 wie in der damals verfolgten Politik. Sie machte aber hier nicht halt, da die Regierung des Reiches zweieinhalb Jahre später die Entscheidung traf, den Konflikt auszuweiten und seine endgültige Verwandlung zum Weltkrieg in Kauf zu nehmen. Deshalb wird die Frage, wie die Politik damit umging, auch im weiteren Verlauf zu verfolgen sein – zumal vieles, was im Jahr 1914 und zuvor zu beobachten ist, sich in der Folge wiederholte und manchmal steigerte. Dieser Teil der Darstellung ist eine Ergänzung zur Herbeiführung des Konflikts und erhebt nicht den Anspruch auf eine Schilderung der Ereignisse und Abläufe während des Krieges – dies leisten die bereits genannten Werke.
Es bleibt noch eine Frage: Wieso diese Darstellung entstanden ist, obwohl die Literatur zum Ersten Weltkrieg Bibliotheken füllt? Die Antwort ist einfach: Die Erklärungsmuster zum Beginn des Großen Krieges, wie er noch heute in England und besonders in Frankreich heißt, erschienen unbefriedigend (die dazu geführten Diskussionen sind am Schluss genannt). Die These vom »Hineinschlittern« in einen Konflikt dieser Dimension, wonach keine der Regierungen den Krieg gewollt, dieser irgendwie dennoch begonnen habe, war stets fragwürdig. Dies zeigt schon seine Fortführung trotz aller sich bald auftürmenden Verluste und Schäden – in der gesamten Weltgeschichte ist wohl kein Krieg bekannt, der wie ein Unfall begonnen hätte, um dann jahrelang fortgesetzt zu werden bis fast alle Kriegführenden an den Rand des Zusammenbruchs gerieten. Aber auch die seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts dem entgegengesetzte These erschien unbefriedigend: Die deutsche Staatsführung habe einen Krieg um die Hegemonie, wenn nicht um die Weltherrschaft, begonnen und gezielt vorbereitet. Wie passt dies zu den Widersprüchen innerhalb der Führung oder auch zu den stark schwankenden Meinungsäußerungen Wilhelms II., den manche – auch im Ausland – als kriegslüstern, andere als Friedensfreund sahen? Auch wird sich zeigen, dass das Deutsche Reich 1914 lange nicht so gut auf einen Krieg vorbereitet war wie es möglich gewesen und anzunehmen wäre, hätte dessen Leitung den Konflikt zielstrebig geplant. Vieles spricht jedoch für eine ausgeprägte Kriegsbereitschaft und auch aus diesem Grund erschien eine dritte Theorie bedenkenswert, die aber in der Öffentlichkeit bisher wenig Beachtung fand: Deutschland und Österreich-Ungarn hätten den Krieg aus präventiven Gründen begonnen. Dazu gibt es allerdings bis heute keine Monographie. Auch deshalb schien es an der Zeit, die bekannten Dokumente auf diese These hin systematisch zu untersuchen – zumal manche neuen Quellen hinzugekommen sind, teilweise in den letzten Jahrzehnten publizierte, teilweise auch kaum bekannte oder unbekannte. Zu fragen ist also, ob solche Erwägungen im Jahr 1914 und zuvor zu beobachten sind und ob sie eine Bedeutung hatten. Dies würde heißen, dass die potenziellen Gegner und deren Pläne oder Absichten einen wahrnehmbaren Einfluss auf die Entscheidung für einen Krieg ausgeübt hätten. Doch wird gerade das Motiv »Präventivkrieg« wohl öfter als jedes andere eingesetzt, um einen Konflikt zu begründen. Deshalb wird es sehr kritisch zu bewerten und zu fragen sein, in welchem Maße die Machtfrage und das Hegemoniestreben nicht doch einen Einfluss besaßen. Zu bedenken ist die Verbindung beider Begründungen, das heißt, ob vielleicht ein Gemisch aus offensiven und defensiven Gründen eine Rolle gespielt hat.
Eines wiederholt sich, und dies gilt auch für den Krieg, der hier im Mittelpunkt steht: Sehr viel Mühe wird darauf verwendet, einen Grund oder Anlass zu finden und die Notwendigkeit einer militärischen Lösung zu beweisen. Nur selten wird dagegen vor Auslösung eines Konflikts darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten sich abzeichnen können, ihn wieder zu beenden. Ein Krieg verläuft selten so wie diejenigen es erwarten, die ihn begannen. Die Verlockung ist groß, dies zu verschweigen und ein geschöntes Bild von der Lage zu zeigen, zumal der Erfolg der Mächtigen und deren Stellung sich mit dem Ausgang eines Krieges verknüpft. Dabei wird meist das weitergeführt, was zu Beginn einer Auseinandersetzung zu deren Begründung genannt wurde. Dies ist auch von 1914 bis 1918 zu beobachten. Doch kann es leicht zu fundamentalen Widersprüchen mit den Interessen einer Nation und ihrer Individuen kommen, deren Geschicke ein Krieg auf stärkere und radikalere Weise bestimmt als irgendein anderes Ereignis. Dies gilt in besonderem Maße, wenn er nicht erfolgreich verläuft. Staatsführer, die dann in der Lage sind, einen selbst herbeigeführten Konflikt beizulegen, sind jedoch eine verschwindende Minderheit. In den meisten Fällen ist ein Regierungswechsel oder öffentlicher Druck oder beides zusammen erforderlich. Es ist stets die Gefahr vorhanden, dass ein unglücklicher Krieg gegenüber einer uninformierten Öffentlichkeit immer weitergeführt oder sogar intensiviert wird bis keine Auswege nichtmilitärischer Art mehr bestehen.
Mein Dank geht an Professor Peter Graf Kielmansegg, der mit stets fundierter und fruchtbarer Kritik so manchen Punkt in Frage stellte. Ebenso an Julia Lössl und den Militzke Verlag, die sich an der Entstehung des Werkes mit einem sehr sorgfältigen und anregenden Lektorat beteiligten. Die Vorgenannten trugen zum wichtigsten Moment bei, der die Arbeit an einem solchen Buch ausmacht, wofür man selbst aber nicht immer den Blick hat: Noch einmal nachzudenken und tiefer zu schürfen. Bessere und kompetentere Kritik kann sich kein Autor wünschen – wie auch das profunde Vorwort andeutet, das viele Fragestellungen aufzeigt und zur Weiterarbeit an diesem unerschöpflichen Thema einlädt. Professor Gerd Krumeich (Universität Düsseldorf) danke ich für den Hinweis auf das deutsche Ultimatum an Russland und Professor Michael Kißener (Universität Mainz) für seine Ermunterung. Walter Heeb hat in vielen Gesprächen dazu beigetragen, die Ereignisse zu durchdenken und auf eine (hoffentlich) verständliche Weise zur Darstellung zu bringen. Ihm gilt ebenso mein Dank wie seiner Frau Ilona, die Geduld mit unseren Diskussionen hatte. Maria Prieß hat manche Passagen kritisch auf Sprache und Verständlichkeit durchgesehen – ihre Kritik wirkte sich beim Verfassen des ganzen Textes aus. Gala half mit ihrem Interesse und so manchem Gespräch und nicht zuletzt mit ihrem Blick auf eines der damals beteiligten Länder. Ebenso danke ich der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz und ihren Mitarbeitern. Dort ist ein erstaunlicher Bestand an Büchern aus jener Zeit vorhanden; was fehlte, wurde ebenso unkompliziert wie zügig beschafft. Stets zuvorkommend waren ebenso die Mitarbeiter des Bundesarchivs in Koblenz, des Militärarchivs in Freiburg, des Politischen Archivs des Auswärtigen Amts in Berlin sowie des Kriegsarchivs in München. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.
Für die interessierten Leser steht am Ende eine Zusammenfassung der Literatur und der Quellenlage zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
1. Kapitel
Die Entscheidung
Dem jungen Offizier, der in das Arbeitszimmer des Chefs der deutschen Streitkräfte eintrat, bot sich ein unauslöschlicher Anblick. Es waren die Tage des großen Kampfes, dessen Ausgang auf das Gelingen des Feldzugs unabsehbare Auswirkungen hatte; ja die Zukunft der ganzen Nation stand auf dem Spiel. Viel hing von der geschickten Führung der vormarschierenden Armeen ab, die seit Wochen mit französischen, britischen und belgischen Truppen in erbittertem Kampf standen. Die Anstrengungen wirksam abzustimmen war die wichtigste Aufgabe des Generalobersten Helmuth von Moltke, dem sich der Offizier gegenübersah: »Er war entsetzt über das Aussehen des Chefs des Generalstabes, der, als er bei ihm eintrat, gebrochen an seinem Tisch saß, das Gesicht in beide Hände vergraben. Als er aufblickte, sah der Besucher in ein bleiches, von Tränen überströmtes Antlitz.« Dieses Bild, das den Zusammenbruch der in jenen Tagen entscheidenden Person auf deutscher Seite zeigte, wurde überliefert von Bernhard Fürst von Bülow, dem früheren Reichskanzler. Er hatte von Moltke gut gekannt; wie er berichtet, ereignete sich die Szene Anfang September 1914. Sie muss sich zugetragen haben bevor die Schlacht entschieden war, vielleicht auch als sie gerade ihrem Höhepunkt zustrebte.
Der 9. September 1914 war ein strahlender Sonnentag. Einer von vielen in jenem Sommer, als Europa seine Zerstörung begann. Seit der Mobilmachung am 2. August war es der 39. Tag – nach der Planung des deutschen Generalstabs sollte Frankreich nach 40 Tagen geschlagen sein. Fast auf den Tag genau hatten die Militärs vorausberechnet, wann die Entscheidung eintreten sollte. Am 6. September starteten die Alliierten einen Versuch, den desaströsen Verlauf des Krieges umzukehren. Wochenlang waren sie von den Deutschen vor sich hergetrieben worden, hatten einige Gefechte gewonnen und mehrere Schlachten verloren. Ihr Rückzug führte sie von Belgien durch die weiten Hügel Nordfrankreichs bis vor die Tore von Paris; der Feind stand bereits südlich der Marne. Der Rückzug war deprimierend und gefährlich, doch fast alle Angriffe endeten in verlustreichen Niederlagen. So hatte die französische 2. Armee bei Mörchingen (Morhange) versucht, in die damals deutschen Teile Lothringens vorzustoßen und eine schwere Niederlage erlitten, die allein am 20. August 7 000 Tote forderte; die Zahl der Verwundeten betrug das Doppelte. Dieselbe Armee stellte sich vor Nancy erneut auf, um die Stadt gegen den Ansturm der Deutschen zu verteidigen. Frankreichs Offensive war an seinen Grenzen gescheitert, die Zahl der Gefallenen zwischen dem 20. und 23. August wird auf 40 000 geschätzt, 27 000 davon am 22., » unserer Geschichte«. Die Unmenschlichkeit dieses Krieges zeigte sich schon in den ersten Aufeinandertreffen, und auch die vormarschierenden Deutschen erlitten große Verluste.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!