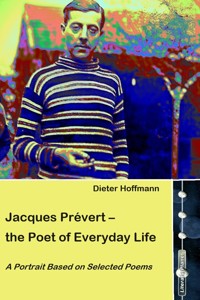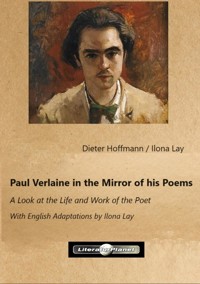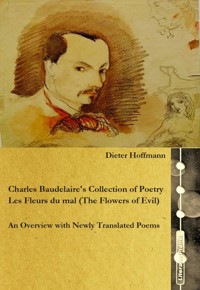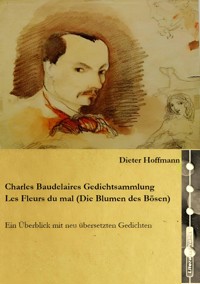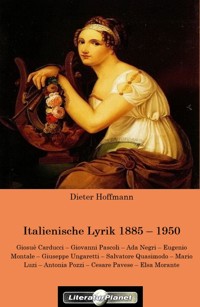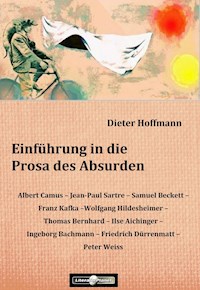4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: LiteraturPlanet
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
In Thomas Bernhards Prosa ist das Absurde nicht nur existenziell, sondern auch sozial bestimmt. Es ergibt sich gleichermaßen aus dem Zum-Tode-Sein des Menschen wie aus der menschlichen Neigung, für andere "der Tod zu sein". Dies verleiht seinem Werk eine besondere Aktualität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dieter Hoffmann:
Die Welt als Schlachthaus
Thomas Bernhards Prosa des Absurden
Literaturplanet
Impressum
© LiteraturPlanet, 2024
Im Borresch 14
66606 St. Wendel
http://www.literaturplanet.de
Über dieses Buch:
In Thomas Bernhards Prosa ist das Absurde nicht nur existenziell, sondern auch sozial bestimmt. Es ergibt sich gleichermaßen aus dem Zum-Tode-Sein des Menschen wie aus der menschlichen Neigung, für andere "der Tod zu sein". Dies verleiht seinem Werk eine besondere Aktualität.
Informationen über den Autor finden sich auf seinem Blog (rotherbaron.com) und auf Wikipedia.
Cover-Bild erstellt auf der Grundlage eines Fotos von Monozigote: Thomas Bernhard in Obernathal (Mai 1988); Wikimedia commons
Vorwort
Publikationsgeschichte
Die vorliegende Studie beruht im Kern auf einem Kapitel über Thomas Bernhard aus meiner 2006 erschienenen Habilitationsschrift über die Prosa des Absurden. Dafür, dass ich den Text jetzt in überarbeiteter Form noch einmal als Einzelveröffentlichung herausbringe, gibt es im Wesentlichen drei Gründe.
Zunächst einmal ist mir die Prosa von Thomas Bernhard persönlich sehr nahe. Es ist mir deshalb schlicht ein Anliegen, dem Autor mit einer eigenen Studie meine Reverenz zu erweisen.
Aktualität des Werks Thomas Bernhards
Darüber hinaus habe ich aber auch den Eindruck, dass das Werk von Thomas Bernhard in der derzeitigen Weltlage eine neue Aktualität gewonnen hat. Dies liegt daran, dass die existenzielle Dimension des Absurden darin in besonderem Maße mit der sozialen Realität des Menschen verbunden wird. Mit anderen Worten: Das Zum-Tode-Sein des Menschen wird eng mit der menschlichen Neigung verknüpft, füreinander "der Tod zu sein".
Dies passt gut zu einer Zeit, in der gewalttätige Formen des zwischenmenschlichen Umgangs in vielerlei Hinsicht auf dem Vormarsch sind. Dabei ist sowohl an die verbale als auch an die unmittelbare körperliche Gewalt zu denken. Beide Formen von Gewalt sind zudem eng miteinander verflochten. So gibt es unzählige Beispiele dafür, dass die berüchtigte "Hate Speech" aus dem Netz in konkrete Gewaltakte übergeht – etwa wenn Gerüchte verbreitet werden, wonach bestimmte, oft ethnisch markierte Personengruppen für Unheil oder gar den Tod anderer verantwortlich seien.
Gleichzeitig nehmen auch die Tendenzen zur gewalttätigen Durchsetzung von Interessen im zwischenstaatlichen Bereich immer weiter zu. Die dabei zu beobachtende Missachtung der Würde anderer, die sich nicht selten sogar zu einer sadistischen Marterlust steigert, erinnert dabei an die düstersten Zeiten der menschlichen Geschichte.
So zeigt sich, dass die nach dem Ende des Kalten Krieges aufgekeimte Hoffnung auf ein neues, von Frieden und Solidarität geprägtes Zeitalter verfrüht war. Offenbar musste lediglich erst die Erinnerung an die Gräuel des 20. Jahrhunderts hinreichend verblassen, ehe wieder an das Gesetz der Steinzeit angeknüpft werden konnte.
Dies geschieht nun allerdings mit den technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Die von diesen vermittelte Illusion, einen Krieg "sauber" aus der Ferne führen zu können, ohne Gefahr für die eigene Bevölkerung, ist ein weiterer Grund für die erneute Zunahme gewalttätiger Konfliktlösungsformen.
Der Spiegel der Literatur als Hilfe zur Selbstreflexion
Die permanente Präsenz dieser Gewalt bringt es mit sich, dass wir uns schleichend daran gewöhnen. Wir erschrecken nicht mehr vor den Eruptionen von Aggressivität, sondern nehmen sie als etwas Alltägliches hin. Dies führt dann aber erst recht dazu, dass sich gewalttätige Formen des Umgangs miteinander als etwas Normales etablieren und sich in den Strukturen unseres Alltags verankern.
Deshalb ist es wichtig, dieser Entwicklung auch literarisch einen Spiegel vorzuhalten. Denn die Literatur gibt uns genau das zurück, was uns im Alltag verlorengeht: Distanz gegenüber dem Geschehen. Sie ermöglicht es uns, innezuhalten und mit Abstand über das nachzudenken, was mit uns geschieht und wozu wir durch unser alltägliches Handeln beitragen.
Die Prosa Thomas Bernhards ist dafür ein geeignetes Mittel. Dafür spielt es keine Rolle, dass die konkreten Gewalterfahrungen, auf die Bernhard in seinem Werk Bezug nimmt, auf die Zeit von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg zurückgehen.
Denn Bernhard geht es nie um den historischen Einzelfall. Was ihn bewegt und zum Schreiben antreibt, sind vielmehr die den Gewaltakten zugrunde liegenden Aspekte der menschlichen Natur. Eben aus dem Widerspruch zwischen dem Streben jedes Einzelnen auf ein friedliches Leben und der menschlichen Neigung, anderen ein solches friedliches Leben zu verunmöglichen, ergibt sich für ihn der soziale Aspekt des Absurden.
Ergänzung zur Einführung in die Prosa des Absurden
Bleibt noch der dritte Grund für die Veröffentlichung dieser Studie. Dieser hängt eng mit der Einführung in die Prosa des Absurden zusammen, die ich im Jahr 2021 herausgebracht habe. Darin konnte ich – um kein Ungleichgewicht zu der anderen darin behandelten Literatur entstehen zu lassen – auf das Werk Thomas Bernhards nur in exemplarischer Weise eingehen.
Die hier vorliegende Publikation ist in diesem Sinne eine Ergänzung zu der auf die Prosa des Absurden im Allgemeinen fokussierten Arbeit. Sie beleuchtet an einem Einzelfall, in welcher Weise das Absurde ein literarisches Werk prägen kann.
Umgekehrt ist die Einführung in die Prosa des Absurden wiederum eine Ergänzung zu der vorliegenden Studie. Wer mehr über Wesen und Theorie sowie andere Erscheinungsformen der Prosa des Absurden erfahren möchte, kann dort fündig werden.
Die Einführung in die Prosa des Absurdenist auf LiteraturPlanet als PDF abrufbar. Außerdem ist sie als Ebook erhältlich.
Zur Einführung: Das Absurde und die Prosa des Absurden
Albert Camus' Deutung des Absurden
Das "vernunftwidrige" Schweigen der Welt
Der zentrale philosophische Bezugspunkt für die Beschäftigung mit dem Absurden in der modernen Literatur ist Albert Camus' 1942 erschienener Essay Der Mythos von Sisyphos. Darin leitet der Autor das Absurde zunächst aus einem Gefühl der Entfremdung ab, das seinerseits wieder auf dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit beruht – oder genauer: darauf, dass für den Menschen das Zum-Tode-Sein seine "Beziehung zum Leben bestimmt" (MS 23).
Vor dem Hintergrund des Sterben-Müssens erscheint die Befolgung der Alltagsroutine als sinnlos. Auch alle moralischen Maßstäbe verlieren vor diesem Hintergrund ihren imperativischen Charakter:
"Aus dem leblosen Körper, auf dem eine Ohrfeige kein Mal mehr hinterlässt, ist die Seele verschwunden. Diese elementare und endgültige Seite des Abenteuers ist der Inhalt des absurden Gefühls. Im tödlichen Licht dieses Verhängnisses tritt die Nutzlosigkeit in Erscheinung. Keine Moral und keinerlei Streben lassen sich a priori vor der blutigen Mathematik rechtfertigen, die über uns herrscht." (MS 19)
Diese Überlegungen verhelfen Camus zu einer genaueren Bestimmung des Absurden. Für den seiner selbst – und damit auch seiner Sterblichkeit – bewussten Menschen ergibt es sich aus der Grundkonstellation einer unmöglichen Suche nach einem absoluten Sinn des Lebens – also aus der "Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt" (MS 29).
"Vernunftwidrig" ist das Schweigen der Welt allerdings nur aufgrund der anders gearteten Erwartungshaltung des Menschen. Die Welt an sich ist, wie Camus unterstreicht (MS 23), weder vernünftig noch unvernünftig. Das Absurde entsteht hier wie in anderen Konstellationen erst "durch einen Vergleich":
"Das Absurde ist im Wesentlichen ein Zwiespalt. Es ist weder in dem einen noch in dem anderen verglichenen Element enthalten. Es entsteht durch deren Gegenüberstellung." (MS 30 f.)
Die so entstehende Absurdität ist nach Camus "das einzige Band" (MS 23 und 31), das Mensch und Welt miteinander verbindet. Daraus schließt er, "dass der Begriff des Absurden etwas Wesentliches ist und als meine erste Wahrheit gelten kann" (MS 31). Konsequenterweise hätte ich also "gerade das, was mich vernichtet, festzuhalten und infolgedessen das, was ich darin für wesentlich halte, zu respektieren" (ebd.).
Wahre Freiheit ist für den Menschen vor diesem Hintergrund nur durch die bewusste Konfrontation mit dem Absurden – als dem zentralen Aspekt seines Daseins – möglich:
"Leben heißt: das Absurde leben lassen. Das Absurde leben lassen heißt: ihm ins Auge sehen." (MS 49)
Die Auflehnung als adäquater Umgang mit dem Absurden
Dem Absurden ins Auge zu sehen, bedeutet für Camus nun allerdings gerade nicht, sich mit ihm abzufinden. Als die einzig adäquate Form der Auseinandersetzung mit ihm ist sieht er vielmehr die ebenso absurde, sisyphoshafte "Auflehnung" (ebd.) gegen es an:
"Das Absurde hat nur insoweit einen Sinn, als man sich mit ihm nicht einverstanden erklärt." (MS 32)
Die Auflehnung gegen das Absurde sieht Camus dabei nicht als einmaligen Akt, sondern als einen "pausenlosen Kampf" (MS 31) an. Das "Motiv der permanenten Revolution" übertrage sich so "auf die individuelle Erfahrung" (MS 49).
Die nach Camus zentrale philosophische Frage, ob die absurde Grundstruktur der menschlichen Existenz notwendig den Selbstmord zur Folge haben müsse, muss vor diesem Hintergrund verneint werden. Denn der Selbstmord ist ja gerade nicht von Auflehnung gegen das Absurde geprägt, sondern erkennt die dem Menschen durch das Absurde gesetzten Grenzen in einem absoluten Sinne an. Er bedeutet die Kapitulation vor der "einzige[n] und furchtbare[n] Zukunft", auf die jedes menschliche Dasein zuläuft. Dadurch hebt er "das Absurde auf seine Art auf":
"Er zieht es mit in den gleichen Tod. Ich weiß aber, dass das Absurde, um sich zu behaupten, sich nicht auflösen darf. Es entgeht dem Selbstmord in dem Maße, wie es gleichzeitig Bewusstsein und Ablehnung des Todes ist." (MS 49)
Aus der zentralen Prämisse seines Denkens – das menschliche Dasein ist absurd – ergibt sich für Camus damit notwendig die Schlussfolgerung, dass Freiheit für den Menschen nur über die Anerkennung dieses Faktums zu erlangen ist. Alles andere ist für ihn – konkretes oder philosophisch-abstraktes – Ausweichen vor der Realität des eigenen Lebens.
Die Konfrontation mit dem eigenen Zum-Tode-Sein wird demzufolge nach Camus' Auffassung bei einem Menschen, der bereit ist, "das Absurde leben [zu] lassen" (s.o.), nicht zum Selbstmord, sondern gerade zur Erkenntnis der eigenen Freiheit führen. Denn "der absurde Mensch, der ganz und gar dem Tode zugewandt ist (der hier als die offensichtlichste Absurdität verstanden wird)", fühlt sich "losgelöst von allem, was nicht zu dieser leidenschaftlichen Aufmerksamkeit gehört, die sich in ihm kristallisiert" (MS 53).
Die hieraus abzuleitende Lebenshaltung veranschaulicht Camus anhand des Mythos von Sisyphos, dem von den Göttern die Strafe auferlegt worden war, immer wieder denselben Felsblock einen Berg hinaufzurollen. In Camus' Deutung des Mythos beweist der antike Held, indem er dieses Schicksal auf sich nimmt, seine Bereitschaft, sich immer wieder neu gegen die Absurdität seines Daseins aufzulehnen:
"Sisyphos ist der Held des Absurden. Dank seinen Leidenschaften und dank seiner Qual. Seine Verachtung der Götter, sein Hass gegen den Tod und seine Liebe zum Leben haben ihm die unsagbare Marter aufgewogen, bei der sein ganzes Sein sich abmüht und nichts zustande bringt. Damit werden die Leidenschaften dieser Erde bezahlt." (MS 99)
Wolfgang Hildesheimers Überlegungen zur Literatur des Absurden
Die "Tragikomik der Ersatzantworten"
Von zentraler Bedeutung für die deutschsprachige Prosa des Absurden sind Wolfgang Hildesheimers Frankfurter Poetik-Vorlesungen aus dem Jahr 1967. Darin hat der Autor sich ausführlich mit der "Wirklichkeit des Absurden" und der Struktur des "absurde[n] Ich[s]" auseinandergesetzt (FV 43 ff. und 82 ff.).
Hildesheimer stützt sich dabei auch auf Albert Camus' Essay über den Mythos von Sisyphos. Insbesondere beruft er sich auf dessen Gegenüberstellung des fragenden Menschen und der "vernunftwidrig schweigenden Welt" (vgl. FV 50 f.). Zentral ist für ihn überdies Camus' Plädoyer, dem Absurden "ins Auge zu sehen", sich also bewusst mit ihm auseinanderzusetzen (s.o.). Und wie Camus leitet auch Hildesheimer daraus keinen Fatalismus ab, sondern die Notwendigkeit einer sisyphoshaften Auflehnung gegen das Unabänderliche.
Wenn Hildesheimer von sich sagt, er fühle sich "im sogenannten 'Absurden' heimisch" (AT 13), so bezieht er sich hierbei daher zunächst ebenfalls auf die existenziell verstandene "Wirklichkeit des Absurden" (s.o.). Konkret versteht er hierunter die "Tatsache", "dass das Leben selbst zusammenhanglos und unlogisch ist" und der Mensch auf seine Frage nach dem Sinn des Daseins stets nur "absurde Ersatzantworten" erhält. Deren zentrales Kennzeichen sei, dass sie nichts anderes aussagen könnten als "die schmerzliche Tatsache, dass es keine wirkliche verbindliche Antwort gibt" (AT 17 f.).
Als Aufgabe der Prosa des Absurden1 – wie auch des Theaters des Absurden, das Hildesheimer in Deutschland ebenfalls entscheidend geprägt hat – sieht es der Autor vor diesem Hintergrund mit Camus an, die Menschen in den Stand zu versetzen, dem Absurden "ins Auge zu sehen" (Camus, s.o.). Die Literatur kann so ein Gegengewicht zum gesellschaftlichen Alltag bilden. Denn dieser spielt sich nach Hildesheimer für gewöhnlich "innerhalb der Grenzen eines logischen Systems" ab, in dem das Absurde nicht vorkommt (Hildesheimer, AT 18).
Im Alltag ist es Hildesheimer zufolge daher kaum möglich, sich der Absurdität des Daseins bewusst zu werden. Nach Auffassung Camus' und Hildesheimers, die hierin die zentrale Wahrheit der menschlichen Existenz erblicken, ist es ohne dieses Bewusstsein jedoch unmöglich, sich aus dem Zustand der Entfremdung, in den einen die "Ersatzantworten" des Alltags versetzen (Hildesheimer, s.o.), zu lösen.
Allerdings erschöpft sich die Prosa des Absurden nach Hildesheimer keineswegs darin, dass sie durch das vergebliche Fragen des Ich-Erzählers das "vernunftwidrige" Schweigen der Welt offenbart. Vielmehr enthüllt sie dabei ihm zufolge zugleich "die Tragikomik der Ersatzantworten", indem sie
"jene anprangert, die sich als Stellvertreter der Welt sehen und Ersatzantworten erteilen, und indem sie jene verspottet, die sich nach den Ersatzantworten richten" (FV 54).
Die soziale Dimension des Absurden
Für Albert Camus ist das Absurde in erster Linie eine ontologische Kategorie. Die Absurdität des Daseins ergibt sich dabei aus der Sinnsuche von Wesen, deren Dasein aufgrund ihres unausweichlichen Todes zur Sinnlosigkeit verurteilt ist.
Wolfgang Hildesheimer ergänzt dieses Verständnis von Absurdität um einen weiteren, auf die konkrete gesellschaftliche Realität bezogenen Aspekt. Für ihn ist das Absurde nicht nur eine abstrakte ontologische Kategorie. Nach Auschwitz ist es in seinen Augen vielmehr in das Alltagsleben aller Menschen eingeschrieben. Dieses Faktum müsse sich folglich auch in der Literatur widerspiegeln:
"Auschwitz und ähnliche Stätten haben das menschliche Bewusstsein erweitert, sie haben ihm eine Dimension hinzugefügt, die vorher kaum als Möglichkeit bestand. Diese Dimension zu berücksichtigen, steht nicht in der Macht des Romans – übrigens auch nicht des Theaterstückes, auch nicht des dokumentarischen Theaterstückes. Aber die Wirklichkeit ist andrerseits ohne diese Dimension nicht mehr denkbar und – wenn sie überhaupt jemals darstellbar war – nicht mehr darstellbar." (FV 57)2
Hildesheimers Absage an den Roman ist im Kern eine Absage an den bürgerlichen Realismus. Er versucht damit der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die neue "Dimension", die dem menschlichen Bewusstsein durch den Holocaust hinzugefügt worden ist, im "präfabrizierten Material" (ebd.) der gesellschaftlichen Denk- und Sprachmuster nicht enthalten sein kann, da diese in der Zeit "vor Auschwitz" wurzeln. Damit aber verharmlosen sie diese Dimension aus seiner Sicht nicht nur, sondern sparen sie schlicht aus.
Auch ein Schriftsteller, der diese "präfabrizierte Realität" in seinem Werk nicht in Frage stellt, "bagatellisiert" Hildesheimer zufolge "diese Dimension, indem er sie schweigend übergeht" oder nur "Teil-Aspekte behandelt". Auch in letzterem Fall werde das Gesamtbild der Wirklichkeit verstellt.
Dies gilt nach Hildesheimer grundsätzlich auch für einen Roman, in dem Aspekte des Holocaust thematisiert werden. Denn auch hierbei würde es sich ja nur um "Teil-Aspekte" handeln, anstatt mit der Darstellung auf "das weite Panorama eines an allen Schrecken und Grauen, an aller Tragik und Komik des Lebens geschulten Bewusstseins" abzuzielen (FV 58 f.).
Literarische Umsetzung der theoretischen Postulate
Hildesheimer hat vor diesem Hintergrund nach einem literarischen Ansatz gesucht, der die durch Auschwitz in die Gesellschaft eingeschriebene neue Dimension des Absurden zu reflektieren erlaubt. Das von ihm dabei entwickelte Konzept einer monologischen Prosa hat er selbst einmal als "Vor-sich-hin-Erzählen eines Ich-Erzählers" (GW 2: 426) charakterisiert.
Erstmals erprobt hat Hildesheimer diese Art des Erzählens in Tynset, seinem – neben Masante (1973) – erzählerischen Hauptwerk. Darin setzt er seine These, dass die neue "Dimension", die Auschwitz dem menschlichen Bewusstsein hinzugefügt habe, zwar selbst nicht "darstellbar" sei, nichtsdestotrotz aber in jedem literarischen Werk "enthalten" sein müsse (s.o.), praktisch um. So wird das "Hauptthema" ("Auschwitz und ähnliche Stätten"; s.o.) "nicht ausgeführt", sondern tritt, wie Hildesheimers selbst erläutert hat, nur als "Anlass" der verschiedenen "Nebenthemen" in Erscheinung (AüT 385).3
Hildesheimer verweigert sich damit zwar dem linearen Erzählen, doch bleibt seine Literatur dennoch auf dem Boden der tradierten Sprachformen. Diese werden auf verschiedene Weise problematisiert und in der ihnen inhärenten Logik hinterfragt, bleiben im Erzählfluss jedoch weitgehend intakt.
Ein Beispiel für eine Prosa, in der sich die Erfahrung des Absurden auch formal widerspiegelt, sind die späteren Erzählungen Ilse Aichingers – vor allem die aus dem Band Eliza Eliza (1965). Darin löst sich die Sprache sukzessive von ihrer Funktion, außersprachliche Realität unmittelbar abzubilden. Stattdessen werden die Wörter in einen neuen Verweisungskontext gestellt, in dem sie eine abweichende Bedeutung entfalten.
So entsteht ein neuer Sprachraum, der Hildesheimers Ideal, die Sphäre der im "präfabrizierten [Sprach-]Material" enthaltenen Denk- und Deutungsmuster zu transzendieren, besonders nahekommt. Dies hat auch Hildesheimer selbst so gesehen und die Schriftstellerkollegin folglich in seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen als Beispiel für die von ihm beschriebene Prosa des Absurden angeführt.
Im Folgenden wird es nun um die Antwort gehen, die Thomas Bernhard auf die Frage nach einer adäquaten Widerspiegelung des Absurden in der Literatur gegeben hat.
1. Biographische Hintergründe von Bernhards Prosa
Die biographischen Hintergründe des in seinem Werk zum Ausdruck kommenden absurden Daseinsgefühls hat Thomas Bernhard selbst in seiner zwischen 1975 und 1982 in fünf Teilen erschienenen autobiographischen Prosa offengelegt. Demnach wäre hier zwischen einem eher persönlich-existenziellen und einem soziohistorischen Begründungszusammenhang zu unterscheiden, die freilich beide eng miteinander verzahnt sind.
Leiden unter staatlichen "Lernfabriken"
Dem letztgenannten Bereich zuzurechnen ist die Prägung des Jugendlichen durch nationalsozialistische Erziehungsanstalten und Schulen.4 Von entscheidender Bedeutung für das spätere Denken Bernhards ist dabei die Erfahrung, dass "der absolute Gehorsam und also die absolute Unterordnung der Zöglinge, also der Schwachen unter die Starken" (AP 1: 11), auch nach dem Krieg das zentrale Prinzip der Erziehung bleibt. Als der 14-Jährige erneut in das nun wieder unter katholischer Leitung stehende Gymnasium eingeschult wird, erlebt er dort dieselbe Einengung seines geistigen Entfaltungsstrebens wie zuvor an den nationalsozialistisch geführten Schulen.
Die Folge hiervon ist der Entschluss zu einer radikalen "Entziehung" (AP 2, Untertitel). Konkret bedeutet dies die Flucht aus der staatlichen "Lernfabrik" (ebd.: 9) und dem "gegen seine ganze Existenz entworfene[n], niederträchtig gegen seinen Geist gebaute[n] Kerker" des Internats (AP 1: 11) in den "Keller" (AP 2: Titel) eines Lebensmittelhändlers, wo der 15-Jährige eine kaufmännische Lehre antritt.
Diese Entscheidung für einen Lebensweg in "entgegengesetzter Richtung", die Bernhard auf wenigen Seiten über zwanzig Mal beschwört (vgl. ebd.: 7 f., 14 ff.), zeitigt zwar zunächst die gewünschten Ergebnisse. Der Jugendliche sieht durch die Lehre seinen Realitätssinn geschärft und findet nebenher auch noch Zeit für den vom Großvater mütterlicherseits – seinem Leitbild und Vaterersatz – geförderten Musik- und Gesangsunterricht, kann also seine kreativen Neigungen mit der Erfahrung nützlicher Tätigkeit verknüpfen.
Zugleich resultiert aus dem ständigen Wechsel zwischen der feingeistigen Musikkultur und der proletarisch geprägten Vorstadtwelt des Kaufmannsladens jedoch eine starke psychische Anspannung. Zusammen mit dem ungesunden Kellerleben mag dies mit zu der schweren Lungenkrankheit beigetragen haben, die bei Bernhard in seinem 18. Lebensjahr ausbricht und an deren Folgen er zeitlebens zu leiden haben sollte.
Frühe Berührung mit Krankheit und Tod
Die Erfahrung der Krankheit selbst ist zwar zweifellos dem persönlich-existenziellen Bereich zuzurechnen: Vier Jahre lang mit dem Tode ringend und dabei mehrfach von den Ärzten aufgegeben, entwickelt der Heranwachsende einen intensiven Sinn für das Zum-Tode-Sein des Menschen. Der Verlauf der Krankheit ist jedoch untrennbar mit den soziohistorischen Umständen der Nachkriegszeit verbunden.5
So hätte der Jugendliche viel früher geheilt sein können, wenn bei seiner Behandlung mehr Sorgfalt an den Tag gelegt worden wäre. Dies gilt bereits für den nachlässigen Umgang mit der anfänglichen Rippenfellentzündung, insbesondere aber für die nach deren Überwindung erfolgte Einweisung in ein "sogenanntes Erholungsheim" für "an den Atmungsorganen Erkrankte" (AP 3: 74, 84). Dieses entpuppt sich als Sterbeheim für die von der Krankenhausleitung "aufgegebenen Fälle" (ebd.: 84), in dem der geschwächte Organismus des 18-Jährigen sich zusätzlich mit Tuberkulose infiziert.
Die Erfahrung der aus dem allgemeinen Zum-Tode-Sein des Menschen resultierenden Absurdität des Daseins verbindet sich bei dem Kranken mit dem Erlebnis der – so der Titel des vierten Teils der autobiographischen Prosa – "Kälte" seiner Umgebung. Das Gefühl der "Isolation" (Untertitel), das ihn in der "Lungenheilstätte Grafenhof", in die er nun eingewiesen wird (AP 3: 101; AP 4: 7 ff.), mehr und mehr ausfüllt, erhält so neben einem existenziellen auch einen sozialen Aspekt. Letzterer bezieht sich auf die Gleichgültigkeit der Mitmenschen seiner Krankheit und seinem möglichen Tod gegenüber.
Analog gilt dies auch für das Gefühl der Verlassenheit. Auch dieses ist zum einen biographisch bestimmt: In die Zeit der Krankheit fallen der Tod des Großvaters und der Mutter. Zum anderen wurzelt es jedoch in der Erfahrung des Ausgeliefertseins an anonyme Instanzen und schicksalhafte Entwicklungsverläufe. Als Gründe für seine damalige Verzweiflung nennt Bernhard denn auch in einem Atemzug "den Krieg und seine Folgen, die Krankheit des Großvaters, den Tod des Großvaters, meine Krankheit, die Krankheit der Mutter, die Verzweiflung aller Meinigen, ihre bedrückenden Lebensumstände" (AP 4: 42).
2. Die Gestaltung des Absurden in Bernhards Prosa der 1960er Jahre
2.1. Das "Entsetzliche" in Bernhards früher Prosa
Die Todesverfallenheit des Lebendigen
Bernhards Prosa der 1960er Jahre ist deutlich von den Erfahrungen geprägt, die er später in seiner autobiographischen Prosa beschrieben hat. In ihr wird eine Welt gezeichnet, die – so die programmatischen Titel seiner ersten längeren, 1963 und 1967 veröffentlichen Prosastücke – von emotionalem Frost und einer tief greifenden Verstörung der in ihr lebenden Menschen bestimmt ist. Beide Texte – wie auch die 1964 veröffentlichte Erzählung Amras – beschwören eine dem Untergang geweihte Welt. Dabei korreliert die äußere Zerstörung mit der inneren Verstörung der Protagonisten:
In
Frost
beauftragt ein Chirurg einen ihm als Famulant zugeordneten Medizinstudenten mit der Beobachtung seines Bruders (des geisteskranken Malers Strauch), um so Erkenntnisse über dessen Gewohnheiten und Denkweisen zu gewinnen. Im Verlauf seines Zusammenseins mit dem Maler gerät der Famulant immer stärker in den Bann von dessen endlosen, die Sinnlosigkeit des Daseins in immer neuen Bildern und Wendungen beschwörenden Monologen. Am Ende verfällt er nur deshalb nicht selbst dem Wahnsinn, weil er sich dem Maler durch seine plötzliche Abreise entzieht.
Amras
– nach Bernhards eigenem Bekunden sein "Lieblingsbuch" (vgl. TBP 187 ff.) – kreist um das Schicksal zweier etwa 20 Jahre alter Brüder
6
, die zusammen mit den Eltern den gemeinschaftlichen Selbstmord beschlossen haben. Dieses "Selbstmordkomplott" (A 31) hat zwar den Tod der Eltern zur Folge, doch werden die Brüder – von denen der ältere als Ich-Erzähler fungiert – noch rechtzeitig von einem Fremden entdeckt und gerettet.
Um sie vor "Beschuldigung und Geschwätz und Verleumdung und Infamie" (A 8) zu schützen, werden sie von ihrem Onkel aus dem Innsbrucker Familienhaus in einen bei Amras stehenden Turm gebracht, der früher einmal ihrem – hoch verschuldet gestorbenen – Vater gehört hatte. Dort bleiben sie mehrere Wochen lang, bis sich der an Epilepsie leidende, um ein Jahr jüngere Bruder des Erzählers von dem Turm in den Tod stürzt.
Daraufhin begibt sich der Erzähler nach Aldrans, wo sein Onkel in einem ausgedehnten Waldstück Forstwirtschaft betreibt.7 Sein Versuch, sich in die Gemeinschaft der Holzfäller einzugliedern und ein geregeltes Leben zu führen, scheitert jedoch, so dass er den Ort am Ende mit unbekanntem Ziel verlässt.
In
Verstörung
wird aus der Sicht eines an der Leobener Montan-Universität eingeschriebenen Studenten von den Krankenbesuchen berichtet, auf die dieser seinen Vater bei einem Wochenendurlaub begleitet. Unterbrochen von kurzen, in indirekter Rede wiedergegebenen Kommentaren des Vaters, entrollt sich dabei eine kaleidoskophafte Szenerie aus Isolation, Brutalität, Geisteskrankheit und Agonie.
Den Höhepunkt dieses Totentanzes bildet der Besuch bei dem in einem Schloss residierenden Fürsten Saurau. Dessen manischer, pausenloser Monolog, mit dem er die Geräusche in seinem Kopf zu übertönen versucht, füllt den zweiten, etwa zwei Drittel des Werkes ausfüllenden Teil des Prosastücks aus.
Die Kompromisslosigkeit und Radikalität von Verstörung übertrifft damit noch die von Frost und Amras, wo in den Reflexionen der jeweiligen Erzähler immerhin noch eine – wenn auch brüchige – Distanz zum Wahnsinn der Hauptfiguren gewahrt wird. Eben diese entfällt in dem Monolog des Fürsten, der denn auch abrupt mit dessen Bitte, ihm beim nächsten Besuch "eine Ausgabe der Times vom 7. September" mitzubringen, abbricht (V 194). Die drei Punkte, die als Auslassungszeichen am Ende des Prosastücks stehen, unterstreichen dabei zusätzlich, dass der Schluss auf einer willkürlich gesetzten Zäsur beruht und der Monolog des Fürsten – ob mit oder ohne Zuhörer – noch endlos weitergehen wird.
Das Zum-Tode-Sein und die Krankheit zum Tode
Das an einer Stelle der Erzählung Zwei Erzieher (1966) direkt angesprochene Gefühl, dass "alles (…) absurd" sei (E 2:47)8, wird in allen drei oben genannten Werken durch zahlreiche Bilder und Beschwörungsformeln für die Todesverfallenheit des Lebendigen zum Ausdruck gebracht. Immer wieder werden dabei die Lebenden als bereits vom Tode Gezeichnete dargestellt. Das Dasein erscheint so letztlich nur als Vorstufe, wenn nicht gar als besondere Manifestation des Nicht-Seins.
In Verstörung beschreibt der Landarzt etwa seinem Sohn einen Patienten als "schwerfälligen sechzigjährigen Mann, der unter der Haut verfaule". Bei seiner Frau deute der "Mundgeruch auf einen rasch fortschreitenden Zersetzungsprozess ihrer Lungenflügel" hin (V 63 f.). Die Erinnerung an seine eigene Frau ist davon geprägt, dass diese – "während er noch keinerlei Anzeichen ihrer Todeskrankheit an ihr entdeckt hatte" – bereits ein Jahr vor ihrem Tod "von ihrer Todeskrankheit durchdrungen gewesen" sei (V 19).9
Ähnlich wird sich in der Erzählung Die Mütze (1966) der Erzähler durch die Begegnung mit einem alten Mann der Präsenz des Todes im Leben bewusst:
"Immer wieder sah ich das schmutzige Gesicht und die schwarzen Flecken darauf, Totenflecken, dachte ich: der Mann lebt noch und hat schon Totenflecken im Gesicht." (E 2:67)
Das Zum-Tode-Sein bedingt demnach unmittelbar die "Krankheit zum Tode", also die existenzielle Verzweiflung im Sinne Kierkegaards.10 Hierauf verweist auch das Erstickungsgefühl des Ich-Erzählers in Verstörung beim Eintritt "in diese Häuser, die nur noch von alten, alleinstehenden Frauen bewohnt sind, die, von ihrer Nachkommenschaft verlassen, sich auf ein Minimum an Lebensfähigkeit zurückziehen".11 Auch dieser Rest von Leben ist dabei aber schon vom Tod durchdrungen:
"Das Lächeln der aus dem Schlaf aufwachenden, sich verloren wissenden Frauen, die feststellen, dass sie noch immer in der qualvollen Welt sind, ist Grauen, sonst nichts." (V 28)
In Frost entspricht dem die Tatsache, dass den Maler Strauch "nur der Selbstmord beschäftigt" (F 18). Der Gedanke daran, "sich aus[zu]löschen" (ebd.)12, erfüllt ihn in einem solchen Maße, dass er schließlich sogar bekennt, der "Selbstmord" sei seine "Natur" (F 311).13
Strauchs Geisteskrankheit erscheint dabei als Folge der Überspanntheit eines Geistes, der sich – wie in es in der 1965 erschienenen Erzählung Das Verbrechen eines Innsbrucker Kaufmannssohns heißt – seiner 'Verlorenheit' bewusst ist (E 2:13).