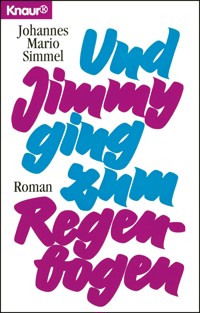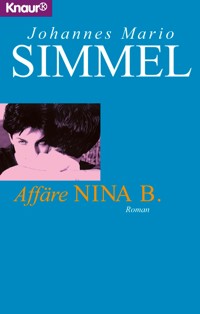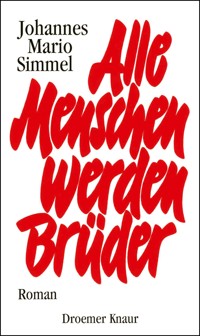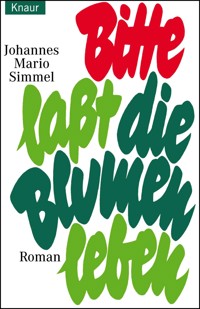4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der Stoff, aus dem die Träume sind - das ist eine Geschichte, die so, wie sie sich abgespielt hat, niemals der Öffentlichkeit hätte bekannt werden sollen. Simmel läßt diese Geschichte auf zwei Ebenen ablaufen: Da ist einmal der gigantische Apparat einer Industrie, in der raffinierteste Macher hemmungslos den Stoff weben für die Träume von Millionen; und da ist zum andern die Traumwelt eines Menschen, der sich aufopfert für die Ohnmächtigen und Hilflosen. Zwischen diesen beiden Welten bewegt sich der Chronist: der zynische Star-Reporter Walter Roland. Sein Auftrag führt ihn durch einen wüsten Alptraum sich überstürzender Ereignisse, in denen Reales und Irreales, Wirklichkeit und Wahn einander durchdringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1151
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Der Stoff aus dem die Träume sind
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Gewidmet dem Mann,
der in diesem Roman
den Namen Bertie erhielt
Man wollte nicht,
daß dieses Buch erscheint.
Das Manuskript wurde dem Autor in der ersten Niederschrift gestohlen und vernichtet, da eine Veröffentlichung unter allen Umständen verhindert werden sollte.
Der Autor – ein Journalist – ging daraufhin nach Übersee. Von dort erreichten mich Tonbänder, auf denen der Ausgewanderte seine Erlebnisse im Detail geschildert hatte. Ich wurde autorisiert, über diese Erlebnisse zu berichten. Das habe ich getan und dabei jede denkbare Methode benützt, die geeignet erschien, jenen Journalisten sowie Unschuldige zu schützen.
In der Tat ist es unmöglich, mit den völlig verschlüsselten Tatsachen, die ich noch dazu in Romanform vorlege, auch nur einem einzigen Menschen zu schaden, und zwar wegen der vielen Veränderungen, die ich vorgenommen habe.
Es entspricht dem Wunsch des Ausgewanderten (der seit Jahren unter einem anderen Namen lebt), daß ich die Geschichte so geschrieben habe, wie er selber sie einst geschrieben hat – in der Ich-Form.
Das schöne Gedicht, das Fräulein Luise spricht, stammt aus dem 1948 produzierten amerikanischen Film ›Ein Bildnis von Jenny ab‹ nach dem gleichnamigen Roman von Robert Nathan.
J. M. S.
Ich will einfach sagen, daß es fruchtbarer ist, an das Unbekannte zu glauben, als an den uns bekannten Dingen zu verzweifeln. Laßt uns ein gutes Wort einlegen für Glauben, Liebe und dergleichen unlogische Dinge, und werfen wir einen etwas mißtrauischen Blick auf die Realität und ähnliche Produkte der Vernunft.
PADDY CHAYEFSKY
Recherche
1
Jetzt also werden meine Freunde diesen Menschen töten«, sagte Fräulein Luise zu mir. Das war gestern. Vor den Fenstern ihres Zimmers standen alte, kahle Kastanienbäume. Es regnete heftig, und die Stämme und Äste der Bäume glänzten. »Auf jeden Fall töten«, sagte Fräulein Luise. »Unter allen Umständen.« Sie lächelte glücklich.
»Haben Sie ihn jetzt endlich gefunden?« fragte ich.
»Nein, das noch immer nicht«, sagte Fräulein Luise.
»Ach so«, sagte ich.
»No ja«, sagte sie. »Kann also nach wie vor Mann oder Frau sein, dieser Mensch.« Gottschalk heißt Fräulein Luise mit dem Familiennamen. Ihr Gesicht war erfüllt von einem Ausdruck grenzenloser Zuversicht. »Junger Mensch, alter Mensch. Ausländer, Deutscher.« (»Deitscher«, sagte sie. Fräulein Gottschalk stammt aus Reichenberg, jetzt Liberec, im ehemaligen Sudetenland, und ihre Sprache ist leicht tschechisch-österreichisch gefärbt.) »Hat er Bruder, Schwester, Vater, Mutter? Irgendwelche Verwandte? Vielleicht. Vielleicht, kann sein, er hat niemanden, der Mensch. Beruf? Was für Beruf? Jeden. Keinen. Beides möglich.« (»meglich«)
»Ich verstehe«, sagte ich.
»Wo ist sein Zuhause? Ist er gerade beim Flüchten?« (»Flichten?«)
»Wie heißt er? Oder sie, wenn es eine Sie ist? Wissen das alles noch nicht, meine Freund. Wissen überhaupt nichts von diesem Menschen. Haben ihn doch nie gesehen, gelt?«
»Nie, nein«, sagte ich. »Und trotzdem sind Sie ganz sicher …«
»Bin ich, ja! Denn warum? Deshalb, weil ich sie hab überlistet.«
»Überlistet?«
»Hab debattiert mit ihnen, bis sie selber so aufgeregt gewesen sind wie ich. Dürfen doch nicht zulassen, daß einer, der Böses getan hat, weiter Böses tut. Seinetwegen nicht! Seinetwegen – Sie verstehen, Herr Roland?«
»Ja«, sagte ich.
»War schlau von mir, was?«
»Ja«, sagte ich.
»Und so habens es mir versprochen, meine Freund. Sehens, darum! Meine Freund können alles tun, es gibt nichts, das sie nicht tun können. Und so weiß ich also bestimmt, sie werden ihn finden, den Menschen, von dem sie noch nichts wissen, und sie werden ihn erlösen, meine Freund«, sagte Fräulein Luise Gottschalk. Sie hat schneeweißes Haar, ist 62 Jahre alt und seit 44 Jahren Jugendfürsorgerin. »Können sich vorstellen, wie froh daß ich bin, Herr Roland?«
»Ja«, sagte ich.
»Alsdern, meiner Seel, wenn sie ihn erwischt haben und er erlöst ist, das wird der schönste Tag sein in meinem ganzen Leben«, sagte das Fräulein und lachte wie ein Kind, das sich auf Weihnachten freut. Der Regen prasselte jetzt mit solcher ’Wucht gegen die Scheiben, daß man die Kastanienbäume kaum mehr erkennen konnte.
Niemals habe ich jemanden getroffen, der gütiger gewesen wäre als Luise Gottschalk. Erst seit ich sie kenne, weiß ich, was sie wirklich bedeuten, alle diese durch skrupellosen Mißbrauch sinnentleerten oder pervertierten Begriffe: Toleranz, Glauben an das Gute, Treue, Zuverlässigkeit, Liebe, Mut und unermüdliche Arbeit für das Glück, die Sicherheit und den Frieden anderer.
Fräulein Luises Freunde sind: ein amerikanischer Werbefachmann aus New Yorks Madison Avenue; ein holländischer Schulbuchverleger aus Groningen; ein deutscher Mayonnaise-Fabrikant aus Seelze bei Hannover; ein russischer Zirkusclown aus Leningrad; ein tschechischer Architekt aus Brünn; ein polnischer Professor für Mathematik von der Universität Warschau; ein deutscher Sparkassenangestellter aus Bad Homburg; ein ukrainischer Bauer aus Petrikowa nahe dem Strom Dnjepr und der Stadt Dnjeprodserschinsk; ein französischer Gerichtssaalreporter aus Lyon; ein norwegischer Koch aus Kristiansand, im äußersten Süden des Landes, bei Kap Lindesnes; und ein deutscher Student der Philosophie aus Rondorf bei Köln.
Fräulein Luises Freunde sind ihrer Herkunft nach völlig verschieden. Und sie haben völlig verschiedene Charaktere, Erfahrungen, Vorlieben, Abneigungen, Ansichten und Grade der Bildung. Es gibt nur eines, das sie gemeinsam haben: Sie sind alle seit Jahrzehnten tot.
2
Er hörte sieben Schüsse. Danach hörte er die Stimme seines Vaters. Sie schien von weither zu kommen. Die Schüsse erschreckten ihn nicht, er hatte schon zu viele gehört, seit er hier war, und außerdem wurde in seinem Traum auch gerade geschossen, aber die Stimme des Vaters weckte ihn.
»Was ist?« fragte er und rieb sich die Augen. Sein Herz klopfte stürmisch, und seine Lippen waren trocken.
»Du mußt aufstehen, Karel«, sagte der Vater. Er stand über das Bett gebeugt, in dem der Junge geschlafen hatte, und lächelte zuversichtlich. Der Vater war ein schlanker, großer Mann mit einer breiten, hohen Stirn und schönen Händen. An diesem Abend hatte sein müdes Gesicht die Farbe von stumpfem Blei angenommen. »Ich habe mit Leuten aus dem Dorf gesprochen«, sagte er. »Um Mitternacht wechseln die Posten. Dann ist der Wassergraben fünf Minuten lang unbewacht. Dann können wir hinüber.«
»Und wenn die Posten nicht wechseln?« fragte Karel.
»Sie wechseln jede Nacht«, sagte der Vater. »Jede Nacht gehen Menschen hinüber. Hast du ausgeschlafen?«
»Ja.« Karel streckte die Arme über den Kopf und dehnte sich. Vor fast fünfzig Stunden hatte er mit dem Vater Prag verlassen. Seit fast fünfzig Stunden befanden sie sich auf der Flucht. Es war schwer gewesen, aus der Stadt herauszukommen. In überfüllten Straßenbahnen, auf einem Lastwagen und zu Fuß hatten sie komplizierte Umwege gemacht, um den fremden Soldaten und ihren Panzersperren und Kontrollen zu entgehen. Zuletzt waren sie mit der Eisenbahn gefahren, lange, in einem leeren Viehwaggon.
Der Vater wußte, daß sie ihn suchten. Er hatte es schon gewußt, bevor er gewarnt worden war. Alles, was geschehen würde, was kommen mußte, hatte er bereits in den ersten Morgenstunden des 21. August klar erkannt, sobald ihn die Nachricht erreichte. Sie suchten ihn, um ihn zu verhaften, und das erschien dem Vater nur logisch und unumgänglich. Er war denen, die ihn jagten, nicht böse, sie mußten nun so handeln, wie er zuvor hatte handeln müssen. Sein Tun hatte das ihre provoziert, wie er und die Freunde provoziert worden waren zum Handeln durch das Verhalten anderer.
Daß sie den Vater suchten, machte ihn sehr vorsichtig. Genau hatte er jeden Schritt überlegt. Alles war gutgegangen bisher, die bayerische Grenze beinahe erreicht. Zwei Kilometer noch – dann hatten sie es geschafft Aber diese letzten beiden Kilometer waren die gefährlichsten, und darum hatte der Vater darauf bestanden, daß Karel sich gründlich ausschlief hier in dem kleinen Haus der Großmutter, die des Vaters Mutter war. Nur Freunde wußten, wo diese Mutter lebte, und sie würden es nicht verraten.
Die alte Frau wohnte allein, nahe dem Ausgang des Dorfes. Sie besaß ein Papier- und Schreibwarengeschäft. Wenn es Zeitungen gab, verkaufte sie auch Zeitungen. Seit zwei Tagen gab es keine. Die kleine Großmutter ging gebückt, denn sie litt an Ischias. Der Vater und Karel waren zu ihr gekommen, weil sie an einem Abschnitt der Grenze lebte, der, so hieß es, noch nicht ganz abgeriegelt war, über den man also leichter fliehen konnte. Und deshalb vermochten Sohn und Enkel von der Großmutter auch noch Abschied zu nehmen, bevor sie hinübergingen in das andere Land.
»Wie spät ist es?« fragte Karel.
»Zehn«, sagte der Vater und legte dem Kind eine Hand auf die Stirn. »Du bist ja ganz heiß! Hast du Fieber?«
»Bestimmt nicht«, sagte Karel. Er sprach sehr reines Tschechisch. Deutsch verstand er, im Gegensatz zu seinem Vater, wenig. Das war eine schwere Sprache, da fiel ihm Englisch noch leichter. Er lernte Englisch und Deutsch in der Schule. »Das Heiße kommt bloß von den Löwen«, sagte er.
»Was für Löwen?«
»Auf dem Wenzelsplatz. In meinem Traum. Da waren viele Löwen. Und noch viel mehr Hasen. Die Löwen haben Gewehre gehabt, und sie waren einfach überall, und die Hasen haben ihnen nicht entkommen können. Alle Löwen hatten Gewehre. Mit ihnen haben sie auf die Hasen geschossen. Und jedesmal, wenn einer geschossen hat, ist einer umgefallen.«
»Arme Hasen.«
»Aber nein! Den Hasen ist gar nichts passiert! Jedesmal, wenn ein Löwe geschossen hat, ist der Löwe umgefallen! Sofort. Und hat sich nicht mehr gerührt. Das ist doch sehr sonderbar, nicht?«
»Ja«, sagte der Vater. »Das ist sehr sonderbar.«
»Sieben Löwen haben nacheinander geschossen, und alle sieben sind umgefallen«, sagte Karel. »In dem Moment hast du mich geweckt.« Er streifte die karierte Decke zurück und sprang nackt aus dem hohen, knarrenden Bett der Großmutter, in dem er geschlafen hatte. Karel war elf Jahre alt. Er hatte einen kräftigen, braungebrannten Körper mit langen Beinen. Die Augen waren groß und so schwarz wie das kurzgeschnittene Haar. Es glänzte im Licht der elektrischen Lampe. Karel war ein nachdenklicher Junge, der sehr viel las. Seine Lehrer lobten ihn. Er hatte mit dem Vater in der großen Wohnung eines alten Hauses an der Jerusalemski-Straße gelebt. Wenn man sich aus einem Fenster lehnte, konnte man die schönen Bäume, die blühenden Sträucher und Blumen des großen Parks Vrchlického sady und den See in seiner Mitte erblicken.
Als ganz kleiner Junge war Karel dort jeden Tag mit seiner Mutter spazieren gegangen. Daran erinnerte er sich noch deutlich. Seine Mutter hatte sich scheiden lassen und war nach Westdeutschland gezogen zu einem anderen Mann, als Karel gerade vor seinem fünften Geburtstag stand. Niemals war ein Brief von ihr gekommen Durch all die Jahre hatte Karel fast täglich aus dem Fenster seines Zimmers hinüber zum Vrchlického sady gesehen, ihn bei Schnee und Eis und Kälte und dann wieder bei Sonnenglut und im Hochsommer und seiner ganzen Blütenpracht forschend und versunken betrachtet – ihn und die vielen jungen Frauen, die, Kinder an der Hand, über die Parkwege gingen oder mit ihren kleinen Söhnen und Töchtern spielten. Karel sah aus dem Fenster, gedachte der eigenen Spaziergänge und hoffte stets, sich an seine Mutter zu erinnern. Aber das war ein vergebliches Unterfangen. Schon lange, lange konnte er nicht einmal mehr sagen, wie seine Mutter auch nur ausgesehen hatte.
Als der Vater Karel in den Morgenstunden des 21. August aus dem Bett holte, zwei Koffer packte und danach eilig mit dem Jungen das Haus verließ, um zunächst bei Freunden unterzutauchen, erblickte Karel zwischen Rosen, Nelken, Goldregenbüschen und Dahlienbeeten Panzerspähwagen mit Maschinengewehren, spielzeughaft und verloren in der Dämmerung und dem Dunst dieses frühen Beginns eines heißen Sommertages. Auf den Panzerspähwagen saßen Männer in fremden Uniformen, ratlos und traurig. Karel winkte ihnen zu, und viele Soldaten winkten zurück …
»Ich habe dir schon deine Sachen herausgesucht«, sagte der Vater und wies auf einen Sessel, der neben dem Bett stand. Hier lag Karels blauer Anzug, der feine, den er sonst immer nur am Sonntag hatte tragen dürfen. »Wir müssen die besten Sachen anziehen, die wir haben«, sagte der Vater. Auch er trug einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine dunkelblaue Krawatte mit vielen sehr kleinen gestickten silbernen Elefanten. In der Sommernacht draußen fielen zwei Schüsse, schnell nacheinander. »Vielleicht verlieren wir unsere Koffer, oder wir müssen sie liegenlassen«, sagte der Vater.
»Ja, darum die feinen Sachen«, sagte Karel. »Ich verstehe«. Er setzte sich auf den Boden, um in die Strümpfe zu schlüpfen. Es war ein glühend heißer Tag gewesen, aber im Zimmer der Großmutter blieb es kühl. Hier blieb es immer kühl, die Luft war ewig feucht, und alle Dinge griffen sich feucht an. Im ganzen Haus roch es ein wenig nach Moder und alten Tüchern. Ob Karel die Großmutter in den Ferien oder zu Weihnachten besuchte – es roch nach Moder in dem gelben Haus mit dem Schindeldach und dem winzigen Papierladen, über dessen Eingang ein Heiliger in einer kleinen Nische stand. Das Schaufenster schmückten seit vielen Jahren zwei große Glaskugeln, gefüllt mit sehr bunten Seidenbonbons, denn die Großmutter verkaufte auch billige Süßigkeiten. Nur die Kugeln standen in der Auslage, sonst nichts.
Während Karel sein Hemd über den Kopf zog, trat der Vater an das schmale Fenster, schob den Kattunvorhang ein wenig zur Seite und sah auf die Dorfstraße hinaus, die verlassen im Mondlicht lag.
»Verfluchter Mond«, sagte der Vater und blickte zu der honigfarbenen Scheibe empor, die in einem samtdunklen Himmel voller Sterne schwamm. »Ich habe so sehr gehofft, es kommen noch Wolken.«
»Ja, Wolken wären gut gewesen«, sagte Karel. »Bindest du mir bitte meine Krawatte?« Er sprach stets äußerst höflich. Als der Vater den Knoten der roten Krawatte schlang, bog Karel den Kopf zurück. »Aber deine Trompete nehmen wir doch auch mit?« fragte er aufgeregt. »Die brauchst du doch in dem anderen Land!«
»Natürlich«, sagte der Vater, der sich tief zu ihm hinabbeugte und ungeschickt an der Krawatte zupfte. »Wir nehmen die beiden Koffer und meine Trompete.«
Der Vater war Musiker. Auf dieser Trompete, die er nun aus seinem Vaterland, der Tschechoslowakischen Volksrepublik, hinübertragen wollte in die Bundesrepublik Deutschland, spielte er seit drei Jahren. Es war eine ganz wundervolle Trompete, auch Karel hatte schon oft auf ihr gespielt. Er war sehr musikalisch. Der Vater hatte in den letzten drei Jahren, bis zur Nacht des 20. August, in der ›EST-Bar‹ gearbeitet. Das war eines der vornehmsten Nachtlokale Prags und untergebracht im Luxushotel ›Esplanade‹. Das ›Esplanade‹ lag in der Washingtonová-Straße, direkt am Park Vrchlického sady, sehr nahe der Wohnung in der Jerusalémská-Straße.
»Ich trage die Koffer, und du trägst das Futteral mit der Trompete«, sagte der Vater.
»O ja!« Karel strahlte ihn an. Er verehrte den Vater, weil der so ein großer Künstler war und so wundervoll Trompete blasen konnte. Wenn Karel einmal erwachsen war, dann wollte auch er Musiker werden, da gab es gar kein überlegen! Sooft der Vater zu Hause übte, als sie noch ein Zuhause hatten, saß Karel stets zu seinen Füßen und lauschte hingerissen. Sein Vater war ganz gewiß der beste Trompeter der Welt! Das war er ganz gewiß nicht, aber er war ein sehr guter, und darum auch seit langem Vorstand seiner Sektion im ›Svaz skladatelů‹, dem Musikerverband. Als der ›Prager Frühling‹ begann, konnte Karel den Vater nicht mehr üben hören. Da erschienen viele fremde und bekannte Männer und Frauen in der großen Wohnung und redeten mit seinem Vater und miteinander, Nachmittage lang. Karel hörte zu. Alle sprachen von einer ›Freiheit‹ und einer ›Neuen Zeit‹ und einer ›Zukunft‹. All das mußten sehr schöne Dinge sein, dachte der Junge damals ergriffen.
Und dann kam der Abend, an dem Karel unendlich stolz auf seinen Vater war! Der ›Svaz špisovatelů, der Schriftstellerverband, hatte die anderen Kulturverbände zu einer Diskussion im Fernsehen eingeladen. Die Diskussion dauerte viele Stunden, und neben berühmten Männern und Frauen, deren Bilder und Namen der Junge aus der Zeitung kannte, sah er auf dem Fernsehschirm im Wohnzimmer immer wieder seinen Vater und hörte, was der sagte, und der Vater hatte viel zu sagen. Karel verstand nur sehr wenig davon; aber er war sicher, daß es sich nur um kluge und gute Dinge handelte, und er konnte sich einfach nicht sattsehen. Die Diskussion dauerte bis halb vier Uhr früh, das Fernsehen gab jede zeitliche Beschränkung auf, und es ist keine Lüge, zu schreiben, daß Millionen, fast alle Erwachsenen im Lande, diese Sendung verfolgten und dabei vor Freude weinten und ihre Apparate anklatschten, um den Männern und Frauen Beifall zu zollen, die das sagten, was die Millionen sagen wollten und erträumt hatten, so lange, lange vergebens.
Karel schlief in seinem Sessel ein, und als der Vater endlich heimkam (es war schon heller Tag), da lag sein Sohn zusammengerollt wie eine Katze vor der weiß flimmernden Scheibe des eingeschalteten Gerätes. Es gehörte zu den vielen Dingen, die Karel noch nicht begriff, daß sie wegen dieses Fernsehauftritts seines Vaters dann später, als die fremden Soldaten kamen, ihr Haus verlassen, einige Tage versteckt bei Freunden leben und nun gar mitten in der Nacht flüchten mußten, doch so war es, der Vater hatte es ihm als Grund genannt.
»Ich wäre gern in Prag geblieben«, sagte der Junge, die Senkel der Schuhe knüpfend.
»Ich auch«, sagte der Vater.
»Aber es geht nicht«, sagte Karel und nickte ernsthaft.
»Nein. Leider geht es nicht.«
»Weil sie dich einsperren würden und mich in ein Heim geben.«
»Ja, Karel.«
Und da er das alles nicht verstand, fing der Junge noch einmal mit seinen Fragen an.
»Wenn ihr nicht soviel von der Zukunft und von der Freiheit und von der neuen Zeit gesprochen hättet im Fernsehen, wären die fremden Soldaten dann nicht zu uns gekommen?«
»Nein, dann wären sie wohl zu Hause geblieben.«
»Und wir könnten weiter in der Jerusalémská-Straße leben?«
»Ja, Karel.«
Der Junge überlegte lange.
»Es war trotzdem sehr schön, was du im Fernsehen gesagt hast«, erklärte er dann. »Am andern Tag, in der Schule, haben mich alle um so einen Vater beneidet.« Wieder überlegte Karel. »Sie beneiden mich gewiß noch immer«, setzte er hinzu, »und es ist noch immer schön, was du und die anderen gesagt haben. Ich habe nie so etwas Schönes im Fernsehen gehört. Ehrlich. Die Eltern von meinen Freunden und alle anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. Und es kann doch nicht etwas sehr schön sein und auf einmal nicht mehr sehr schön – oder?«
»Nein.«
»Ja, und deshalb«, sagte Karel grübelnd, »verstehe ich nicht, weshalb du jetzt dafür flüchten mußt mit mir und warum sie dich einsperren wollen. Warum wollen sie denn das?«
»Weil es eben doch nicht allen Leuten gefallen hat«, sagte der Vater zu Karel.
»Den fremden Soldaten hat es nicht gefallen, wie?«
»Ach, die fremden Soldaten«, sagte der Vater.
»Was ist mit ihnen?«
»Die tun nur, was man ihnen befiehlt.«
»Also denen, die befehlen, hat es nicht gefallen?«
»Es darf ihnen nicht gefallen haben«, sagte der Vater.
»Das ist aber kompliziert«, sagte sein Sohn. »Sind sie sehr mächtig, die Leute, die über die Soldaten befehlen?«
»Sehr mächtig, ja. Und auch wiederum sehr machtlos.«
»Das verstehe ich nun aber wirklich nicht«, sagte Karel.
»Siehst du«, sagte der Vater, »in ihrem Herzen hat es vielen von denen, die über die Soldaten befehlen, genauso gefallen wie dir und deinen Freunden und den Menschen in unserem Land. Den meisten ist es so gegangen, sicherlich. Und sie werden jetzt so traurig sein, wie es die Soldaten im Park waren.«
»Dann sind sie also nicht böse?«
»Nein, sie sind nicht böse«, sagte der Vater. »Aber sie dürfen nicht zugeben, daß es ihnen gefallen hat. Und sie dürfen nicht zugeben, daß man bei uns solche Sachen sagt und denkt und schreibt, denn es könnte ihnen sonst ein Unglück geschehen.«
»Was für ein Unglück?« fragte Karel.
»Ihre Völker könnten sie davonjagen, so wie wir unsere Mächtigen davongejagt haben«, sagte der Vater. »Deshalb sind diese Leute so mächtig und doch so machtlos. Verstehst du?«
»Nein«, sagte Karel. Und als wäre es eine Entschuldigung, setzte er stirnrunzelnd hinzu: »Das ist Politik, nicht wahr?«
»Ja«, sagte der Vater.
»Natürlich«, sagte Karel. »Darum kann ich es nicht verstehen.«
Irgendwo hinter den mondbeschienenen kleinen Häusern, draußen in den Feldern, auf denen hoch die Ernte stand, ertönte schnell und ohne Hall das Geratter einer Maschinenpistole.
»Jetzt schießen sie wieder«, sagte Karel.
»Aber nicht mehr soviel wie am Nachmittag«, sagte der Vater. »Komm, Großmutter wartet in der Küche.«
Sie verließen das düstere, altmodische Schlafzimmer mit den Möbeln aus dem vorigen Jahrhundert. Der Vater warf einen kurzen Blick auf das Bild über dem Bett. Es war ein großer Öldruck und zeigte Jesus und die Jünger im Garten von Gethsemane. Die Jünger schliefen, doch Jesus stand vor ihnen, wach als einziger. Mit erhobener Hand sprach Er. Am unteren Bildrand standen, in tschechischer Sprache, die Worte: WACHET UND BETET, AUF DASS IHR NICHT IN ANFECHTUNG FALLET! DENN DER GEIST IST WILLIG, ABER DAS FLEISCH IST SCHWACH. Links, in der Ecke, stand in sehr kleiner Schrift: Printed by Samuel Levy & Sons, Charlottenburg (Berlin), 1909.
Draußen in der unwirklichen Mondnacht hämmerte weiter die Maschinenpistole. Hunde heulten. Dann war es wieder still. Im Jahre 1909 von Samuel Levy und Söhnen in Berlin-Charlottenburg auf Öldruckpapier gebannt, sprach der Erlöser der Welt noch immer zu Seinen schlafenden Jüngern.
Es war 22 Uhr 14 am 27. August 1968, einem Dienstag.
3
»… hier spricht ›Radio Freiheit für Europa‹. Wir brachten Nachrichten für unsere tschechoslowakischen Hörer. Die Sendung ist beendet«, ertönte die Ansagerstimme Aus einem Studio in München übertrug ›Radio Freedom for Europe‹, ein Sender, der in vielen Sprachen und Programmen für Ostblockstaaten operierte, eine Schallplattenaufnahme der ›Fidelio‹-Ouvertüre.
Der alte Radioapparat stand in einer Ecke der verräucherten, niedrigen Küche. Das Ohr dicht am Lautsprecher, hatte die Großmutter der Sendung gelauscht. Nun verstellte sie den Skalenzeiger genau auf die Marke für den Prager Rundfunk und schaltete den Apparat ab. Gebückt ging sie zum Herd, auf dem ein großer Topf stand. Ihr Gesicht war, je älter sie wurde, immer kleiner geworden. Und immer mehr hatte sie die Fähigkeit verloren, auch nur halbwegs aufrecht zu gehen. Gegen den Ischias gab der Arzt ihr Injektionen, aber die Spritzen halfen nicht sehr. Die Großmutter wünschte oft den Tod herbei. Doch der Tod ließ auf sich warten.
»Da seid ihr ja«, sagte die Großmutter, als der Vater mit Karel in die Küche kam. Sie ergriff einen Schöpflöffel und füllte drei Teller. »Es gibt Bohnensuppe«, sagte sie. »Ich habe ein paar Scheiben Selchfleisch hineingeschnitten.«
»Fettes?« fragte Karel und blinzelte ängstlich, während er sich an den gedeckten Tisch neben dem Herd setzte.
»Mageres. Ganz mageres, mein Herzel«, sagte die Großmutter. Sie sagte immer ›Herzel‹ zu Karel.
»Gott sei Dank, mageres!« Der kleine Junge lachte sie an und beleckte einen großen Löffel. In der Ferne hallte wieder ein Schuß durch die Nacht. Karel band sich eine riesige Serviette um den Hals, wartete, bis die anderen zu essen begonnen hatten, und tauchte den Löffel dann auch in die Suppe. »Prima, Großmutter«, sagte er. »Wirklich. Magerer geht es nicht!«
Über dem Tisch hingen leuchtend gelbe Maiskolben an ausgespannten Schnüren. Das Herdfeuer knisterte laut. Trotzdem wurde es auch in der Küche nie richtig warm, und immer roch es auch hier ein bißchen nach Moder.
Nachdem die Großmutter den Löffel viermal zum Mund geführt hatte, erzählte sie: »Der Radio Freiheit für Europa hat gerade gesagt, daß die UNO ohne Unterbrechung tagt unseretwegen.«
»Das ist aber rührend von der UNO«, sagte der Vater.
»Und daß die Amerikaner außer sich sind vor Empörung!«
»Ja, natürlich sind sie das«, sagte der Vater. »Und nach den Nachrichten haben sie Beethoven gespielt, was?«
»Ich weiß nicht. Es hat so geklungen.«
»Ganz sicher war es Beethoven«, sagte der Vater.
»Woher weißt du das?« fragte Karel.
»Wenn so etwas passiert ist wie bei uns, spielen alle Rundfunkstationen nach den Nachrichten immer Beethoven«, sagte der Vater. »Die Fünfte oder die Ouvertüre zu ›Fidelio‹.«
»Fidelio ist sehr schön«, sagte Karel. »Die Fünfte auch. Alles von Beethoven ist schön, nicht wahr?«
»Ja«, sagte der Vater. Er strich Karel über das schwarze Haar.
»Wir sollen Widerstand leisten und tapfer bleiben. Wir sind ein heroisches Volk, hat der Radio gesagt.«
»Jaja«, sagte der Vater und löffelte Suppe.
»Und sie werden uns zu Hilfe kommen.«
»Natürlich werden sie das tun. Wie sie den Ungarn damals zu Hilfe gekommen sind«, sagte der Vater.
»Nein, diesmal wirklich! Hat der Radio gesagt! Alle erwarten, daß die Amerikaner die Russen auffordern, sofort wieder aus unserem Land abzuziehen. Und alle die anderen Staaten auch.«
»Einen Dreck werden sie tun«, sagte der Vater. »Die Amerikaner am wenigsten. Denen haben die Russen es doch vorher eigens mitgeteilt, daß sie uns besetzen müssen. Damit die Amerikaner keinen Schreck kriegen und glauben, der Dritte Weltkrieg geht los. Die Russen haben den Amerikanern gesagt, daß sie unser Land besetzen müssen, aber sonst werden sie nichts tun. Die Amerikaner haben gesagt, schön, wenn ihr sonst nichts tut, ist es okay.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte die Großmutter erschrocken.
»Politik«, sagte Karel.
»Woher weißt du das denn?« fragte die Großmutter ihren Sohn.
»Unsere Leute haben es inzwischen herausgekriegt in Prag. Ist eine verabredete Sache zwischen den Großen. Nach außen hin müssen die im Westen nun empört tun. Und dieser Sender macht unserem Volk noch Hoffnung und ruft zum Widerstand! Genauso, wie er es bei dem Ungarnaufstand getan hat und vorher bei dem Aufstand in Ostdeutschland und bei dem Polenaufstand!«
Es folgte Schweigen.
»Die Amerikaner und die Russen sind die Größten und die Stärksten auf der Welt?« fragte Karel endlich.
»Ja«, sagte der Vater. »Und wir gehören zu den Kleinsten und Schwächsten.«
»Man muß sehr froh darüber sein«, sagte Karel, nachdem er überlegt hatte.
»Froh? Weshalb?«
»Ich finde. Wenn wir auch so stark wären, dann müßten wir jetzt lügen wie die mächtigen Amerikaner, oder wir würden so traurig sein und Angst haben wie die mächtigen Russen. Ich meine … Vorhin hast du gesagt, daß sie traurig sind, aber befehlen haben müssen aus Angst …« Karel verwirrte sich. »Oder ist das nicht richtig, was ich denke?«
»Es ist schon richtig«, sagte der Vater. »Und nun iß deine Suppe auf.«
»Du bist sehr klug, Herzel«, sagte die Großmutter.
»Nein, gar nicht. Aber ich möchte es gerne sein«, sagte Karel. Er saß aufrecht am Tisch, die linke Hand über dem linken Knie. Die rechte Hand mit dem Löffel führte er sicher und wohlerzogen zum Mund.
Die Großmutter fragte: »Wie werde ich wissen, daß ihr gut hinübergekommen seid? Wie werde ich wissen, daß euch nichts zugestoßen ist?«
»Uns stößt schon nichts zu«, sagte der Vater.
»Trotzdem. Ich muß es genau wissen. Du bist mein letzter Sohn. Und Karel ist mein einziger Enkel. Außer euch beiden habe ich niemanden mehr.«
»Wir nehmen die Trompete mit«, sagte der Vater. »Wenn wir drüben sind, spiele ich ein Lied, das du kennst. Die Grenze ist so nah, du wirst es bestimmt hören.«
»Ich kann auch schon Trompete blasen, Großmutter!«
»Wirklich, Herzel?«
»Ja!« Karel nickte stolz. »Ich kann ›Škoda lásky‹ und ›Kde domoův můj‹ und ›Plují lodi do Triany‹ und ›Strangers in the Night‹ … und noch andere … Aber die kann ich am besten!«
›Kde domov můj‹ heißt auf deutsch ›Wo meine Heimat ist‹ und ist die Nationalhymne, die anderen Melodien sind Schlager.
»Bitte, spiel ›Strangers in the Night‹«, sagte die Großmutter zu ihrem Sohn. »Das ist doch ein ganz altes Lied, das sie jetzt wieder ausgegraben haben.«
»Ja, Frankie-Boy«, sagte Karel.
»Es war das Lieblingslied von meinem Andrej. Gott hab ihn selig. Und ich habe es auch so gerne. Wirst du dieses Lied spielen, Sohn?«
»Ja, Mutter«, sagte der Vater.
Plötzlich ließ die Großmutter ihren Löffel sinken und bedeckte das kleine Gesicht mit den roten, abgearbeiteten Händen.
Karel starrte sie erschrocken an. Der Vater senkte den Kopf.
»Ist sie so traurig, weil wir hinübergehen in das andere Land?« fragte Karel leise.
Der Vater nickte.
»Aber hier können wir doch nicht bleiben«, flüsterte Karel.
»Darum ist sie ja so traurig«, flüsterte der Vater noch leiser.
4
Um 23 Uhr 15 brachen sie auf.
Die Großmutter hatte sich beruhigt. Sie küßte Karel und ihren Sohn. Und beiden machte sie das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn.
»Leb wohl, Mutter«, sagte der Vater und küßte ihre Hand. Dann hob er die Koffer auf, einen großen und einen kleineren. Karel ergriff das schwarze Futteral, in dem die Jazz-Trompete lag.
Sie verließen das Haus durch den Ausgang zu dem kleinen Gemüse- und Obstgarten hinter dem Haus, denn es erschien dem Vater gefährlich, sich auf der leeren Dorfstraße sehen zu lassen. Seite an Seite ging er mit seinem Sohn in den Mondschein hinaus, der die ganze Landschaft, Bäume, Hecken, Häuser und Felder geisterhaft erscheinen ließ. Sie wanderten durch den Garten, an den Beeten vorbei, unter den Obstbäumen hindurch, und stiegen zuletzt über einen kleinen Zaun, der das Grundstück gegen einen Feldweg abgrenzte.
Die Großmutter war in der Tür stehengeblieben, krumm und lahm, und ihre Greisenlippen formten lautlose Worte: Allmächtiger Gott im Himmel, beschütze bitte meinen Sohn und den Buben, laß sie gut hinüberkommen, und mach, daß ich die Trompete höre. Ich tu alles, was Du willst, lieber Gott, alles, alles, aber bitte laß mich die Trompete hören …
Als der Vater und Karel ihren Blicken entschwunden waren, schloß die Großmutter die Gartentür und eilte in die Küche zurück. Ein Fenster öffnete sie weit, um besser hören zu können, was draußen vorging. Das Licht hatte sie vorher gelöscht. So saß sie nun im Dunkeln, reglos …
Inzwischen hatten der Vater und Karel das Dorf schon hinter sich gelassen und gingen vorsichtig, immer wieder lauschend, hintereinander querfeldein. Hier war noch nirgends gemäht worden. Das Getreide verdeckte Karel fast ganz, dem Vater reichte es bis zur Brust. Die Nacht war sehr warm. Als sie einen Feldweg kreuzten, konnte Karel in der Ferne Lichter leuchten sehen.
»Ist das schon drüben?« flüsterte er.
»Ja«, flüsterte der Vater. »Wir sind gleich am Wassergraben.« Das wesenlose Mondlicht machte ihn plötzlich rasend. Er dachte: Ich muß mich zusammennehmen. Ich darf nicht zuletzt noch die Nerven verlieren. Er flüsterte: »Wenn sie uns entdecken, wirfst du dich sofort hin und rührst dich nicht mehr. Wenn sie dann schreien, du sollst aufstehen und die Hände heben, tust du es. Du tust alles, was sie sagen, verstanden?«
»Ja.«
»Aber wenn ich sage ›Lauf!‹, dann läufst du, egal, was geschieht und was sie schreien. Immer auf die Lichter da drüben zu. Du läufst auf alle Fälle, ganz gleich, was ich noch tue. Wenn ich ›Lauf!‹ sage, dann läufst du!«
»Ja«, sagte Karel wieder. Sein Gesicht leuchtete hell im Mondschein. Das Getreidefeld war nun zu Ende. Ein schmaler Waldstreifen folgte. Fichten standen hier dicht nebeneinander. Der Boden war bedeckt von einer Nadelschicht, die ihre Schritte unhörbar werden ließ. Über die weichen Polster schlichen sie dahin. Immer wieder nach allen Seiten blickend, suchte der Vater von Stamm zu Stamm seinen Weg. Einmal knackte ein Ast unter seinen Schuhen. Da standen sie ein paar Sekunden lang reglos. Dann bewegten sie sich vorsichtig weiter.
Hinter den Bäumen tauchte die Silhouette eines primitiv zusammengezimmerten Wachtturms auf. Das hohe Gerüst mit dem viereckigen Verschlag sah sehr häßlich aus. Nichts regte sich dort oben, kein Licht drang durch die Ritzen des Verschlags. Der Wachtturm stand etwa einen halben Kilometer entfernt. Sie hatten den Waldrand erreicht.
Der Vater legte sich auf den Nadelboden, Karel legte sich dicht neben ihn. Der Boden war warm, die Nadeln rochen stark und würzig. Karel flüsterte in das Ohr des Vaters: »Die Posten – sind die da auf dem Turm?«
»Nein«, flüsterte der Vater in Karels Ohr. »Die Leute im Dorf haben gesagt, auf dem Turm ist niemand. Die Posten stehen bei ihren Panzern, weit verstreut. Und die Panzer haben sie getarnt.« Er sah auf seine Armbanduhr. »Noch elf Minuten bis Mitternacht«, sagte er leise. »Wir müssen warten.«
Karel nickte. Er lag gegen die Erde gepreßt und atmete tief den Geruch des Nadelbodens ein. Wie einfach alles geht, dachte er. Nun haben wir auch schon den Wald hinter uns, und da ist das Wasser.
Das Wasser lag schwarz vor ihnen. Träge floß es in einem schnurgeraden Graben von Norden nach Süden. An manchen Stellen blitzte es auf und reflektierte das Mondlicht. Der ’Wassergraben war etwa fünf Meter breit. Die ersten Flüchtlinge hatten ihn noch durchschwommen. Nun lag ein Fichtenstamm quer über dem künstlichen Flußbett, und in einer Höhe von etwa einem Meter lief ein dünner Draht, an dem man sich festhalten konnte, wenn man auf dem Stamm balancierte. Die Fichte mußte im Wäldchen gefällt und über den etwa zehn Meter breiten Wiesengrund zum Wasser hinuntergeschleppt worden sein. Das Gelände fiel hier zum Graben hin ab.
»Du gehst zuerst hinüber«, flüsterte der Vater. »Der Stamm trägt nur einen Menschen auf einmal, und ich muß außerdem aufpassen, daß er nicht ins Rollen kommt.«
»Wenn ich aber ins Wasser falle … Ich kann nicht schwimmen …«
»Du wirst nicht ins Wasser fallen. Siehst du den Draht?« Der Draht blinkte im Mondlicht. »Daran hältst du dich fest. Wenn du willst, laß die Trompete da. Ich schaffe auch die noch.«
»Mit zwei Koffern? Nein, die Trompete nehme ich!« Karels kleine Faust klammerte sich fest um den Ledergriff des schwarzen Futterals. Danach schwiegen sie. Der Vater nahm den Blick nicht mehr von der Armbanduhr. Die Minuten schienen zu Stunden zu werden, zur ersten Sekunde der Ewigkeit.
Dann, endlich, hörte man den Motor eines Autos.
Weit weg arbeitete der Motor, leise zuerst, wurde etwas lauter, verstummte. Im gleichen Moment begann die Glocke der Dorfkirche Mitternacht zu schlagen.
»Pünktlich«, flüsterte der Vater.
»Jetzt lösen sie sich ab?«
»Ja.« Der Vater sah noch einmal nach allen Seiten, dann gab er Karel einen Klaps. »Los, lauf jetzt. Lauf!«
Gebückt rannte Karel über den feuchten Wiesengrund hinab zum Wasser und dem Fichtenstamm. Zwei Herzschläge später rannte der Vater mit den beiden Koffern hinter ihm her. Während Karel schon auf den Stamm kletterte, stellte der Vater die Koffer ab und setzte sich auf das dicke Baumende.
Mit der linken Hand hielt Karel das Trompetenfutteral fest, mit der rechten packte er den kalten, glatten Draht. Langsam balancierte er auf dem Stamm über dem Wasser hinaus.
»So ist es recht«, flüsterte der Vater.
Der Draht schwankte plötzlich. Karel knickte ein. Einen Moment lang sah es aus, als glitte er ab, dann hatte er sich gefangen. Der Schweiß rann ihm jetzt über das kleine Gesicht, und seine Zähne schlugen vor Aufregung gegeneinander. Jetzt hatte er die Mitte des Wassergrabens erreicht. Er dachte: Nicht hinunterschauen. Wenn ich bloß nicht hinunterschaue, geht alles gut. Das einzige, was ich nicht darf, ist hinunterschauen …
Noch ein Schritt. Noch einer.
Karel keuchte. Der Fichtenstamm wurde dünner, bog sich durch. Krampfhaft sah Karel geradeaus.
Nicht hinunterschauen!
Nun trennten ihn noch eineinhalb Meter vom anderen Ufer. Nun war es noch ein Meter. Nicht hinunterschauen … Nicht hinunterschauen … Der Stamm drehte sich ein wenig. Wieder glitt Karel aus, wieder fing er sich. Noch zwei Schritte …
Er sprang und war an Land. Den Lederbügel des Futterals umklammernd, rannte er gebückt über einen Wiesengrund, der so breit und naß und weich war wie der auf der anderen Seite, bis zum Beginn eines Waldrandes und hinter die ersten Bäume. Dort kauerte er sich nieder. Auch lauter Nadeln, dachte er. Auch lauter Fichten. Alles fast so wie drüben, nur der Wald kleiner.
Er sah, daß der Vater nun auf den Stamm kletterte. Der Vater hielt einen Koffer in der linken Hand, den zweiten, kleineren, hatte er unter den linken Arm geklemmt, und mit der rechten Hand suchte er am Draht Halt, wie Karel es getan hatte. Der Vater kam viel schneller vorwärts. Karel bewunderte seine Geschicklichkeit. Mit so schweren Koffern! Nach wenigen großen Schritten hatte der Vater die Mitte des Stammes erreicht. Als er den ersten Schritt über die Mitte machte, flammten auf dem Wachtturm zwei Scheinwerfer auf, irrten mit rasender Geschwindigkeit den Wassergraben entlang, und dann packten ihre Lichtkegel den Vater, der wie gelähmt in der Bewegung erstarrt war.
Karel schrie unterdrückt auf.
Die grellen Scheinwerfer trafen den Vater und blendeten ihn. Er schwankte auf dem Stamm hin und her und versuchte, den Kopf so zu halten, daß er ins Dunkel blicken konnte.
Entsetzt dachte Karel: Also sind doch Menschen auf dem Turm! Also ist er doch nicht verlassen! Haben die Leute im Dorf den Vater angelogen? Nein, bestimmt nicht. Das waren lauter gute Landsleute. Sie hatten nicht gewußt, daß der Turm wieder besetzt ist – vielleicht erst seit heute nacht. Also eine Falle? Also stimmt das alles nicht mit den Posten bei ihren Panzern, die sich um Mitternacht ablösen?
Karels Gedanken jagten einander in rasender Eile. Eine verzerrte Megaphonstimme dröhnte: »Kommen Sie zurück, oder wir schießen!«
Karel hatte sich auf den Bauch geworfen. Er starrte zum Vater hinüber, als abermals hallend die heisere Stimme ertönte: »Zurück, oder wir schießen!«
Der Vater machte eine groteske Bewegung, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Sein ganzer Körper bog sich dabei zusammen, er ließ die beiden Koffer los. Klatschend flogen sie ins Wasser. Und dann begannen zwei Maschinenpistolen auf den Mann im Scheinwerferlicht zu feuern.
»Lauf!« schrie der Vater gellend. »Lauf, Karel, lauf!«
Die Geschosse, die seinen Körper trafen, rissen ihn herum. Schwer stürzte er in die Tiefe. Die Maschinenpistolen bellten weiter, ihre Kugeln klatschten jetzt auch ins Wasser, ließen sprühend Fontänen aufsteigen, und dann trafen sie wieder den Vater, der, mit dem Gesicht nach unten, langsam abtrieb.
Der erste Scheinwerfer folgte dem Vater, der zweite hob sich zum anderen Ufer, zum Waldrand, an dem Karel lag. In der gleichen Sekunde kam Leben in den Jungen. Er sprang auf und rannte los. Er rannte, so schnell er konnte, über den Nadelboden, so schnell, wie er noch nie im Leben gerannt war. Er stürzte bei einer Wurzel, erhob sich sofort wieder, um weiterzurennen, sein Herz klopfte rasend, er bekam kaum Luft, aber immer noch lief er.
Mondschein erleuchtete den weichen Boden zwischen den Bäumen, hellbraun, dunkelbraun, grün. Auf dem glatten Teppich der Nadeln schlidderte Karel wild dahin in rasendem Zickzack zwischen den Baumstämmen hindurch. Er sah ein Feld. Er stürzte zweimal, als er über nun harte Erde rannte. Er erreichte einen Feldweg, an dessen Rändern viele Obstbäume standen. Hinter sich, beim Wassergraben, hörte er undeutliche Männerstimmen. Die Stimmen brachten ihn ein wenig zu sich. Er sank auf dem staubigen Weg zusammen Keuchend sah er zum Mond empor. Das Futteral mit der Trompete lag hinter ihm. Sein Vater fiel ihm ein. Er hatte ihn völlig vergessen gehabt. Jetzt schrie er, so laut er konnte: »Vater!«
Und noch einmal: »Vater!« Und wieder: »Vater!«
Es kam keine Antwort.
Ein furchtbares Schluchzen erstickte Karels Stimme Wie ein Tier begann er auf allen vieren im Staub herumzukriechen, und dabei kam seine Stimme wieder, und er schrie von neuem: »Vater! … Vater! … Vater!«
Er stand taumelnd auf und preßte die Hände gegen die Augen, weil er so weinen mußte. Um ihn drehte sich alles. Er dachte immer dasselbe: Vater ist tot. Sie haben Vater erschossen. Vater ist tot. Mein Vater. Sie haben ihn erschossen. Trotzdem schrie er mit dünner, verzweifelter Kinderstimme: »Vater! Hier bin ich, Vater! Vater! Komm zu mir!«
Der Vater antwortete nicht. Drüben kläfften Hunde, fluchten Soldaten. Wieder schrie Karel. Dann drehte sich sein Magen um, und er übergab sich würgend. Nun wimmerte er: »Vater … Vater … Vater …« Und verstummte jäh.
Vielleicht war der Vater gar nicht tot? Vielleicht war er an Land geschwommen und suchte seinen Karel nun irgendwo in dieser silbernen Finsternis? Vielleicht hörte er Karel nicht?
Das Kind fuhr auf.
Ein Gedanke war ihm gekommen Wenn man seine Stimme schon nicht hörte – die Trompete hörte man bestimmt ganz weit! Vater selber hatte es gesagt. Er wollte doch für die Großmutter dieses Lied spielen … Wenn Karel es nun spielte, dann mußte der Vater ihn hören. Mußte! Mußte! Mußte!
Karel lachte und weinte jetzt durcheinander Ihm war so schwindlig, daß er dauernd umfiel, als er zu dem schwarzen Futteral zurücklief, das am Wegrand lag. Mit zitternden Händen öffnete er es. Nun würde der Vater zu ihm finden! Wenn er nur lange genug Trompete spielte, würde der Vater wieder bei ihm sein. Karel weinte und lachte und lachte und weinte. Er hob die schwere, goldglänzende Trompete mit beiden Händen zum Mund. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel um. Sofort erhob er sich.
»Vater …«, flüsterte er, »warte, Vater, warte, gleich …«
Danach fiel er wieder in sich zusammen.
Vor dem nächsten Versuch, die Trompete an die Lippen zu setzen, lehnte Karel sich vorsichtshalber gegen einen Apfelbaum, dessen Äste, dicht mit Früchten beladen, tief herabhingen. Die kleinen Schuhe hakten sich im Erdreich fest. So stand Karel da, das Instrument erhoben.
Und nun begann er zu blasen. Laut und sehnsuchtsvoll ertönte die alte Melodie. Nicht jeder Ton, den Karel der Trompete entlockte, war ein richtiger, klangreiner Ton, aber deutlich war das Lied zu erkennen.
›Strangers in the Night‹ blies der kleine Junge im Niemandsland der Grenze. Er dachte: Vater wird es hören. Er wird mich finden. Er ist nicht tot. Es war alles ein Trick von ihm. Er ist klug. Er hat so getan, als wäre er getroffen, und dann hat er sich ins Wasser fallen lassen und ist an das Ufer auf dieser Seite geschwommen. Ja, ganz bestimmt war es so. So war es, ganz bestimmt …
»Hör mal«, sagte der Oberwachtmeister Heinz Subireit, der in einem Geländewagen des Bundesgrenzschutzes etwa zwei Kilometer von Karel entfernt über den Feldweg Patrouille fuhr, zu seinem Freund, dem Truppjäger Heinrich Felden.
»Strangers in the Night«, sagte Felden, am Steuer des Wagens. »Ein Verrückter«, sagte Subireit. »Ein Verrückter, der hier Trompete bläst.«
»… exchanging glances, wond’ring in the night«, sang Felden leise mit.
›… what were the chances we’d be sharing love before the night was through‹, blies Karel. Komm zu mir, Vater. Bitte, komm. Ich habe solche Angst. Vater, bitte, lieber Vater.
»… something in your eyes was so inviting«, sang der Truppjäger Felden am Steuer.
»Hör auf«, sagte der Oberwachtmeister Subireit. »Mach schon. Da vorne muß das sein. Wollen mal sehen, was da los ist.«
›… something in your smile was so exciting‹, blies Karel, und dicke Tränen rannen über seine Kinderwangen. Vater lebt. Vater lebt. Er kommt zu mir. Jetzt hört er mich. Ja, ja, jetzt hört er mich …
›… little did we know that love was just a glance away …‹ Das Lied der Trompete hob sich von der alten gleichgültigen Erde empor zu dem alten gleichgültigen Himmel mit seinem Mond und seinen unendlich fernen, kalten Sternen. Es flog über das Land. Die Soldaten, die den Toten aus dem Wassergraben zogen, hörten es ebenso wie die Großmutter in ihrer niedrigen Küche.
›… a warm embracing dance away, and ever since that night we’ve been together, lovers at first sight …‹
Vor dem Herd kniete die Großmutter schwerfällig nieder, und mit gefalteten Händen sprach sie diese Worte: »Ich danke Dir, lieber Gott, daß Du meinen Sohn und das Kind gerettet hast.«
Noch immer tönte die Melodie der Trompete durch die Nacht. Die Großmutter kniete auf dem Küchenboden und mußte weinen über so viel Glück.
5
»… und weiter und weiter hat er sein Lied gespielt, der arme kleine Kerl, bis daß die Soldaten vom Bundesgrenzschutz ihn gefunden haben«, erzählte Fräulein Luise Gottschalk. Da war es etwa 15 Uhr 30 am 12. November 1968. Eine grelle Spätherbstsonne stand in einem wolkenlosen, sehr blauen Himmel; es war erstaunlich warm für Mitte November. Zwischen dem früchteschweren Apfelbaum an der bayerisch-tschechischen Grenze und jener Fluchtnacht in der ersten Morgenstunde des 28. August und dem Ort und dem Tag, an dem ich Fräulein Luise kennenlernte, lagen rund tausend Kilometer und genau elf Wochen. In Norddeutschland, in einer Gegend tiefster Einöde zwischen Bremen und Hamburg, hatte ich Fräulein Luise kennengelernt – vor etwa zwei Stunden, gleich nachdem wir hier angekommen waren, mein Freund Bert Engelhardt und ich.
Engelhardt war ein großer, schwerer Mann von 56 Jahren, mit sehr hellen Augen und Haaren, einem rosigen Jungengesicht und einem Leben so voller Abenteuer und Gefahren, daß diesen Mann nichts, aber auch gar nichts mehr erschüttern konnte. Was sage ich erschüttern? Auch nur im entferntesten berühren! Er hatte ein großes Herz und ein fröhliches Gemüt und Nerven aus Stahl. Das hielt ihn so jung. Keiner hätte sein Alter erraten. Er lächelte fast immer, herzlich, freundschaftlich, zuvorkommend. Er lächelte auch, wenn er ärgerlich war. Um die Stirn trug Bertie einen weißen Verband. Er war gestern abend noch erneuert worden. Den Verband brauchte Bertie, um eine Stirnwunde zu schützen. Die hatte er sich vor 72 Stunden zugezogen, in Chicago.
Seit 1938 war Bertie Fotoreporter. Angefangen hatte er bei der ›Berliner Illustrirten‹. Er wußte selbst nicht mehr, wie oft er seitdem um die Welt geflogen war zu sensationellen politischen Konferenzen und sensationellen Mordprozessen, zu Filmstars, Millionären, Nobelpreisträgern, Leprakranken, auf die Schmugglerinsel Macao, in die schlimmsten Elendsviertel Kalkuttas, tief, tief hinein nach Tibet und China und Brasilien und Mexiko, zu den Goldminen Südafrikas, in die grüne Hölle Borneos, die Antarktis, die Weiten Kanadas, und immer wieder hinein in Kriege. Es waren mehr Kriege, als er sich hatte merken können, und er war immer dorthin geschickt worden, wo es am dreckigsten und am mörderischsten zuging, natürlich, und an Kriegen hatte es keinen Mangel gegeben, seit Bertie im Geschäft war. Er besaß viele internationale Auszeichnungen, und eine Ausstellung mit seinen besten Fotos wanderte durch die ganze Welt, so wie Bertie durch diese Welt trampte. Er war ein paarmal leicht verwundet worden in den vielen großen und kleinen fremden Kriegen, und einmal war er schwer verwundet worden in unserem eigenen Zweiten Weltkrieg, den wir angefangen und verloren hatten. Am rechten Bein war es passiert. Bertie hinkte immer noch leicht.
Ich, Walter Roland, war gerade 36 Jahre alt geworden, als wir in die wüste und seltsame, süße und grausige Geschichte hineinschlidderten, die ich hier berichten will, und wenn Bertie viel jünger aussah, als er tatsächlich war, dann sah ich älter aus, als ich war. Ziemlich viel älter, o ja. Ich war hochgewachsen, aber hager. Ich hatte nicht Berties frische Gesichtsfarbe, meine war gelblich, unter den braunen Augen, die stets müde wirkten, lagen schwere Ringe, das braune Haar war an den Schläfen bereits ganz weiß und durch und durch von weißen Strähnen durchzogen. Ewig appetitlos, wenn Ihnen das etwas sagt. Ewig mit einer Zigarette im Mundwinkel. Ewig mit einem angewiderten Zug um die Lippen, wie viele behaupteten. Wird schon stimmen. So wie ich mich fühlte. So wie ich lebte. Zuviel Arbeit, zu viele Weiber, zu viele Zigaretten, zuviel Suff. Suff vor allem. Seit Jahren konnte ich ohne Whisky einfach nicht mehr auskommen. Wenn da nicht stets eine Flasche griffbereit war, bekam ich Platzangst. Unterwegs trug ich einen großen Hüftflacon aus Silber bei mir. Ab und an nämlich wurde ich blaß und fühlte mich gräßlich, einfach gräßlich, und ich hatte dann immer große Angst, umzukippen. Na ja, in diesen Fällen brauchte ich ein paar mächtige Schlucke, und es ging wieder. Reine Frage des Alkoholspiegels.
Ich war Schreiber. Top-Autor der Illustrierten BLITZ. Seit vierzehn Jahren. Bei Bertie waren es schon achtzehn Jahre. Zwei Asse, er und ich. Ich will mich nicht berühmen, wahrhaftig nicht. Bestünde auch nicht der geringste Anlaß dazu. Aber Asse in dieser Jauchegrube waren wir. Unter Exklusiv-Vertrag. Bertie der höchstbezahlte Fotograf Deutschlands, ich der höchstbezahlte Schreiber. Sie kennen doch BLITZ. Eine der drei größten Illustrierten der Bundesrepublik. Außerdem – aber davon erzähle ich noch. Da laßt mich nur ran, da habe ich eine Menge zu sagen. Später.
Anfangs war alles schön gewesen und ich auch noch nicht so versoffen und so verhurt. Dann hatte sich allerhand geändert bei BLITZ. Und ich hatte mich auch verändert. Bertie nicht. Der blieb immer derselbe normale, zuverlässige, gutmütige und mutige Kumpel. Nur ich drehte durch mit den Jahren.
Weil ich soviel verdiente, war ich ein Snob geworden, der sich Anzüge, Hemden, ja sogar seine Schuhe nach Maß machen ließ; der einen der verrücktesten Wagen fuhr; der in einem Luxus-Penthaus wohnte; und der nur ›Chivas Regal‹ soff, den teuersten Whisky der Welt. Klar. Etwas anderes kam nicht in Frage. Die Bienen mußten auch immer erster Klasse sein und ein Vermögen kosten.
In den letzten Jahren betäubte ich mich mehr und mehr und immer heftiger mit Weibern und Whisky und Roulette. Das kam, weil mich in den letzten Jahren mehr und mehr alles ankotzte, was ich für BLITZ zu schreiben hatte – ich werde auch davon noch erzählen. Es gab Zeiten, nicht oft zum Glück, da konnte ich nicht arbeiten, da mußte ich im Bett bleiben und Valium und stärkeres Zeug in Mengen schlucken, um durchschlafen zu können, einen Tag und eine Nacht, zwei Tage und zwei Nächte, denn da war ich plötzlich völlig erledigt von diesem schauderhaften Gefühl der Schwäche und Panik und Hilflosigkeit, da bekam ich keine Luft und hatte Herzbeschwerden, und mir war taumelig, und ich konnte nicht richtig denken, und ich hatte Angst, Angst, Angst. Weiß nicht, wovor. Vor dem Tod? Auch, aber nicht in der Hauptsache. Kann nicht sagen, was für eine Art Angst das war. Vielleicht kennen Sie sie gleichfalls.
Angeknackste Leber. Und noch allerhand natürlich. Kam von dem Leben, das ich führte. Deshalb hatte ich meinen Schakal. Ich nannte den Zustand so, weil mich zuzeiten immer das Gefühl überfiel, daß ein solches Vieh in der Nähe kreiste und immer näher kam und sich über mich neigte, bis ich an seinem höllischen Atemgestank fast erstickte.
Nach zwei Tagen spätestens waren die Anfälle, von denen ich eben erzählt habe, vorbei. Dann mußte ich mich schnellstens richtig vollaufen lassen, und alles ging wie geschmiert, ich konnte wieder arbeiten. Daß ich immer noch, bei Tag und bei Nacht, mehr arbeiten konnte als das ganze andere Schreiber-Gesocks, das wir hatten, zusammen, war mein Stolz. Erst wenn ich das nicht mehr konnte, wollte ich mein Leben ändern. Auch so eine Scheiß-Idee von mir. Zum Arzt ging ich nur, wenn es unbedingt sein mußte, denn was die Ärzte sagten, das kannte ich auswendig. Ich solle bloß so weitermachen, dann würde ich keine vierzig. Sagten sie mir seit vier Jahren. Alle. Wunderbare Menschen, Ärzte. Verehrungswürdig.
Der Verlag von BLITZ und die Redaktion und das Druckhaus befanden sich in Frankfurt. Sie werden fragen, warum man gerade Bertie und mich hier herauf in die Einöde geschickt hatte, uns, die höchstbezahlten Leute. Gab natürlich einen Grund. Wenn ich Ihnen mehr von BLITZ erzählt habe, werden Sie alles begreifen. Wir waren also da. Und hatten Fräulein Luise kennengelernt. Und wußten noch nicht, was uns bevorstand. Keine blasse Ahnung hatten wir.
»… hat sich gewehrt wie ein Irrer, der Karel«, erzählte Fräulein Luise. »Hat da nicht wegwollen. Hat doch geglaubt, sein Vater lebt und kommt zu ihm …« Sie hatte Bertie und mir die ganze Geschichte der Flucht, die ich schon aufgeschrieben habe, in ihrem Büro erzählt. Dieses sehr große, sehr häßliche Arbeitszimmer lag in einer Baracke, in der noch zahlreiche andere Büros untergebracht waren. Schreibtisch, Telefon, Schreibmaschine, Stühle, Regale mit Aktenordnern gab es hier und eine elektrische Kochplatte, auf die das Fräulein einen Topf Wasser gestellt hatte, weil sie uns Kaffee machen wollte. (»Hab ich Ihnen jetzt schon soviel gezeigt, machen wir kleine Pause. Meine Füß. Nach’m Kaffee führ ich Ihnen meine tschechischen Kinder vor und erzähl Ihnen alles über sie. Diesen Buben hätt ich gleich da …«) Auf dem staubigen Fensterbrett standen drei Tontöpfe, in denen traurig anzusehende Kakteen dahinwelkten.
Dem Fenster gegenüber hing eine große Zeichnung. Nur in den Farben Schwarz, Grau und Weiß zeigte sie einen gewaltigen Berg, bestehend aus Totenschädeln und Knochen. Über dieser Stätte des Grauens erhob sich, in einen lichten Himmel hinein, ein mächtiges Kreuz. Ich sah genau hin. Rechts unten las ich: ›GOTTSCHALK 1965‹. Fräulein Luise hatte dieses düstere Bild also selbst gemalt. Unter ihm befand sich ein Kanonenofen mit mehrfach gewinkeltem Rohr, das schließlich durch eine Außenwand der Baracke führte. Brannte kein Feuer im Ofen, war doch noch so warm an diesem 12. November.
»Hat mit den Soldaten gekämpft, der Karel«, sagte Fräulein Luise. »Mit Fäusten und Füßen und Nägeln und Zähnen. Ist ja nicht richtig im Kopf gewesen damals.«
»Was haben sie mit ihm gemacht?« fragte ich. Ich saß dem Fräulein gegenüber auf einem umgedrehten Stuhl, die Ellbogen über der Lehne. Fern, sehr fern, fühlte ich den Schakal. Keine Bange. In der Hüfttasche meiner Hose steckte der Flacon mit ›Chivas‹. Ich paßte schon immer sehr auf mich auf.
»Angst gekriegt haben sie. Über Funk Ambulanz gerufen mit Arzt. Der hat Karel Spritze gegeben, da ist er zusammengeklappt und war ruhig, und sie haben ihn transportieren können.«
»Kennen«, sagte sie. Schon seltsam, hier oben im Norden jemanden mit böhmischem Akzent zu treffen.
»Wohin haben sie ihn denn gebracht?« fragte ich und streifte die verglühte Krone meiner Gauloise in einen Aschenbecher aus gehämmertem Aluminiumblech. Ich rauchte nur schwarze französische Zigaretten. Neben dem Aschenbecher lag auf dem Schreibtisch einer der Blocks, die ich immer mitnahm. Ich stenographierte sehr gut und schnell. Und mein Gedächtnis funktionierte auch noch. Viele Seiten waren bereits gefüllt, denn ich hatte hier oben schon eine Menge gesehen. Was ich gehört hatte, war nicht ins Stenogramm übertragen. Ich besaß einen Kassetten-Recorder für Netz und Batterie. Nahm ich auch überall mit hin. Jetzt stand das kleine Gerät mit dem kleinen Mikrophon auf dem Schreibtisch, eingeschaltet. Ich hatte immer eine Menge Kassetten bei mir und verwendete so ein Gerät oder ein anderes bei jeder Recherche. Der Recorder zeichnete auf, seit wir Fräulein Luise begegnet waren. Mit Pausen dazwischen natürlich.
»Wohin er gebracht worden ist? Na ja, erst dahin, dann dorthin, endlich nach München. In eine Klinik. Schwerer Schock. Sechs Wochen hat er im Krankenhaus bleiben müssen, mein armer Kleiner. Dann haben sie ihn uns hergeschickt, ins Lager hier.«
»Das heißt, er ist schon seit fünf Wochen da.«
»Ja. Wird noch länger bleiben.«
»Wie lange?«
»Solange ich es durchsetzen kann. Ich will nicht, daß er in irgend so ein Heim kommt Wir suchen doch immer noch nach der Mutter. Die soll in Westdeutschland leben. Sonst hat er keinen Menschen, der Karel. Seit er hier ist, redet er andauernd von seiner Mutter. Andauernd!« Das Fräulein sagte, an ihrem vollgeräumten Schreibtisch sitzend: »Ist eine schlimme Welt, meine Herren. Besonders für Kinder. Ist schlimm, solange ich arbeit als Fürsorgerin. Und vorher war sie nicht besser. Darum bin ich ja Fürsorgerin geworden. Denn warum? Was können die Kinder dafür, daß sie so schlecht ist, die Welt?«
»Seit wann sind Sie Fürsorgerin?« fragte ich.
»Seit 1924.«
»Was?«
»Ja, da schauens, gelt? Vierundvierzig Jahre! Fast mein ganzes Leben war ich Fürsorgerin, immer nur für die Kinder da. Mit achtzehn hab ich angefangen. War eine böse Zeit, damals, gleich nach der Inflation. Hab ich zuerst in Wien gearbeitet. Zwanzigster Bezirk. Ein Elend, sage ich Ihnen. Hunger. Kein Essen, kein Geld, Dreck und Armut, so viel Armut. Haben wir Kinderkrippen eingerichtet. Bin ich betteln gegangen zu die Ämter um Geld für meine Kinder. Füß hab ich mir wund gelaufen damals. Ist nicht besser geworden. Weltwirtschaftskrise 1929. Noch mehr Elend danach! In der Zeit haben sie mich …« Sie brach jäh ab.
»Was haben sie?« fragte ich. »Und wer hat was?«
»Nichts«, sagte sie hastig, »gar nichts. Noch mehr Elend nach 1929! Arbeitslose. Man hätte glauben mögen, das halberte Österreich ist arbeitslos, wie daß dann der Hitler gekommen ist. Darum hat ers ja auch so leicht gehabt. Denn warum? Arbeit und Brot hat er versprochen, nicht?«
»Ja«, sagte ich. »Und als der Hitler da war?«
»Bin ich Fürsorgerin geblieben natürlich! Ist doch gleich nachher der Krieg losgegangen. Durch den ganzen Krieg hab ich mich gekümmert um die armen Kinder. Bin ich mit ihnen aufs Land gezogen, wie daß der Krieg immer ärger geworden ist. Ausgerechnet in meine Heimat. Ganz nah bei Reichenberg! 1945, im Januar, da haben wir weg müssen. 250 Kinder und nur drei Fürsorgerinnen. Hab ich sie durch Schnee und Eis geleitet« (sie sagte wirklich »geleitet«) »bis nach München, in Sicherheit vor die Stadt, auch in ein Lager. Alle hab ich durchgebracht, nur drei sind mir erfroren in der großen Kält …« Sie sah traurig ins Leere. »In der großen Kält«, wiederholte sie verloren.
Fräulein Gottschalk (»Nennens mich Fräulein Luise«, hatte sie gleich zur Begrüßung gebeten) war nur mittelgroß und machte einen erschöpften, überarbeiteten Eindruck. Sie war sehr mager. Ihr weißes Haar leuchtete richtig, sie trug es straff nach hinten gekämmt, mit einem Knoten im Genick. Die Augen waren groß und blau und voll unendlicher Freundlichkeit – wie das ganze zarte, schmale, blasse Gesicht mit den breiten, aber blutleeren Lippen. Sie hatte noch sehr gute, kräftige Zähne. Zu einem grauen Rock trug sie eine alte braune Strickjacke, aus der am Hals der Kragen einer Bluse sah, und an den Füßen Stiefeletten, die ihre geschwollenen Beine stützen sollten. (»Tu ich mir bissel schwer mitm vielen Gehen. Wasser, wissens, in die Füß.« – »Fieß«, hatte sie gesagt. – »Aber nicht, daß ich mich beklagen tät! Hab mein ganzes Leben laufen müssen, immerzu laufen. Halten schon was aus, die Füß …«)
»Und dann«, sagte ich, drückte den Stummel der Zigarette aus und zündete eine neue an mit einem Feuerzeug, natürlich aus 18karätigem Gold, »dann kamen die Amerikaner nach Bayern, nicht wahr?«
Fräulein Luises Blick kehrte aus der Leere zurück. Sie nickte.
»Ja. Freundliche Leut. Gute Leut. Haben mir Essen und Kleider und Kohlen und Baracken gegeben für meine Kinder. Russen auch sehr freundliche Leut!« sagte sie schnell. »Denen ihre Panzer haben uns überholt auf der großen Flucht. Haben die russischen Soldaten Essen heruntergeworfen und Decken aus ihre Panzer – für die Kinder. Und ein paar Pferdegespanne organisiert. Ohne die Freundlichen unter die Russen hätten wir es gar nicht geschafft bis zu die Freundlichen unter die Amis Komisch, nicht? Krieg und Tod und Verderben, und schlecht waren die Menschen, ich habs doch erlebt. Aber im größten Elend haben unsere Feinde geholfen, alle, meinen Kindern, auch die Russen, trotz allem, was sie erlebt haben, ach ja …« Sie seufzte. Und der Recorder zeichnete auf, zeichnete auf. »No, hab ich dann also unter die Amis gesorgt für die Kleinen in Bayern, bis zur Spaltung und zur Blockade, bis daß die vielen, vielen Menschen aus der Zone herübergekommen sind, und darunter auch wieder die Kinder. Da habens mich hier herauf geschickt …«
»Was? 1948?« sagte ich verblüfft und ließ fast die Zigarette fallen. »Seit zwanzig Jahren sind Sie schon hier?«