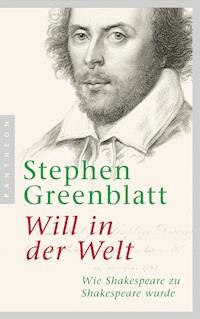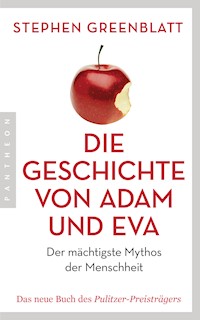12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was uns Shakespeare über Trump, Putin und Co. verrät
Wie kann es sein, dass eine große Nation in die Hände eines Tyrannen fällt? Warum akzeptieren die Menschen die Lügen eines Mannes, der ihrem Land so offensichtlich schadet? Und gibt es eine Chance, den Tyrannen zu stoppen, ehe es zu spät ist? In seinen Dramen - von "Richard III." bis "Julius Cäsar" - hat sich William Shakespeare immer wieder mit diesen Fragen beschäftigt und vom Aufstieg der Tyrannen, von ihrer Herrschaft und ihrem Niedergang erzählt. Stephen Greenblatt, einer der renommiertesten Shakespeare-Experten unserer Zeit, zeigt uns, wie präzise und anschaulich der Dichter aus Stratford das Wesen der Tyrannei eingefangen hat – und wie erschreckend aktuell uns dies heute erscheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Was uns Shakespeare über Trump, Putin & Co. verrät
Wie kann es sein, dass eine große Nation in die Hände eines Tyrannen fällt? Warum akzeptieren die Menschen die Lügen eines Mannes, der ihrem Land so offensichtlich schadet? Und gibt es eine Chance, den Tyrannen zu stoppen, ehe es zu spät ist? In seinen Dramen – von »Richard III.« bis »Julius Cäsar« – hat sich William Shakespeare immer wieder mit diesen Fragen beschäftigt und vom Aufstieg der Tyrannen, von ihrer Herrschaft und ihrem Niedergang erzählt. Stephen Greenblatt, einer der renommiertesten Shakespeare-Experten unserer Zeit, zeigt uns, wie präzise und anschaulich der Dichter aus Stratford das Wesen der Tyrannei eingefangen hat – und wie erschreckend aktuell uns dies heute erscheint.
Zum Autor
Stephen Greenblattist Professor für Englische und Amerikanische Literatur und Sprache an der Universität Harvard. Er ist einer der angesehensten Forscher zu Shakespeares Werk sowie zur Kultur und Literatur in der Renaissance. Greenblatt ist Herausgeber der »Norton Anthology of English Literature« sowie Autor mehrerer Bücher, darunter die hochgelobte Shakespeare-Biografie »Will in der Welt« (2004). Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen geehrt, u. a. mit dem National Book Award und dem Pulitzerpreis für sein Werk »Die Wende« (2012). Bei Siedler erschien zuletzt »Die Geschichte von Adam und Eva. Der mächtigste Mythos der Menschheit« (2018).
STEPHEN GREENBLATT
DER TYRANN
Shakespeares Machtkunde für das 21. Jahrhundert
Aus dem Englischen von Martin Richter
Siedler
Die Originalausgabe ist 2018 unter dem Titel »Tyrant. Shakespeare on Politics« bei W. W. Norton, New York, erschienen. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
September 2019
Copyright © by Stephen Greenblatt, 2018
© 2018 für die deutsche Ausgabe by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Bernd Klöckener
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22862-0 V002 www.siedler-verlag.de
Für Joseph Koerner und Luke Menand
INHALT
KAPITEL 1VERBORGENE PERSPEKTIVEN
KAPITEL 2PARTEIPOLITIK
KAPITEL 3POPULISMUS ALS BETRUG
KAPITEL 4EINE FRAGE DES CHARAKTERS
KAPITEL 5ERMÖGLICHER
KAPITEL 6TRIUMPH DER TYRANNEI
KAPITEL 7DIE ANSTIFTER
KAPITEL 8WAHNSINN IN GROSSEN
KAPITEL 9FALL UND WIEDERAUFSTIEG
KAPITEL 10AUFHALTSAMER AUFSTIEG
CODA
DANKSAGUNG
ANHANG
ANMERKUNGEN
REGISTER
KAPITEL 1 VERBORGENE PERSPEKTIVEN
Vom Anfang seiner Karriere in den frühen 1590er-Jahren bis zu ihrem Ende rang Shakespeare immer wieder mit einer zutiefst beunruhigenden Frage: Wie ist es möglich, dass ein ganzes Land einem Tyrannen in die Hände fällt?
»Ein König herrscht über willige Untertanen, ein Tyrann über unwillige«, schrieb der einflussreiche schottische Gelehrte George Buchanan im 16. Jahrhundert. Die Institutionen einer freien Gesellschaft sind dazu geschaffen, jene abzuwehren, die, mit Buchanans Worten, »Macht nicht für ihr Land, sondern für sich ausüben würden, denen nicht am Gemeinwohl liegt, sondern an ihrem eigenen Vergnügen«.1 Unter welchen Umständen, fragte sich Shakespeare, erweisen sich solche hochgeschätzten Institutionen, die tief verwurzelt und unüberwindlich schienen, plötzlich als fragil? Warum lassen sich so viele Menschen in die Irre führen, obwohl sie wissen, dass man sie belügt? Wie kommt eine Gestalt wie Richard III. oder Macbeth auf den Thron?
Ein solches Unheil war für Shakespeare ohne einen weiten Kreis von Mittätern nicht denkbar. Seine Dramen erkunden die psychischen Mechanismen, die eine ganze Nation dazu bewegen, ihre Ideale und sogar ihr Eigeninteresse aufzugeben. Wie kann es sein, so fragte er, dass jemand sich von einem Führer angezogen fühlt, der zum Regieren offensichtlich ungeeignet ist, der keine Selbstbeherrschung kennt, durch Hinterhältigkeit und Niedertracht brilliert oder sich nicht um die Wahrheit schert? Unter welchen Umständen wirken Zeichen von Verlogenheit, Rohheit oder Grausamkeit nicht abstoßend, sondern attraktiv, ja, erregen sogar glühende Bewunderung? Warum geben sonst stolze Menschen ihre Selbstachtung auf und unterwerfen sich der Unverfrorenheit des Tyrannen, seiner Überzeugung, ungestraft sagen und tun zu können, was er will, seiner spektakulären Schamlosigkeit?
Shakespeare stellte wiederholt den tragischen Preis dieser Unterwerfung dar – die moralische Korrumpierung, die ungeheure Vergeudung von Ressourcen, den Verlust an Menschenleben – und die verzweifelten, schmerzhaften, heroischen Anstrengungen, die nötig sind, um die Gesundheit einer angeschlagenen Nation wenigstens einigermaßen wiederherzustellen. Gibt es eine Möglichkeit, fragen die Dramen, das Abgleiten in eine gesetzlose Willkürherrschaft aufzuhalten, bevor es zu spät ist, irgendein wirksames Mittel, um die gesellschaftliche Katastrophe abzuwenden, die Tyrannei unabdingbar mit sich bringt?
Der Dramatiker bezichtigte Englands Herrscherin Elisabeth I. nicht der Tyrannei. Ganz gleich, was Shakespeare insgeheim wohl dachte – es wäre Selbstmord gewesen, so etwas auf der Bühne anzudeuten. Seit 1534, unter der Regierung ihres Vaters Heinrichs VIII., erklärte ein Gesetz es zum Hochverrat, den Herrscher als Tyrannen zu bezeichnen.2 Die Strafe für solch ein Verbrechen war der Tod.
In Shakespeares England gab es keine freie Meinungsäußerung, weder auf der Bühne noch sonst irgendwo. Die Aufführungen eines angeblich umstürzlerischen Stücks mit dem Titel Die Hundeinsel brachte den Dramatiker Ben Jonson 1597 ins Gefängnis und zog einen – zum Glück nicht ausgeführten – Befehl der Regierung nach sich, alle Londoner Theater niederzureißen.3 Spitzel besuchten die Aufführungen in der Hoffnung, den Behörden etwas als subversiv Deutbares anzeigen zu können, um eine Belohnung dafür zu kassieren. Besonders riskant waren Versuche, sich kritisch zu aktuellen Ereignissen oder prominenten Persönlichkeiten zu äußern.
Wie in modernen totalitären Regimen entwickelten die Menschen Techniken der verschlüsselten Rede, mit denen sie mehr oder weniger indirekt über das sprechen konnten, was sie am meisten bewegte. Doch Shakespeares Vorliebe für die Verschiebung von Zeit und Ort war nicht allein durch Vorsicht motiviert. Er scheint gespürt zu haben, dass er klarer über die Fragen nachdachte, die seine Welt bewegten, wenn er sie nicht direkt anging, sondern eine verborgene Perspektive wählte. Seine Stücke legen nahe, dass er der Wahrheit durch den Kunstgriff der Fiktion oder der historischen Distanz gerecht werden konnte, ohne daran zugrunde zu gehen. Darum faszinierten ihn der legendäre römische Feldherr Gaius Marcius Coriolanus oder der historische Julius Cäsar, daher reizten ihn Figuren aus englischen und schottischen Chroniken wie York, Jack Cade, Lear und vor allem die exemplarischen Tyrannen Richard III. und Macbeth. Und daher auch zogen ihn frei erfundene Figuren an wie der sadistische Kaiser Saturninus in Titus Andronicus, der korrupte Statthalter Angelo in Maß für Maß, der paranoide König Leontes im Wintermärchen.
Shakespeares Popularität lässt darauf schließen, dass viele seiner Zeitgenossen dasselbe empfanden. Befreit von den aktuellen Umständen sowie den endlos wiederholten Floskeln über Patriotismus und Gehorsam, konnte das, was er schrieb, schonungslos ehrlich sein. Der Dramatiker blieb seinem Ort und seiner Zeit verbunden, war aber nicht ihr bloßer Sklave. Was zum Verzweifeln unklar schien, das wurde nun in aller Schärfe deutlich, und er brauchte nicht über das zu schweigen, was er sah.
Shakespeare verstand auch etwas, das in der heutigen Zeit zutage tritt, wenn ein bedeutendes Ereignis – das Ende der Sowjetunion, der Zusammenbruch des Immobilienmarktes, ein verblüffendes Wahlergebnis – ein grelles Licht auf eine beunruhigende Tatsache wirft: Selbst jene, die zum innersten Zentrum der Macht gehören, haben oft keine Ahnung, was geschehen wird. Obwohl sich auf ihren Schreibtischen Berichte, Hochrechnungen und Prognosen türmen, obwohl sie ein kostspieliges Netzwerk von Spionen und Experten unterhalten, tappen sie fast völlig im Dunkeln. Am Rande stehend, hegt man den Traum, wenn man nur nahe genug an diese oder jene Schlüsselfigur herankäme, dann wüsste man, was wirklich vor sich geht und was zu tun wäre, um sich selbst oder sein Land zu retten. Doch dieser Traum ist eine Illusion.
Zu Beginn eines seiner Historiendramen führt Shakespeare die Figur des Gerüchts ein. Ihr Kostüm ist »mit Zungen bemalt«, und ihre Aufgabe besteht darin, unablässig durch »Argwohn, Misstrauen, Mutmaßung« (2 Heinrich IV., Einführung, 16) aufgeblasene Geschichten in Umlauf zu bringen.4 Die Wirkungen sind schmerzhaft offenkundig – fatal fehlgedeutete Zeichen, trügerischer Trost, blinder Alarm, plötzliche Umschwünge von wilder Hoffnung zu abgrundtiefer Verzweiflung. Und am meisten getäuscht sind nicht die Angehörigen der breiten Masse, sondern eher jene, die über Privilegien und Macht verfügen.
Für Shakespeare war es also leichter, klar zu denken, wenn das Geräusch dieser schwatzenden Zungen verebbte, und leichter, die Wahrheit aus einem strategischen Abstand zur Gegenwart zu sagen. Die verborgene Perspektive erlaubte es ihm, falsche Annahmen, altehrwürdige Überzeugungen und Glaubensirrungen beiseitezuschieben und unbeirrt das in den Blick zu nehmen, was darunter lag. Darum sein Interesse für die Welt der Antike, wo christliche Frömmigkeit und monarchische Rhetorik keinen Platz haben; seine Faszination für das vorchristliche England von König Lear oder Cymbeline; seine Auseinandersetzung mit dem gewalttätigen Schottland des 11. Jahrhunderts in Macbeth. Und selbst wenn er seiner eigenen Welt näher kam, in der bemerkenswerten Folge von Historiendramen von der Herrschaft Richards II. im 14. Jahrhundert bis zum Sturz Richards III., blieb Shakespeare mindestens ein Jahrhundert von den dargestellten Ereignissen entfernt.
Als er schrieb, regierte Elisabeth I. schon seit mehr als dreißig Jahren. Mochte sie bisweilen reizbar, schwierig und herrschsüchtig sein, so zweifelte doch im Allgemeinen niemand an ihrem grundsätzlichen Respekt vor der Unantastbarkeit der politischen Institutionen des Königreichs. Selbst wer für eine aggressivere Außenpolitik plädierte oder forderte, härter gegen innere Feinde vorzugehen, als sie erlauben wollte, anerkannte für gewöhnlich ihren klugen Sinn für die Grenzen ihrer Macht. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Shakespeare, selbst in seinen innersten Gedanken, in ihr eine Tyrannin sah. Doch wie seine Mitbürger hatte er allen Grund zur Sorge über das, was kommen würde. 1593 feierte die Königin ihren sechzigsten Geburtstag. Obwohl unverheiratet und kinderlos, weigerte sie sich beharrlich, einen Nachfolger zu benennen. Glaubte sie, sie werde ewig leben?
Für mit Vorstellungskraft begabte Menschen gab es noch mehr Grund zur Sorge als das stete Verrinnen der Zeit. Man fürchtete, das Königreich sei durch einen unerbittlichen Feind bedroht, eine skrupellose internationale Verschwörung, deren Führer im Ausland fanatische Geheimagenten ausbildeten und losschickten, um Terror zu verbreiten. Diese Agenten waren überzeugt, Menschen zu töten, die als Irrgläubige galten, sei keine Sünde, vielmehr täten sie dadurch Gottes Werk. In Frankreich, den Niederlanden und anderswo hatten sie bereits Attentate, Massengewalt und Massaker zu verantworten. Ihr unmittelbares Ziel in England war die Ermordung der Königin, die Krönung eines Sympathisanten ihres Glaubens und die Unterwerfung des Landes unter ihre verzerrte Form der Frömmigkeit. Ihr oberstes Ziel war die Weltherrschaft.
Die Terroristen auszumachen fiel nicht leicht, denn die meisten von ihnen waren im Land aufgewachsen. Nachdem sie radikalisiert, in ausländische Trainingslager gelockt und dann zurück nach England geschleust worden waren, fielen sie in der Masse gewöhnlicher, loyaler Untertanen nicht auf. Diese wiederum sträubten sich verständlicherweise, die eigenen Verwandten anzuzeigen, selbst wenn der Verdacht bestand, dass sie gefährliche Ansichten hegten. Die Extremisten bildeten Zellen, beteten heimlich zusammen, tauschten verschlüsselte Botschaften aus und versuchten mögliche Anhänger zu rekrutieren, bevorzugt unter den unzufriedenen, labilen Jugendlichen, die von Gewalt und Märtyrertod träumten. Einige von ihnen standen in geheimer Verbindung mit Vertretern ausländischer Regierungen, die dunkle Andeutungen machten über Invasionsflotten und die Unterstützung für bewaffnete Aufstände.
Die englischen Spionagedienste waren sich der Gefahr sehr bewusst. Sie schleusten Maulwürfe in die Ausbildungslager ein, lasen systematisch Briefe mit, belauschten Gespräche in Gasthäusern und Kneipen und überwachten sorgfältig Häfen und Grenzübergänge. Doch es war schwierig, die Gefahr zu bannen, selbst wenn es den Behörden gelang, einen oder mehrere Terrorverdächtige festzunehmen und unter Eid zu verhören. Schließlich waren dies Fanatiker, denen ihre religiösen Führer erlaubt hatten, sich zu verstellen, und die in der Technik der sogenannten Äquivokation geschult waren, einer Methode des Irreführens, ohne im formalen Sinn zu lügen.
Selbst wenn die Verdächtigen beim Verhör gefoltert wurden, was regelmäßig geschah, waren sie oft kaum zu brechen. Einem Bericht an den Geheimdienstchef der Königin zufolge blieb der Extremist, der 1584 Wilhelm von Oranien ermordete – der Erste, der je ein Staatsoberhaupt mit einer Schusswaffe tötete –, auf unheimliche Weise verstockt:
Am selben Abend wurde er mit Tauen geschlagen und sein Fleisch mit gespaltenen Federkielen gestochen, wonach man ihn in einen Salzwasserbottich tunkte und ihm Essig und Branntwein in die Kehle goss; doch ungeachtet dieser Qualen gab es kein Zeichen von Verzweiflung oder Reue, sondern er sagte im Gegenteil, er habe eine Gott wohlgefällige Tat vollbracht.5
»Eine Gott wohlgefällige Tat« – diese Menschen waren einer Gehirnwäsche unterzogen worden und glaubten, sie würden im Himmel für ihren Verrat und ihre Gewalttaten belohnt.
Die Bedrohung, um die es hier geht, war für die eifrigen Protestanten im England des späten 16. Jahrhunderts der römisch-katholische Terrorismus. Zum großen Ärger der engsten Ratgeber der Königin scheute Elisabeth sich, die Drohung beim Namen zu nennen und die Maßnahmen zu ergreifen, die sie für nötig hielten. Sie wollte keinen kostspieligen und blutigen Krieg mit mächtigen katholischen Staaten provozieren oder eine ganze Religion mit den Verbrechen einiger Fanatiker identifizieren. Da sie es ablehnte, wie ihr Spionagechef Francis Walsingham sich ausdrückte, »Fenster in die Herzen der Menschen zu machen und ihre geheimen Gedanken zu erkunden«,6 erlaubte sie ihren Untertanen viele Jahre lang, den katholischen Glauben stillschweigend zu behalten, sofern sie sich nach außen hin der offiziellen Staatsreligion gemäß verhielten. Und trotz heftigen Drängens weigerte sie sich wiederholt, die Hinrichtung ihrer katholischen Cousine und Königin von Schottland, Maria Stuart, zu erlauben.
Nach ihrer Vertreibung aus Schottland wurde Maria ohne Anklage oder Prozess in einer Art »Schutzhaft« im Norden Englands festgehalten. Da sie einen starken Erbanspruch auf den englischen Thron hatte – manche hielten ihn für stärker als den Elisabeths –, lag es nahe, dass sich die Ränke der katholischen Mächte in Europa und die überhitzten Tagträume und gefährlichen Verschwörungen katholischer Extremisten im Inland auf sie konzentrierten. Maria selbst war tollkühn genug, finstere Pläne zu ihren Gunsten zu billigen.
Für den Drahtzieher dieser Pläne hielt man allgemein niemand anderen als den Papst in Rom. Seine Spezialeinheiten waren die ihm zu unbedingtem Gehorsam verpflichteten Jesuiten, seine verborgenen Legionen in England die Tausenden von »Kirchenpapisten«, die pflichtgemäß den anglikanischen Gottesdienst besuchten, aber im Herzen dem Katholizismus anhingen. Als Shakespeare erwachsen wurde, waren Gerüchte über die Jesuiten – die das Land bei Todesstrafe nicht betreten durften – und die Bedrohung, die von ihnen ausging, weit verbreitet. Ihre tatsächliche Anzahl mag gering gewesen sein, aber die Furcht und der Abscheu, die sie erregten, waren (ebenso wie die heimliche Bewunderung in manchen Kreisen) beträchtlich.
Es ist unmöglich, mit einiger Sicherheit zu sagen, wo Shakespeares heimliche Sympathien lagen. Er kann aber nicht neutral oder gleichgültig gewesen sein. Seine Eltern waren in eine katholische Welt hineingeboren worden, und für sie wie für die meisten ihrer Zeitgenossen überdauerten die Bindungen an diese Welt die Reformation. Es gab allen Anlass zu Wachsamkeit und Vorsicht, nicht nur wegen der harten Strafen, die von den protestantischen Behörden verhängt wurden.
Die Bedrohung, die man dem militanten Katholizismus in England zuschrieb, war keineswegs bloß eingebildet. 1570 erließ Papst Pius V. eine Bulle, in der er Elisabeth als Ketzerin und »Freveldienerin« exkommunizierte. Ihre Untertanen wurden jedes Treueschwurs entbunden, den sie geleistet haben mochten, ja sogar feierlich zum Ungehorsam aufgefordert. Ein Jahrzehnt später gab Gregor XIII. zu verstehen, es sei keine Todsünde, die Königin von England zu ermorden. Im Gegenteil bestehe, wie der Staatssekretär des Papstes im Namen seines Herrn erklärte, »kein Zweifel, dass, wer immer sie in der frommen Absicht, Gott zu dienen, aus der Welt schafft, nicht nur nicht sündigt, sondern sich ein Verdienst erwirbt«.7
Diese Erklärung war ein Mordaufruf. Obwohl die meisten englischen Katholiken mit solchen Gewalttaten nichts zu tun haben wollten, setzten es sich einige von ihnen in den Kopf, das Land von seiner ketzerischen Monarchin zu befreien. 1583 deckte das Spionagenetzwerk der Regierung ein Mordkomplott gegen die Königin unter Beteiligung des spanischen Botschafters auf. In den folgenden Jahren gab es immer wieder ähnliche Geschichten von gerade noch abgewehrten Gefahren: abgefangene Briefe, beschlagnahmte Waffen, festgenommene katholische Priester. Von misstrauischen Nachbarn alarmiert, stürmten Beamte Häuser auf dem Land, die als Unterschlupf dienten, zerschlugen Schränke, klopften die Wände nach verräterischen Hohlräumen ab und rissen Fußböden auf, um sogenannte »Priesterlöcher« aufzuspüren. Doch Elisabeth unternahm immer noch nichts gegen die Bedrohung durch Maria. »Gott öffne Ihrer Majestät die Augen«, betete Walsingham, »auf dass sie die Gefahr erkenne.«8
Der innere Kreis um die Königin vollzog einen höchst ungewöhnlichen Schritt: Man gründete einen Bund (»Bond of Association«), dessen Unterzeichner sich verpflichteten, nicht nur an jedem Rache zu nehmen, der einen Anschlag auf die Königin verübte, sondern auch an jedem, der Ansprüche auf den Thron erheben mochte – Maria war das offensichtliche Ziel – und zu dessen Unterstützung ein solcher Anschlag diente, ob erfolgreich oder nicht.
1586 bekamen Walsinghams Spione Wind von einem weiteren Komplott, an dem diesmal ein wohlhabender katholischer Edelmann namens Anthony Babington beteiligt war. Mit einer Gruppe gleichgesinnter Freunde war er zu der Überzeugung gelangt, es sei moralisch vertretbar, die »Tyrannin« zu ermorden. Mit Hilfe von Doppelagenten, die der Gruppe angehörten und ihre geheimen Botschaften entschlüsselten, beobachteten die Behörden, wie sich die Verschwörung allmählich entwickelte. Als Babington kalte Füße bekam, wurde er sogar von einem Agent Provocateur Walsinghams ermuntert. Die Strategie der protestantischen Hardliner zahlte sich aus. Im Netz verfingen sich nicht nur vierzehn Verschwörer, die wegen Hochverrats verurteilt und dann gehängt, ausgeweidet und gevierteilt wurden, sondern auch die leichtsinnige, verschlagene Maria.
Wie die Erschießung Osama bin Ladens 2011, beendete die Enthauptung Maria Stuarts am 8. Februar 1587 nicht die terroristische Gefahr in England; auch mit der Niederlage der spanischen Armada im folgenden Jahr war sie nicht gebannt. Wenn überhaupt, verdüsterte die Stimmung sich sogar. Eine erneute Invasion schien bevorzustehen. Die Spione der Regierung arbeiteten weiter; katholische Priester sickerten weiter nach England ein und kümmerten sich um ihre immer verzweifelteren und bedrängteren Gemeinden; wilde Gerüchte machten weiter die Runde. 1591 musste ein Tagelöhner am Pranger stehen, weil er gesagt hatte: »Wir werden keine fröhliche Welt mehr haben, solange die Königin lebt.« Ein anderer erhielt eine ähnliche Strafe für die Äußerung: »Das ist keine gute Regierung, unter der wir jetzt leben … wenn die Königin stirbt, wird es einen Wandel geben, und alle Anhänger der jetzigen Religion werden rausgeworfen.«9 Beim Hochverratsprozess gegen Sir John Perrot war 1592 der Vorwurf, er habe die Königin »eine niedrige, uneheliche Küchenmagd« genannt, ein wichtiger Anklagepunkt. In der Star Chamber (praktisch dem Obersten Gericht) beklagte sich der Lordsiegelbewahrer über die »offen lästerlichen Reden [und] falschen, lügnerischen, verräterischen Verleumdungen«, die in London zirkulierten.10
Auch wenn lockere Sprüche, die an Hochverrat grenzten, sich noch irgendwie mit einem Schulterzucken abtun ließen, war da immer noch die Sorge um die Thronnachfolge. Die leuchtend rote Perücke der Königin und ihre extravaganten, juwelenbesetzten Roben konnten nicht verbergen, dass die Jahre ins Land gingen. Sie hatte Arthritis, verlor den Appetit und begann sich beim Treppensteigen auf einen Stock zu stützen. Sie war, wie ihr Höfling Sir Walter Raleigh es diskret ausdrückte, »eine Dame, die von der Zeit überrascht wurde«. Dennoch benannte sie keinen Nachfolger.
Im spätelisabethanischen England wusste man sehr gut, wie zerbrechlich die Ordnung der Dinge war. Die Unruhe beschränkte sich nicht auf eine kleine protestantische Elite, die ihre Vorherrschaft sichern wollte. Bedrängte Katholiken hatten seit Jahren geäußert, die Königin sei von machiavellistischen Politikern umgeben, die ständig versuchten, die Interessen der eigenen Fraktion zu stärken, paranoide Ängste vor katholischen Verschwörungen schürten und nur darauf warteten, selbst als Tyrannen die Macht zu ergreifen. Enttäuschte Puritaner richteten ähnliche Ängste auf einen vergleichbaren Personenkreis. Jeder, dem die religiöse Ordnung des Landes, die Verteilung des Wohlstands, die auswärtigen Beziehungen, die Möglichkeit eines Bürgerkriegs Sorgen bereitete – also jeder, der in den 1590er-Jahren mit offenen Augen am Leben teilnahm –, muss über die Gesundheit der Königin gegrübelt und über rivalisierende Favoriten und Ratgeber am Hof geredet haben, die drohende spanische Invasion, die geheime Anwesenheit der Jesuiten, die Agitation der Puritaner (damals Brownisten genannt) und andere Gründe zur Sorge.
Das meiste davon konnte selbstverständlich nur geflüstert werden, aber so ging es immer und immer weiter, auf stets die gleiche, obsessive Weise, wie sie politischen Diskussionen nun mal eigen ist. Shakespeare zeigt wiederholt Nebenfiguren – etwa die Gärtner in Richard II., namenlose Londoner in Richard III., Soldaten am Vorabend der Schlacht in Heinrich V., hungernde Plebejer in Coriolan, zynische Untergebene in Antonius und Kleopatra –, die Gerüchte weitergeben und Staatsangelegenheiten diskutieren. Solche Reflexionen der kleinen Leute über »die da oben« erzürnten die Elite: »Los, schafft euch heim, ihr Brösel!«, schnauzt ein Adliger eine Gruppe von Aufrührern an (Coriolan, I, 1, 218). Doch die »Brösel« (»fragments«) ließen sich nicht zum Schweigen bringen.
Keine der großen oder kleinen Fragen, die Englands nationale Sicherheit betrafen, durfte direkt auf die Bühne gebracht werden. Die Schauspielertruppen, die in London florierten, suchten fieberhaft nach aufregenden Geschichten und hätten liebend gern das Publikum mit so etwas wie der Fernsehserie Homeland ins Theater gezogen. Doch das elisabethanische Theater wurde zensiert, und auch wenn der Zensor manchmal nachlässig sein konnte, er hätte es nie erlaubt, Geschichten zu inszenieren, in denen eine Bedrohung für die Herrschaft der Königin gezeigt wurde, geschweige denn eine direkte Darstellung von Personen wie Maria Stuart, Anthony Babington oder Elisabeth selbst.11
Zensur erzeugt unweigerlich Ausweichstrategien. Wie Midas’ Ehefrau spüren Menschen den Drang, über das zu sprechen, was sie zutiefst beunruhigt, und sei es auch nur gegenüber Wind und Schilfrohr. Rivalisierende Theatertruppen hatten einen starken wirtschaftlichen Anreiz, diesem Drang gerecht zu werden. Sie entdeckten, dass sie dies konnten, indem sie als Schauplatz abgelegene Orte wählten oder Begebenheiten aus einer fernen Vergangenheit präsentierten. In seltenen Fällen fand der Zensor die Parallelen zu offensichtlich oder forderte einen Nachweis, dass historische Ereignisse korrekt wiedergegeben wurden, meist aber drückte er ein Auge zu. Vielleicht erkannten die Behörden, dass irgendein Sicherheitsventil nötig war.
Shakespeare war der unübertroffene Meister darin, die Verschiebungen von Ort und Zeit zu nutzen und strategische Umwege einzuschlagen. Er schrieb nie sogenannte Stadtkomödien, die im zeitgenössischen England angesiedelt waren, und hielt bis auf ganz seltene Ausnahmen sicheren Abstand zum Tagesgeschehen. Er bevorzugte Geschichten, die sich an Orten wie Ephesos, Tyros, Illyrien, Sizilien, Böhmen oder auf einer geheimnisvollen namenlosen Insel in einem fernen Meer entfalten. Wenn er sich mit heiklen historischen Ereignissen befasste – Nachfolgekrisen, korrupten Wahlen, Mordanschlägen, dem Aufstieg von Tyrannen –, trugen sich diese im antiken Griechenland oder Rom zu, im prähistorischen England oder zumindest im England seiner Ur-Urgroßeltern. Er nahm sich die Freiheit, das Material, das er den Chroniken entnahm, zu verändern und umzustellen, um zwingendere und pioniertere Geschichten zu schaffen, aber er arbeitete mit identifizierbaren Quellen, die er zu seiner Verteidigung zitieren konnte, falls das die Behörden wünschten. Er war verständlicherweise nicht gewillt, ins Gefängnis zu wandern oder sich die Nase abschneiden zu lassen.
Von dieser lebenslangen Strategie des Umwegs gibt es nur eine bemerkenswerte Ausnahme. Das 1599 geschriebene Stück Heinrich V. stellt den spektakulären, fast zwei Jahrhunderte zurückliegenden Sieg einer englischen Invasionsarmee in Frankreich dar. Gegen Ende fordert ein Chor die Zuschauer auf, sich den glorreichen Empfang des Königs bei der Rückkehr in seine Hauptstadt vorzustellen: »Doch jetzt, jetzt seht/In der Gedanken schneller Schmiedewerkstatt,/Wie London seine Einwohner verströmt!« (V, 0, 22-24). Und gleich nach diesem Bild einer Feier in der Vergangenheit der Nation beschwört der Chor eine vergleichbare Szene herauf, der er in naher Zukunft beizuwohnen hofft:
Als käm der Feldherr unsrer Königin,Wie er’s demnächst wohl tut, von Irland heimUnd brächt den Aufstand auf sein Schwert gespießt:Wie viele liefen aus dem ruhigen London los,Ihn zu begrüßen! (V, 0, 30-34)
Der »Feldherr«, um den es hier geht, war der Favorit der Königin, der Graf von Essex, der zu diesem Zeitpunkt englische Truppen gegen irische Aufständische unter Hugh O’Neill, dem Grafen von Tyrone, führte.
Es ist nicht klar, warum Shakespeare beschloss, sich direkt auf ein zeitgenössisches Ereignis zu beziehen – und eines, von dem man nur erhoffen konnte, dass es sich »demnächst« zutragen werde.12 Vielleicht wurde der Dramatiker von seinem Gönner gedrängt, dem mächtigen Grafen von Southampton, dem Shakespeare die Gedichte Venus und Adonis und Die Schändung der Lukrezia gewidmet hatte. Essex’ enger Freund und politischer Verbündeter Southampton wusste, dass sein prahlerischer und verschuldeter Freund nach öffentlichem Beifall gierte, und das Theater war der perfekte Ort, um die Massen zu erreichen. Vielleicht deutete er also gegenüber dem Dramatiker an, dass er eine patriotische Vorwegnahme des bevorstehenden Triumphs des Feldherrn sehr begrüßen würde. Das abzulehnen wäre Shakespeare schwergefallen.
Kurz nach der Uraufführung von Heinrich V. kehrte der dickschädlige Essex tatsächlich nach London zurück, aber nicht mit dem Kopf von Hugh O’Neill. Angesichts des totalen Scheiterns seines Feldzugs hatte er aufgegeben und Irland verlassen. Die Königin hatte ihm zwar ausdrücklich befohlen, dort zu bleiben, er aber war entschlossen heimzukehren.
Nun setzt eine Abfolge von Ereignissen ein, die rasch zu einer Krise im Zentrum des Regimes führen. Essex’ überstürzte und unerwünschte Rückkehr – noch schlammbespritzt eilte er zur Königin, warf sich ihr zu Füßen und schimpfte wild auf die, die ihn hassten – war für seine wichtigsten Feinde am Hof, Elisabeths ersten Minister Robert Cecil und ihren Favoriten Walter Raleigh, die lang ersehnte Gelegenheit. Immer aufgewühlter musste der Graf mit ansehen, wie ihm die Gunst der Königin entglitt. Von jeher hatte er sich nur schwer in der Gewalt gehabt, nun machte er den tödlichen Fehler, im Zorn zu sagen, die Königin sei »alt und bösartig« geworden und ihr Geist »so krumm wie ihr Gerippe«.13
Eine Hofkultur bringt zwangsläufig heftig rivalisierende Fraktionen hervor, und Elisabeth hatte es jahrelang meisterhaft verstanden, die eine gegen die andere auszuspielen. Doch mit ihrer zunehmenden Altersschwäche verschärften sich die alten Feindschaften und wurden mörderisch. Als der Kronrat Essex zu einer Sitzung vorlud, um über Staatsgeschäfte zu beraten, weigerte er sich zu erscheinen und begründete dies damit, er solle auf Raleighs Befehl ermordet werden. Furcht und Abscheu in Verbindung mit der wahnhaften Zuversicht, die Londoner Bevölkerung werde sich erheben, um ihn zu unterstützen, trieben Essex schließlich dazu, einen bewaffneten Aufstand gegen die Ratgeber der Königin anzuzetteln und vielleicht sogar gegen sie selbst. Der Aufstand scheiterte jämmerlich. Essex und seine Hauptverbündeten, darunter der Graf von Southampton, wurden verhaftet.
Raleigh drängte Cecil, der die offizielle Untersuchung führte, sich diese Gelegenheit zur endgültigen Vernichtung ihres Feindes nicht entgehen zu lassen; er schrieb an Cecil: »Sofern Ihr gegenüber diesem Tyrannen Milde zeigt, werdet Ihr es bereuen, wenn es zu spät ist.«14
»Tyrann« ist hier mehr als eine zufällige Beleidigung. Sollte Essex seine frühere Machtstellung wiedererlangen, gibt Raleigh damit zu verstehen, wäre er angesichts des fortgeschrittenen Alters der Königin in der Lage, das Land zu beherrschen, und würde sich bestimmt nicht mit juristischen Feinheiten aufhalten. Er wäre darauf erpicht, seine Rivalen loszuwerden – und zwar nicht, indem er sie höflich bittet, sich zurückzuziehen. Er würde das tun, was Tyrannen tun.
Nachdem Cecil seine Untersuchung abgeschlossen hatte, wurden Essex und Southampton vor Gericht gestellt, des Hochverrats für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Southamptons Strafe wurde in lebenslängliche Haft umgewandelt, aber für den einstigen Favoriten der Königin gab es keine Gnade. Am 25. Februar 1601 wurde Essex hingerichtet. Die Regierung achtete darauf, dass das zerknirschte Geständnis, das er angeblich auf dem Schafott ablegte – er habe den verräterischen Aufstand geplant und werde nun »gerechterweise vom Reich ausgespien« –, nach seinem Tod gedruckt wurde.
Es war töricht von Shakespeare gewesen, sich auch nur in die Nähe dieser bösartigen Kämpfe zu begeben. Der untypisch zeitgenössische Bezug auf den »Feldherrn« in Heinrich V. hat offenbar keine offizielle Reaktion nach sich gezogen, hätte ihm jedoch leicht zum Verhängnis werden können. Am Samstag, dem 7. Februar 1601, dem Tag vor dem Putschversuch, hatten sich nämlich einige von Essex’ wichtigsten Unterstützern, darunter sein Verwalter Sir Gelly Meyrick, nachmittags über die Themse rudern lassen, um das Globe-Theater zu besuchen. Wenige Tage zuvor hatten Meyricks Bundesgenossen die dortige Schauspielertruppe, die Lord Chamberlain’s Servants, ersucht, ein früheres Shakespeare-Stück zu spielen, ein Stück über »die Absetzung und Ermordung von König Richard II.«. Die Schauspieler lehnten ab; Richard II. sei ein altes Stück und werde wohl kaum ein großes Publikum anziehen. Ihr Einwand wurde durch das Angebot von 40 Schilling zusätzlich zum üblichen Honorar von 10 Pfund für eine Sondervorstellung entkräftet.
Warum aber wollten Gelly Meyrick und die anderen unbedingt Richard II. aufgeführt sehen? Sie folgten keiner spontanen Laune; in einem entscheidenden Augenblick, als sie wussten, dass es um Leben und Tod ging, kostete es sie Planung, Zeit und Geld. Sie hinterließen kein Zeugnis über ihre Gründe, erinnerten sich aber vermutlich, dass Shakespeares Stück den Sturz eines Monarchen und seiner Kamarilla schilderte. »Ich hab viel Zeit vertan, nun vertut mich die Zeit« (V, 5, 49), klagt der dem Untergang geweihte König, nachdem seine gierigen Ratgeber (»Maden, die am Allgemeinwohl fressen«, nennt der Usurpator sie) das Schicksal gefunden haben, das Essex Cecil und Raleigh zugedacht hatte.
In Richard II. werden nicht nur die Ratgeber des Königs vom Usurpator getötet, sondern auch der König selbst. Der Usurpator Bolingbroke erklärt niemals direkt, er wolle den regierenden Monarchen stürzen, geschweige denn ermorden. Wie Essex eifert er gegen die Korruption des inneren Kreises um den Herrscher und betont dabei vor allem die Ungerechtigkeit, die ihm selbst widerfahren sei. Nachdem er aber Richards Abdankung und Kerkerhaft eingefädelt hat und als Heinrich IV. zum König gekrönt wurde, unternimmt er den entscheidenden letzten Schritt mit raffinierter Vagheit – einer Vagheit, die das ermöglicht, was Politiker »Bestreitbarkeit« nennen. Passenderweise stellt Shakespeare diesen Schritt nicht direkt dar. Stattdessen zeigt er einfach jemanden, der darüber nachdenkt, was er den König hat sagen hören:
EXTON: Hast nicht bemerkt, was da der König sprach?»Hab ich denn keinen Freund, der mich befreitVon dieser so lebendig drohnden Furcht?«War das nicht so?DIENER: Genau das warn die Worte.EXTON: »Hab ich denn keinen Freund?«, sagt er. So sagt er zweimal,Und zweimal sehr betont, war das nicht so?DIENER: Ganz so.EXTON: Und sah mich, wie er’s sagte, an – vielsagend,Als sollt es heißen: »Wärst du doch der Mann,Der mir die Angst von meinem Herzen nimmt!«In Pomfret dort der König war gemeint.Komm, ich als Königs Freund befreie ihn vom Feind.(V, 4, 1-11)
Das ist die gesamte Szene. Sie dauert nur einen Moment, reicht aber aus, um ein ganzes Ethos der Machtpraxis heraufzubeschwören. Kein förmliches juristisches Verfahren wird gegen den abgesetzten König angestrengt, es bedarf nur eines bedeutungsvollen Winks, sorgfältig wiederholt und in Verbindung mit Blicken, die bewusst (»vielsagend«) auf jemanden gerichtet sind, der die Bedeutung wohl verstehen wird.
Es gibt in einem neuen Regime immer Menschen, die alles tun, um die Gunst des Herrschers zu gewinnen. Exton, wie Shakespeare ihn zeichnet, ist ein Niemand; dies ist das erste Mal, dass wir ihn sehen oder von ihm hören. Er will des »Königs Freund« werden. »Auf geht’s«, sagt er zu seinen Handlangern, und unverzüglich wird Richard ermordet (V, 4, 11). Wie unschwer vorauszusehen, wird Exton aber, als er seinen Lohn abholen will – »Deine begrabne Furcht, mein König, bring/Ich dir in diesem Sarg« –, zurückgewiesen: »Tot wollte ich ihn sicherlich,/Jedoch den Töter hass, den Toten liebe ich« (V, 6, 30-40). »Den Toten liebe ich«: Mit dieser köstlich bitteren Ironie endet das Stück.
Gelly Meyrick und seine Mitverschwörer griffen sicher nicht auf Shakespeares Drama zurück, um ihm eine Anleitung für ihr Handeln zu entnehmen. Sie mussten begriffen haben, dass die Umstände, die der Autor schilderte, sich nicht einfach mit den ihren deckten; sie hätten sich auf jeden Fall nicht in die Karten schauen lassen wollen. Und für einen modernen Leser scheint die Erforschung des Innenlebens des gestürzten Monarchen in dieser Tragödie sehr weit von einem Propagandastück entfernt, das die Menge zum Aufstand reizen soll.
Dennoch muss der Schlüssel bei der Menge liegen. Sondervorstellungen fanden oft an privaten Spielstätten vor ausgesuchtem Publikum statt, doch die Lord Chamberlain’s Servants erhielten Geld dafür, Richard II. in einem großen Freilufttheater wiederaufzuführen, vor Zuschauern, von denen die meisten einen Penny für den Stehplatz zahlten. Essex hatte stets die Londoner Menge hofiert und auf ihre Unterstützung gezählt, jenes gemeine Volk, das Shakespeare seine Zuschauer bittet, sich vorzustellen, wie es dem triumphierend aus Irland zurückkehrenden Feldherrn ebenso zujubelt wie dem siegreich aus Frankreich zurückkehrenden Heinrich V. Es war nicht so gekommen, aber die Verschwörer müssen geglaubt haben, mit Richard II. lasse sich etwas gewinnen, indem man nämlich einem großen Publikum (und vielleicht auch sich selbst) einen erfolgreichen Putsch vorspielte. Vielleicht wollten sie einfach das vorstellbar machen, was sie sich vorgenommen hatten umzusetzen.15
Seit 1352 erklärte ein Gesetz es zum Hochverrat, den Tod des Königs, der Königin oder der obersten Beamten »zu ersinnen oder vorzustellen«.16 Der Gebrauch des mehrdeutigen Begriffs »vorstellen« gab der Regierung freie Hand bei der Entscheidung, wen sie verfolgen solle, und sicherlich bewegte sich die Aufführung von Richard II. im Globe-Theater auf sehr dünnem Eis. Schließlich setzte Shakespeares Stück das Spektakel der Absetzung und Ermordung eines gekrönten Königs für ein Massenpublikum in Szene, dazu die standrechtliche Tötung der höchsten königlichen Ratgeber. Doch die geschilderten Ereignisse fanden in der englischen Vergangenheit statt, und durch eine stillschweigende Übereinkunft bot ein solcher Zeitabstand eine gewisse Immunität, sodass Handlungen, die in einem zeitgenössischen Rahmen sofort den Zorn des Zensors erregt und vielleicht zu einem Gerichtsverfahren geführt hätten, sich ohne großes Risiko für den Dramatiker und sein Ensemble präsentieren ließen.
Dennoch stellte die von Meyrick arrangierte Aufführung die stillschweigende Übereinkunft infrage, das Bühnengeschehen sei – solange es sich vom Tagesgeschehen fernhielt – nur ein Spiel und daher unbedeutend. Ganz im Gegenteil: Offensichtlich hielten die Verschwörer um Essex es für strategisch nützlich, dass Shakespeares Tragödie über Englands mittelalterliche Vergangenheit entstaubt und im Globe gezeigt wurde.
Es lässt sich unmöglich sagen, was Meyrick dachte, als er an diesem Nachmittag Richard II. sah; wir wissen aber, dass zumindest eine Person damals die Bedeutung des Stücks erfasste. Sechs Monate nach Essex’ Hinrichtung gewährte Königin Elisabeth William Lambarde, den sie kurz zuvor zum Bewahrer der Schriftrollen und der Unterlagen im Tower ernannt hatte, eine gnädige Audienz. Der gelehrte Archivar ging pflichtbewusst die Listen der Dokumente einer Regierungszeit nach der anderen durch, die er für die Königin vorbereitet hatte. Als er zur Regierungszeit Richards II. kam, sagte Elisabeth plötzlich: »Ich bin Richard II., wisst Ihr das nicht?«17 Wenn ihr Ton eine Spur zorniger Anspannung verriet, dann vielleicht, weil der Gelehrte ausschließlich auf die Vergangenheit zu blicken schien, während sie selbst, wie alle anderen auch, über die dunklen Parallelen zwischen dem Geschehen im 14. Jahrhundert und Essex’ Putschversuch sinnierte. Geistesgegenwärtig verstand Lambarde rasch, dass der Schlüsselpunkt die »Vorstellung« vom Tod des Monarchen war. »Eine so üble Vorstellungskraft«, sagte er zur Königin, »gehört einem höchst böswilligen Edelmann, der es erdacht hat und ins Werk gesetzt, dem am meisten geschmückten Geschöpf, das Eure Majestät je schuf.« Übertreibend erwiderte Elisabeth: »Diese Tragödie wurde vierzigmal auf offener Straße und in den Häusern gespielt.« Es ist das Theater – Shakespeares Theater –, das den Schlüssel zum Verständnis der gegenwärtigen Krise bot.
Shakespeares direkte Anspielung auf den Grafen von Essex in Heinrich V. lenkte die Aufmerksamkeit auf eindringliche politische Reflexionen in seinen Stücken, die besser im Dunkeln blieben. Die Königin, die häufig Vorstellungen am Hof befohlen hatte, bestrafte die Schauspieler nicht, was ihr ein Leichtes gewesen wäre – Shakespeare und sein ganzes Ensemble entgingen knapp einer Katastrophe. Nie mehr wagte der Dramatiker sich so nah an die aktuelle Politik heran.
Nach dem Putschversuch wurde die Sondervorstellung von Richard II. Gegenstand einer amtlichen Untersuchung. Ein Mitglied von Shakespeares Theatertruppe musste vor dem Kronrat aussagen und erklären, was die Lord Chamberlain’s Servants sich dabei gedacht hätten. Seine Antwort – nur ein kleiner Nebenverdienst – wurde akzeptiert. Sir Gelly Meyrick hatte weniger Glück. Er wurde schuldig gesprochen, die Sondervorstellung arrangiert und den Aufstand auf andere Weise unterstützt zu haben, und auf dem Richtplatz gehängt, ausgeweidet und gevierteilt.
KAPITEL 2 PARTEIPOLITIK
In einer sehr frühen Trilogie, die er vielleicht mit anderen Dramatikern zusammen schrieb, folgte Shakespeare dem verschlungenen Pfad von der gewöhnlichen Politik zur Tyrannei. Die drei Teile von Heinrich VI. gehören heute zu seinen unbekannteren Stücken, brachten ihm aber ersten Ruhm ein und zeigen nach wie vor hellsichtig, wie eine Gesellschaft reif wird für einen Despoten.
Der Ausgangspunkt ist die Schwäche im Zentrum des Reichs. König Heinrich VI. ist noch ein unerfahrener Jüngling, der durch den frühen Tod seines Vaters auf den Thron gelangt ist; die Staatsgeschäfte werden vom Lordprotektor geführt, seinem Onkel Humphrey, dem Herzog von Gloucester. Obwohl dieser sich uneigennützig dem öffentlichen Wohl verschrieben hat, ist seine Macht stark eingeschränkt, und er ist von einem Kreis gewalttätiger, egoistischer Adliger umgeben. Als sie sich beklagen, dass ihr König ein Kind ist, stellt der Protektor ihre verlogene Nostalgie bloß. In Wahrheit sei ihnen doch ein schwacher Herrscher lieber, »den ihr wie einen Schulbub schrecken könnt« (1 Heinrich VI., I, 1, 36). Das Machtvakuum im Zentrum verschafft den Rivalen Raum, um zu taktieren und gegeneinander zu intrigieren. Doch so ein parteiischer Kleinkrieg hat Folgen. Das Gemeinwohl bleibt auf der Strecke, und wie wir bald sehen, verhärten sich die Fronten – aus Widersachern werden Todfeinde.
In einem an die Gebäude der Londoner Rechtsschulen angrenzenden Garten streiten sich zwei mächtige Adlige, der Herzog von York und der Herzog von Somerset, über die Auslegung einer Rechtsfrage. Sie bitten die Zeugen ihres Streites zu entscheiden, wer von ihnen recht hat, die jedoch lehnen es klugerweise ab, sich einzumischen. Dem Stück sind die juristischen Details, um die es dabei geht, nicht zu entnehmen; vielleicht hielt Shakespeare das für letztlich nicht so wichtig. Entscheidend war die fehlende Kompromissbereitschaft, die militante Überzeugung eines jeden, dass seine und nur seine Position vertretbar sei. »Die Wahrheit steht so nackt auf meiner Seite,/Daß sie ein Kurzsichtiger finden könnt«, erklärt York, und Somerset erwidert: »Und steht auf meiner Seite so gut angekleidet,/So klar, so strahlend und so offenbar,/Daß sie selbst Blinden in die Augen glänzt« (II, 4, 20-24). Es gibt hier keine Anerkennung einer Grauzone, keine Bereitschaft einzusehen, dass es für vernünftige Menschen möglich sein könnte, verschiedener Meinung zu sein. Beide halten es für bloßen Starrsinn, nicht zuzugeben, was so unzweifelhaft »offenbar« ist.