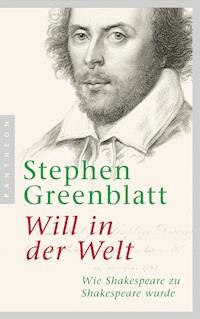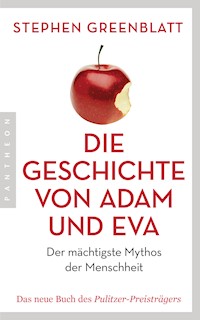9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Pulitzerpreis und dem National Book Award
Bestsellerautor Stephen Greenblatt führt uns in seinem neuen Buch an die Zeitenwende zwischen dem Ende des Mittelalters und dem Beginn der Renaissance. Er folgt dabei den Spuren von Lukrez' „De rerum natura” – einem antiken Text, der zu Beginn des 15. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde, das Denken der Menschen radikal veränderte und die Welt in die Moderne führte.
An einem kalten Januartag des Jahres 1417 fällt dem Humanisten Poggio Bracciolini in einem deutschen Kloster ein altes Manuskript in die Hände. Damit rettet er das letzte vorhandene Exemplar von Lukrez’ antikem Meisterwerk „De rerum natura” vor dem Vergessen, nicht ahnend, dass dieses Buch die damalige Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Denn der antike Text mit seinen unerhörten Gedanken über die Natur der Dinge eröffnet den Menschen des ausgehenden Mittelalters neue Horizonte, befeuert die beginnende Renaissance und bildet die Basis unserer modernen Weltsicht.
Farbenfroh und spannend beschreibt Stephen Greenblatt, wie die Verbreitung des Buches die Renaissance beeinflusste und bedeutende Künstler wie Botticelli und Shakespeare, aber auch Denker wie Giordano Bruno und Galileo Galilei prägte. Greenblatt bietet einen neuen Blick auf die Geburtsstunde der Renaissance, der zugleich zeigt, wie ein einzelnes Buch dem Lauf der Geschichte eine neue Richtung geben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für Abigail und Alexa
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Als ich noch Student war, besuchte ich gegen Ende des Semesters regelmäßig den Yale-Laden und schaute, was ich für den Sommer zu lesen fand. Mein Taschengeld war knapp, doch die Buchhandlung schlug alljährlich ihre Ladenhüter los, zu lächerlich kleinen Preisen. Die Bücher wurden in Wühlkästen gestopft, und ohne feste Absichten machte ich mich darüber her, wartete einfach ab, was mir ins Auge fiel. Auf einem dieser Beutezüge stieß ich auf ein Taschenbuch mit einem äußerst seltsamen Cover, aufmerken ließ mich ein Ausschnitt aus einer Zeichnung des Surrealisten Max Ernst. Unter einer Mondsichel hoch über der Erde waren zwei Beinpaare – die Körper fehlten – mit etwas beschäftigt, das wohl ein himmlischer Beischlaf sein sollte. Das Buch – eine Prosaübersetzung von Lukrez’ zweitausend Jahre altem Gedicht De rerum natura (Von der Natur) – war herabgesetzt auf zehn Cent, und wie ich gestehen muss, hatte ich es eher auf den Umschlag abgesehen als auf die klassische Darstellung des Kosmos und seiner Ausstattung.
Antike Physik ist nicht ganz das, was man sich unter Ferienlektüre vorstellt, doch irgendwann in diesem Sommer, in einer müßigen Stunde, nahm ich das Buch in die Hand und begann zu lesen. Und stieß schon in den ersten Versen auf eine mehr als hinreichende Rechtfertigung für die erotische Umschlagillustration. Lukrez setzt ein mit einem glühenden Hymnus an Venus, die Göttin der Liebe, deren Erscheinung im Frühling das Gewölk vertreibt, den Himmel mit Licht füllt und die ganze Welt mit rasendem sexuellem Begehren:
Kaum nämlich ist die Pforte des Frühlings aufgesprungen und es wirkt, plötzlich befreit, die Brise des Zephyr, da, Göttin, künden die Vögel dich an, ins Herz getroffen von deinen mächtigen Pfeilen. Dann toben das Wild und das Vieh über üppige Weiden, schwimmen durch wilde Ströme: Von deinem Zauber gefangen, begierig folgen sie alle dir, willig, wohin du sie führst. Dann senkst du verführerische Liebe ins Herz aller Kreaturen, die leben in den Meeren und Bergen und fließenden Strömen und in der Vögel belebtem Dickicht, auf grünenden Fluren; den leidenschaftlichen Trieb senkst du in sie, ihre Art zu vermehren.1
Fasziniert von der Intensität dieses Auftakts las ich weiter, kam zur Vision des in Venus’ Schoß ruhenden Kriegsgottes Mars – »bezwungen von der nie heilenden Wunde der Liebe, den Nacken zurückgeworfen, schaut er in Liebe begierig dich an« –; von dort zu einer Bitte um Frieden, zum Lobpreis auf die Weisheit des Philosophen Epikur und zur resoluten Abwehr abergläubischer Furcht. Als ich dann bei einer längeren Darstellung erster Prinzipien der Philosophie landete, zweifelte ich, ob mein Interesse noch lange anhalten würde: Niemand hatte mir das Buch empfohlen, ich suchte allein Vergnügen und Leselust, hatte allerdings jetzt schon den Eindruck, mehr als den Wert meiner zehn Cent zurückerhalten zu haben. Und zu meiner großen Überraschung ließ mich das Buch nicht mehr los.
Es war nicht die herrliche Sprache Lukrez’, die mich fesselte. Später erst arbeitete ich De rerum natura in seinen lateinischen Hexametern durch und begann etwas zu ahnen von der reichen Textur dieser Sprache, den feinen Rhythmen, von Raffinesse, Präzision und Prägnanz der Lukrez’schen Bilderwelt. Bei meiner ersten Begegnung half mir Martin Ferguson Smiths gediegene englische Prosa – klar und schnörkellos, aber kaum bemerkenswert. Nein, etwas anderes hatte mich berührt, etwas, das über die zweihundert eng bedruckten Seiten hinweg in allen Sätzen lebte und webte. Mein Beruf bringt mich dazu, Menschen anzuhalten, bei ihrer Lektüre genau auf die sprachliche Oberfläche dessen zu achten, was sie lesen. An dieser Aufmerksamkeit hängt zum Gutteil das Vergnügen, auch das Interesse an Dichtung. Und selbst aus einer bescheidenen Übersetzung lässt sich ein nachhaltiger Eindruck von einem Kunstwerk gewinnen, von einer brillanten Übertragung ganz zu schweigen. Schließlich entdecken wir den größten Teil der literarischen Welt auf diese Weise, lernen so die Genesis kennen und ebenso die Ilias oder Hamlet, und selbst wenn es gewiss das Beste wäre, solche Werke in ihrer Originalsprache lesen zu können, wäre die Behauptung irreführend, dass es keinen anderen, nur diesen Zugang zu ihnen gibt.
Ich jedenfalls kann bezeugen, dass On the Nature of Things selbst als Prosaübersetzung eine tiefe Saite in mir zum Klingen brachte. Das hatte auch etwas mit besonderen persönlichen Umständen zu tun – Kunst dringt stets durch bestimmte Risse im Seelenleben eines Menschen in diesen ein. Im Kern ist Lukrez’ Lehrgedicht eine tiefe, therapeutische Meditation über die Todesfurcht, und diese Furcht hat meine ganze Kindheit bestimmt. Nicht die Angst vor meinem eigenen Tod bedrängte mich derart; mich selbst hielt ich auf die übliche, kindlich gesunde Art für unsterblich. Die Angst entsprang der absoluten Gewissheit meiner Mutter, dass ihr ein früher Tod bestimmt sei.
Sie fürchtete sich nicht vor dem Jenseits. Wie die meisten Juden hatte sie nur eine vage, schemenhafte Vorstellung dessen, was jenseits des Grabes liegen mochte, und sie machte sich darüber auch nur wenige Gedanken. Der Tod selbst – also schlicht die Tatsache, dass sie nicht mehr sein würde – erfüllte sie mit Angst und Schrecken. So weit ich zurückdenken kann, grübelte sie über ihr unmittelbar bevorstehendes Ende, beschwor es wieder und wieder, insbesondere in Momenten des Abschieds. Mein Leben war voll ausgedehnter, opernhafter Abschiedsszenen. Ob sie mit meinem Vater übers Wochenende von Boston nach New York fuhr, ob ich aufbrach ins Sommerlager, sogar – wenn ihr selbst das Leben besonders schwer erschien – wenn ich mich einfach nur auf den Weg in die Schule machte, jedesmal klammerte sie sich fest an mich, sprach von ihrer Hinfälligkeit und davon, dass es keineswegs ausgeschlossen sei, dass ich sie nie wiedersehen würde. Gingen wir irgendwo spazieren, hielt sie häufig an, so, als würde sie gleich zusammensinken. Manchmal zeigte sie dann auf eine an ihrem Hals pulsierende Vene, nahm meinen Finger und ließ sie mich fühlen, diese Signale ihres bedenklich rasenden Herzens.
Sie muss damals, zu der Zeit, da meine Erinnerungen an ihre Ängste einsetzen, Ende dreißig gewesen sein, aber ihre Ängste reichten ganz eindeutig weiter zurück, offenbar bis in das Jahrzehnt vor meiner Geburt. Damals war ihre jüngere Schwester, gerade sechzehn Jahre alt, an einer Halsentzündung gestorben. Dieses Ereignis – nicht wirklich selten in der Zeit vor Einführung des Penizillin – war für meine Mutter eine noch immer offene Wunde: Permanent sprach sie davon, weinte still, ließ mich wieder und wieder die ergreifenden Briefe lesen, die dieses junge Mädchen während seiner tödlichen Krankheit geschrieben hat.
Ich habe schon früh verstanden, dass das »Herz« meiner Mutter – das Herzrasen, das sie und alle um sie herum immer wieder zum Innehalten brachte – eine Überlebensstrategie war, ein Symbol, das Mittel, sich mit ihrer toten Schwester zu identifizieren und um sie zu trauern. Es war auch ein Weg, sowohl Ärger – »Da siehst du, wie du mich wieder aufregst!« – als auch Liebe zu zeigen – »Sieh doch, ich tue alles für dich, selbst wenn mir das Herz dabei bricht.« Es war ein Ausagieren, Probe und Vorwegnahme der Auslöschung, die sie fürchtete. Und vor allem erzwang sie so Aufmerksamkeit, forderte Liebe. Doch selbst wenn mir das klar war, minderte das die Wirkung dieses Verhaltens auf meine Kindheit nicht: Ich liebte meine Mutter und fürchtete, sie zu verlieren. Mir fehlten die Voraussetzungen, zwischen psychologischer Strategie und gefährlichem Symptom zu unterscheiden. (Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie selbst dazu in der Lage war.) Und als Kind konnte ich auch nicht richtig einschätzen, wie verquer dieses permanente Lamento vom drohenden Tod war, dieses Aufladen jedes Abschieds mit Endgültigkeit. Erst jetzt, nachdem ich selbst eine Familie gegründet habe, ahne ich, wie dunkel die Zwänge gewesen sein müssen, die eine liebende Mutter – und meine Mutter liebte tatsächlich – dazu brachten, ihren Kindern diese emotionale Bürde aufzuladen. Jeder Tag brachte ihr aufs Neue die trübe Gewissheit, dass ihr Ende nahe sei.
Wie sich herausstellte, lebte meine Mutter lange und hat ihren neunzigsten Geburtstag nur um einen Monat verpasst. Sie war, als ich On the Nature of Things zum ersten Mal in der Hand hatte, um die fünfzig. Damals war meine Furcht, sie könne sterben, schon verwoben mit der schmerzlichen Wahrnehmung, wie viel von ihrem Leben sie sich, so sehr in Anspruch genommen von ihren obsessiven Ängsten, verdorben hatte und wie sehr dies zudem einen Schatten auf meines geworfen hatte. Lukrez’ Worte erklangen darum in fürchterlicher Klarheit: »Der Tod berührt uns nicht.« Es sei, schreibt Lukrez, schierer Unfug, das Leben im Griff der Todesangst zu verbringen. Es sei ein sicherer Weg, Lebenszeit unerfüllt und freudlos verrinnen zu lassen. So artikulierte er einen Gedanken, den zu fassen, und sei’s nur innerlich, ich mir damals noch nicht erlaubt hatte: dass es nämlich manipulativ und grausam ist, anderen diese Angst einzuflößen.
Das also war, in meinem Fall, das ganz persönliche Einfallstor für das Gedicht, die eigentliche Quelle der Macht, die es über mich gewann. Doch war das nicht ausschließlich Folge meiner eigentümlichen Lebensgeschichte. On the Nature of Things berührte mich als erstaunlich überzeugende Darstellung dessen, wie die Dinge wirklich sind. Erstaunlich deswegen, weil natürlich auch mir klar war, dass viele Einzelheiten dieses antiken Berichts heute absurd erscheinen. Wie hätte das anders sein können? Was werden Menschen in zweitausend Jahren von unserer Darstellung des Universums halten? Lukrez glaubte, dass sich die Sonne um die Erde drehe, behauptete, sie könne nicht viel heißer, nicht viel größer sein, als unsere Sinne sie wahrnähmen. Würmer hielt er für spontane Hervorbringungen feuchter Erde, erklärte den Blitz als Saat des Zorns, aus hohlen Wolken geschleudert, malte die Erde als Mutter im Klimakterium, erschöpft von so viel Vermehrung. Den Kern des Gedichts jedoch bilden Leitsätze und Prinzipien eines neuzeitlich modernen Weltverständnisses.
Stofflich besteht das Universum, wie Lukrez erklärt, aus unzähligen Atomen, die sich zufällig durch den Raum bewegen, so wie Staub im Sonnenlicht tanzt. Dabei stießen sie zusammen, verhakten sich, bildeten komplexe Strukturen, brächen wieder auseinander – und all das in einem endlosen Prozess von Schöpfung und Zerstörung, aus dem es kein Entrinnen gebe. Schaut man zum Nachthimmel auf und wundert sich, unerklärlich bewegt, über die zahllosen Sterne, dann, so Lukrez, betrachtet man nicht das Handwerk von Göttern, auch keine kristalline Sphäre, die losgelöst wäre von unserer vergänglichen Welt. Im Himmel erblicke man die gleiche materielle Welt, deren Teil man selbst sei und aus deren Elementen man auch selbst bestehe. Es gibt für Lukrez keinen Schöpfungsplan, keinen göttlichen Architekten, kein intelligentes Design. Alle Dinge, auch die Spezies, zu der wir selbst gehören, haben sich in riesigen Zeiträumen gebildet. Diese Evolution erfolgt zufällig, bei lebenden Organismen allerdings kommt ein Prinzip natürlicher Auslese ins Spiel. Will sagen, Arten, die geeignet sind, zu überleben und sich zu reproduzieren, überdauern erfolgreich, zumindest für eine gewisse Zeit; die weniger geeigneten dagegen sterben rasch aus. Nichts jedoch – angefangen von unserer eigenen Art über den Planeten, auf dem wir leben, bis hin zur Sonne, die unsere Tage erleuchtet – ist für immer. Unsterblich sind allein die Atome.
Ein derart konstituiertes Universum, so Lukrez weiter, bietet keinen Grund anzunehmen, dass die Erde oder ihre Bewohner einen zentralen Platz innehätten; keinen Grund, die Menschen von allen anderen Tieren zu sondern; keine Hoffnung, die Götter bestechen oder besänftigen zu können; weder Ort noch Anlass für religiösen Fanatismus; keinen Grund für den Ruf nach asketischer Selbstverleugnung, keine Rechtfertigung für Träume grenzenloser Macht oder vollkommener Sicherheit; keinen vernünftigen Grund für Kriege der Eroberung oder Selbstverherrlichung; keine Chance, die Natur überwinden zu können, dem unaufhörlichen Werden und Vergehen und erneuten Werden der Formen je entkommen zu können. Jenseits des Ärgers über all jene, die entweder mit falschen Visionen der Sicherheit hausieren gehen oder irrationale Ängste vor dem Tod schüren, hat Lukrez noch etwas ganz anderes zu bieten, nämlich ein Gefühl der Befreiung, die Kraft, auf das herabzublicken, was so quälend scheint. Etwas nämlich, schrieb er, können die Menschen, und sie sollen es auch tun: ihre Ängste bezwingen, akzeptieren, dass sie selbst und alle Dinge, die ihnen begegnen, vergänglich sind. Nur so werde es ihnen gelingen, die Schönheit, die Lust an der Welt zu erfassen und festzuhalten.
Ich wunderte mich – und tue dies bis heute –, dass Gedanken wie diese einen so vollkommenen Ausdruck fanden in einem Werk, das vor über zweitausend Jahren verfasst wurde. Die Verbindung zwischen diesem Text und der Moderne ist keine direkte, so simpel liegen die Dinge nie. Zwischen beiden Epochen dehnen sich unzählige Perioden des Vergessens, des Verschwindens, Wiederentdeckens, Verfehlens, unzählige Momente der Verzerrungen, Anfechtungen, Wandlungen und des erneuten Vergessens. Und doch gibt es so etwas wie eine Leben stiftende Verbindung. Versteckt hinter der Weltauffassung, die ich als meine eigene begreife, gibt es ein uraltes Gedicht, ein Gedicht, das irgendwann verloren ging, unwiederbringlich, wie es schien, und dann doch wiederentdeckt wurde.
Die philosophische Tradition, der Lukrez’ Gedicht entsprang, war unvereinbar mit dem Kult der Götter und dem Kult des Staates; diese Tradition wurde selbst in der toleranten Kultur der klassisch-antiken Welt des Mittelmeers als skandalös empfunden. Ihre Anhänger galten als Verrückte, wurden als gottlos gebrandmarkt oder schlicht als verrückt. Und kaum hatte das Christentum an Kraft gewonnen, wurden die Texte der Atomisten erst recht bekämpft, verspottet, verbrannt oder – was am nachhaltigsten wirkte – einfach übergangen und schließlich vergessen. Das alles ist nicht verwunderlich; viel erstaunlicher ist, dass eine so überwältigend prachtvolle Artikulation dieser Philosophie – das Gedicht, dessen Wiederentdeckung Gegenstand dieses Buches ist – überlebt hat und erhalten blieb. Von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, ist alles, was von dieser großartigen Tradition blieb, in diesem einen und einzigartigen Werk erhalten. Ein zufälliger Brand, ein Akt des Vandalismus, eine Entscheidung, diese letzte Spur dessen zu verwischen, was als häretisch galt, und Neuzeit und Moderne hätten einen völlig anderen Beginn und Verlauf genommen.
Dabei hätte von allen Meisterwerken der Antike gerade dieses Gedicht unbedingt verschwinden müssen, ein für alle Mal und zusammen mit den Werken, die es inspiriert hatten. Dass dies nicht geschah, dass es nach vielen Jahrhunderten wieder auftauchte und seine zutiefst subversiven Thesen erneut verbreiten konnte, grenzt, so möchte man denken, an ein Wunder. Der Autor des in Frage stehenden Gedichts aber glaubte nicht an Wunder. Nichts in der Welt, dachte er, sollte die Gesetze der Natur verletzen. Er setzte auf etwas anderes, auf etwas, das er lateinisch clinamen nannte: eine geringfügige Abweichung, ein zufälliger Richtungswechsel, Ruck und unerwartete Bewegung der Materie.2 Das Wiederauftauchen seines Gedichts war eine solche Irritation, ein plötzliches Aus-der-Richtung-Geraten, eine unvorhersehbare Abweichung vom eingeschlagenen Weg, der dem Gedicht und der es begründenden Philosophie bestimmt schien – und der, ohne diesen Ruck, ins Vergessen geführt hätte.
Als es nach einem Jahrtausend plötzlich wieder Verbreitung fand, erschien vieles absurd, was dieses Werk über ein Universum sagte, das entstanden sein sollte aus dem Zusammenstoß von Atomen in einer unendlichen Leere. Ausgerechnet das jedoch, was zunächst als gottlos und unsinnig betrachtet wurde, hat sich später als Basis unseres gegenwärtigen, rationalen Weltverständnisses erwiesen. Es geht hier nicht nur um die überraschende Entdeckung von Schlüsselelementen der Moderne in der Antike, wobei es sicher nichts schadet, wenn wir uns erinnernd vor Augen führen, dass gerade die griechischen und römischen Klassiker, die wir aus unseren Curricula gestrichen haben, das neuzeitlich-moderne Bewusstsein entscheidend bestimmt haben. Vielleicht noch mehr wird uns überraschen, wenn uns De rerum natura auf jeder Seite klarmacht, dass die wissenschaftliche Sicht der Welt – die Vision von Atomen, die sich zufällig durch ein unendliches Universum bewegen – erfüllt ist vom Gespür für das Wunderbare, wie es nur ein Dichter besitzt. Doch Wunder sind hier nicht länger die Sache von Göttern und Dämonen, von Träumen vom Leben im Jenseits; bei Lukrez entspringt das Wunderbare der Erkenntnis, dass wir aus der gleichen Materie gemacht sind wie Sterne und Meere und alle anderen Dinge auch. Und diese Erkenntnis lieferte die Grundlage für seine Vorstellungen davon, wie wir unser Leben führen sollten.
Nach meiner Meinung, und ganz sicher nicht nur nach dieser, war es die Renaissance, die von allen in der Nachfolge der Antike stehenden Kulturen am genauesten verkörpert hat, was Lukrez’ Sinn für Schönheit und Lust ausmacht und was er zu einem legitimen, den Menschen würdigen Streben entfaltet. Dieses Streben beschränkte sich nicht allein auf die Kunst. Es prägte Kleidung und Etikette an den Höfen, die Sprache der Liturgie, Gestaltung und Schmuck der Alltagsdinge. Es durchdrang Leonardo da Vincis wissenschaftliche und technische Erkundungen, Galileo Galileis lebendige Dialoge zur Astronomie, Francis Bacons ehrgeizige Forschungsvorhaben, Richard Hookers Theologie. Es war fast so etwas wie ein Reflex, dass auch Werke, die anscheinend weit entfernt waren von jeglicher ästhetischen Ambition – Machiavellis Untersuchung politischer Strategien, Walter Raleighs Beschreibung von Guyana, Robert Burtons enzyklopädische Darstellung seelischer Krankheit –, in einer Weise ausgeführt wurden, die intensivstes Vergnügen erzeugte. Die sublimsten Zeugnisse des Strebens nach Schönheit jedoch waren die Künste der Renaissance – Malerei, Bildhauerei, Musik, Architektur, Literatur.
Auch wenn meine ganz persönliche Liebe Shakespeare galt und gilt, erschienen mir dessen Hervorbringungen stets als nur eine atemberaubende Facette einer viel breiteren kulturellen Bewegung, die auch Alberti, Michelangelo und Raphael, Ariost, Montaigne und Cervantes umfasst, um unter vielen Dutzend Künstlern und Schriftstellern nur sie zu nennen. Diese Bewegung hatte viele miteinander verknüpfte, einander auch zuwiderlaufende Aspekte, die jedoch alle durchpulst waren von jener herrlichen Bestätigung und Feier der Lebenskraft. Sie prägt sogar solche Werke der Renaissancekunst, in denen der Tod zu triumphieren scheint. So verschlingt das Grab am Ende von Romeo und Julia die Liebenden weniger, als dass es ihnen eine Zukunft eröffnet als Verkörperung der Liebe schlechthin. In den hingerissenen Zuschauern, die seit über vierhundert Jahren in dieses Stück drängen, hat sich Julias Wunsch erfüllt:
Komm, milde, liebevolle Nacht! Komm, gib Mir meinen Romeo! Und stirbt er einst, Nimm ihn, zerteil in kleine Sterne ihn: Er wird des Himmels Antlitz so verschönen, Daß alle Welt sich in die Nacht verliebt Und niemand mehr der eitlen Sonne huldigt.
(III.2:2–24)
Ein vergleichbar weiträumiges Umfassen von Schönheit und Lust – eines, das den Tod ebenso einbegreift wie das Leben, Vergehen nicht anders als Schöpfung – charakterisiert Montaignes ruhelose Reflexionen über Materie in Bewegung, Cervantes’ Chronik seines wirren Ritters, Michelangelos Darstellung geschundener Haut, Leonardos Skizzen von Wasserwirbeln, Caravaggios liebevolle Aufmerksamkeit für Christi schmutzige Fußsohlen.
Es muss etwas geschehen sein in der Renaissance, etwas, das anbrandete gegen die Dämme und Grenzen, die Jahrhunderte gegen Neugier, Begehren, Individualität, gegen nachhaltige Aufmerksamkeit für die Welt, gegen Ansprüche des Körpers errichtet hatten. Dieser kulturelle Umbruch ist bekanntlich schwer zu fassen, und um seine Bedeutung wurde erbittert gestritten. Doch lässt sich, was damals geschehen sein muss, leicht erspüren, wenn man in Siena die Maestà, Duccio di Buoninsegnas Altar mit der thronenden Jungfrau betrachtet, dann in Florenz Botticellis Primavera, ein Gemälde, in dem nicht zufällig Einflüsse von Lukrez’ De rerum natura zu erkennen sind. Es ist die Haupttafel von Duccios prächtigem Altar (um 1310), auf die sich die Anbetung der Engel, Heiligen und Märtyrer richtet: das heiter ruhige Zentrum, die in schweres Tuch gekleidete Muttergottes und das Kind in feierlicher Kontemplation. Auf Botticellis Primavera (um 1482) dagegen versammeln sich die antiken Götter in einem üppig grünen Gehölz, alle bewusst eingebunden in die komplexe rhythmische Choreographie der sich erneuernden natürlichen Fruchtbarkeit, wie sie Lukrez’ Gedicht beschwört:
Frühling kommt und Venus, und ihnen voraus sind Venus’ geflügelter Bote und Mutter Flora, auf den Fersen folgt ihnen Zephyr, und sie bereiten der Göttin den Weg, verbreiten mit den Blumen herrliche Farben und Wohlgerüche.
(V:737ff.)3
Worin Wechsel und Veränderung bestehen, erschließt sich nicht nur im wiedererwachten, intensiv erlebten, höchst kundigen Interesse an heidnischen Gottheiten und den reichen Bedeutungen, die einst mit ihnen verknüpft waren. Er liegt auch in der Gesamtvision einer Welt in Bewegung, einer sinnlichen Welt, die darum nicht bedeutungslos gemacht wird, sondern ihre Schönheit erst in ihrer Vergänglichkeit gewinnt, in ihrer erotischen Kraft, ihrem unermüdlichen Sich-Wandeln.
Auch wenn er sich in der Kunst am deutlichsten zeigt, so beschränkt sich der Übergang von einer Art der Wahrnehmung und des Lebens in der Welt zu einer anderen nicht auf Ästhetisches: Er hilft auch zu erklären, wie es zu den geistigen Wagnissen eines Kopernikus oder eines Vesalius, eines Giordano Bruno oder William Harvey, eines Hobbes und Spinoza kommen konnte. Der Wandel kam nicht plötzlich, geschah nicht ein für alle mal, sondern schrittweise, zunehmend wurde es möglich, sich aus der Präokkupation mit Engeln und Dämonen und immateriellen Ursachen zu lösen, sich stattdessen den Dingen in dieser Welt zuzuwenden; zu erkennen, dass die Menschen aus dem gleichen Stoff bestehen wie alles andere auch; dass sie Teil der natürlichen Ordnung sind; dass man, ohne fürchten zu müssen, in Gottes eifersüchtig bewahrte Geheimnisse einzubrechen, Experimente durchführen, Autoritäten anzweifeln, überlieferte Lehren in Frage stellen kann; dass sich das Streben nach Lust, das Vermeiden von Schmerz und Leid rechtfertigen lassen; dass man sich andere Welten vorstellen kann neben der einen, die wir bewohnen, den Gedanken fassen kann, dass unsere Sonne nur ein Stern ist unter vielen in einem unendlichen Weltenraum; dass wir ein moralisches Leben führen können, ohne dass man uns mit Lohn locken, mit Strafe nach dem Tod schrecken müsste; ja, dass sich sogar der Tod der Seele ohne Furcht und Zittern denken lässt. Kurz, es wurde, um Audens Dichterworte zu bemühen, möglich – nicht einfach, aber möglich –, an der sterblichen Welt sein Genügen zu finden.
Der Anbruch der Renaissance, das Freisetzen der Kräfte, die unsere Welt geformt haben, lässt sich nicht aus einem einfachen Grund erklären. Gleichwohl möchte ich mit diesem Buch eine wenig bekannte, für die Renaissance jedoch exemplarische Geschichte erzählen, die Geschichte von Poggio Bracciolinis Wiederentdeckung des Gedichts De rerum natura. Diese Wiederentdeckung hat den Vorzug, dass sie auch der Bezeichnung die Treue hält, mit der wir den kulturellen Wandel zu Beginn des neuzeitlich modernen Lebens und Denkens für gewöhnlich umreißen: als ReNaissance, Wiedergeburt der Antike. Natürlich kann man ein Gedicht allein nicht verantwortlich machen für eine so umfassende geistige, moralische und gesellschaftliche Transformation – das vermag ein einziges Werk nicht, und schon gar nicht eines, über das man jahrhundertelang nicht ohne Furcht öffentlich und frei hatte reden können. Mit diesem ganz besonderen Buch der Antike, das plötzlich in den Blick geriet, verhielt es sich allerdings doch etwas anders.
So ist hier zu erzählen, wie die Welt plötzlich um ein Geringes aus der Bahn gestoßen wurde, ein zufälliger Ruck, der einen folgenreichen Richtungswechsel auslöste. Das Agens dieses Richtungswechsels war keine Revolution, keine unversöhnliche Armee vor den Toren der Stadt, keine Landung auf einem unbekannten Kontinent. Für Ereignisse dieser Größenordnung haben Historiker und Künstler der volkstümlichen Einbildungskraft erinnerbare, einprägsame Bilder präsentiert, den Sturm auf die Bastille, die Plünderung Roms, den Augenblick, in dem die zerlumpten Seeleute auf den spanischen Schiffen in der Neuen Welt ihre Fahne aufpflanzten. Diese Embleme weltgeschichtlichen Wandels können trügerisch sein – in der Bastille saßen so gut wie keine Gefangenen; Alarichs Heerscharen zogen rasch wieder ab aus der Hauptstadt des Imperiums; und das eigentlich schicksalhafte Ereignis für den amerikanischen Kontinent war nicht das Entrollen der Fahne, sondern dass ein kranker, bazillenverseuchter, von staunenden Eingeborenen umringter Seemann nieste oder hustete. Dennoch können wir uns in solchen Fällen an das einprägsame Symbol halten. Der epochale Wandel allerdings, mit dem dieses Buch sich befasst, lässt sich, obwohl er doch das Leben von uns allen beeinflusst hat, nicht ohne weiteres mit einem dramatischen Bild verknüpfen.
Als es vor fast sechshundert Jahren zu diesem Wandel kam, war das Schlüsselereignis verhüllt, fast unsichtbar, geschah versteckt, unsichtbar hinter Wänden an einem abgelegenen Ort. Es gab keine heroischen Gesten, keine leidenschaftlich beteiligten Beobachter, die das große Ereignis für die Nachwelt festgehalten hätten, weder Zeichen am Himmel noch auf Erden hätten auf irgendeine Weise erkennen lassen, dass alles sich für immer geändert hatte. Eines Tages streckte ein kleiner, genialer, ebenso umsichtiger wie aufmerksamer Mann Ende dreißig seine Hand aus, um ein sehr altes Manuskript aus einem Regal zu nehmen, betrachtete überrascht, was er entdeckt hatte, und erteilte sofort den Auftrag, die Schrift zu kopieren. Das war alles, aber es war genug.
Natürlich hat der Entdecker des Manuskripts die Bedeutung dessen, was er sah, gar nicht voll erfassen, auch den Einfluss nicht vorausahnen können, der Jahrhunderte brauchte, um sich zu entfalten. Wenn er denn geahnt hätte, welche Kräfte er da losließ, hätte er es sich wohl zweimal überlegt, ein so explosives Werk aus dem Dunkel zu ziehen, in dem es schlummernd lag. Das Werk, das jener Mann in den Händen hielt, war Jahrhunderte zuvor sorgfältig von Hand kopiert worden, doch ebenso lange war es nicht von Hand zu Hand gegangen, war vielleicht nicht einmal von den einsamen Seelen verstanden worden, die es kopiert hatten. Über Generationen hinweg wurde über dieses Buch nicht einmal gesprochen. Zwischen dem vierten und dem neunten Jahrhundert wurde es noch gelegentlich zitiert, und zwar in Listen mit grammatischen oder lexigraphischen Beispielsätzen, diente also als Steinbruch zur Demonstration korrekt verwendeten Lateins. Im siebten Jahrhundert, als er seine riesige Enzyklopädie erstellte, nutzte es Isidor von Sevilla als Autorität in Sachen Meteorologie. Erneut tauchte es auf zur Zeit Karls des Großen, als sich das Interesse an alten Büchern zum ersten Mal regte und ein irischer Mönch namens Dungal eine Abschrift sorgfältig korrigierte. Nach diesen flüchtigen Augenblicken des Wiederauftauchens versank es stets wieder in den Wellen. So lag es schlafend und vergessen über tausend Jahre, bevor es erneut in Umlauf kam.
Verantwortlich für diese folgenreiche Rückkehr war Poggio Bracciolini, ein passionierter Briefschreiber. Er verfasste einen Bericht über seine Entdeckung und schickte sie an einen Freund zuhause in Italien; der Brief ging leider verloren.4 Allerdings lässt sich anhand anderer Briefe sowohl aus Poggios Feder wie auch aus Briefen seines Kreises rekonstruieren, wie die Sache sich entwickelt hat. Aus unserer Perspektive ist dieses eine und besondere Manuskript zu Poggios größtem Fund geworden, war aber beileibe nicht sein einziger, und er verdankte sich auch nicht dem Zufall. Poggio Bracciolini war ein Bücherjäger, vielleicht der größte in einer Zeit, die versessen darauf waren, das Erbe der antiken Welt aufzuspüren und wieder zu entdecken.
Der Fund eines verlorenen Buches gilt gemeinhin nicht als besonders aufregendes Ereignis, doch in diesem Fall sind damit die Verhaftung und Gefangenschaft eines Papstes, Scheiterhaufen für Ketzer und ein großes, die ganze damalige Kultur explosionsartig erfassendes Interesse an der heidnischen Antike verknüpft. Dem Akt der Entdeckung galt die lebenslange Leidenschaft eines brillanten Buchjägers. Und dieser wurde, ohne es gewollt oder bemerkt zu haben, zum Geburtshelfer der Moderne.
KAPITEL EINS
DER BÜCHERJÄGER
Im Winter 1417 reitet Poggio Bracciolini durch die bewaldeten Täler und Höhen Süddeutschlands seinem fernen Ziel entgegen, einem Kloster, von dem es heißt, es beherberge ein geheimes Lager alter Handschriften. Dorfleute, die in den Türen ihrer Häuser stehen und ihm nachsehen, erkennen sofort, dass er ein Fremder ist. Schlank von Gestalt und glatt rasiert,1 wird er vermutlich nicht aufwändig gekleidet gewesen sein, in einfachem, aber gut geschnittenem Rock und Überwurf. Auch dass er nicht vom Land kommt, sieht man sofort. Aber er erinnert auch nicht an einen Städter oder Höfling, wie sie das Bauernvolk hin und wieder zu Gesicht bekommt. Er ist unbewaffnet, reist ohne Schutz eines rasselnden Trupps von Kriegsleuten, ist also gewiss kein teutonischer Ritter – ein beherzter Schlag mit der Keule eines Bauerntölpels würde ihn ohne weiteres zu Boden strecken. Er wirkt nicht wie ein Armer, doch sieht man auch keines der vertrauten Zeichen von Reichtum und Stand: Er ist kein Höfling mit prachtvollen Gewändern und parfümiertem, in langen Locken getragenem Haar, kein Edelmann auf Jagd oder Beiz. Aber wie Haartracht und Kleidung zeigen, ist er auch kein Priester oder Mönch.
Süddeutschland war damals eine blühende Region. Die Katastrophen des Dreißigjährigen Krieges, die diesen Landstrich verwüsten und ganze Städte ruinieren sollten, lagen noch in ferner Zukunft, ebenso die Schrecken unserer Zeit, die viel von dem zerstörten, was aus jener frühen Epoche geblieben war. Es reisten damals nicht nur Ritter, Höflinge und Adlige, auch andere wohlhabende Männer zogen geschäftig über die ausgefahrenen Straßen. Ravensburg nördlich des Bodensees und Konstanz waren im Leinenhandel engagiert, und kürzlich hatte man dort auch begonnen, Papier zu schöpfen. Ulm, am Ufer der Donau, war eine reiche Stadt mit Handwerk und Handel, ebenso Heidenheim, Aalen, Rothenburg ob der Tauber und das noch schönere Würzburg. Stadtbürger, Wollhändler, Kaufleute, die mit Leder und Stoffen handelten, Weinhändler und Bierbrauer, Handwerker und ihre Lehrlinge, aber auch Diplomaten, Bankiers und Steuereintreiber, sie alle traf man regelmäßig auf den Straßen. Einer wie Poggio aber passte nicht in dieses Bild.
Auch weniger betuchtes Volk war unterwegs, Gesellen, Kesselflicker, Messerschleifer und andere, deren Gewerbe sie zum Umherziehen zwang; dazu Pilger auf dem Weg zu bestimmten Wallfahrtsorten, wo sie in Gegenwart von Reliquien, dem Splitter eines Knochens eines Heiligen oder einem Tropfen heiligen Blutes beten konnten; Gaukler, Wahrsager, Falkner, Akrobaten und Schauspieler zogen von Dorf zu Dorf; dazu Entflohene, Vagabunden und Gauner. Und dann waren da auch Juden unterwegs, mit konischen Hüten und dem gelben Judenzeichen, die sie auf Anordnung der christlichen Obrigkeiten tragen mussten, was sie, Objekte von Verachtung und Hass, leicht identifizierbar machte. Auch zu diesen Gruppen gehörte Poggio ganz sicher nicht.
Kurz, er muss denen, die ihn vorbeireiten sahen, tatsächlich als rätselhafte Gestalt erschienen sein. Die meisten Menschen damals signalisierten ihre Herkunft, Stand oder Identität, ihre Stellung im hierarchischen Gesellschaftssystem der Zeit. Das geschah mit Zeichen, die jedermann lesen konnte, so wie die Farbe an den Händen der Färber. Poggio aber war einfach nicht zuzuordnen. Ein vereinzelter Mann, der offenbar außerhalb von Familienbindungen lebte, keinem Gewerbe angehörte, das konnte es eigentlich gar nicht geben. Denn damals zählten Zugehörigkeit und Herkunft. Ein kleines Couplet, das Alexander Pope im 18. Jahrhundert verfasste, um einen der kleinen Möpse der Königin zu verspotten, hätte, und zwar ohne Spott, auf die Welt gepasst, in der Poggio lebte:
I am his Highness’ dog at Kew; Pray tell me, sir, whose dog are you?
Ich bin ihrer Hoheit Hund aus Kew; Ich bitt euch, Herr, sagt, wessen Hund bist du?
Der Hausstand, das Netzwerk der Verwandten, Zunft und Gilde, Handelsgesellschaft und Gemeinde – das waren die Zeichen, die Bausteine, aus denen eine Person gemacht wurde. Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein waren kulturell noch keine Werte, ja, sie waren kaum wahrzunehmen, woher also sollte Wertschätzung kommen? Identität erhielt man durch einen genau umrissenen, ausgemachten Platz in der Kette von Befehl und Gehorsam.
Jeder Versuch, sich aus dieser Kette zu befreien, wäre töricht gewesen. Eine anmaßende Geste – die Weigerung, sich zu verbeugen, niederzuknien, die Kopfbedeckung zu ziehen, wenn eine entsprechend honorable Person vorüberkam – konnte dazu führen, dass einem die Nase aufgeschlitzt, womöglich das Genick gebrochen wurde. Doch warum auch hätte man so etwas tun sollen? Schließlich war es ja nicht so, dass es irgendwelche sinnvollen, haltbaren Alternativen gegeben hätte, gar solche, die Kirche oder Gerichte oder die städtischen Oligarchen formuliert hätten. Am besten fuhr, wer Identität und Rolle demütig akzeptierte, in die er oder sie hineingeboren worden war: Der den Pflug führte, musste eben nur wissen, wie man diesen führte, der Weber, wie man webte, der Mönch, wie zu beten war. Natürlich konnte man in diesen Dingen besser oder schlechter bewandert sein; die Gesellschaft, in der Poggio sich befand, konnte ungewöhnliche Fähigkeiten durchaus anerkennen und auch belohnen, manchmal in beträchtlichem Umfang. Doch so gut wie nie hatte man davon gehört, dass eine Person für irgendeine unwägbare Individualität oder wegen ihrer Vielseitigkeit oder besonderen Neugier anerkannt worden wäre. Tatsächlich hielt die Kirche Neugier für eine der Todsünden. Wer sich ihr hingab, riskierte ein ewiges Leben in der Hölle.2
Wer also war Poggio dann? Warum hat er seine Identität nicht mit irgendwelchen Zeichen kundgetan, so wie anständige Leute das zu tun gewohnt waren? Er trug solche Insignien nicht, schleppte keine Warenbündel mit sich herum. Er zeigte das selbstbewusste Auftreten eines Mannes, der es gewohnt war, sich in Gesellschaft der Großen zu bewegen, er selbst aber war ganz offensichtlich kein Mann von großer Bedeutung. Jedermann wusste doch, wie solche bedeutenden Persönlichkeiten aussahen und daherkamen, denn dies war eine Gesellschaft der Dienstverpflichteten und bewaffneten Leibgarden und livrierten Diener. Dieser Fremde, einfach gekleidet, ritt in Begleitung nur eines Gefährten. Machten sie Rast in einem Gasthaus, erledigte der Begleiter, offenbar ein Gehilfe oder Diener, die Bestellung; wenn der Meister sprach, wurde klar, dass er wenig oder gar kein Deutsch konnte, seine Sprache war vielmehr das Italienische.
Hätte er einer neugierigen Person erklären wollen, mit welchen Absichten er reiste, hätte dies das Geheimnis um seine Person nur vergrößert. In einer Gesellschaft, in der nur sehr wenige Menschen lesen und schreiben konnten, konnte Interesse an Büchern zu äußern nur merkwürdig wirken. Und wie hätte Poggio über die noch verrücktere Art seiner ganz persönlichen Interessen sprechen sollen? Er suchte keine Stundenbücher, nicht Messbücher oder Gesangbücher, deren Wert Illiterate immerhin an ihrer prachtvollen Bindung, an Ausstattung und Illustrationen hätten erkennen können. Solche Bücher, einige davon juwelenbesetzt und in Gold gefasst, wurden zumeist in besonderen Schränken eingeschlossen oder an Lesepulte und Regale gekettet, sodass sich leichtfingrige Leser nicht mit ihnen aus dem Staub machen konnten. Doch solche Bücher reizten Poggio gar nicht. Ihn zog es auch nicht zu den theologischen, medizinischen oder juristischen Folianten, deren Besitz unter führenden Vertretern der jeweiligen Profession der Prestigesteigerung diente. Diese Bücher hatten die Macht, selbst diejenigen einzuschüchtern, die sie kaum lesen konnten. Sie verströmten eine Art soziale Magie, derart, dass sie in den meisten Fällen mit unangenehmen Erlebnissen verbunden waren: ein Gerichtsprozess, eine schmerzhafte Schwellung in der Leistengegend, eine Anklage wegen Hexerei oder Ketzerei. Ein normaler Mensch hätte ohne weiteres geglaubt, dass solche Bücher über Zähne und Klauen verfügten, hätte sich darum auch vorstellen können, warum gescheite Menschen Jagd auf sie machten. Doch auch in dieser Hinsicht gab Poggios Gleichgültigkeit Rätsel auf.
Der Fremdling war auf dem Weg in ein Kloster, war aber weder Priester noch Theologieprofessor noch Inquisitor, er suchte auch keineswegs nach Gebetbüchern. Er war hinter alten Manuskripten her, von denen viele halb verrottet waren, voller Wurmlöcher und selbst für geübteste Leser alles andere als leicht zu entziffern. Waren die Pergamentbögen, auf denen solche Bücher geschrieben wurden, noch intakt, hatten sie immerhin einen gewissen Materialwert, denn man konnte sie mit einer Messerklinge sorgfältig abschaben, mit Talkum glätten und dann erneut beschreiben.
Doch Poggio war auch nicht im Pergamentenhandel aktiv, vielmehr hasste er alle, die alte Buchstaben abkratzten. Er wollte sehen, was da geschrieben stand, selbst wenn das Geschriebene schlecht lesbar war, und vor allem hatten es ihm jene Manuskripte angetan, die vier-, fünfhundert Jahre alt waren, aus dem zehnten Jahrhundert stammten, vielleicht aus noch älteren Zeiten.
Allenfalls eine Handvoll Menschen in Deutschland hätten, wenn er mit ihnen darüber gesprochen hätte, nicht verschroben, gar unheimlich gefunden, was Poggio tat. Und es wäre den Zeitgenossen noch unheimlicher erschienen, hätte Poggio davon erzählt, dass ihn auch das nicht interessierte, was vor vier- oder fünfhundert Jahren geschrieben worden sei. Denn er verachtete diese Zeit, die ihm als Jauchegrube voller Aberglauben und Unwissenheit erschien. Was er tatsächlich zu finden hoffte, waren Worte, die nichts mit der Zeit zu tun hatten, in denen sie auf das alte Pergament gesetzt worden waren, Worte, die im besten Fall unverdorben, jedenfalls nicht verdorben waren durch das geistige Universum des niederen Schreibers, der sie kopierte. Dieser Schreiber war, so hoffte Poggio, pflichtbewusst und genau beim Kopieren eines Pergaments, das damals schon alt gewesen war, das zuvor ein anderer Schreiber kopiert hatte, dessen bescheidenes Leben, abgesehen davon, dass er diese Spur hinterlassen hatte, für den Bücherjäger ebenfalls ohne besonderes Interesse war. Wenn die ans Wunderbare grenzende Glückssträhne anhielt, war dieses ältere Manuskript, seit langem unter Staub vergraben, seinerseits eine getreue Kopie einer noch älteren Handschrift, und auch die wiederum die Kopie einer nochmals älteren. In solchem Fall begann die Sache spannend zu werden, vor Aufregung würde Poggios Herz schneller schlagen. Die Spur würde ihn zurückführen nach Rom, nicht ins zeitgenössische Rom mit dem korrupten Hofstaat des Papstes, den Intrigen und der politischen Schwäche, den periodischen Ausbrüchen der Beulenpest, sondern in das Rom des Forum und des Senatspalastes und eines Latein, dessen kristalline Schönheit ihn mit Staunen erfüllte und mit Sehnsucht nach einer untergegangenen Welt.
Welche Bedeutung sollte das für einen Menschen haben, der im Jahre 1417 mit beiden Beinen fest auf dem Boden des südlichen Deutschland stand? Ein Mann musste, wenn er Poggio zuhörte, nicht sonderlich abergläubisch sein, um an eine besondere Spielart der Zauberei zu denken, an Bibliomantie; ein etwas gebildeterer Zeitgenosse hätte vielleicht psychische Zwänge diagnostiziert, Bibliomanie. Und ein Frommer hätte sich gefragt, wie sich überhaupt irgendeine Seele derart leidenschaftlich nach einer Zeit sehnen konnte, in der Christus den in finsterer Nacht lebenden Heiden sein Versprechen der Erlösung noch gar nicht gebracht hatte. Und alle hätten sie sich die naheliegende Frage gestellt: Wem diente dieser Mann eigentlich?
Vielleicht hätte man Poggio bedrängt, unter Druck gesetzt, um eine Antwort zu erhalten. Und erfahren, dass er bis vor kurzem im Dienst des Papstes gestanden hatte, wie er schon zuvor einer Reihe einander ablösender Päpste gedient hatte. Seine Berufsbezeichnung war Skriptor, das heißt, er war ein begabter Schreiber amtlicher Dokumente der päpstlichen Bürokratie; und er hatte sich, gewandt und klug, wie er war, auf den begehrten Posten eines apostolischen Sekretärs emporgearbeitet. Als solcher stand er zur Verfügung, wenn die Worte des Papstes niederzulegen, seine Regierungsentscheidungen festzuhalten, die ausgedehnte internationale Korrespondenz in elegantem Latein zu verfassen waren. In der förmlichen Umgebung eines Hofes, in der die physische Nähe zum absoluten Herrscher von entscheidender Bedeutung war, war Poggio ein bedeutender, ein gefragter Mann. Er hörte zu, wenn der Papst etwas in sein Ohr flüsterte, er flüsterte seine Antwort, er wusste das Lachen des Papstes ebenso zu deuten wie dessen Stirnrunzeln. Er hatte – wie das Wort Sekretär nahelegt, das abgeleitet ist vom lateinischen secretus, geheim – Zugang zu den Geheimnissen des Papstes. Und dieser Papst hatte eine Menge Geheimnisse.
Zu der Zeit, als sich Poggio auf seine Jagd nach uralten Handschriften machte, war er allerdings nicht länger apostolischer Sekretär. Er hatte seinen Dienstherrn, den Papst, nicht verärgert, und dieser lebte auch noch, und doch hatte sich alles verändert. Der Papst, dem Poggio gedient hatte und vor dem die Gläubigen (wie auch die weniger Gläubigen) einst gezittert hatten, saß in diesem Winter 1417 im Heidelberger Schloss in kaiserlicher Haft. Er hatte alles verloren: Titel, Namen, Macht und Würde, war öffentlich gedemütigt worden, verurteilt von den Fürsten seiner eigenen Kirche. Das heilige und unfehlbare Konzil von Konstanz erklärte, durch seinen »verabscheuungswürdigen und unziemlichen« Lebenswandel habe er Schande über die Kirche und das Christentum gebracht, sei in seinem erhabenen Amt darum nicht länger tragbar.3 Entsprechend entband das Konzil alle Gläubigen von ihrer Treue und ihrem Gehorsam gegenüber dem Papst; tatsächlich war es verboten, ihn länger Papst zu nennen oder seinen Anordnungen zu gehorchen. In der ganzen langen Geschichte der Kirche hatte es dergleichen noch nicht gegeben – und es sollte auch in Zukunft nie wieder so weit kommen.
Der abgesetzte Papst hatte diese formelle Absetzung nicht persönlich miterlebt, doch Poggio, bis dahin apostolischer Sekretär dieses Papstes, war möglicherweise dabei, als der Erzbischof von Riga den päpstlichen Siegelring einem Goldschmied übergab, der ihn zusammen mit dem päpstlichen Wappen feierlich in Stücke schlug. Alle Bediensteten des Ex-Papstes wurden förmlich entlassen, seine Korrespondenz – die Poggio verwaltet hatte – wurde offiziell beendet. Den Papst, der sich Johannes XXIII. genannt hatte, gab es nicht mehr; der Mann, der diesen Titel getragen hatte, war nun wieder der, als der er getauft worden war, Baldassare Cossa. Und Poggio ein Mann ohne Herr und Dienst.
Das war zu Beginn des 15. Jahrhunderts kein beneidenswerter, ja ein gefährlicher Status. Dörfer und Städte beobachteten wanderndes Volk mit Misstrauen; Vagabunden wurden ausgepeitscht und gebrandmarkt, und auf den einsamen Wegen und Straßen einer weitgehend unkontrollierten Welt waren Menschen ohne Schutz äußerst gefährdet. Natürlich war Poggio kein Vagabund, hatte sich, bestens ausgebildet und kenntnisreich, lange in höchsten Kreisen bewegt. Die Wachen am Vatikan und in der Engelsburg ließen ihn ohne Befragung passieren, bedeutende Bittsteller am päpstlichen Hof suchten seine Aufmerksamkeit. Er hatte direkten Zugang zu einem absoluten Herrscher, dem reichen und gerissenen Herrn über riesige Territorien, der zugleich beanspruchte, das geistliche Oberhaupt der abendländischen Christenheit zu sein. In den Privatgemächern des Palastes wie am päpstlichen Hof selbst war der apostolische Sekretär Poggio eine vertraute Erscheinung, man sah ihn mit juwelengeschmückten Kardinälen scherzen, mit Gesandten plaudern und dabei aus Kristallgläsern oder goldenen Bechern besten Wein trinken. In Florenz war er befreundet mit den Mächtigsten aus der Signoria, dem regierenden Rat der Stadt, und er hatte einen erlesenen Freundeskreis.
Doch 1417 war Poggio weder in Rom noch in Florenz, sondern in Deutschland, und der Papst, dem er nach Konstanz gefolgt war, saß im Gefängnis. Die Gegner Johannes’ XIII. hatten gesiegt, nun verfügten sie über die Macht. Türen, die Poggio einst offengestanden hatten, fand er jetzt fest verschlossen. Und Bittsteller, die eine Gunst erlangen wollten – einen Ehedispens, eine gerichtliche Entscheidung, einen lukrativen Posten für sich oder einen Verwandten –, jene, die an seinen Herrn heranzukommen suchten und deshalb dessen Sekretär umwarben, würdigten ihn nun keines Blickes mehr. Poggios Einkünfte versiegten abrupt.
Und sie waren beträchtlich gewesen. Skriptoren erhielten keine fixen Summen, aber es war ihnen gestattet, Gebühren für die Ausfertigung von Dokumenten zu verlangen sowie für das Erwirken dessen, was »Gnadenerweis« genannt wurde, legale Gefälligkeiten in Angelegenheiten, die sachkundige Regulierung oder Ausnahmeregelungen erforderten, die der Papst mündlich oder schriftlich gewährte. Dazu kamen weniger offizielle Vergütungen, die demjenigen persönlich zuflossen, der das Ohr des Papstes hatte. Mitte des 15. Jahrhunderts lag das jährliche Einkommen eines Sekretärs zwischen zweihundertfünfzig und dreihundert Fiorini, mit einigem Geschäftssinn konnte man es auf mehr bringen. Am Ende einer zwölfjährigen Tätigkeit auf diesem Posten hatte Poggios Kollege Georg von Trapezunt über viertausend Fiorini auf den Konten römischer Banken, dazu kamen bedeutende Investitionen in Grundstücke.4
In Briefen an seine Freunde behauptete Poggio zeitlebens, er sei weder ehrgeizig noch gierig. Schließlich war er Autor einer gefeierten Abhandlung, in der er gegen die Habsucht wetterte, sie sei die hassenswerteste unter den menschlichen Lastern, und die Gier scheinheiliger Mönche, skrupelloser Fürsten und habgieriger Kaufleute heftig geißelte. Natürlich wäre es naiv, wollte man solche Bekenntnisse für bare Münze nehmen: Es gibt ausreichend Hinweise, dass er später in seinem Leben, nachdem es ihm gelungen war, an den Hof des Papstes zurückzukehren, seine Chancen durchaus nutzte und ein stattliches Vermögen erwarb. In den 1450er Jahren besaß er einen Stadtpalast und ein Landgut für die Familie, dazu mehrere Güter, hatte insgesamt neunzehn Grundstücke und zwei Häuser in Florenz erworben, verfügte außerdem über enorme Einlagen bei Banken und anderen Geschäftshäusern.5
Doch 1417 lag dieser Wohlstand noch in weiter Zukunft. Nach einer amtlichen, 1427 durch Steuerbeamte angefertigten Aufstellung – einem sogenannten catasto – verfügte Poggio nur über ziemlich bescheidene Mittel. Und ein Jahrzehnt früher, als Papst Johannes XXIII. seines Amtes enthoben wurde, wird er wohl noch weniger sein Eigen genannt haben. Vielleicht war sein späterer Erwerbstrieb eine Reaktion auf die Erinnerung an jene langen Monate, aus denen schließlich mehrere magere Jahre wurden, in denen er sich in einem fremden Land wiederfand, ohne sichere Stellung, ohne Einkommen und mit nur geringen Ressourcen, auf die er zurückgreifen konnte. Im Winter 1417 jedenfalls, als er durch die süddeutschen Landschaften ritt, hatte Poggio wenige oder gar keine Vorstellungen davon, woher die nächsten Fiorini wohl kommen könnten.
Umso erstaunlicher war, dass sich Poggio in dieser für ihn schwierigen Zeit nicht rasch um eine neue Stellung bemüht oder zumindest gesehen hat, dass er nach Italien zurückkam. Stattdessen begab er sich auf Bücherjagd. 6
KAPITEL ZWEI
DER MOMENT DER ENTDECKUNG
Bereits seit gut hundert Jahren waren Italiener besessene Bücherjäger, seit nämlich der Dichter und Gelehrte Petrarca sich damit Ruhm erworben hatte, dass er um die 1330er Jahre Livius’ Monumentalwerk Ab urbe condita (Römische Geschichte – Von der Gründung der Stadt an) aus Fragmenten rekonstruiert, dazu vergessene Meisterwerke von Cicero, Propertius und anderen wiederentdeckt hatte.1 Mit seinem Erfolg hat Petrarca andere dazu animiert, nach verlorenen Klassikern zu suchen, die häufig seit Jahrhunderten irgendwo ungelesen herumgelegen hatten. Die wiederentdeckten Texte wurden kopiert, ediert und kommentiert, sodann eifrig ausgetauscht, womit sie zum Ruhm ihrer Wiederentdecker beitrugen. So bildeten sich die Grundlagen der studia humanitatis heraus; sachlich entsprachen diese in etwa dem, was im angelsächsischen Sprachgebrauch »Humanities« genannt wird.
Die »Humanisten« – so die Bezeichnung der Männer, die Grammatik, Rhetorik, Poesie, (Moral-)Philosophie und antike Geschichte in der praktischen Absicht einer umfassenden Geistesbildung studierten und lehrten – hatten, soweit diese erhalten waren, die Texte aus der Zeit der römischen Klassik gründlich gelesen und wussten darum, dass viele damals berühmte Bücher oder Teile solcher Bücher fehlten. Schmerzliche Neugier wurde wach, wenn Poggio und seine humanistischen Kollegen und Freunde in den Schriften antiker Autoren, die sie so gespannt lasen, immer wieder auf Zitate aus jenen verlorenen Büchern stießen, oft verbunden mit überschwänglichem Lob oder scharfzüngiger Kritik. So etwa bemerkt der römische Rhetoriker Quintilian im Zusammenhang seiner Auseinandersetzung mit Vergil und Ovid, »Macer und Lukrez muss man zwar lesen, doch nicht so, als ob sie für das Ausdrucksvermögen ... etwas einbrächten«, geht dann auf Schriften von Publius Terentius Varro, auch Atacinus genannt, Cornelius Severus, Saleius Bassus, Gaius Rabirius, Albinovanus Pedo, Marcus Furius Bibaculus, Lucius Accius, Marcus Pacuvius und andere ein, die er sehr bewundert.2 Die Humanisten wussten, dass einige dieser ihnen unbekannten Schriften wahrscheinlich für immer verloren waren – und tatsächlich stellte sich heraus, dass dies auf alle der oben erwähnten Autoren zutraf: mit Ausnahme von Lukrez. Doch warum sollten sich nicht andere Werke, vielleicht sogar viele andere Werke erhalten haben, irgendwo versteckt an dunklen Orten, nicht nur in Italien, sondern auch jenseits der Alpen? Hatte nicht Petrarca eine Handschrift von Ciceros Pro Archia (Rede für den Dichter Archias) im belgischen Lüttich aufgestöbert und das Propertius-Manuskript in Paris?
Bibliotheken alter Klöster waren die wichtigsten Jagdreviere für Poggio und die anderen Bücherjäger, und das aus gutem Grund: Über Jahrhunderte hinweg waren Klöster praktisch die einzigen Institutionen, die sich um Bücher kümmerten. Selbst in stabilen und prosperierenden Zeiten des Römischen Imperiums war, nach unseren Maßstäben, die Zahl derer, die lesen und schreiben konnten, nur sehr klein.3 Als das Reich bröckelte, die Städte verfielen, der Handel erlahmte und die Bevölkerung die Horizonte zunehmend verängstigt nach barbarischen Horden absuchte, zerfiel auch das römische System elementarer und höherer Bildung. Zunächst wurden die Schulen kleiner, dann verschwanden sie ganz, und mit den Schulen schlossen die Bibliotheken und Akademien, Grammatiker und andere Lehrer wurden arbeitslos. Und es gab wichtigere Dinge, um die man sich sorgen musste, als Bücher.
Nur von Mönchen wurde erwartet, dass sie lesen konnten. In einer Welt, die zunehmend von ungebildeten, des Lesens unkundigen Kriegsherren bestimmt wurde, bekam diese Forderung, die in der Frühzeit des Klosterwesens formuliert wurde, unschätzbare Bedeutung. Hier folgt die Regel, die der koptische Heilige Pachomius Ende des vierten Jahrhunderts formuliert hatte und die in Ägypten und während des gesamten Mittelalters in Klöstern galt. Darin, in Regel 139, heißt es, die Klosterältesten sollen, wenn sich ein Neuling um die Aufnahme in das Kloster bewirbt,
ihm zwanzig Psalmen oder zwei Apostelbriefe oder ein [entsprechendes] Stück aus der übrigen [Heiligen] Schrift aufgeben [zum Auswendiglernen]. Und wenn er des Lesens unkundig ist, soll er zur ersten, dritten und sechsten Stunde zu einem befähigten Lehrer gehen, der ihm zugewiesen wurde, und soll mit größtem Eifer und mit allem Dank [als Schüler] vor ihm stehen. Später soll man ihm die Buchstaben, Silben, Tätigkeitswörter, Hauptwörter aufschreiben, und so soll er angehalten werden, auch wenn er nicht mag, lesen zu lernen.4
»Auch wenn er nicht mag, lesen zu lernen« – genau dieser Zwang war ein Grund, warum die Errungenschaften des antiken Denkens über Jahrhunderte hinweg bewahrt wurden.
In der einflussreichsten aller Klosterregeln, die im sechsten Jahrhundert niedergelegt wurden, hat der heilige Benedikt keine ausdrücklichen Anforderungen hinsichtlich der Schreib- und Lesefähigkeit von Mönchen formuliert, aber er sorgte für ein Äquivalent: Ein gewisser Teil des Tages war für das Lesen – für die »heilige Lesung«, wie er dies nannte – vorgesehen, so wie ein anderer für körperliche Arbeit. »Müßiggang« hielt der Ordensgründer für »der Seele Feind«, achtete also darauf, dass die Stunden des Tages ausgefüllt waren. Auch zu bestimmten anderen Tageszeiten war den Mönchen das Lesen erlaubt, wobei dieses freiwillige Lesen in strikter Stille geschehen sollte. (In der Regel wurde zu Benedikts Zeiten, wie auch während der gesamten Antike, laut gelesen.) An den vorgeschriebenen Lesezeiten allerdings war nichts freiwillig.
Die Mönche mussten also lesen, ob ihnen danach war oder nicht; und die Regel verlangte, dass dies auch streng überwacht wurde:
Vor allem aber bestimme man einen oder zwei Ältere, die zu den Stunden, da die Brüder für die Lesung frei sind, im Kloster umhergehen. Sie müssen darauf achten, ob sich etwa ein träger Bruder findet, der mit Müßiggang oder Geschwätz seine Zeit verschwendet, anstatt eifrig bei der Lesung zu sein; damit bringt einer nicht nur sich selbst um den Nutzen, sondern lenkt auch andere ab.5
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »The Swerve. How the World Became Modern« bei W. W. Norton & Company, New York.
Erste Auflage April 2012
Copyright © 2011 by Stephen Greenblatt
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg Lektorat: Andreas Wirthensohn, München Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
eISBN 978-3-641-09888-9
www.siedler-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe