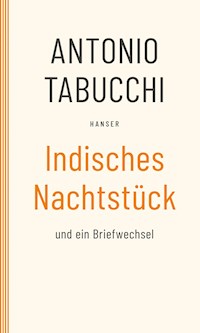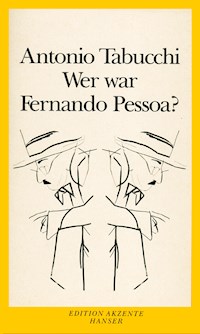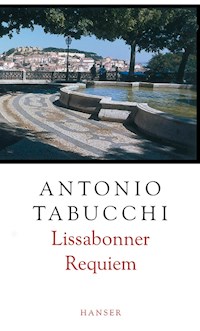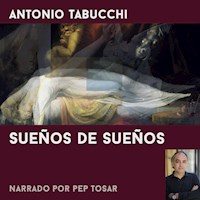Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der Zigeunerkönig Manolo macht eines Morgens eine unheimliche Entdeckung: Im Park liegt eine Leiche ohne Kopf! Firmino, der sich im Grunde viel lieber mit portugiesischer Literatur beschäftigt als mit Mordfällen, wird von seiner Zeitung nach Porto geschickt, um über das Verbrechen zu berichten. Und tatsächlich stößt er mit Hilfe seiner mütterlichen Pensionswirtin Dona Rosa und des renommierten Anwalts Don Fernando auf Dinge, die selbst die Polizei nicht zu wissen scheint. Unversehens gerät er vom neutralen Berichterstatter zum Kämpfer gegen Korruption und Verbrechen. Bis plötzlich ein Augenzeuge des Mordes auftaucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Der Zigeunerkönig Manolo macht eines Morgens eine unheimliche Entdeckung: Im Park liegt eine Leiche ohne Kopf! Firmino, der sich im Grunde viel lieber mit portugiesischer Literatur beschäftigt als mit Mordfällen, wird von seiner Zeitung nach Porto geschickt, um über das Verbrechen zu berichten. Und tatsächlich stößt er mit Hilfe seiner mütterlichen Pensionswirtin Dona Rosa und des renommierten Anwalts Don Fernando auf Dinge, die selbst die Polizei nicht zu wissen scheint. Unversehens gerät er vom neutralen Berichterstatter zum Kämpfer gegen Korruption und Verbrechen. Bis plötzlich ein Augenzeuge des Mordes auftaucht.
Antonio Tabucchi
Der verschwundene Kopf des Damasceno Monteiro
Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl
Carl Hanser Verlag
Für Antonio Cassese und Manolo den Zigeuner
Science fiction
O marciano encontrou-me na rua
e teve mêdo de minha impossibilidade humana.
Como pode existir, pensou consigo, um ser
que no existir põe tamanha anulação de existenência?
(Der Marsmensch begegnete mir auf der Straße und hatte Angst vor meiner menschlichen Unmöglichkeit. Wie kann ein Wesen existieren, dachte er bei sich, das, indem es existiert, die Existenz völlig vernichtet?)
Carlos Drummond de Andrade
1
Manolo der Zigeuner schlug die Augen auf, blickte in das schwache Licht, das durch die Ritzen der Baracke drang, und stand auf, wobei er versuchte, keinen Lärm zu machen. Er brauchte sich nicht anzuziehen, denn er schlief angezogen, die orange Jacke, die er von Agostinho da Silva geschenkt bekommen hatte, der im Zirkus Maravilhas zahnlose Löwen bändigte und Franz der Deutsche genannt wurde, diente ihm inzwischen als Oberbekleidung und als Pyjama. Im schwachen Licht des Morgens suchte er tastend seine Sandalen, die nur noch als Schlappen zu gebrauchen waren und die er anstelle von Schuhen trug. Er fand sie und schlüpfte hinein. Er kannte die Baracke in- und auswendig und fand sich auch im Halbdunkel zurecht, denn er wußte genau, wo sich die armseligen Möbel befanden, mit denen sie eingerichtet war. Er ging leise zur Tür, und in diesem Augenblick stieß er mit dem Fuß gegen eine Petroleumlampe, die auf dem Boden stand. Scheißweiber, stieß Manolo der Zigeuner zwischen den Zähnen hervor. Seine Frau hatte die Petroleumlampe am Abend davor neben ihrer Liege stehenlassen, unter dem Vorwand, im Dunklen hätte sie Alpträume und ihr würden die toten Verwandten erscheinen. Wenn die Lampe ganz schwach brannte, sagte sie, getrauten sich die Geister der Toten nicht, sie heimzusuchen, und ließen sie in Ruhe schlafen.
— Was macht El Rey um diese Zeit — Gott sei der Seele unserer andalusischen Toten gnädig?
Die Stimme seiner Frau war belegt und undeutlich, wie von jemandem, der gerade aufgewacht ist. Wenn seine Frau mit ihm sprach, verwendete sie immer geringonça, einen Mischmasch aus Zigeunersprache, Portugiesisch und Andalusisch. Und sie nannte ihn El Rey, den König.
König einer schönen Scheiße, hätte Manolo am liebsten erwidert, sagte jedoch nichts. König einer schönen Scheiße, ja, früher einmal war er tatsächlich ein König gewesen, als die Zigeuner angesehene Leute waren, als sie frei durch die Ebenen Andalusiens zogen, Kupferschmuck herstellten und in den Dörfern verkauften, als sich sein Volk schwarz kleidete, mit vornehmen Filzhüten, und das Messer in der Tasche nicht zur Verteidigung diente, sondern ein Schmuckstück aus ziseliertem Silber war. Ja, das war die Zeit des Rey gewesen. Aber jetzt? Jetzt waren sie gezwungen, sonstwo herumzuziehen, jetzt, wo man ihnen in Spanien das Leben unmöglich machte und in Portugal, wohin sie sich geflüchtet hatten, vielleicht sogar noch mehr, jetzt, wo es ihnen nicht mehr möglich war, Schmuckstücke und Mantillas herzustellen, jetzt, wo sie sich mit kleinen Diebstählen und Drogenhandel über Wasser halten mußten — was zum Teufel war er, Manolo, da für ein König? König einer schönen Scheiße, wiederholte er bei sich. Die Gemeinde hatte ihnen dieses von Papierfetzen übersäte Grundstück am Stadtrand überlassen, hinter den letzten Häusern, sie hatte es ihnen gnädigerweise überlassen, er erinnerte sich gut an das Gesicht des Gemeindebeamten, der die Genehmigung mit einem Ausdruck der Herablassung und zugleich des Mitleids unterzeichnet hatte, zwölf Monate zu einem symbolischen Preis, aber er solle ja nicht glauben, daß die Gemeinde für Infrastruktur sorge, an Wasser und Licht brauche er gar nicht zu denken, und zum Scheißen sollten sie in den Wald gehen, das waren die Zigeuner ja gewohnt, so düngten sie wenigstens den Boden, und aufgepaßt, die Polizei wußte über ihre kleinen Geschäfte Bescheid und hielt die Augen offen.
König einer schönen Scheiße, dachte Manolo, in diesen Pappbaracken mit dem Blechdach, die im Winter vor Feuchtigkeit trieften und im Sommer Backöfen waren. Die trockenen, sauberen Höhlen von Granada, wo er in seiner Kindheit gewohnt hatte, gab es nicht mehr, das hier war ein Flüchtlingslager, wenn nicht gar ein Konzentrationslager, sagte sich Manolo, König einer schönen Scheiße.
— Was macht El Rey um diese Zeit — Gott sei der Seele unserer andalusischen Toten gnädig? wiederholte seine Frau.
Inzwischen war sie völlig aufgewacht, und ihre Augen waren weit aufgerissen. Mit ihren grauen Haaren, die sie zum Schlafengehen auf der Brust ausbreitete, nachdem sie die Kämme aus dem Knoten gezogen hatte, und dem rosa Schlafrock, in dem sie schlief, sah sie selbst aus wie ein Gespenst.
— Ich gehe pissen, antwortete Manolo lakonisch.
— Das tut dir gut, sagte seine Frau.
Manolo rückte sein Geschlecht in der Unterhose zurecht, das hart und prall war und so stark auf seine Hoden drückte, daß es weh tat.
— Ich könnte noch immer finfar, sagte er, jeden Morgen wache ich so auf, mit einem mangalho, der so hart ist wie ein Strang, ich könnte noch immer finfar.
— Das ist die Blase, antwortete seine Frau, du bist alt. Rey, du hältst dich für jung, aber du bist alt, älter als ich.
— Ich könnte noch immer finfar, erwiderte Manolo, aber dich kann ich nicht finfar, dein Loch ist voller Spinnweben.
— Dann geh pissen, sagte seine Frau abschließend.
Manolo kratzte sich am Kopf. Seit einigen Tagen hatte er einen Ausschlag, der aus kleinen rosa Bläschen bestand und sich vom Nacken bis zur Glatze ausgebreitet hatte und unerträglich juckte.
— Soll ich Manolito mitnehmen? flüsterte er seiner Frau zu.
— Laß das arme Kind schlafen, antwortete seine Frau.
— Manolito geht gern mit seinem Großvater pissen, rechtfertigte sich Manolo.
Er warf einen Blick auf die Liege, auf der Manolito schlief, und spürte, wie er von Zärtlichkeit übermannt wurde. Manolito war acht Jahre alt und der einzige Nachkomme, der ihm geblieben war. Dabei sah er nicht einmal wie ein Zigeuner aus. Er hatte zwar dunkle, glatte Haare wie ein richtiger Zigeuner, aber seine Augen waren blaugrün; die hatte er wahrscheinlich von seiner Mutter geerbt, die Manolo nie kennengelernt hatte. Sein Sohn Paco, sein einziger Sohn, hatte ihn mit einer Prostituierten aus Faro gezeugt, einer Engländerin, wie er sagte, die in Gibraltar auf den Strich ging und deren Zuhälter Paco gewesen war. Dann war das Mädchen nach England verschwunden, weil die Polizei sie abgeschoben hatte, und Paco hatte mit dem Kind dagestanden. Da er an der Algarve ein wichtiges Geschäft zu erledigen hatte — er handelte mit Zigaretten —, hatte er es bei den Großeltern abgeladen, war jedoch von seiner Geschäftsreise nie wieder zurückgekehrt. Und Manolito war bei ihnen geblieben.
— Er sieht gerne den Sonnenaufgang, beharrte Manolo hartnäckig auf seinem Vorhaben.
— Laß das arme Kind schlafen, es ist noch so früh, hast du denn gar kein Herz? Geh deine Blase entleeren.
Manolo der Zigeuner öffnete die Tür der Baracke und trat in die Morgenluft hinaus. Der Platz war menschenleer. Das ganze Lager schlief. Der kleine Mischlingshund, der sich im Lager eingenistet hatte, erhob sich von seinem Sandhaufen und kam schwanzwedelnd auf ihn zugelaufen. Manolo schnalzte mit den Fingern, und der kleine Hund stellte sich auf die Hinterbeine und wedelte noch mehr. Mit dem Hündchen im Gefolge ging Manolo über den Platz und bog auf den Weg ein, der am Pinienhain entlangführte. Der Hain gehörte der Gemeinde und bedeckte jenen Teil des Hügels, der zum Douro hin abfiel. Es waren nur ein paar Hektar, aber man hatte sie großspurig Stadtpark getauft und als grüne Lunge vermarktet. In Wirklichkeit handelte es sich um ungenutztes Gelände, das nicht bewacht und wo in keinerlei Weise für Sicherheit gesorgt wurde. Jeden Morgen fand Manolo Präservative und Spritzen am Boden, die einzusammeln sich die Stadtverwaltung nicht die Mühe machte. Er ging den kleinen Weg hinunter, der von üppigen Ginsterbüschen gesäumt wurde. Es war August, und aus irgendeinem Grund blühte der Ginster noch immer, als wäre es Frühling. Manolo schnupperte sachkundig. Er war imstande, die unterschiedlichsten Gerüche der Natur wahrzunehmen, wie er es durch sein Leben im Freien gelernt hatte. Er zählte auf: Ginster, Lavendel, Rosmarin. Unter ihm, am Ende des Abhangs, schillerte der Douro im schräg einfallenden Licht der Sonne, die hinter den Hügeln aufging. Zwei oder drei Lastkähne, die aus dem Landesinneren kamen und Richtung Porto unterwegs waren, schienen auf dem Fluß stillzustehen, der sich wie ein Band dahinschlängelte. Manolo wußte, daß sie die Kellereien der Stadt mit Fässern voller Wein belieferten, der dann in Portweinflaschen abgefüllt und in alle Welt versandt wurde. Manolo verspürte eine große Sehnsucht nach der großen weiten Welt, die er nie kennengelernt hatte. Ferne, unbekannte, wolkenverhangene Häfen, auf die sich Nebel senkte, wie er einmal in einem Film gesehen hatte. Er hingegen kannte nur dieses gleißend weiße iberische Licht, das Licht seines Andalusiens und das Licht Portugals, die weißgetünchten Häuser, die wilden Hunde, die Korkeichenwälder und die Polizisten, die ihn von einem Ort zum anderen jagten.
Zum Pissen hatte er sich eine dicke Eiche ausgesucht, die ihren großen Schatten auf eine grasbewachsene Lichtung ein Stück außerhalb des Pinienhains warf. Wer weiß, warum Manolo es tröstlich fand, an den Stamm dieser Eiche zu pissen, vielleicht weil der Baum viel älter war als er und es ihm gefiel, daß es auf der Erde Lebewesen gab, die älter waren als er, auch wenn es sich nur um einen Baum handelte. Jedenfalls fühlte er sich immer sehr wohl, wenn er seine Notdurft verrichtete, und eine große Ruhe überkam ihn. Er fühlte sich im Einklang mit sich und dem Universum. Er näherte sich dem dicken Stamm und schlug erleichtert sein Wasser ab. Und in diesem Augenblick sah er einen Schuh. Was seine Aufmerksamkeit erregte, war, daß es sich offensichtlich um keinen von jenen alten, weggeworfenen Schuhen handelte, wie man sie auf diesem Gelände immer wieder fand, sondern um einen blankgeputzten, glänzenden Schuh aus Leder, Ziegenleder offenbar; und er zeigte nach oben, als ob ein Fuß darin steckte. Und er ragte unter einem Strauch hervor.
Manolo trat vorsichtig näher. Er wußte aus Erfahrung, daß es ein Betrunkener sein konnte oder ein in seinem Versteck lauernder Verbrecher. Er warf einen Blick über das Gebüsch, konnte jedoch nichts sehen. Er hob ein Stück Holz auf und schob damit die Zweige des Gebüschs auseinander. Vom Schuh, der sich als Halbstiefel entpuppte, wanderte sein Blick entlang zweier Beine, die in hautengen Jeans steckten, weiter bis zur Taille, und da hielt er inne. Der Gürtel war aus hellem Leder und hatte eine große Silberschnalle, auf der ein Pferdekopf abgebildet war und »Texas Ranch« stand. Manolo entzifferte mühsam die Worte und versuchte sie sich gut einzuprägen. Dann setzte er seine Erkundung fort, indem er mit dem Holz weitere Zweige des Gebüschs beiseite schob. Der Rumpf steckte in einem kurzärmeligen blauen T-Shirt, auf dem ein fremdsprachiger Ausdruck stand, »Stones of Portugal«, und Manolo betrachtete ihn lange, um ihn sich gut zu merken. Er arbeitete sich mit dem Holzstück weiter, ruhig und vorsichtig, als ob er befürchtete, er könne der Leiche, die auf dem Rücken im Gebüsch lag, weh tun. Er gelangte bis zum Hals, aber weiter ging es nicht. Denn die Leiche hatte keinen Kopf. Der war mit einem sauberen Schnitt abgetrennt worden und hatte im übrigen kaum geblutet, nur ein paar dunkle Klümpchen, um die herum Fliegen summten. Manolo zog sein Holzscheit zurück, und die Zweige des Gebüschs schlossen sich wieder über dem unschönen Anblick. Er ging ein paar Meter zurück, setzte sich mit dem Rücken an den Stamm der Eiche und dachte nach. Um besser denken zu können, zog er seine Pfeife heraus und füllte sie mit dem Tabak von Definitivos-Zigaretten, die er sorgfältig zerkrümelte. Früher einmal hatte er gern Schnittabak in der Pfeife geraucht, aber der war inzwischen zu teuer, und so war er gezwungen, Zigaretten aus dunklem Tabak zu zerkrümeln, die er offen kaufte, im Kiosk von Herrn Francisco, genannt der Hosenscheißer, weil er mit zusammengekniffenen Pobacken ging, als würde er sich gerade die Hosen vollmachen. Manolo füllte den Pfeifenkopf, machte ein paar Züge und dachte nach. Er dachte darüber nach, was er entdeckt hatte, und beschloß, daß es nicht notwendig war, noch einmal nachzusehen. Was er gesehen hatte, war mehr als genug. Und inzwischen verging die Zeit, die Zikaden hatten mit ihrem unerträglichen Zirpen begonnen, und ringsherum roch es stark nach Lavendel und Rosmarin. Unter ihm lag der sich dahinschlängelnde Fluß, ein leichter, heißer Wind war aufgekommen, der Schatten der Bäume wurde kürzer. Manolo dachte daran, daß er zum Glück seinen Enkel nicht mitgenommen hatte. Kinder sollten solche schrecklichen Sachen nicht sehen, nicht einmal Zigeunerkinder. Er fragte sich, wie spät es wohl war, und blickte prüfend auf den Sonnenball. Erst jetzt bemerkte er, daß der Schatten gewandert war, daß er im prallen Sonnenlicht saß und schweißgebadet war. Erschöpft stand er auf und ging zum Lager zurück. Zu dieser Zeit war der Platz sehr belebt. Die alten Frauen badeten die Kinder in den Zubern, und die Mütter bereiteten das Essen zu. Die Leute begrüßten ihn, aber er gab kaum Antwort. Er betrat seine Baracke. Seine Frau zog Manolito gerade eine alte andalusische Tracht an, denn man hatte beschlossen, die Kinder zum Blumenverkaufen nach Porto zu schicken, und in den traditionellen Trachten würden sie mehr auffallen.
— Ich habe im Pinienhain einen Toten gefunden, sagte Manolo leise.
Seine Frau begriff nicht. Sie kämmte gerade Manolito und schmierte seine Haare mit Brillantine ein.
— Was hast du gesagt, Rey? fragte die Alte.
— Eine Leiche, neben der Eiche.
— Laß sie verfaulen, antwortete seine Frau, hier ist sowieso alles faul.
— Sie hat keinen Kopf, sagte Manolo, man hat ihn ihr ganz sauber abgetrennt, zack.
Und er fuhr sich mit der Hand über den Hals. Die Alte sah ihn aus weit aufgerissenen Augen an.
— Was willst du damit sagen? fragte sie.
Manolo führte die Hand wie ein Messer an seinen Hals und wiederholte: Zack.
Die Alte richtete sich auf und schickte Manolito weg.
— Du mußt zur Polizei gehen, sagte sie entschlossen.
Manolo sah sie mitleidig an.
— El Rey geht nicht zur Polizei, sagte er stolz, Manolo von den freien Zigeunern Spaniens und Portugals geht nicht in eine Polizeiwache.
— Was dann? fragte die Alte.
— Herr Francisco soll sie verständigen, erwiderte Manolo, der Hosenscheißer hat ein Telefon und ist ständig mit der Polizei in Kontakt, er soll sie verständigen, er steht ja so gut mit ihnen.
Die Alte sah ihn betrübt an und gab keine Antwort. Manolo stand auf und öffnete die Tür der Baracke. Als er auf der Schwelle stand und von mittäglichem Licht überflutet wurde, sagte seine Frau zu ihm:
— Du schuldest ihm zweitausend Escudos, Rey, er hat dir zwei Flaschen giripití auf Kredit gegeben.
— Wen kümmern schon zwei Flaschen Schnaps, antwortete Manolo, er soll mich am Arsch lecken.
2
Firmino hielt vor der Ampel am Largo do Rato. Vor dieser Ampel mußte man ewig warten, das wußte er, und das ungeduldige Taxi hinter ihm war fast mit der Stoßstange auf sein Auto aufgefahren. Aber man mußte Geduld haben angesichts der Bauarbeiten der Stadtverwaltung, die eine saubere und ordentliche Stadt versprach und sich für die Weltausstellung rüstete. Die Werbeplakate, die man an besonders verkehrsreichen Punkten der Stadt aufgestellt hatte, kündigten ein Ereignis von weltweiter Bedeutung an, und Lissabon würde dadurch zur Stadt der Zukunft werden. Firmino wußte im Augenblick nur, wie seine unmittelbare Zukunft aussah, sonst nichts. Sie bestand darin, daß er mindestens fünf Minuten vor der Ampel warten mußte, bis der Bagger zur Seite gefahren war, und selbst wenn die Ampel auf Grün sprang, war nichts zu machen, man mußte warten. Also fand er sich damit ab, zündete sich eine Multifilter-Zigarette an, die ihm ein Schweizer Freund geschickt hatte, stellte im Radio die Sendung »Zuhörer fragen« ein, bloß um zu erfahren, was so los war, und warf einen Blick auf die elektronische Uhr, die sich ganz oben auf dem Gebäude gegenüber befand. Sie zeigte an, daß es zwei Uhr nachmittags war und achtunddreißig Grad hatte. Na ja, es war ja August. Firmino war gerade von einem einwöchigen Urlaub zurückgekehrt, den er mit seiner Freundin in einem Dorf im Alentejo verbracht hatte, es waren erholsame Tage gewesen, obwohl das Meer eher stürmisch gewesen war, aber der Alentejo hatte ihn wie immer nicht enttäuscht. Sie hatten ein Bauernhaus mit Pensionsbetrieb an der Küste entdeckt, die Besitzer waren Deutsche, es gab nur neun Zimmer, und außerdem den Pinienhain, den menschenleeren Strand, die Liebesspiele unter freiem Himmel, die regionale Küche. Firmino betrachtete sich im Rückspiegel. Er war schön braun, fühlte sich in Form, die Weltausstellung war ihm egal, und er hatte Lust, seine Arbeit bei der Zeitung wiederaufzunehmen. Im übrigen war es nicht nur eine Frage der Lust, sondern der Notwendigkeit. Im Urlaub hatte er sein letztes Gehalt verbraucht, und jetzt war er blank.
Die Ampel sprang auf Grün, der Bulldozer fuhr zur Seite, und Firmino startete. Er fuhr um den Platz herum in die Alexandre Herculano und bog auf die Avenida da Liberdade ein. An der Saldanha steckte er fest. Auf der linken Fahrspur hatte sich ein Unfall ereignet, und alle Autos versuchten auszuweichen. Er nahm die Busspur und hoffte, daß kein Polizist in der Nähe war. Firmino hatte erst kürzlich mit Catarina nachgerechnet und festgestellt, daß die Bußgelder zehn Prozent seines spärlichen Monatsgehalts ausmachten. Aber um zwei Uhr nachmittags und bei dieser Hitze war vielleicht kein Wachmann auf der Avenida. Und wenn, um so schlimmer. Als er an der Nationalbibliothek vorbeifuhr, konnte er nicht umhin, langsamer zu fahren und ihr einen wehmütigen Blick zuzuwerfen. Er dachte an die Nachmittage, die er im Lesesaal verbracht hatte, um die Romane Vittorinis zu studieren, und an seinen unbestimmten Plan, einen Essay mit dem Titel Der Einfluß Vittorinis auf den portugiesischen Nachkriegsroman zu schreiben. Gemeinsam mit dieser Erinnerung wehte ihn der üble Geruch von gebratenem Stockfisch an, den es im Selbstbedienungsrestaurant der Bibiliothek gab, wo er wochenlang gegessen hatte. Stockfisch und Vittorini. Aber der Plan war vorerst ein Plan geblieben. Wer weiß, vielleicht würde er ihn wiederaufgreifen, wenn er ein wenig Freizeit hatte.
Er kam nach Lumiar und fuhr um die Gebäude des Holiday Inn herum. Ein schreckliches Ding. Hier stiegen die durchschnittlichen amerikanischen Touristen ab, die die malerischen Winkel Lissabons suchten und sich statt dessen mitten in einem von Neubauten zerstörten Viertel wiederfanden: der Stelzenautobahn, die zum Flughafen führte, und der zweiten Umgehungsstraße. Hier einen Parkplatz zu finden war immer ein Problem. Er stellte das Auto vor einem Eigentumshaus mit elektronisch verriegeltem Gartentor ab und achtete darauf, nicht die Zufahrt zu verstellen. Sein Auto stand einen guten halben Meter vor, aber sei’s drum. Wenn es abgeschleppt wurde, erhöhte sich der Anteil seiner Geldstrafen um zwei Prozent, und das bedeutete, daß er den letzten Band des Grande Dizionario della Lingua Italiana nicht kaufen konnte. Den brauchte man allerdings, wenn man Vittorini studieren wollte. Aber sei’s drum. Ein paar Meter entfernt stand das Gebäude, in dem sich die Redaktion der Zeitung befand, ein Zementbau aus den siebziger Jahren, häßlich und vulgär, ohne jeglichen Charakter. Auf allen Stockwerken wohnten gewöhnliche Leute, die im Zentrum der Stadt arbeiteten und in diesem Haus nur schliefen. Um die trostlosen Balkons etwas freundlicher zu gestalten, hatten einige Mieter einen Sonnenschirm und Plastikstühle darauf gestellt. Zu den kleinbürgerlichen Verschönerungen in auffallendem Kontrast stand ein Spruchband auf der Veranda des letzten Stockwerks, auf dem in zinnoberroten Buchstaben zu lesen war: O Acontecimento. »Was der Bürger wissen muß.«
Das war seine Zeitung, und er schritt verwegen darauf zu. Er wußte, daß er der vollbusigen, gelähmten Telefonistin gegenübertreten mußte, die von ihrem Rollstuhl aus alle Abteilungen der Zeitung kontrollierte, daß er, um sein Kämmerchen zu erreichen, am Schreibtisch Doktor Silvas vorbeimußte, des Chefredakteurs, der den Namen seiner Mutter, Huppert, benutzte, weil ein französischer Name eleganter war, und daß er wie immer eine unerträgliche Platzangst verspüren würde, sobald er seinen Schreibtisch erreicht hatte, weil das Kämmerchen mit den künstlichen Wänden, in das man ihn verbannt hatte, kein Fenster hatte. All das wußte Firmino, und dennoch schritt er verwegen darauf zu.
Die Querschnittgelähmte war auf ihrem Rollstuhl eingeschlafen. Vor ihrem ausladenden Busen stand ein kleiner, an den Rändern mit Fett beschmierter Metallbehälter. Er war leer. Das war das Mittagessen, das vom Schnellimbiß an der Ecke geliefert wurde. Firmino ging erleichtert an ihr vorbei und betrat den Lift. Der Lift hatte keine Türen, wie ein Lastenaufzug. Unter den Knöpfen befand sich ein Stahlschild, auf dem stand: »Minderjährigen ohne Begleitung ist die Benutzung des Aufzugs verboten.« Und daneben hatte jemand mit Kugelschreiber geschrieben: »fuck you«. Der Architekt des großartigen Gebäudes hatte die Idee gehabt, zum Ausgleich wenigstens den Aufenthalt im Lift durch etwas Gedudel erträglicher zu machen, das aus einem kleinen Lautsprecher drang. Es war immer dasselbe: Strangers in the night. Im dritten Stock blieb der Lift stehen. Eine ältere Dame mit gefärbter Dauerwelle, die nach einem schrecklichen Parfum roch, stieg ein.
— Fahren Sie hinunter? fragte die Dame, ohne zu grüßen.
— Hinauf, antwortete Firmino.
— Ich fahre hinunter, sagte die Dame in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Und drückte auf den »Abwärts«-Knopf.
Firmino fand sich damit ab und fuhr hinunter, die Dame stieg aus, ohne sich zu verabschieden, und er fuhr wieder hinauf. Als er das vierte Stockwerk erreicht hatte, blieb er verwirrt auf dem Treppenabsatz stehen. Was tun? fragte er sich. Und wenn er einfach zum Flughafen fahren und ein Flugzeug nach Paris nehmen würde? Paris, die großen Zeitschriften, die Sonderkorrespondenten, die Reisen in alle Welt. So eine Art kosmopolitischer Journalist. Hin und wieder kam Firmino auf die Idee, sein Leben ein für allemal zu ändern, eine radikale Entscheidung, einen spontanen Entschluß zu treffen. Aber das Problem war, daß er blank war und Tickets teuer sind. Und Paris auch. Firmino stieß die Tür auf und ging hinein. Die Redaktion befand sich in einem sogenannten Loft. Aber natürlich war es ursprünglich nicht als solches geplant gewesen. Man hatte es geschaffen, indem man die Trennwände der ursprünglichen Wohnung entfernt hatte, die im übrigen auch leicht niederzureißen gewesen sein mußten, da sie aus Lochziegeln bestanden. Das war die Idee der Firma gewesen, die davor hier ihren Sitz gehabt hatte. Einer Firma, die Thunfisch in Dosen exportierte, und die Zeitung hatte das Lokal in diesem Zustand übernommen, wobei der Herausgeber gute Miene zum bösen Spiel gemacht hatte. Die zwei Schreibtische vor dem Eingang waren leer. Am ersten saß für gewöhnlich ein älteres Fräulein, die Sekretärin, am anderen ein Journalist, der am einzigen Computer arbeitete, den die Zeitung besaß. Der dritte Schreibtisch gehörte Herrn Silva beziehungsweise Huppert, wie er seine Artikel zeichnete.
— Guten Nachmittag, Herr Huppert, sagte Firmino freundlich.
Herr Silva musterte ihn streng.
— Der Herausgeber ist außer sich vor Zorn, stieß er zwischen den Zähnen hervor.
— Warum? fragte Firmino.
— Weil er nicht wußte, wo er dich finden kann.
— Aber ich habe Urlaub am Meer gemacht, rechtfertigte sich Firmino.
— In Zeiten wie diesen macht man nicht einfach Urlaub, fügte Herr Silva bitter hinzu. Und dann gab er seinen Lieblingssatz von sich: Mala tempora currunt.
— Ja, erwiderte Firmino, aber eigentlich sollte ich erst morgen zurückkommen.
Herr Silva gab keine Antwort und zeigte auf das Büro des Herausgebers, einen winzigen Raum mit Milchglasscheiben.
Firmino trat ein, noch während er klopfte. Der Herausgeber telefonierte gerade und bedeutete ihm, er solle warten. Firmino schloß die Tür und blieb stehen. In dem kleinen Kämmerchen war es drückend heiß, und der Ventilator war abgestellt. Der Herausgeber trug dennoch ein makelloses graues Sakko mit Krawatte. Er hatte ein weißes Hemd. Der Herausgeber legte auf und musterte ihn von oben bis unten.
— Wo hast du gesteckt? fragte er gereizt.
— Ich war im Alentejo, antwortete Firmino.
— Und was hast du im Alentejo zu suchen? fragte der Herausgeber in noch gereizterem Ton.
— Ich bin auf Urlaub, stellte Firmino klar, mein Urlaub geht morgen zu Ende, ich bin nur in die Redaktion gekommen, um nachzusehen, ob es etwas Neues gibt und ich mich nützlich machen kann.
— Du kannst dich nicht nur nützlich machen, sagte der Herausgeber, sondern unentbehrlich, du fährst mit dem Sechs-Uhr-Zug.
Firmino fand, es sei besser, sich zu setzen. Er setzte sich und zündete sich eine Zigarette an.
— Wohin? fragte er gelassen.
— Nach Porto, sagte der Herausgeber mit unbeteiligter Stimme, natürlich nach Porto.
— Warum natürlich nach Porto? fragte Firmino und versuchte ebenfalls, unbeteiligt zu klingen.
— Weil ein Verbrechen geschehen ist, sagte der Herausgeber, ein Verbrechen, über das jede Menge Tinte verspritzt werden wird.
— Und der Sonderkorrespondent aus Porto ist nicht genug? fragte Firmino.
— Nein, er ist nicht genug, das ist eine Nummer zu groß für ihn, stellte der Herausgeber klar.
— Schicken Sie doch Herrn Silva hin, erwiderte Firmino ruhig, er reist gern, und außerdem kann er dann mit seinem französischen Namen zeichnen.
— Er ist der Chefredakteur, antwortete der Herausgeber, er muß die schlechten Artikel der Korrespondenten redigieren, du bist der Sonderkorrespondent.
— Aber ich habe gerade erst über die Frau geschrieben, die in Coimbra von ihrem Mann erstochen wurde, protestierte Firmino, das ist keine zehn Tage her, vor meinem Urlaub, und ich habe einen ganzen Nachmittag im Leichenschauhaus von Coimbra verbracht und mir die Aussagen der Gerichtsmediziner angehört.
— Na wenn schon, antwortete trocken der Herausgeber, du bist der Sonderkorrespondent, und außerdem ist schon alles vorbereitet, ich habe dir für eine Woche ein Zimmer in einer Pension in Porto reservieren lassen, fürs erste einmal, denn der Fall wird sich in die Länge ziehen.
Firmino dachte nach und versuchte sich zu fassen. Am liebsten hätte er gesagt, daß ihm Porto nicht gefiel, daß man in Porto vor allem Kaldaunen auf Porto-Art aß und daß ihm vor Kaldaunen ekelte, daß es in Porto schwül war, daß die Pension, die man ihm reserviert hatte, bestimmt ein elendes Loch mit Bad auf dem Gang war und daß er vor Heimweh sterben würde. Statt dessen sagte er:
— Aber Herr Direktor, ich muß meinen Essay über den portugiesischen Nachkriegsroman zu Ende schreiben, das ist für mich sehr wichtig, und außerdem habe ich bereits einen Vertrag mit einem Verlag unterschrieben.
— Es geht um ein Verbrechen, unterbrach ihn der Herausgeber, ein Geheimnis, das gelüftet werden muß, die Öffentlichkeit ist neugierig, seit heute morgen spricht man von nichts anderem mehr.
Der Herausgeber zündete sich eine Zigarette an, senkte die Stimme, als ob er ein Geheimnis verriete, und flüsterte:
— In der Gegend von Matosinhos hat man eine Leiche ohne Kopf gefunden, sie ist noch nicht identifiziert worden, ein Zigeuner, ein gewisser Manolo, hat sie gefunden und eine wirre Zeugenaussage abgegeben, aber mehr als das, was er bereits der Polizei gesagt hat, ist nicht aus ihm rauszukriegen, er lebt in einem Zigeunerlager am Stadtrand von Porto, du mußt ihn aufspüren und interviewen, das wird die Sensation der Woche.
Der Herausgeber schien versöhnt zu sein, als ob der Fall für ihn abgeschlossen wäre. Er öffnete eine Schublade und holte ein paar Zettel heraus.
— Das ist die Adresse der Pension, fügte er hinzu, es ist kein Luxushotel, aber Dona Rosa ist ein Schatz, ich kenne sie seit dreißig Jahren. Und das ist der Scheck. Kost, Logis und Spesen für eine Woche. Und wenn irgendwelche Extras anfallen, setz sie auf die Rechnung. Vergiß nicht, der Zug fährt um sechs.