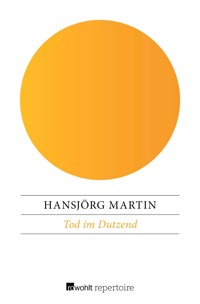9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hinter einem langen Tisch in einer alten Villa tagt – wie ein Gericht – der Prüfungsausschuß für Wehrdienstverweigerer. Davor ganz allein – fast wie ein Angeklagter – Wolfgang. Er will den «Dienst mit der Waffe» verweigern. Ist er auf alles gut genug vorbereitet? Der Vorsitzende fragt: «Wie würden Sie sich verhalten, wenn gar nicht Sie selbst bedroht wären – sondern, sagen wir mal, eine Gruppe Kinder. Da läuft ein Besoffener oder Verrückter auf einen Spielplatz und fängt an, zu schlagen und zu treten … Was machen Sie, wenn Sie das zufällig beobachten?» Was soll Wolfgang antworten? Kann er so eine Frage ablehnen? Kann man überhaupt das Gewissen eines Menschen prüfen? Der Verfasser war selbst Mitglied in so einem Prüfungsausschuß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Der Verweigerer
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Hinter einem langen Tisch in einer alten Villa tagt – wie ein Gericht – der Prüfungsausschuß für Wehrdienstverweigerer. Davor ganz allein – fast wie ein Angeklagter – Wolfgang. Er will den «Dienst mit der Waffe» verweigern. Ist er auf alles gut genug vorbereitet? Der Vorsitzende fragt: «Wie würden Sie sich verhalten, wenn gar nicht Sie selbst bedroht wären – sondern, sagen wir mal, eine Gruppe Kinder. Da läuft ein Besoffener oder Verrückter auf einen Spielplatz und fängt an, zu schlagen und zu treten … Was machen Sie, wenn Sie das zufällig beobachten?» Was soll Wolfgang antworten? Kann er so eine Frage ablehnen? Kann man überhaupt das Gewissen eines Menschen prüfen?
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
I
«Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.»
Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland
«Es ist besser Gewissen ohne Wissen,als Wissen ohne Gewissen.»
Alter Spruch
1
13. Februar
Morgen vormittag halb elf!
Ich kriege jetzt schon nasse Hände, wenn ich bloß dran denke. Das liegt auch daran, daß jeder was andres sagt.
Pit Mertens sagt, es ist ein Klacks. Er hat’s auch gleich im ersten Anlauf geschafft.
Hannes Weiß sagt, es ist echter Terror. Er wartet seit zwei Monaten auf die dritte Verhandlung, nachdem sie ihn die beiden ersten Male haben abblitzen lassen.
Ulf Baumann kann ich nicht fragen. Er sitzt im Knast. Schon wieder, seit einer Woche. Es ist die dritte Bestrafung, seit er kapituliert und die Uniform angezogen hat, nachdem sein Antrag zweimal abgelehnt worden ist.
«Wenn du’s erst mal anfängst», hat Hannes Weiß gesagt, «dann mußt du auch durch. Das ist ’ne Nervensache. Aber wenn du mittendrin aufgibst, dann ist es bestimmt noch ’ne viel schlimmere Nervensache, denn dann bist du fünfzehn Monate lang denen ausgeliefert, deren Handwerk du ablehnst und die wissen, daß du dagegen bist. Du kannst Pech haben, und sie machen dich fertig – auf die leise Tour, aber mit allen Schikanen …»
Möglich, daß Hannes recht hat. Ulf Baumann jedenfalls sitzt schon wieder im Knast in der Kaserne, weil er einfach nicht zurechtkommt mit seinen Vorgesetzten. Er hat versucht, denen klarzumachen, daß er alles mitmacht: Exerzieren und Geländedienst und auch den Unterricht, Staatsbürgerkunde, oder wie sie das nennen, und Sport und die Übungsmärsche und alles – bloß nichts, wo er eine Waffe anfassen muß, ein Gewehr oder ein Geschütz oder ’ne Handgranate oder so was.
Aber das geht nicht, haben sie gesagt: der Unteroffizier und der Feldwebel und der Leutnant und sogar der Major, zu dem Ulf hingebracht worden ist, als er das dritte Mal abgelehnt hat, auf dem Schießstand einen Karabiner in die Hand zu nehmen.
Der Major, hat Ulfs Freundin Ille gesagt, ist sehr freundlich gewesen. Er hat immer wieder erklärt, daß er Ulf verstehen kann, aber Befehl ist Befehl, und wer einen Befehl nicht ausführt, wer sich weigert, was zu machen, was er nicht einsieht oder was ihm gegen den Strich geht, der ist ein Befehlsverweigerer und muß bestraft werden.
Ich bin auch ein Verweigerer. Ich habe zwar keinen Befehl verweigert, aber ich habe einen Antrag gestellt, als «Kriegsdienstverweigerer» anerkannt zu werden, damit ich nicht Soldat werden muß, sondern statt dessen «Ersatzdienst» machen kann.
Sechzehn Monate in einem Altersheim oder Krankenhaus oder Kindergarten oder beim Roten Kreuz – ganz egal, nur nicht zum Bund.
Den Antrag habe ich fünf Wochen vor der Musterung gestellt. Und ich bin froh, daß ich das so gemacht habe – vor der Musterung, meine ich –, damit sie nicht sagen können, daß ich erst mal spekuliert habe, ob ich nicht «untauglich» geschrieben werde.
Hannes Weiß hat erst nach der Musterung seinen Antrag gestellt, obwohl er schon vorher immer gesagt hat, daß er nicht zum Bund will.
Er hat’s einfach verbummelt.
Jetzt kann es ihm passieren, daß er geholt wird, weil er schon in zwei Verhandlungen abgelehnt worden ist. Dann ist er natürlich schlecht dran: vor der dritten Verhandlung in die Uniform und in die Kaserne!
Da kriegt er keinen Fuß an die Erde, glaube ich, und kommt gar nicht raus aus dem Knast, wie Ulf Baumann.
Aber mir kann das nicht passieren, denn sie können einen nicht einziehen, wenn man vor der Musterung seinen Antrag gestellt hat. Auch dann nicht, wenn der Prüfungsausschuß einen nicht anerkennt.
So schrecklich viel Bammel brauchte ich also eigentlich nicht zu haben vor morgen vormittag. Auch wenn sie mich nicht anerkennen, weil sie mir vielleicht nicht glauben, daß es eine «Gewissensentscheidung» ist, kann ich nicht eingezogen werden … eben weil ich zum Glück vor der Musterung geschrieben habe, daß ich den Kriegsdienst verweigere … aus Gewissensgründen.
Trotzdem kriege ich jetzt schon nasse Hände, wenn ich bloß dran denke …
2
Wenn mich einer fragt, wie das eigentlich angefangen hat, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, dann fällt mir als erstes die Geschichtsstunde ein, die wir vor anderthalb Jahren bei so einem jungen Typ gehabt haben. Steinke hieß der.
Er war Referendar und nur ein paar Wochen an unserer Schule. Ich weiß auch nicht, wo er dann hingekommen ist. Hartmut Bentz meinte, den hätten sie bestimmt wegen seiner linken Sprüche nicht angestellt – aber Hartmut Bentz ist ein Klugscheißer und sowieso gegen alles, was er für «unordentlich» hält.
Sein Vater hat die Fleischereimaschinenfabrik und ist Vorsitzender vom Heimatverein.
Also jedenfalls war das eine unheimlich gute Stunde, die der Steinke mit uns gemacht hat. Eigentlich war was ganz anderes dran, nämlich die Weimarer Republik, aber Steinke hat gefragt, ob wir wüßten, welche geschichtliche Bedeutung der heutige Tag habe. Keiner hat es gewußt.
Er hat erklärt, daß Hitler am 1. September vor neununddreißig Jahren den Krieg angefangen hat und daß er mit uns darüber reden wollte. Die meisten haben lange Gesichter gemacht, und einige haben sogar lautstark protestiert.
«Ich kann mir denken, warum euch das nicht schmeckt», hat er gesagt, «weil ihr wahrscheinlich diese Kriegsgeschichten von Großvätern oder Nachbarn kennt: wie sie in Afrika feindliche Panzer geknackt oder in Rußland Gefangene gemacht oder sonstwo Heldentaten vollbracht haben – und was sie alles durchgemacht haben: Hunger und Kälte und Achtzig-Kilometer-Märsche … und so was. Ich kenne die Geschichten auch alle. Und ich kenne auch die Sprüche, die dazu gehören: ‹Es hat uns nichts geschadet!› und ‹Da kriegt man eine andere Einstellung zum Leben!› und ‹Das war ein Stahlbad – da erwies sich, wer was taugte!› – und so weiter. Stimmt’s? Habt ihr solche Reden auch schon gehört?»
Die meisten aus meiner Klasse haben genickt.
Ich hab an Herrn Rohmeissel gedacht, der bis letzten Herbst neben uns gewohnt hat. Der war Feldwebel bei der Artillerie gewesen im Krieg. Er hat auch immer erzählt, wie sie «den Iwans Zunder gegeben haben» – und solche Sachen.
Der Steinke hat uns dann Zahlen an die Tafel geschrieben, die waren so wahnwitzig – ich hab sie mir damals notiert:
45 Millionen Menschen sind im 2. Weltkrieg evakuiert, eingesperrt, deportiert oder sonstwie aus ihrem Geburtsort entfernt worden.
21 Millionen haben durch Bomben ihr Hab und Gut verloren.
2 Millionen 429 Tausend und 475 Tonnen Bomben wurden auf Europa abgeworfen.
54 Millionen und 789 Tausend Menschen sind getötet worden – davon allein in der Sowjetunion über 20 Millionen.
Bei uns in Deutschland 6 Millionen 600 Tausend.
«Das sind so erschreckende Zahlen», hat der Steinke gesagt, «daß man es sich gar nicht vorstellen kann. Deshalb will ich euch ein paar Fotos zeigen, heute, am 1. September, zum 39jährigen Jubiläum des Kriegsanfangs.»
Bis dahin hat mich die Unterrichtsstunde nicht besonders interessiert, obwohl ich das schon ganz gut fand, was Steinke da sagte, mit den Sprüchen der alten Kriegsteilnehmer und so – aber als ich die Fotos sah, wurde mir plötzlich klar, wie grausam das gewesen sein muß.
Das waren schaurige Fotos: verstümmelte und zerfetzte Tote und Menschen ohne Arme und Beine, die aber noch lebten, und manche sogar heute noch – mehr als drei Dutzend Jahre später noch leben, und blindgeschossene Kinder und Männer mit Gesichtern wie Teufelsfratzen, von Narben und Nähten bis zur Unmenschlichkeit entstellt und so weiter … und so weiter.
Mir ist ganz elend geworden bei den Bildern. Ines Bachmann hat leise zu heulen angefangen, und es war sonst ganz still in der Klasse. Unheimlich still, wie bei einer schweren Klassenarbeit – nur eine andere Art von Stille, als ob eben einer gestorben wäre und läge da noch rum.
Dann hat der Steinke die Fotos wieder eingesammelt. Er hat gesagt, daß das ein Thema sei, über das man mehrere Stunden reden müsse. Aber da er nur diese eine Stunde bei uns hätte, wollte er uns lieber noch ein Stück aus einem Buch vorlesen, das uns vielleicht ein paar Denkanstöße geben könnte. Es war ein Buch vom Krieg. Keins mit Zahlen und Namen von Städten oder Schlachtfeldern oder Generälen. Da erzählte einer, wie er eine Nacht lang neben einem in einem Granattrichter gelegen hat und sie nicht raus konnten, weil die anderen immerzu geschossen haben – und der andere hatte einen Schuß im Bauch und starb sechs Stunden lang. Es war eine schauderhafte Geschichte, und der Steinke las sie auch so vor, daß man das richtig sah und roch und hörte, was da los war.
Furchtbar. Wir waren jedenfalls alle echt geschafft und eher erleichtert, als es zur Pause klingelte.
Auf dem Schulhof gab es gleich eine Diskussion. Hartmut Bentz schimpfte. Das wäre wieder so eine typische linke Stunde gewesen, sagte er, und man müßte den Typ eigentlich anzeigen. Wie der uns zu beeinflussen versucht hätte, das wäre ja nicht mehr feierlich. Schließlich könnte man den 2. Weltkrieg und überhaupt jeden Krieg auch anders sehen. Als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, zum Beispiel. Und als Selbsterhaltungstrieb eines Volkes. Es hätte immer Kriege gegeben und würde immer Kriege geben, das wäre eben ein Naturgesetz, und damit müßten die Menschen leben.
«Leben?» hab ich böse gefragt, weil mir das auf den Wecker ging, diese Phrasendrescherei. «Leben? Hast du gesagt, man muß mit dem ‹Naturgesetz Krieg› leben? Ich halte das für eine Krankheit wie die Schwarzen Pocken oder die Pest oder die Tuberkulose. Man muß sich nicht damit abfinden. Man muß was dagegen tun, verdammt noch mal!»
Ines Bachmann meinte: «Ja, richtig, der Wolfgang hat recht! Ich bin schon lange der Meinung, daß man so was nicht alles unter den Teppich kehren darf.»
Und das hat mich gefreut, eben gerade weil es Ines war, die das gesagt hat, denn ich fand schon lange, daß sie ein duftes Mädchen ist. Und ein paar andere haben auch genickt. Manfred Seidel hat mich gefragt:
«Was willst du denn da tun?»
Und Hartmut kam wieder mit ’ner zynischen Bemerkung:
«Wolfgang Bieber macht ’ne Friedensbewegung auf, so wie der Schwarze in den USA, der Martin Luther King, haha!»
Ich hätte es gern mal drauf ankommen lassen und ihm ’n Tritt verpaßt, aber es hat zur Stunde geklingelt, und das war auch gut so, denn es lohnt sich nicht, sich mit so ’nem Typ wie Hartmut überhaupt anzulegen.
Wir hatten zwei Stunden Kunst. Frau Kliebhahn hat uns Dias von Bildern expressionistischer Maler vorgeführt, die wir miteinander vergleichen sollten. Das war ganz interessant, aber ich bin die ganze Zeit die Gedanken an die Fotos nicht losgeworden, die uns der Steinke gezeigt hatte, und an die Geschichte, die er vorgelesen hatte.
So hat das angefangen bei mir, vor anderthalb Jahren …
3
Kann sein, daß ich trotzdem nicht gleich auf die Idee gekommen wäre, den Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu stellen, wenn nicht ausgerechnet an jenem Tag der Brief dagelegen hätte, als ich mittags – noch bedrückt von dem Erlebnis in der Schule – nach Hause kam.
«Da ist so ein amtlicher Brief für dich gekommen, Wolfgang», sagte meine Mutter.
«Was wollen die denn?» fragte ich.
«Weiß ich doch nicht», sagte sie. «Ich mach doch deine Post nicht auf. Hast du denn irgendwas ausgefressen?»
«Nee», sagte ich – aber ich war mir natürlich nicht so ganz sicher. Irgendwo hat man ja immer ein schlechtes Gewissen. Vielleicht hatte ich mit meinem Mofa irgendwann mal ’ne Vorfahrt nicht beachtet oder sonstwas.
Es war aber keine Anzeige und überhaupt nichts von der Polizei.
Es war ein vorgedrucktes Schreiben der Stadtverwaltung, genauer: vom Bürgermeister der Stadt, Örtliche Ordnungsbehörde. Ich war nicht überrascht, als ich das grüne Kuvert öffnete, denn so einen Brief hatten schon mehrere Jungen aus meiner Klasse gekriegt und mit in die Schule gebracht.
Einige waren sogar richtig stolz darauf gewesen.
«Aufforderung zur Erfassung» stand da fettgedruckt drüber. Und dann hieß es:
«Sehr geehrter Herr!» – Keine Anrede mit Namen, nur «Herr» und Ausrufungszeichen.
«Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Wehrpflichtgesetzes in der Fassung vom 25. Mai 1962 (Bundesgesetzblatt I S. 349) sind Sie wehrpflichtig. Die Wehrpflichtigen Ihres Geburtsjahrganges sind zur Erfassung aufgerufen.
Auf Grund des § 15 Abs. 2 Satz 1 des Wehrpflichtgesetzes werden Sie aufgefordert, sich am 13. September 1978 in der Zeit von – bis, um 10 Uhr 45 beim Ordnungsamt, Rathaus, Zimmer 11 persönlich zur Erfassung zu melden.
Zur Erfassung wollen Sie bitte Ihren Personalausweis oder Reisepaß und – soweit vorhanden – die in der öffentlichen Bekanntmachung genannten Unterlagen mitbringen. Sie finden diese Bekanntmachung in der Tagespresse und am Schwarzen Brett der Gemeinde.»
Und dann noch eine Dreiviertelseite mit näheren Erläuterungen.
Zum Schluß, als letzte Zeile über der unleserlichen Unterschrift, stand:
«Näheres über mit der Wehrpflicht zusammenhängende Fragen erfahren Sie aus dem beiliegenden Merkblatt des Bundesministers der Verteidigung.»
Das beiliegende Merkblatt war ein 16seitiges Heft. Ich habe es genau gelesen und mich zunächst mal über die komische und ungewöhnliche Sprache gewundert, in der das geschrieben war.
Da gab es Worte, die ich noch nie gehört oder gelesen hatte: «Kreiswehrersatzamt», «Soldatenlaufbahnverordnung», «Befreiungstatbestand», «Unabkömmlichstellung», «Unterhaltssicherungsbehörde» – und so weiter.
Ich habe gedacht, was das für ein wichtiges Unterrichtsfach in der Schule wäre, so was kennen-, lesen- und verstehenzulernen. Doch wir haben in Gemeinschaftskunde wochenlang über die verschiedenen Staatsformen geredet – aber so ein Merkblatt hat uns keiner gezeigt oder erklärt. Na ja.
Bei dem Schreiben von der Stadtverwaltung bin ich ziemlich sauer geworden. Das war mal wieder ein typisches Beispiel dafür, wie man mit Behörden-Briefen und Merkblättern die Leute einschüchtern kann. Diejenigen nämlich, die dieses komische Amtsdeutsch nicht verstehen, werden schon aus lauter Ehrfurcht vor den Behörden-Briefbögen und -Stempeln alles glauben und schlucken und für unabänderlich halten, was da steht. Aber ich bin auch noch aus einem anderen Grund sauer geworden.
Da lag nämlich außer dem «Merkblatt des Bundesministers der Verteidigung für junge Wehrpflichtige» auch gleich eine Reklame bei: «Soldat auf Zeit». So ein schöngedruckter Handzettel – schwarz-weiß-rot –, mit dem für die Soldatenkarriere geworben wurde.
Das war viel verständlicher formuliert als das amtliche Zeug – Aufforderung zur Erfassung und Wehrpflichtgesetz. Es war verlockend, was da stand. Wieviel man als «Soldat auf Zeit» gleich am Anfang verdienen kann, und was der Staat alles Dolles für seine Soldaten auf Zeit tut: Ausbildung und Versicherung und Sorge für die Familie und weiß der Kuckuck was alles – phantastisch! Einer, der sich acht oder zwölf Jahre verpflichtet, kann dann auf Staatskosten studieren, sich mit staatlicher Hilfe ein Haus bauen und kriegt sogar noch ein paar zigtausend Mark in die Hand, wenn er die Zeit rum hat.
Das alles mag soweit in Ordnung sein, denn Reklame ist erlaubt –, aber für die Kriegsdienstverweigerer war in dem amtlichen Brief kein Flugblatt drin, auf dem vielleicht gestanden hätte, welche Vorteile es hat, wenn man sechzehn Monate lang alten Leuten hilft oder Kranke pflegt oder behinderte Kinder betreut.
Meine Mutter kam aus der Küche und fragte, als sie mich da mit saurem Gesicht sitzen sah, was denn das für ein Brief wäre. Ob es was Ärgerliches sei oder was.
«Ich werde erfaßt», sagte ich.
«Erfaßt? Wofür erfaßt?» fragte sie und beugte sich über den Brief, der auf dem Tisch lag, und las und wurde schon, ehe ich was erklären konnte, bei der ersten Zeile blaß und setzte sich auf die Stuhlkante.
«Du … du sollst … du sollst Soldat werden!?» stotterte sie.
«Ja», sagte ich. «Mein Jahrgang ist dran. Aus meiner Klasse sind schon mehrere erfaßt und zwei sogar schon gemustert. Aber sie ziehen niemanden ein, der noch zur Schule geht. Ich hab also noch anderthalb Jahre Zeit.»
Meine Mutter sagte gar nichts. Sie hatte die Hände vors Gesicht gelegt. Ich konnte also nicht sehen, was sie für eine Miene machte. Nach einer ganzen Weile sagte sie zwischen den Fingern durch:
«Ich war knapp fünf, als der Krieg anfing, und neun, als mein Vater bei Charkow fiel, und eben über zehn, als wir Allenstein verlassen mußten und sieben Wochen auf der Flucht waren, bis wir wieder ein richtiges Dach über dem Kopf und ein Bett hatten … wenn auch nichts zu essen außer fünf Scheiben Maisbrot und fünfzig Gramm Fett pro Woche. Ich habe dir nie viel davon erzählt, Wolfgang. Das war alles so furchtbar …»
Sie fing an zu weinen.
Ich wußte nicht, was ich machen sollte. Meine Mutter weint nur ganz selten. Ich habe es bloß drei- oder viermal erlebt. Und nie hab ich da gewußt, was ich machen sollte, hab immer blödsinnig hilflos daneben gestanden.
«Hör doch auf, Mama!» hab ich also sagen wollen – aber ich war so heiser, daß ich nur was Unverständliches krächzen konnte.
Ich langte über den Tisch und legte ihr die Hand auf die Schulter.
«Mußt nicht weinen!» sagte ich, nachdem ich mir die Kehle freigeräuspert hatte. «Vielleicht brauche ich ja nicht Soldat zu werden.»
Sie nahm die Hände vom Gesicht und sah mich ganz erstaunt an.
«Warum nicht? Du bist doch gesund! Du wirst bestimmt tauglich geschrieben, und dann mußt du hin, o Gott, mein Junge …» – und schon ging’s wieder los mit den Tränen.