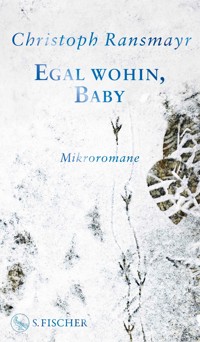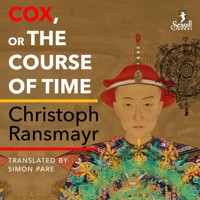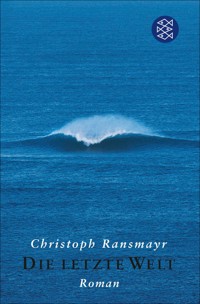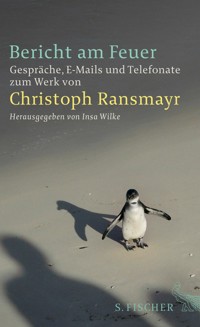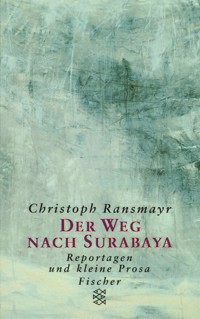
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Christoph Ransmayrs große Reiseerzählungen. Christoph Ransmayr begann seine literarische Arbeit als Kulturredakteur und Reporter. Er schrieb seine ersten Artikel für die österreichische Monatszeitschrift Extrablatt, später für Merian oder Geo, und vor allem für TransAtlantik. Aus der großen Zahl dieser Arbeiten hat Ransmayr jetzt die wichtigsten Stücke ausgewählt und mit sechs Beispielen »kleiner Prosa« zur vorliegenden Sammlung zusammengefasst. ›Der Weg nach Surabaya‹ zeichnet damit auch eine schriftstellerische Entwicklungsgeschichte nach, den Aufbruch eines großen Autors. Ob Ransmayr in seinen Reportagen vom Bau der Staumauern von Kaprun erzählt, von Häftlingskolonnen und Zwangsarbeit inmitten österreichischer Idyllen, von einer Wallfahrt zur letzten Kaiserin Europas und dem mühsamen Leben auf den Halligen des Nordfriesischen Wattenmeeres – oder ob er den Leser seiner »kleinen Prosa« in das Labyrinth von Knossos versetzt, auf die Ladefläche eines Lastwagen in Ostjava oder in die erloschene Pracht der indischen Ruinenstadt Fatehpur: stets verbindet er die scheinbare Leichtigkeit seines Erzählens mit einem wachen Blick für die Gegenwart und einer seltenen sprachlichen Perfektion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Der Weg nach Surabaya
Reportagen und kleine Prosa
Über dieses Buch
Christoph Ransmayrs große Reiseerzählungen.
Christoph Ransmayr begann seine literarische Arbeit als Kulturredakteur und Reporter. Er schrieb seine ersten Artikel für die österreichische Monatszeitschrift Extrablatt, später für Merian oder Geo, und vor allem für TransAtlantik. Aus der großen Zahl dieser Arbeiten hat Ransmayr jetzt die wichtigsten Stücke ausgewählt und mit sechs Beispielen »kleiner Prosa« zur vorliegenden Sammlung zusammengefasst. ›Der Weg nach Surabaya‹ zeichnet damit auch eine schriftstellerische Entwicklungsgeschichte nach, den Aufbruch eines großen Autors. Ob Ransmayr in seinen Reportagen vom Bau der Staumauern von Kaprun erzählt, von Häftlingskolonnen und Zwangsarbeit inmitten österreichischer Idyllen, von einer Wallfahrt zur letzten Kaiserin Europas und dem mühsamen Leben auf den Halligen des Nordfriesischen Wattenmeeres – oder ob er den Leser seiner »kleinen Prosa« in das Labyrinth von Knossos versetzt, auf die Ladefläche eines Lastwagen in Ostjava oder in die erloschene Pracht der indischen Ruinenstadt Fatehpur: stets verbindet er die scheinbare Leichtigkeit seines Erzählens mit einem wachen Blick für die Gegenwart und einer seltenen sprachlichen Perfektion.
»Die großen Reiseerzählungen der Gegenwart sind Abenteuerfahrten in die Tiefe der Einbildungskraft. Und keiner hat diesen Phantasieraum weiter ausgespannt als der Weltenwanderer Christoph Ransmayr.« Sigrid Löffler
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger
Coverabbildung: Hubert Scheibl, ›Pol-W2‹
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1997
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403207-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Hauptteil]
Ein Leben auf Hooge
Habach
Die vergorene Heimat
Die ersten Jahre der Ewigkeit
Kaprun
Auszug aus dem Hause Österreich
Die Königin von Polen
Der Blick in die Ferne
Chiara
Die Neunzigjährigen
Przemyśl
Der Held der Welt
Das Labyrinth
Schnee auf Zuurberg
Der Weg nach Surabaya
Fatehpur
Nachweise
[Hauptteil]
Ein Leben auf Hooge
Porträt einer untergehenden Gesellschaft
Hooge ist ein weiches Land ohne Steine und ohne Quellen. Gemessen an der langsamen Vergänglichkeit eines Gebirgszuges, eines Tales oder eines einzigen Steines, ist Hooge nur ein flüchtiges Schwemmland, das heute in der Brandung liegt und morgen wieder verschwunden ist. Hooge ist eine Weide, eine Wiese im nordfriesischen Wattenmeer, von Salzwasserrinnsalen durchzogen und einem geteerten, niedrigen Sommerdeich gefaßt. Wie trockengefallene Archen und weit auseinanderliegend, erheben sich aus der baumlosen Ebene Hooges neun, von wenigen Häusern bestandene Erdhügel – die Warften. Nur dort, im Windschatten der Häuser, gedeihen auch Bäume und Sträucher. Auf den Fennen, den Weiden zwischen den Warften, grasen Rinderherden und vereinzelt auch Pferde; darüber ziehen Seevögel, Silbermöwen und Austernfischer, ihre Schleifen. Hooge ist ein Land aus Torf, Schlick und Sand, von der See über den Untiefen und den Resten versunkener Marsch- und Moorlandschaften aufgeschichtet und dem Meeresspiegel doch zu nahe geblieben, um den Namen einer Insel zu erfüllen: Land von solchem Land heißt Hallig.
Achtmal, neunmal und öfter im Jahr rauscht das Meer über die Hallig Hooge hinweg, allein die Warften ragen dann umbrandet aus der Flut, und zieht sich die See zurück, liegen auf den Weiden Muschelkränze, Tang und Seesterne. Wenn dann kein Regen das Salz von den Gräsern wäscht, färbt sich dieses Land auch im Frühjahr kastanienbraun und rot. Daß Hooge im Strom der Gezeiten liegt, heißt auch: Hooge liegt zweimal im Verlauf eines Tages und einer Nacht inmitten des Meeres und zweimal in einer Schlickwüste. Klein ist Hooge; der Deich aus Granit und Basalt, der die fünfhundertfünfzig Hektar der Hallig umschließt, ist bei guten Kräften in zwei Stunden abzuschreiten, und die Bewohner dieses Landes sind rasch gezählt. Es sind einhundertvierunddreißig. Eigentlich ist Hooge nur eine Zuflucht auf 54º34' nördlicher Breite und 8º33' östlicher Länge und kaum elf nautische Meilen von der Küste Nordfrieslands entfernt; eine Zuflucht unter einem Himmel, der manchmal hoch und ungeheuer wird und sich dann wieder jäh herabsenkt und kalt und still und undurchdringlich über den Weiden liegt. Unter diesem Himmel wurde Johannes Hansen im Jahre 1896 geboren. Einige schmerzhafte Jahre auf dem Festland ausgenommen, hat er sein Leben auf Hooge verbracht. Jetzt ist er der älteste unter den Bürgern der Hallig. Es ist Frühjahr 1985, Ende April.
Hansen war Hufschmied und Kirchenrechnungsführer und schnitzte in seinen Mußestunden aus dem Harz der im Meer versunkenen Wälder Seehunde; es waren filigrane, augenlose Geschöpfe, Bernsteinabbilder jener unnahbaren Tiere, die damals wie heute auf den kalkweißen Sandbänken jenseits der Brandung im Wind lagen. Der Hufschmied verwandelte den rohen, blinden Bernstein, den die Krabbenfischer aus ihren Schleppnetzen lasen oder den er selber auf seinen Gängen durch das Watt fand, niemals in etwas anderes als in Seehunde. Aber anstelle der Augen schnitt er immer nur leere Kerben in das Gold der Köpfe, weil ihm schien, daß der Blick eines lebendigen Wesens ohnedies unnachahmlich sei. Johannes Hansen achtete die Seehunde sehr. War er nach vieler Sorgfalt mit einer Schnitzerei endlich zufrieden, dann verwahrte er sie in einem Glasschrank seiner Stube neben anderen Erinnerungsstücken an das wirkliche Leben: Kaum größer als die Finger einer Mädchenhand, lagen die Bernsteinseehunde dort zwischen Delfter Kacheln, Tonscherben, Harlinger Tellern und englischen Tassen - den Überresten jener Warften, die in den Sturmfluten der Nordsee untergegangen waren und deren freigespülter Hausrat nun bei Ebbe manchmal im Schlick glänzte.
Der Glasschrank steht immer noch in Hansens Stube und klirrt sachte, wenn eine Bö an den kleinen, weiß gestrichenen Fensterläden reißt. Unversehrt schimmert die Sammlung im Halbdunkel, das Strandgut, die blinden Skulpturen, die Scherben, die Reste. Und obwohl er aus einem anderen Jahrhundert kommt, sitzt der ehemalige Hufschmied und Kirchenrechnungsführer Johannes Hansen immer noch vor diesem Glasschrank an seinem Tisch, allein, versunken, stundenlang oft, und liest in der Heiligen Schrift. Seehunde schnitzt Hansen nun keine mehr. Gewiß, die Robben liegen immer noch draußen auf den Sänden, bei klarem Wetter brauchte Hansen nur vor sein Haus zu treten, um die Rudel zu sehen, dunkle, zitternde Flecken im Fernglas, sie sind immer noch da – aber die Feilen, die Messer und den lange gesammelten Bernstein, ja, die ganze Werkstatt, die draußen vor dem Gartenzaun stand, hat eine Sturmflut schon vor Jahren fortgetragen und dorthin zurückgebracht, wohin wohl alles hier auf Hooge irgendwann zurückmuß – zum Grund des Meeres und hinaus in die freie Nordsee.
Wenn Hansen jetzt noch Abbilder schnitzen wollte, dann müßte er seinen Skulpturen wohl auch jene schwärenden Wunden in die Hälse schneiden, an denen viele von den Tieren dort draußen leiden; solche und verborgenere Zeichen ätzt das vergiftete Meer den Seehunden ins Fleisch. Aber aus Hansens Fenstern sieht man keine Wunden; aus Hansens Fenstern sieht man weder die paar ölverschmierten Mantelmöwen und Trauerenten, die am Steinfuß des Deiches verwesen, noch das von Geschwüren entstellte Fischzeug, das sich nach manchen Fängen zwischen Tausenden Garnelen in den Schleppnetzen windet und ins Meer zurückgeworfen wird. Aus Hansens Fenstern erscheint Hooge seltsam unzerstörbar und geborgen vor dem Fraß der Zeit: Da ist der sorgsam bearbeitete Garten, der Zaun mit den hölzernen Ziersäulen, dahinter die grasbewachsene Warftböschung, ein Stück Weideland, der Deich und, je nach dem Stand des Flutkalenders, das Watt oder die Brandung und es ist, als ob die letzten Jahrzehnte, in denen sich Hooge vom beschwerlichen, bäurischen Ort im Meer in eine von vielen Adressen des Fremdenverkehrs verwandelt hat, noch gar nicht angebrochen wären.
Aber die Abgeschiedenheit dieses verwandelten Ortes ist längst nur noch ein vorübergehender Mangel der kalten, stürmischen Jahreszeit. In den milderen Monaten läßt der tägliche Fährverkehr, der Hooge mit den anderen Halligen, Inseln und dem Festland vernäht, keine Weltferne mehr zu. An den Nachmittagen der Sommersaison sind die Asphaltwege von Hooge schwarz von Menschen: Vier- und fünftausend sind es manchmal an einem einzigen schönen Tag, einhundertsechzig- und einhundertsiebzigtausend sind es im Jahr, Ausflügler, Tagestouristen, die bei auflaufendem Wasser aus Amrum, Föhr oder vom Festland kommen, weiß und groß stampfen ihre Fähren dem wirren Verlauf der Priele nach und auf Hooge zu, es sind fünf, sechs, auch sieben Schiffe an einem Nachmittag, und ihre Besatzungen umkreisen, belagern, erobern die Warften, Bastion für Bastion, die dem Dock nächstgelegene Backenswarft immer zuerst, dann die Kirchwarft, die Hanswarft und immer voran. Erst allmählich gerät der Einfall vor den wenigen, weit verstreuten Kneipen ins Stocken und kommt schließlich zum Stillstand.
Spaziergänger und Radfahrer lösen sich vom Troß und fahnden stundenlang nach dem Idyll und der Halligeinsamkeit, einem kostbaren, fremden Stoff, bis sie von den Sirenen allesamt wieder an Bord zurückgerufen werden und mit dem ablaufenden Wasser verschwinden, so gesetzmäßig und berechenbar wie der Wechsel von Ebbe und Flut. Zurück bleiben nur die weniger auffälligen Wattwanderer, Erholungs- und Sommergäste, die in den fünfhundert Fremdenbetten Hooges alljährlich fünfundfünfzigtausend Nächte verbringen. So ist es in der Statistik verzeichnet, von der Johannes Hansen nichts weiß. Aus Hansens Fenstern sind auch keine schwarzen Wege zu sehen und auf dem Meer keine Fähren, sondern nur die ein- oder auslaufenden Baumkorkutter der drei letzten Fischer von Hooge. Fährenrouten und Wege verlaufen anderswo. So leer und still wie vor diesen Fenstern wird es auf Hooge erst wieder im Herbst, der im August beginnt, stiller im Winter, wenn das Treibeis, das sich in den Gezeiten verkeilt und zu unüberwindlichen Barrieren auftürmt, jede Fährverbindung unterbricht, manchmal für Wochen; wenn sich das Leben auf Hooge wieder aus den Vorratskellern versorgt und die Post und Wichtigeres aus Flugzeugen und Helikoptern über der Eiswüste abgeworfen wird. Vieles ist dann wieder so, wie es hier lange war. Aber wer auf Hooge will dorthin zurück? Zurück in die Zeiten der großen Entlegenheit und des fauligen Zisternenwassers, das nach den Reetdächern stank, über die es zuvor geflossen war, in die Zeiten der Tranlichter und des Petroleumrußes, des Treibholzsammelns und vor allem der Armut. Dorthin, sagt Hansen, will wohl niemand zurück. Es ist gut, wie es ist, sagt Hansen, nichts soll wieder werden, wie es war.
Wann die neue Zeit begann? Ach, neue Zeiten haben so viele erste Jahre. An zwei Feste erinnert sich Hansen, schöne Feste mit Gedichten und Ansprachen und Musik. Das letzte wurde 1969 gefeiert, das Wasserfest, als die Hallig über eine tief in den Schlick eingespülte Doppelrohrleitung glücklich mit dem Wassernetz des Festlandes verbunden war. Fließendes, frisches Wasser! Das Ende der Hooger Wassernot, sagt Hansen, sei ihm sehr bedeutsam erschienen, denn wie oft sei es in der Vergangenheit vorgekommen, daß eine Flut das Süßwasser in den Soodbrunnen und Fethingen versalzte und das Vieh in den Ställen vor Durst brüllte und auch die Menschheit litt. Noch 1962, als die erste der vier großen Sturmfluten des bisherigen Jahrhunderts Hooge heimsuchte und so sehr verwüstete, daß vieles nicht mehr zu retten, sondern nur von allem Anfang an und neu zu machen war, Höfe, Dächer, Wege, ja ganze Warften … noch damals also mußten sieben Millionen Liter Wasser mühselig vom Festland herübergeschafft werden, um das Übel zu lindern. Und so, sagt Hansen, habe er sich über das Wasserfest auch mehr gefreut als über das Lichtfest, das schon zehn Jahre früher gefeiert wurde.
Mit dem Lichtfest, das der Verlegung eines zwanzigtausend Volt starken Kabels gegolten hatte, das Hooge an die Kraft des Festlandes anschloß, sei das alte Halligleben zu seinem Ende gekommen; ein Leben, dessen Beschwerlichkeit sich keiner von den Heutigen vorzustellen vermöchte. Das Kabel schuf diesem Leben eine solche Erleichterung, daß Hansen sich damals fragte, ob dies überhaupt noch das Hooger Leben sei. Mit der Beschwerlichkeit vergingen aber auch viele Künste des Bauerntums, der Fischerei und des Handwerks. Noch im Jahr des Lichtfestes brachte Otto Dell-Missier von der Hanswarft, geachteter Bürgermeister ist er jetzt und Vorarbeiter bei den Deichsetzern, das erste Fernsehgerät auf die Hallig. Die Welt kam dadurch zwar nicht näher, sagt Hansen, aber man konnte sie nun wenigstens aus der Ferne betrachten.
Schön war sie nicht.
Aber vielleicht ist die neue Zeit auch sehr viel älter als die Erinnerung an diese Feste, fast so alt wie Hansen selbst, alt wie der Sommerdeich vor seinen Fenstern. Denn was wäre das neue Hooge ohne diesen Deich? Vielleicht nur noch eine heillos veraltete Kontur auf den Seekarten, die hier ihre Gültigkeit so rasch verlieren; vielleicht nur noch ein zur Wildnis geschrumpftes, verkommenes Land, von Strandastern, Halligflieder und Salzmieren überwuchert und unbewohnbar, ein Land wie Norderoog, dieser dunkle Strich dort draußen im Watt, die Vogelinsel. Dort hauste der Einsiedler Jens Sörensen Wand einundvierzig Jahre seines Lebens in einem Pfahlbau und schützte die brütenden Brandseeschwalben, Sandregenpfeifer oder Eiderenten mit einem Prügel vor den Angriffen der Silber- und Sturmmöwen, bis er im Mai des Jahres 1950 in die Irre ging und in einem Priel ertrank. Hansen kannte den Vogelwärter gut.
Auf Norderoog lag noch im letzten Jahrhundert ein Gehöft und lebten Menschen und Vieh; und so wie Norderoog verwildert alles flache Land und fällt ans Meer zurück, wenn es nicht in Stein gefaßt wird und keine Buhnen und Lahnungen die Gezeitenströme mildern. Nach den Verlustlisten, die Hansen vor Jahren aus den Büchern des Kirchspiels abgeschrieben hat, war Hooge noch vor zweihundert Jahren doppelt so groß wie heute und trug nicht neun, sondern sechzehn – und vor vierhundert Jahren fünfundzwanzig Warften. Hansen war ein Kind, als sich die Obrigkeit entschloß, Hooge und die umliegenden Halligen in Stein zu fassen, um sie dem Festland als Wellenbrecher noch ein, zwei Jahrhunderte lang zu bewahren. Und Hansen war fünfzehn, als man unter der Anleitung holländischer Deichsetzer mit dem Bau jenes Bollwerks dort draußen begann, das die kleinen Springfluten des Sommers, vor allem aber die Wucht der Brandung abhalten sollte; bis dahin war die Küste von Hooge noch in jedem Jahr um die Spurbreite eines großen Pferdewagens vor dem Meer zurückgewichen.
Zur Bauzeit des Sommerdeiches sprach man in vielen Hooger Häusern noch Friesisch. In dieser Sprache war Johannes Hansen über die Erschaffung der Welt und in den Grundrechnungsarten unterrichtet worden; es war die Sprache seiner Kindheit und die der alten Halligen. Aber nun kann man auf Hooge in dieser Sprache nur noch Fragen stellen, sagt Hansen, und man wird die Fragen vielleicht noch verstehen, aber plattdeutsch antworten. Über dem Plattdeutschen habe man das Friesische vergessen. Gewiß, einige von den alten Losungen und auch den friesischen Wappenspruch, den sagen auch die Heutigen noch weiter – Lewwer duad us Slaav. Lieber tot als Sklave – in Zierschrift schreiben sie diese bittere Entscheidung an die Wände ihrer Stuben oder halten sie in einem Rahmen unter Glas … Aber wer unter den Heutigen betet auch das Vaterunser noch in der Sprache der Kindheit? Daan Wale schien oef dae Eerde, allikh oes oen dae Hemmel. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Also ist es vielleicht auch gut, daß die alten Halligleute samt ihrer Sprache vergehen.
Noch sind einige da – die Siebzig- und die Achtzigjährigen, der ehemalige Postschiffer Hans von Holdt und seine Frau Maria, die alte Frau Petersen von der Backenswarft und die Klara Joachimsmeier vom Königspesel oder selbst der ehemalige Maschinist und Seefahrer Mextorf, Hansens Nachbar – mit ihm und den anderen könnte Johannes Hansen immer noch das Friesische reden, an den Abenden und ganz wie in den Zeiten, in denen noch nicht jeder für sich und allein in der Dunkelheit vor dem Fernsehen saß. Aber seit seine Frau nicht mehr ist, hat Johannes Hansen kein Verlangen mehr nach diesem Reden und verläßt sein Haus und die Ockenswarft nur noch selten. So bewahrt jeder die Geschichte und die Erinnerung auf seine Art. Hans von Holdt zum Beispiel, der in Ehren alt gewordene Sohn jenes weit über Hooge hinaus bekannten Seehundjägers Heinrich Wilhelm von Holdt (der in seinem Leben mehr als sechstausend Seehunde erlegte) – dieser Hans von Holdt hat nicht bloß einen schmalen, selten geöffneten Glasschrank der Erinnerung, sondern hat in seinem Haus auf der Hanswarft ein Heimatmuseum eingerichtet, in dem er gegen eine Mark Eintritt zeigt, was ihm an der Geschichte wertvoll erschien: Ein Nebelhorn, eine Korkschwimmweste, einen Kreiselkompaß und einen Sextanten; in einer Koje eine Strandszene mit Sträuchern, ausgestopften Seevögeln und Sand; Knochen aus einem im Watt freigespülten Friedhof und einen ausgelaugten hölzernen Robbenschläger aus dem Eismeer und Werkzeuge und Möbel des alten Lebens, Bilder …, ach, Hans von Holdt hat bewahrt, was zu bewahren war. Auch die Erinnerung an die Baracken des Reichsarbeitsdienstes, die 1938 und noch Jahre danach auf der Westerwarft standen. Zweihundertfünfzig Arbeiter zogen damals schnurgerade Gräben durch das Weideland, rasterten Hooge in Grundstücke auf und beendeten so die Allmendewirtschaft, die schwierige, altgermanische Form des gemeinsamen Landbesitzes. Und dann, sozusagen mit der Einführung des privaten Grundeigentums, sagt Hansen, begann der Weltkrieg. Sechzehn Hooger mußten in diesen Krieg und zugrunde gehen, bis der Krieg schließlich selbst nach Hooge kam: Holdt ruderte damals vier Halligleute in seinem Postboot die zwei Seemeilen nach Pellworm hinüber, als plötzlich ein Flugzeug rasend und entsetzlich größer wurde, einen Herzschlag lang über ihnen und schon wieder hoch am Himmel war, noch bevor sich das Wasser über dem Einschlag der Feuergarben wieder geglättet hatte. In Pellworm trug Holdt damals zwei Tote an Land.
Anders als der Postschiffer Holdt, dem die zerschlissenen, wertlosen Dinge der Geschichte gleich lieb sind wie die kostbaren und der seine Sammlungen immer noch ergänzt und wieder und wieder ordnet, hütet seine Nachbarin Klara Joachimsmeier in ihrem Haus nur Kostbarkeiten, von denen die jüngste und zarteste dreihundert Jahre alt ist. Klara Joachimsmeier hat ihre Wohnung, ihr ganzes Haus zum Museum gemacht; und wie Hansens Haus trägt auch dieses noch das alte Reetdach, die Wände sind mit Muschelkalk verputzt und bis an die Decke mit Delfter Kacheln geschmückt, die biblische Bilder tragen. Königspesel – seinen Namen trägt dieses Haus nach einer einzigen Nacht, die ein König darin verbracht hat. Es war der Däne Friederich VI., der im Sommer nach der großen Frühjahrsflut des Jahres 1825 nach Hooge kam, um das Elend seiner Untertanen zu inspizieren und dann vom schweren Wasser an der raschen Weiterfahrt gehindert wurde. In der Nacht zwischen dem 3ten und 4ten Feber war eine Fluth wie seit Menschengedenken nicht – hatte der Hooger Pastor Anton Wilhelm Conrad Schmidt über das Unglück der Hallig ins Kirchenbuch geschrieben – 3 Warften, Klein- und Großsüderwarft und Fedder Bandixwarft, sind gänzlich mit ihren Wohnungen und Bewohnern untergegangen. Außerdem sind die 5westlichen Warften größtenteils zertrümmert … 25 Menschen haben hier in Einer Schreckensnacht das Leben eingebüßt, davon sind 5im Bette ertrunken, die übrigen 20 mit ihren Wohnungen vergangen … Die übrig gebliebenen Halligbewohner sitzen mehrenteils weinend, durchnäßt, hungernd und frierend auf den Trümmern ihrer Hütten …
Der Herr aus Dänemark verfügte damals die Erhöhung der Warften und eine Kollekte gegen die Not. So war es oft nach den großen Fluten und so blieb es auch: Hohe Herren kamen, im letzten Jahrhundert eben ein dänischer König und in diesem ein deutscher Bundespräsident wie noch 1962 einer namens Lübke, sie kamen alle in großer Begleitung, bedauerten die Verwüstungen und verordneten Maßnahmen und Hilfe. Und dann wurden eben wieder einmal die Warften erhöht, die Deiche verstärkt und die Häuser fester gebaut. Aber die Flut stieg allen Maßnahmen nach. Auch nun, nach einer langen Zeit der Ruhe, scheint sich der Spiegel des Meeres wieder zu heben, von Jahr zu Jahr, fast unmerklich langsam und unaufhaltsam und kalt.
Klara Joachimsmeiers Haus jedenfalls ist immer noch gerüstet für hohen Besuch. Der Kapitän Tade Hans Bandix, einer von dreißig Kapitänen und vielen Seefahrern, die Hooge hervorgebracht hat, ließ dieses Haus 1760 errichten und stattete es mit allen Kostbarkeiten aus, die er auf seinen Fahrten sammelte, bis er vor der Küste Spitzbergens mit seinem Schiff im Eismeer versank. Sechzig Jahre lang hat Klara Joachimsmeier Fremde durch dieses Haus geführt; seltene Gäste zuerst, dann Reisegruppen, schließlich die Horden von den Fähren. Sechzig Jahre lang hat Klara Joachimsmeier am Beispiel der Erlesenheit ihres Porzellans aus Tsingtau und Meißen, der italienischen Alabasterfiguren und Rubingläser, der Standuhr des Londoner Meisters Sam Honeychurch und japanischer Teebrettmalereien von der Blütezeit des Walfanges in der Arktis erzählt, vom Reichtum des Tade Hans Bandix und aller Hooger Kapitäne des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Und von der großen Stille hat Klara Joachimsmeier erzählt, der Stille auf Hooge nach den Abschiedstagen, in denen die Grönlandfahrer zum Walfang ins Eismeer oder die Ostindienfahrer nach dem Pazifischen Ozean aufgebrochen waren.
Aber aller Reichtum der Seefahrt ging an Hooge vorüber. Denn viele Hooger, die zu Ehren, zu Geld oder gar zu Kapitänswürden kamen, nahmen irgendwann einen fremden Namen an, nannten sich so, wie sie von den holländischen Reedern genannt wurden, und ließen sich in einer Küstenstadt des Festlandes nieder. Rauschende, schwarze, langmähnige Wogen kommen wie rasende Rosse geflogen – so hat Detlev von Liliencron, der Dichter und preußische Kirchspielvogt auf der Insel Pellworm, die Sturmflut beschrieben. Und wer wollte denn sein Haus und seinen im Eis oder in der Tropenglut unter Gefahren erworbenen Reichtum auf einer Hallig hinterlassen, wo ihm alles und in einer einzigen Nacht von einem solchen Wasser wieder genommen werden konnte?
Aber so bedrohlich dieses schwarze Wasser den Halligen auch stets geblieben ist und mit welcher Wucht auch immer sich die See gegen ihre Küsten warf – von den alten Hoogern spricht keiner groß von der Sturmflut, ohne danach gefragt worden zu sein. Wozu auch? Das mag den Sommergästen oder zugewanderten Festländern überlassen bleiben, die in der Flut hartnäckig mehr sehen wollen als Wasser, dem Pastor Dietrich Heyde etwa, der in seiner Kirche Lichtbildervorträge über die Sturmflut hält, dazu Psalmen hersagt und mit einem Leuchtpfeil von der Kanzel herab auf die Schaumkronen besonders großer Brecher zeigt. Auf einer Leinwand vor dem Altar führt Heyde den Fremden das Meer vor, wie sie es noch nie gesehen haben, den kleinen, überfluteten Friedhof der Kirchwarft, umgestürzte Grabsteine in der Gischt, gleißende Wogen, die über die Warften hinwegrollen und sich an Zäunen und Hausmauern brechen undsofort.
Doch, die Bilder sind wahr und manche sind schön, die Hooger haben sie nicht erst auf der Leinwand gesehen, die Hooger erinnern sich. Und der Pastor ist eben noch jung und begeistert. Dietrich Heyde ist der dreiunddreißigste Pastor, den man auf Hooge zählt, und kommt wie die meisten seiner Vorgänger vom Festland und schreibt wie die meisten seiner Vorgänger an der Chronik der Fluten weiter. Soll sein. Aber Sache der Halligleute ist es nicht, den Sommergästen Worte wie Blanker Hans immer wieder als den Namen der Nordsee vorzusagen oder ihnen wieder und wieder den Unterschied zwischen einem bloßen Landunter und der Sturmflut auseinanderzusetzen. Wer den Unterschied erfahren will, wird ihn erfahren. Nicht, daß man auf Hooge etwas gegen Belehrungen einzuwenden hätte - die jungen Leute vom Festland wie der Wattführer Dirk Post oder der Vogelwart Stefan Bräger, Naturschützer und Biologen, die auf der Hanswarft ihre Schutzstation Wattenmeer betreiben, halten doch auch Vorträge und zeigen Filme und Ausstellungen – aber warum sollten die Hooger sich nun auch noch in Lehrstunden mit dem Meer beschäftigen, mit dem sie ohnedies seit Jahrhunderten beschäftigt sind?
Aber gut. Pastor Heyde ist ein braver Mann; ganz anders zwar als sein Vorgänger, der Pastor Speck, dem man nachsagt, er hätte unter seinem Ornat stets das Ölzeug getragen, um nach dem Gottesdienst schneller wieder unter Segeln zu sein, nein, ein Mann der See ist Heyde nicht; aber ein braver Mann. Seit die Bohlsens ihrer Trunksucht wegen für sechs Wochen ans Festland mußten, er nach Schleswig und sie nach Bredstedt, sorgt sich der Pastor auch um Johannes Hansen. Hansen war ja nach dem Tod seiner Frau zu den Bohlsens in Kost gekommen. Und schließlich war Pastor Heyde auch an Bord, als der Krabbenfischer und sozialdemokratische Gemeindevertreter Paul Hermann von Holdt, Hans von Holdts Sohn, gemeinsam mit dem Fischer Ocke Friedrichsen und einer ganzen Kutterflotte von den Halligen nach dem Festland fuhr, um dort gegen die Vergiftung der Nordsee zu protestieren. Zwar ist das Wasser um Hooge immer noch sauberer als die Küstengewässer, weil eine den Hoogern gnädige Strömung die Jauche aus der Weser- und Elbmündung weit hinaus in die Deutsche Bucht und erst dann hart nach Norden treibt – aber Paul Hermann von Holdt erfährt vom schlimmen Zustand der Nordsee immer wieder aus seinen Grundschleppnetzen, wenn er die Steertknoten öffnet und die Sortiermaschine ihm seinen Fang entschlüsselt. Holdt hat schon vor Jahren gesagt, daß selbst ein Meer sterben kann.
Viel Dreck, viel Protest und alles umsonst, pflegt Hansens Nachbar Theodor Adolf Mextorf zu sagen, wenn die Rede auf das Meer kommt – gegen die allmächtige Verbindung von Blödheit und Gier bliebe ja doch jeder Protest wirkungslos; denn ehe die Nordsee nicht tot sei wie ein Trog voll Salzsäure, würden die Verbrecher in der Wirtschaft und im Staat nichts, aber auch gar nichts begreifen. Zweiundvierzig Länder hat der Erste Maschinist und Schiffsingenieur Theodor Adolf Mextorf in seinem Leben gesehen; als einziger von vier Söhnen einer alten Halligfamilie ist er aus dem Krieg zurückgekehrt und hat dann Korinthen aus Afrika und Erdöl aus Lateinamerika geholt, hat Hunderte Häfen von der Seeseite fotografiert, die immer gleichen Kräne, Kaimauern und das Dickicht der Masten, hat das Nordlicht und das Kreuz des Südens gesehen und ist in einem Orkan vor der türkischen Küste gestrandet. Selbst jetzt noch, mit zweiundsiebzig Jahren, wird er für einige Sommerwochen an Bord eines dreimastigen Klippers wieder die Maschinenaufsicht führen, wird nach Nordafrika reisen und wieder nach Hooge zurückkehren und hier doch wieder sein, was er immer gewesen ist: Ich bin der Bösewicht unter den Hoogern, sagt Mextorf über sich selbst, ich bin der Querulant.
Der Maschinist hat sich die Zeichen der Zeit immer selber gedeutet und dabei den Frieden des Fortschritts manchmal gestört: Seit Jahren liegt er mit dem Fischer Ocke Friedrichsen in einem Gerichtsstreit um das Aussehen der Warft, das Friedrichsen mit seinem Hausbau gestört haben soll. Und obwohl sein eigenes Haus bequem und geräumig ist, vermietet Mextorf keine Zimmer an Sommergäste wie viele andere Hooger, wie selbst der Bürgermeister Dell-Missier, der am Feierabend, nach seiner Arbeit am Deich und den Buhnen und nach der Stallarbeit, nun auch noch an zwei neuen Ferienwohnungen für seine Hausgäste baut. Aber Mextorf will keine Fremden im Haus. Er verleiht auch keine Fahrräder wie Jürgen Diedrichsen von der Backenswarft, kutschiert keine Gäste im Pferdewagen über das Land wie Heiner Brogmus, will auch kein Lokal und keinen Verkaufsstand eröffnen und macht selbst die Vergangenheit nicht zugänglich wie Hans von Holdt oder Klara Joachimsmeier. Eine alte Schiffskajüte in seinem Keller hat der Maschinist allein für sich und seine Erinnerungen aus Strandgut und Wrackteilen zusammengesetzt. Unter den Bullaugen dieser Kajüte sitzt er an vielen Nachmittagen, blättert in verjährten Journalen und Karten und betrachtet seine Aufnahmen von Palmenpromenaden und Klippen, während im Erdgeschoß über ihm seine Frau, die ehemalige Posthalterin und Funkerin von Hooge, Hemden bügelt.
Einmal im Monat versammeln sich im Cafe Seehund auf der Hanswarft die drei christdemokratischen und vier sozialdemokratischen Gemeindevertreter vor den Bürgern von Hooge, um dort die nächste Zukunft der Hallig öffentlich zu besprechen, Klagen zu hören oder Beschlüsse zu fassen. Theodor Adolf Mextorf war lange nicht mehr im Seehund und ist mit der Gemeindeversammlung dort eigentlich nur in einem wichtigen Punkt gleicher Meinung: Die Landesregierung in Kiel möge den Halligleuten und der gesamten Küste Nordfrieslands mit ihren Gesetzen und Phantasien über den rechten Naturschutz vom Halse bleiben. Denn was tut diese Regierung an der Ostseeküste, in Kiel!, wo man die großen Gezeitenströme nur vom Hörensagen kennt? Beschließt sie etwa ein Verbot der Bombardierung des Watts und all dieser idiotischen Schießübungen der Armee in der Meldorfer Bucht? Oder verbietet sie die Ölbohrung und die Tankerreinigung auf See oder auch nur die Dünnsäureverklappung, die zwanzig Seemeilen vor Hooge das Meerwasser zur Giftbrühe macht? Einen Teufel tut diese Regierung. Nichts davon ist verboten. Alles ist erlaubt. Um aber über diese Sauereien hinwegzulügen, erklären die Kieler nun das Wattenmeer zum Nationalpark und beschließen eine Litanei unsinniger Vorschriften, ein Gesetz, das weite Küstenstriche in Tabuzonen verwandelt und den Hoogern verbietet, die Außensände, die Seehundbänke und viele Wattflächen auch nur zu betreten. Ja verflucht, wohin sollen wir denn gehen, fragt man im Cafe Seehund, wohin, wenn nicht ins Watt?
Paragraphen! Als ob das Land und die Sände durch Paragraphen zu schützen wären. Ohne unsere Deiche, ohne unsere Buhnen und Lahnungen, heißt es im Cafe Seehund, gäbe es hier schon längst nichts mehr zu schützen. Und wie soll denn überhaupt etwas tabu werden, was ohnedies von der Brandung zerschlagen und von den Gezeitenströmen in die freie See verfrachtet wird? Die Außensände verlagern sich doch in jeder Sturmflut zehn Meter und mehr von West nach Ost; der Japsand driftet auf Hooge zu und wird die Hallig noch innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahrzehnte erreichen; der Norderoogsand driftet auf die Vogelinsel Norderoog zu, wird dort auflaufen, wird die Insel ersticken und weiterwandern und schließlich in den immer tiefer und breiter werdenden Prielen verschwinden. Noch vor zwanzig Jahren konnte Paul Hermann von Holdt nur mit einem Plattbodenfahrzeug von höchstens siebzig Zentimetern Tiefgang zum Krabbenfang; jetzt erlauben ihm die Meeresverhältnisse einen siebenunddreißig Tonnen großen Baumkorkutter, der fast zwei Meter tief im Wasser liegt. Und die Priele um Hooge vertiefen und verästeln sich weiter, verbinden sich miteinander und werden den Wattsockel der Hallig endlich umspülen wie das Wasser eines Burggrabens die Burg. Aber die Priele werden die Hallig nicht schützen, sondern ihr Fundament abtragen, geduldig, Schicht um Schicht.
Wir sind Halligleute, sagen die Hooger, wir kennen das Meer und gehen mit ihm um, wie man mit einem Meer umgehen muß. Wir brauchen keine Tabuzonen, sondern Leitdämme und Deiche, und wir brauchen auch keine menschenleeren Vogelparadiese, sondern Abschußgenehmigungen, bevor uns die von Jahr zu Jahr größer werdenden Ringelgansschwärme mit ihrem Kot noch die letzten Weiden verbrennen.
Die Deutschen sind ein seltsames Volk, sagt der Erste Maschinist Theodor Adolf Mextorf zum Bullauge seiner Kellerkajüte hinaus, ein sehr seltsames Volk. Noch vor ein paar Jahrzehnten haben sie ganze Kulturen zugrunde gerichtet und Millionen Menschen verschleppt und erschlagen und wohin sie auch kamen, nur vernichtet und verwüstet. Und jetzt? Jetzt träumen sie von einer stillen, menschenleeren Natur und errichten um jeden verseuchten Seehund, um jeden Borstenwurm ein Gesetz.