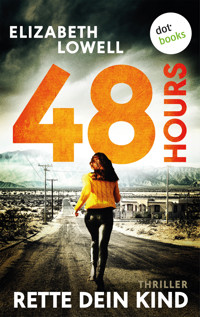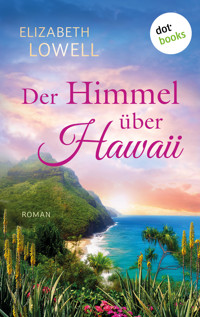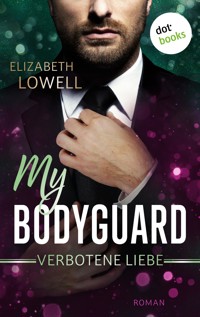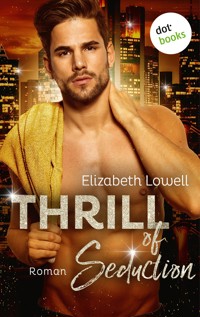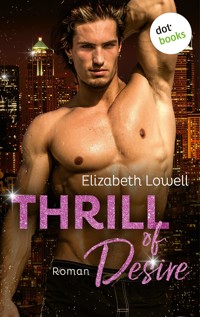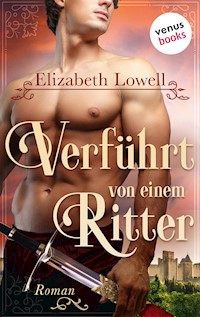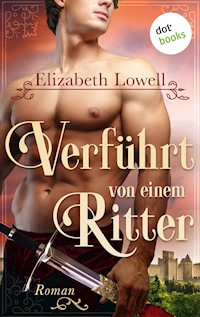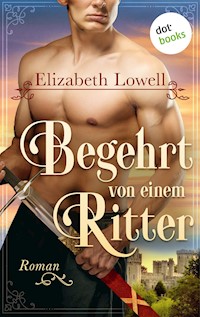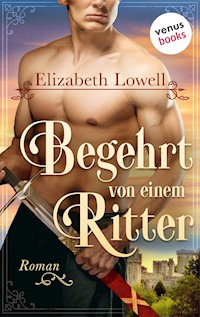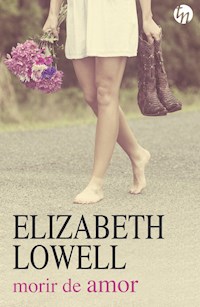2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Es wird die Reise ihres Lebens: Von der bitterkalten Arktis in die flirrende Hitze Australiens, auf der Suche nach einem mysteriösen Erbe … Die Arktis ist für Fotografin Erin Shane Windsor seit sieben Jahren Heimat und Zufluchtsort zugleich. Die menschenleere Eiswüste gibt ihr ein Gefühl der Sicherheit – und lässt sie hinter ihrem geliebten Objektiv ihre traumatische Vergangenheit vergessen. Doch dann erreicht Erin in ihrem friedlichen Exil eine alles verändernde Nachricht: Sie soll Erbin einer Diamantenmine in Australien sein! Aber wer ist der mysteriöse Onkel, der ihr dieses kuriose Erbe vermachte? Und gibt es die Miene wirklich? Notgedrungen tauscht Erin die Kälte der Arktis gegen die sengende Hitze des Outbacks und stürzt sich ins Unbekannte. Als ihre Recherchen stagnieren, beauftragt sie den charismatischen Geologen Cole Blackburn als Scout. Doch den Abenteurer umgibt eine Dunkelheit, die ebenso anziehend wie beunruhigend ist … Prickelnde Romance im roten Herzen Australiens für Fans von Nora Roberts und Di Morrisey!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Arktis ist für Fotografin Erin Shane Windsor seit sieben Jahren Heimat und Zufluchtsort zugleich. Die menschenleere Eiswüste gibt ihr ein Gefühl der Sicherheit – und lässt sie hinter ihrem geliebten Objektiv ihre traumatische Vergangenheit vergessen. Doch dann erreicht Erin in ihrem friedlichen Exil eine alles verändernde Nachricht: Sie soll Erbin einer Diamantenmine in Australien sein! Aber wer ist der mysteriöse Onkel, der ihr dieses kuriose Erbe vermachte? Und gibt es die Miene wirklich? Notgedrungen tauscht Erin die Kälte der Arktis gegen die sengende Hitze des Outbacks und stürzt sich ins Unbekannte. Als ihre Recherchen stagnieren, beauftragt sie den charismatischen Geologen Cole Blackburn als Scout. Doch den Abenteurer umgibt eine Dunkelheit, die ebenso anziehend wie beunruhigend ist …
Über die Autorin:
Elizabeth Lowell ist das Pseudonym der preisgekrönten amerikanischen Bestsellerautorin Ann Maxwell, unter dem sie zahlreiche ebenso spannende wie romantische Romane verfasste. Sie wurde mehrfach mit dem Romantic Times Award ausgezeichnet und stand bereits mit mehr als 30 Romanen auf der New York Times Bestsellerliste.
Die Website der Autorin: elizabethlowell.com
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Liebesromane »Begehrt von einem Ritter«, »Verführt von einem Ritter« und »Geküsst von einem Ritter« sowie ihren Thriller »48 Hours – Rette dein Kind« Außerdem veröffentlichte sie ihre Romantic-Suspense-Romane »Dangerous Games – Dunkles Verlangen«, »Dangerous Games – Tödliche Gier« und die Donovan-Saga mit den Bänden »Thrill of Desire«, »Thrill of Seduction«, »Thrill of Passion« und »Thrill of Temptation« sowie den Roman »Der Himmel über Hawaii«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »The Diamond Tiger« bei Harper Paperbacks/HarperCollins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Flammender Diamant« bei Goldmann
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Two of a Kind, Inc.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 beim Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-225-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der weite Horizont Australiens« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Lowell
Der weite Horizont Australiens
Roman
Aus dem Amerikanischen von Sabine Ivanovas
dotbooks.
Prolog
Wenn Abe Windsor nicht wirklich tot ist, dann schwör’ ich, daß ich ihn umbringe.
Für Jason Street war dieser Gedanke sowohl Wunsch als auch Versprechen. Zehn Stunden war es her, daß sein Informant aus Crazy Abes Station in Westaustralien seinen Funkspruch durchgegeben hatte. Seitdem war Street ununterbrochen unterwegs gewesen zu der verlassenen Station nahe den Sleeping Dog-Minen. Zuerst vier Stunden Flug mit einer gecharterten Maschine von Perth aus, dann die endlosen nächtlichen Stunden hinter dem Steuer eines heruntergekommenen Geländewagens, mit gnadenlosem Tempo über steinige Pisten, in Richtung einer der verlassensten Gegenden des Kontinents.
Aber nicht die halsbrecherische Fahrt war der Grund für Streets Zorn, sondern die Angst, daß womöglich mehr als zehn Jahre Geduld und Mühe verloren waren, allein des Suffs eines wüsten alten Kerls wegen.
Das Kreuz des Südens verblaßte am Himmel und wich langsam der brutalen gelben Glut der aufgehenden Sonne. Schon jetzt war es am Südostrand des Kimberley-Plateaus dreißig Grad heiß, und mit der Sonne würde die Temperatur steigen. Das grelle Licht enthüllte trockenes Wüstengras und verkrüppelte Eukalyptusbäume, roten Staub und vereinzelte felsige Erhebungen. Über allem stand die Sonne, immer die Sonne, das Einzige, was in Westaustralien wirklich zu Hause war.
Es klang wie Schüsse, wenn aufgewirbelte Steine von der Bodenwanne des schwer strapazierten Wagens abprallten, der schlingernd über die kaum erkennbare Piste raste. Doch Street wußte genau, wo er hinwollte. Zehn Jahre lang war er diese Strecke immer wieder gefahren, zehn Jahre, in denen er versucht hatte, dem alten Mann irgendwie sein Geheimnis zu entlocken. Wenn Crazy Abe jetzt noch irgendwie ansprechbar war, würde Street alles erfahren, bevor das Kreuz des Südens wieder über Australien aufging.
Der Wagen schoß in einer Staubwolke über eine leichte Anhöhe, und Abes Station, seine dürftige Behausung, lag vor ihm. Die Besitztümer des alten Mannes waren wie Wrackteile über mehrere Morgen flaches, kahles Land verstreut: ein klappriges Haus mit Wellblechdach, ein paar windschiefe Schuppen, rostige Zugmaschinen, kaputte Bergbaugerätschaften und die Reste einer Propellermaschine, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs ganz in der Nähe abgestürzt war.
Plötzlich erhob sich ein glitzernder, lauter und sehr moderner Hubschrauber dicht hinter dem Haus in den Himmel. Street trat in die Bremse und versuchte, irgendwelche Erkennungszeichen an dem Hubschrauber auszumachen, als dieser schwenkte und über ihn hinwegbrauste. Vielleicht das Wappen der Polizei, der Armee oder der Luftrettung.
Aber die glatten Seiten des Hubschraubers waren unbeschriftet und anonym. Seine Eigentümer hatten offensichtlich genausowenig Interesse daran, bekannt zu werden, wie Street. Wütend und beunruhigt schlug er mit der Faust gegen das Steuerrad, legte heftig den Gang ein und raste den flachen Hügel hinunter.
Der Wagen war auf der staubigen roten Erde kaum zum Stehen gekommen, da rollte Street sich mit einer halbautomatischen Pistole in der Hand aus dem Jeep und ließ sich fallen. Dann glitt er mit gekonnten Bewegungen hinüber in den Schutz einer der Hausecken und riskierte einen kurzen Blick durch ein schmutziges Fenster.
Eine einzige Paraffinlampe erleuchtete das große Zimmer des Hauses. Eine barfüßige Leiche lag unter einem ausgefransten Stück Segeltuch auf dem langen Tisch mitten im Raum. Das Einzige, was sich bewegte, waren die hier draußen im Outback üblichen Schwärme von Fliegen.
Street fluchte, ließ seine Vorsicht fahren und brach mit dem Stiefel die Tür ein. Der Gestank des Todes strömte auf den kahlen Hof hinaus. Street blickte über den Lauf seiner Pistole in den Raum. Nichts erwiderte seinen Blick. Würgend angesichts des Geruchs ging er zum Tisch und hob einen Zipfel des Tuches. Eine Wolke von Fliegen stob auf.
Dem Zustand der Leiche nach zu urteilen war Abe Windsor schon seit einer ganzen Weile tot. Selbst wenn man die für Oktober normale feuchte Hitze des Buildup, jener Zeit wachsender Schwüle vor der Regenperiode, berücksichtigte, war der alte Mann sicher schon drei Tage tot. Doch die breite Narbe an seinem linken Handgelenk, die der Verwesung länger standgehalten hatte als das weichere Fleisch drumherum, ließ keinen Zweifel daran, daß der Tote Abe Windsor war.
Mit einem angewiderten Laut ließ Street die Plane fallen und blickte sich um. Er nahm nicht an, daß der Hubschrauber mehr als die Fliegen hiergelassen hatte. Vielleicht hatte Street sie aber auch überrascht, bevor sie die ganze Station durchsucht hatten. Street verzog das Gesicht und wandte sich wieder der Leiche zu. Der abgenutzte Samtbeutel hing nicht mehr wie sonst an Abes Hals. Street sah zu dem schäbigen Regalbrett neben dem Schaukelstuhl hinauf. Die verbeulte Blechdose war auch weg.
»Tja, jetzt hast du deinen letzten Gang durch den Busch hinter dir, alter Meckerer«, murmelte Street. »Hast du die verdammte Dose mitgenommen so wie immer? Ist dein Geheimnis mit dir draußen im Busch eingegangen? Und wer zum Teufel hat dich noch beobachtet außer mir?« Nur das bösartige Schweigen des Todes antwortete ihm. »Du hast die ganze Zeit gewußt, was ich wollte, stimmt’s? Wie gern hast du mich immer gepiesackt. Aber du alter Schweinehund bist jetzt tot, und ich nicht!«
Leise Geräusche verrieten, daß die alten Fußbodenbretter in der Küche sich bewegten. Jemand verließ das Haus. Street drehte sich hastig um und stürzte in die finstere Küche, wo er gerade noch eine dunkel gekleidete Gestalt durch die Hintertür schlüpfen sah.
Mit einem Satz war Street in der offenen Tür und gab einen schnellen Schuß ab. Die Kugel erwischte den Flüchtenden, kurz bevor dieser den Schutz eines Schuppens erreichte. Er fiel nach vorn in den rostbraunen Staub. Street trat vorsichtig näher und drehte den Mann mit dem Fuß um, nachdem er ihn kurz auf Waffen untersucht hatte. Es war Chu, Abes Koch, der mit schmerzverzerrtem Blick zu ihm aufsah. Street zielte auf einen Punkt zwischen seinen Augen. »Wo ist die Dose, du räuberischer Chinese?«
Chu ächzte nur und sagte nichts. Street lehnte sich mit einem Fuß auf die verletzte Schulter des Mannes. »Also?«
Chu stöhnte und murmelte etwas auf chinesisch, vielleicht ein Fluch oder eine Bitte um Gnade.
Street trat fester zu. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie eine Gestalt den Schutz des Schuppens verließ und auf ihn zusprang. In diesem Augenblick, in dem Streets Aufmerksamkeit abgelenkt war, versuchte Chu, ihn mit einem Tritt zu erwischen. Die beiden Ereignisse kamen so gut koordiniert, daß Street sofort wußte, daß er es mit Profis zu tun hatte. Er reagiert gleichermaßen schnell und tödlich. Ohne zu zielen, feuerte er auf Chu und drehte sich gleichzeitig um, so daß dessen Tritt danebenging. Street warf sich zur Seite und richtete dabei seine Waffe auf den anderen Angreifer. Er schoß zweimal, während er auf dem Boden landete. Beide Schüsse gingen daneben, vereitelten aber einen auf seinen Kopf gezielten Sprung, der seinen Schädel sicher zertrümmert hätte.
Der Angreifer flog an Street vorbei, der sich abrollte, bis er ganz auf dem Bauch lag. Er drehte sich zur Seite und schoß dem Angreifer zweimal in den Rücken. Irgendetwas an der Art des Falls und des Aufschreies machten Street klar, daß es eine Frau gewesen war, die er gerade erschossen hatte. Er rollte sich in der Erwartung eines weiteren Angriffs wieder zur Seite und richtete sich geduckt auf, den Rücken zum Haus, die Pistole auf den leeren Hof gerichtet.
Aus fünfzig Metern Entfernung ertönten die Schreie von ein paar aufgescheuchten Kakadus zwischen verkrüppelten Bäumen herüber. Als sie sich nach einigen Sekunden wieder auf die Äste setzten, senkte sich die Stille des Todes über Abe Windsors Station.
Eilig durchsuchte Street die beiden Leichen. Weder die Blechdose noch der Samtbeutel waren bei ihnen. Da Chu und die Chinesin keinerlei Papier oder andere Kennzeichen bei sich trugen, konnte Street nicht herausfinden, wer sie geschickt hatte und warum. Chu war schon seit Jahren hiergewesen, aber Street waren die Schwielen an seinen Händen und Füßen nie aufgefallen, die ihn als ausgebildeten Kämpfer zu erkennen gaben. Die Hände der Frau sahen ähnlich aus. Beide waren offensichtlich ein Team gewesen, bereit zu töten oder zu sterben.
Jetzt waren sie tot, und Street war der Antwort auf die Frage, wer sie geschickt hatte, nicht näher als Crazy Abes Diamantenmine. Er spuckte auf den Boden und wandte den Leichen den Rücken zu. Es war wohl kaum noch etwas von Wert hier, aber nach den zehn Jahren, die er dieses Mauseloch beobachtet hatte, würde er jetzt nicht riskieren, irgendetwas zu übersehen. Es war immerhin möglich, daß die Aufzeichnungen des alten Mannes, seine Gedichte sowie sein Testament noch irgendwo auf der Station versteckt waren.
Der Gestank im Haus war unverändert. Street durchsuchte, was er schon so oft durchsucht hatte, aber wie immer ohne Erfolg. Dann stand er wieder bei der Leiche. Er mußte an »Chunder from Down under« denken, Abes schräge Verse. »Zehn Jahre lang dein falsches Lachen, du sollst verrotten, Abe Windsor. Und auch der, der die Sleeping Dog-Minen erbt, wer immer es sein mag.«
Kapitel 1
»Zwei Menschen mußten sterben, damit dies hier zu mir gelangt.«
Cole Blackburn betrachtete den kleinen, abgenutzten Samtbeutel. »War es das wert?«
»Das frage ich dich«, meinte Chen Wing und schüttete den Inhalt des Beutels mit einer schnellen Bewegung auf seinen Ebenholzschreibtisch. Eine Handvoll durchsichtiger Steine fiel wie ein Lichtregen mit leisen, kristallenen Geräuschen übereinander. Auf den ersten Blick erinnerten sie an große, rauhe Murmeln, die durch langjährigen Gebrauch angestoßen und abgesplittert waren. Neun der dreizehn Steine waren farblos, drei waren rosa. Einer war leuchtend grün wie ein Fluß an einer tiefen Stelle.
Coles Hand legte sich sofort um die grüne Murmel, die so dick wie seine Daumenkuppe war. Der Stein war für seine Größe erstaunlich schwer. Er rieb ihn zwischen den Fingern. Die Oberfläche fühlte sich beinah glitschig an, als hätte man sie geölt. Er entdecke eine flache, glatt abgesprungene Stelle und hauchte darauf. Die Oberfläche beschlug nicht.
Cole spürte, wie er von Erregung gepackt wurde. Wortlos griff er ein schweres Kristallglas von dem Wagen mit der kleinen Bar darauf und sah Wing an, der nickte. Cole zog den Stein mit einer schnellen Bewegung über die Seite des Glases.
Der Stein schnitt eine tiefe Rille in das Glas, wobei er selbst unberührt blieb. Cole nahm noch verschiedene andere Steine vom Tisch und wiederholte den Vorgang. Weitere Kratzer bildeten sich. Er zog eine abgenutzte Juwelierslupe aus der Tasche, bog sich die Schreibtischlampe zurecht, nahm den grünen Stein und untersuchte ihn.
Er hatte das Gefühl, in ein Meer aus durchdringendem, smaragdgrünem Licht zu sinken. Aber dies war kein Smaragd. Selbst ungeschliffen brach der Stein in einer Weise das Licht, wie es nur ein Diamant konnte. Er funkelte mit jeder kleinen Bewegung seiner Hand. Das Licht strömte durch alle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche des Steins und sammelte sich in seinen leuchtenden Tiefen. Er hatte keine Risse und nur zwei ganz kleine Einschlüsse, die den Wert des Diamanten nicht beeinträchtigten, denn sie lagen so dicht unter der Oberfläche, daß sie durch den Schliff verschwinden würden.
Cole sah sich noch ein paar der anderen Steine an, steckte dann seine Lupe wieder ein und sagte: »Weißes Papier.«
Wing zog ein reinweißes Blatt Papier aus seiner Schreibtischschublade und reichte es Cole hinüber. Dieser suchte einen kleinen Wildlederbeutel aus seiner Tasche und beförderte einen Rohdiamanten hervor, von dem er wußte, daß er reinweiß und vom ersten Wasser war.
Der Stein aus Coles Tasche war zwar ungeschliffen, aber dennoch ein perfekter Oktaeder. Er sah fast unnatürlich aus neben den abgenutzten, ungleichmäßig geformten Steinen aus Wings Beutel. Cole verteilte die Diamanten über das Papier. Einer von ihnen veränderte leicht seine Farbe, vom Rosa zum Korallenrot, die anderen vertieften ihren Ton vom Rosa zu einem wunderschönen, klaren Rosenrot. Die meisten weißen Steine bekamen ein bläuliches Leuchten, genau wie Coles Diamant, oder einen ganz leichten Stich ins Gelbliche, der nur für einen Experten zu erkennen war.
Der grüne Stein brannte sogar noch lebhafter, wie eine smaragdene Flamme vor einem Hintergrund von Schnee.
Cole betrachtete ihn wieder genau. Er glitzerte mit einem gleichzeitig heißen und kalten Leuchten. vor Jahren hatte er in Tunesien einmal einen Stein gesehen, der diesem beinahe ebenbürtig gewesen war. Der Schmuggler, dem der Rohdiamant gehörte, behauptete, der Stein käme aus Venezuela, was Cole bezweifelte. Noch bevor er damals genug Geld aufbringen konnte, um die Wahrheit zu erkaufen, hatte jemand den Schmuggler zum Schweigen gebracht, indem er ihm die Gurgel durchschnitt.
Der Tod des Schmugglers hatte Cole nicht schockiert. Auf den Diamantenfeldern und im Bereich des Juwelenschwarzmarkts waren ungewöhnliche Todesursachen häufiger. Wenn es um Diamanten ging, war das Leben eines Menschen nur noch für diesen selbst von Bedeutung, während sein Tod durchaus mehreren Leuten nutzen konnte.
Was Cole überraschte, war, daß diese Diamanten nur zwei Menschenleben gefordert hatten. Er hatte noch nie Steine gesehen, die denen auf dem weißen Papier vor ihm vergleichbar waren.
Cole steckte seinen eigenen Diamanten wieder ein und betrachtete den dunklen Samtbeutel auf dem Schreibtisch. Der Samt war schon so alt, daß die Zeit und die harten Diamanten darin ihn an manchen Stellen fast bis zur Durchsichtigkeit abgeschabt hatten.
Wie prächtig waren dagegen die Steine. Sie schimmerten wie erfüllt von Licht und Zeit und dem unstillbaren Hunger des Menschen nach seltenen Dingen.
»Was willst du von mir?« fragte Cole und sah dabei die Diamanten mit nachdenklichen grauen Augen an.
Einen Moment lang dachte Wing, Cole habe einen der Steine gefragt. Er kannte Cole seit vielen Jahren, und doch glaubte der Geschäftsmann aus Hongkong nicht, das komplexe Denken des amerikanischen Geologen und Diamantensuchers zu verstehen oder seine Reaktion voraussagen zu können.
»Sind das Diamanten?« fragte Wing leise.
»Ja.«
»Kein Irrtum möglich?«
Cole zuckte die Schultern. Durch die Bewegung leuchtete das Licht ihn anders aus. Schwarze Rohseide schimmerte in seinem sportlichen Jackett. Sein Haar besaß genau denselben Glanz und Farbton. Seine Haut war dem Wetter der verschiedensten Wildnisse dieser Welt ausgesetzt gewesen. Feine Linien lagen um seine Augen, denn er hatte oft in gleißende Wüstensonne oder das grelle Licht der Bergmannslampen gesehen. Über seiner linken Schläfe zogen sich ein paar Silberstreifen durch sein dichtes Haar. Er sah älter aus als vierunddreißig. Und er war tatsächlich reifer als die Jahre, die er schon gelebt hatte.
»Ein Irrtum ist nie ausgeschlossen«, sagte Cole, »aber wenn ein Mensch diese Steine gemacht hätte, wäre das der Ruin der gesamten Diamantminen der Welt.«
Wing lächelte.
»Wenn du dir Sorgen darüber machst, kann ich in Darwin jemanden mit einem Gerät zum Messen der Wärmeleitfähigkeit finden. Diesen Test hat noch niemand ausgetrickst – bisher.«
Diesmal zuckte Wing mit den Schultern. »Wenn du das Gerät nicht mitgebracht hast, ist dafür keine Zeit. Diese Steine müssen schon in ein paar Stunden unterwegs sein.«
»Wohin?«
»Amerika.«
»Und woher sind sie gekommen?«
»Kimberley.«
Cole schwieg. Als er wieder etwas sagte, klang seine Stimme neutral. »Die Vorkommen in Südafrika sind schon ziemlich ausgebeutet.«
»Nicht von Kimberley in Afrika«, korrigierte Wing. »Vom Kimberley-Plateau hier in Australien.«
Wing lächelte, als genieße er die Gelegenheit zu beweisen, daß er den Unterschied zwischen den beiden Kimberleys verstand. Die Verwechslung kam häufiger vor, denn normalerweise dachte bei Diamanten jeder an Afrika, auch wenn die größte Diamantenmine der Welt, die Argyle-Mine, in der abgelegenen tropischen Wüste des Bundesstaates Westaustralien lag.
Cole erwiderte das Lächeln, doch seine Lippen wirkten hart und wenig zu Humor aufgelegt. »Hat die Familie Chen auf der Grundlage dieser Steine in die Argyle-Mine investiert?«
»Ich habe nicht Argyle gesagt, nur Kimberley.«
Schweigend bedachte Cole, was damit gemeint sein könnte. Wenn diese Steine aus der Argyle-Mine kamen, dann hatte das Kartell, das weltweit den Handel mit Diamanten kontrollierte, eine wichtige Neuentdeckung gemacht und war dabei noch etwas reicher geworden. Aber wenn die Steine aus einer neuen Quelle stammten, dann gab es einen neuen Spieler im Diamantenpoker, und schon bald würde die Hölle los sein.
»Kimberley in Australien«, wiederholte Cole und sah Wing mit einem grauen Blick an, der so klar wie Gletschereis wirkte. »Dort sind diese Steine gefunden worden?«
Zum ersten Mal zögerte Wing. »Von dort habe ich sie bekommen, aber wo sie ursprünglich gefunden wurden ...« Er machte mit seinen schmalen Händen eine Geste der Unwissenheit.
»Gibt es noch mehr davon?« fragte Cole und deutete zu den Steinen hinüber.
»Ich habe nur diese bekommen«, sagte Wing vorsichtig.
Cole ging zum Fenster hinüber und blickte auf die Palmen vor dem Kasino der Regierung in Darwin, Nordaustralien, hinaus, das tausendfünfhundert Meilen vom Kimberley-Plateau entfernt lag. Das gleißende Sonnenlicht und der dunstfeuchte Himmel ließen die Timor-See wie gesponnenes Aluminium wirken.
Die Hitze spürte Cole auch durch die Doppelscheiben des Fensters. Man hörte das Summen der Klimaanlage, die den Rauch aus der Luft der Spielräume unten filterte und gleichzeitig die dampfige, schwere Hitze des tropischen Oktobers herunterkühlte. Hier Down Under, ›unten drunten, wie die Briten das für sie unter der Erdkugel liegende Australien nannten, ging gerade der Frühling zu Ende. Der Buildup hatte schon begonnen, jene Zeit, in der Tiere starben und Menschen durchdrehten.
Cole verstand, warum. Das tropische Australien im Oktober war einer der wenigen Orte der Welt, die er als unerträglich empfand. Aus irgendeinem Grund machte ihm die Hitze und die Feuchtigkeit in dem mit Eukalyptus und Akazien bewachsenen Buschland hier mehr aus als die ähnlichen Bedingungen in Venezuela oder Brasilien.
Innerhalb des Casinos von Darwin hielt jedoch die Maschinerie des Menschen die Tropen in Schach und lieferte hochtechnisiert gereinigte Luft, die weder den Geruch noch die Konsistenz irgendeines Klimas hatte. Hingen nicht die Zeichnungen der Aborigines, der australischen Ureinwohner, an der Wand, hätte der Raum überall zwischen Hongkong, London, Bombay und Johannisburg liegen können.
»Stammen diese Diamanten aus einer Mine auf dem Kimberley?« fragte Cole direkt, weil es keinen Sinn hatte, noch länger um die Sache herumzureden.
»Ich hatte gehofft, du würdest mir das sagen können.«
Coles Augen unter den schwarzen Augenbrauen verengten sich. Wing war gewöhnlich nicht ausweichend, nicht wenn er etwas wollte. Aber gewöhnlich lief Wing ja auch nicht mit einem mittleren Vermögen in ungeschliffenen Diamanten in der Tasche herum. Er und seine Familie waren zu praktisch orientiert, um sich in einem Bereich des Mineralienmarktes zu engagieren, in dem die Preise von einem gut abgesicherten Kartell bestimmt wurden. Die Chens beschränkten sich gewöhnlich darauf, Mineralien abzubauen und aufzubereiten, deren Namen nur Weltraumspezialisten oder Waffenherstellern geläufig waren.
»Ich kann dir nicht genau sagen, woher die Diamanten kommen«, meinte Cole schließlich, »aber ich kann mit Sicherheit sagen, daß sie nicht aus der Argyle-Mine stammen.«
»Das siehst du den Steinen an?« fragte Wing mißtrauisch.
Cole wartete ab.
»Wie kannst du so sicher sein?« wollte Wing wissen. »Schließlich gibt es in der Argyle-Mine rosa Diamanten.«
»Die Argyle-Mine ist ein Loch, da gibt es fast nur Industriediamanten. Sicher finden sie da auch ab und zu ein paar rosa Steine, aber diese hier sind dunkler, klarer und verdammt viel größer als alles, was die Australier je offiziell gefunden haben. Man braucht schon die Geduld eines indischen Schleifers, um aus dem Mist von Argyle Schmuck zu machen.«
Wing rollte die Diamanten mit der Fingerspitze hin und her. Das Licht brach sich in ihnen und ließ die Steine funkeln, als wären sie naß. »Willst du damit sagen, daß dies keine australischen Diamanten sind?«
»Das nicht, sie sind nur nicht aus Argyle. Verdammt, Wing, auf dem Kimberley-Plateau arbeiten siebzig verschiedene Gesellschaften. Und keine von ihnen hat bisher mehr als nur Industrieware gefunden.« Cole fügte nach einer kurzen Pause noch hinzu: »Zumindest hat ConMin bisher nichts anderes verlautbaren lassen.«
Wing grunzte. ConMin veröffentlichte stets nur das, was die Welt über Diamanten erfahren sollte. »Was sagen dir die Steine sonst noch?«
»Sie sind alluvial.«
»Erklär mir das, bitte.«
»Sie sind schon vor sehr langer Zeit durch Erosion aus ihren ursprünglichen Lagerstätten herausgewaschen worden.«
»Ist das schlecht?«
Cole schüttelte den Kopf. »Mensch, du kannst immer noch nicht Scheiße von Schiefer unterscheiden, stimmt’s?«
»Als wir noch Partner waren, bist du nie meinen Fragen ausgewichen.«
»Als wir noch Partner waren, hast du auch nie versucht, mich mit einer Handvoll unglaublicher Rohdiamanten zu ködern«, gab Cole zurück. »Diese Diamanten sind die besten aus einem vor Urzeiten schon erodierten Diamantenlager. Die Steine mit Fehlern und die kleinen Steine sind im Laufe der Zeit zerrieben worden. Die übrigen Diamanten sind in Jahrtausenden abgerundet worden, so daß ihre natürliche Kristallform nicht mehr zu erkennen ist.«
»Ist das gut?« fragte Wing zweifelnd.
»Wenn es ums Schleifen geht, ja. Steine, die gerade scharfkantig aus ihrer Lagerstätte gegraben worden sind, verlieren beim Schleifen die Hälfte ihres Gewichts. Diese alluvialen Steine werden nicht mehr als zwanzig Prozent ihres Gewichts verlieren, bis sie am Finger irgendeiner verwöhnten Dame glitzern.«
»Das heißt, diese Steine haben mindestens dreißig Prozent mehr Wert als nicht alluviale Rohdiamanten von gleichem Gewicht?«
Cole lächelte. Wing brauchte nicht viel über Diamanten zu wissen, vom Geschäft verstand er viel. Das war einer der Gründe, warum Cole seinem ehemaligen Partner traute. Er wußte, was Chen Wing motivierte: Profit.
»Wenn du noch Farbe und Größe mitberechnest«, sagte Cole, »heißt das, daß im Großhandel mindestens eine Million Dollar bei den Steinen herausspringt, so wie sie hier auf dem Tisch liegen. Geschliffen sind sie verdammt viel mehr wert.«
»Wieviel mehr?«
»Hängt davon ab, wie dringend sie jemand haben will. Die ›Schönheiten‹ –«
» ›Schönheiten‹?« unterbrach ihn Wing.
»Farbige Diamanten. Sie sind verflucht selten, und ein echtes Grün ist noch seltener. Wo auch immer die hierhergekommen sind – der Ort ist Gottes persönliches Schmuckkästchen.«
»Gibt es solche Minen?«
»In Australien? Nicht, daß ich wüßte.«
»Gibt es irgendwo sonst solche Minen?« wollte Wing wissen.
»Hast du je von Namaqualand gehört? An der afrikanischen Südwestküste, gleich südlich der Mündung des Oranje?« fragte Cole.
Wing schüttelte den Kopf.
»Vor ungefähr sechzig Jahren hat ein Geologe namens Hans Merensky dort gegraben. Er stolperte über ein paar Diamanten, die beieinander einfach oben auf dem Boden lagen, ordentlich wie Eier in einem Wachtelnest.«
Wing sagte zwar nichts, setze sich aber auf und beugte sich weiter zu Cole vor.
»Wo auch immer Merensky hinschaute, fand er weitere Diamanten«, sagte Cole. »Schon bald konnte er sie nicht mehr allein in einer Hand halten. Die meisten waren auch zu groß, um durch den Hals seiner Feldflasche zu passen. Er mußte sie in Bonbondosen aufbewahren.«
Mit einem leisen Ächzen betrachtete Wing die kleine Portion Diamanten auf seinem Schreibtisch und stellte sich vor, wie es wäre, wenn er an einen noch größeren Fund dieser Art käme.
»Ja«, sagte Cole leise, »so habe ich mich auch gefühlt, als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe. Jeder Diamantprospektor liegt nachts wach und träumt davon, wie es wäre, ein solches Schmuckkästchen zu finden.«
»Schmuckkästchen. Das meinst du also ernst?«
»Schmuckkästchen, Diamantenfalle, nenn es, wie du willst. Gemeint ist ein Ort, wo Zeit und Wasser und Schwerkraft die lästige Bergbauarbeit für dich erledigt haben. Sie haben den weicheren Felsen abgewaschen, die Überreste wegtransportiert und die Diamanten dicht beieinander liegenlassen.«
»Das verstehe ich nicht.«
Cole unterdrückte seine Ungeduld und erklärte: »Diamanten sind schwerer und viel härter als die meisten anderen Mineralien, also sammeln sie sich an Flußbiegungen, hinter Felsen oder in Baumwurzeln. Aus dem gleichen Grund verhält sich auch Gold so. Es ist schwer. Die meisten großen Diamantenfunde waren an Orten, wo man nach Gold gewaschen hat.«
»Was ist aus Merensky geworden?«
»Er hat ein halbes Dutzend Bonbondosen mit Diamanten in Größen bis zu achtzig Karat gefüllt. Allesamt Schmucksteinqualität. Dann verkaufte er seinen Claim für eine Million Pfund, was damals noch ein Vermögen war.«
»An wen?«
»Komm schon, Wing, das weißt du genausogut wie ich.«
Wing verzog das Gesicht und zischte »Scheiße«.
»Das mag deine Meinung sein, aber die Diamantenbesitzer halten viel von ConMin.«
»Glaubst du, daß das hier Kartelldiamanten sind?« fragte Wing und sah die Steine auf seinem Schreibtisch an.
»Nein.«
»So schnell? Keine Zweifel?«
»Du hättest mehr als zwei Leute verloren, wenn du versucht hättest, dem Diamantenkartell solche Steine wegzunehmen«, sagte Cole direkt.
»Und das Kartell würde Interesse daran haben?«
Cole lachte verächtlich. »Wenn diese Steine hier alle von derselben Stelle stammen und die neu ist, würde das Kartell Himmel und Erde bewegen, um sie in Besitz zu bekommen. Archimedes hat gesagt, er könne die Erde aus den Angeln heben, wenn der Hebel nur lang genug wäre. Die Mine, aus der diese Steine stammen, ist ein solcher Hebel.«
Wing grunzte. »Was kannst du mir sonst noch über diese Steine sagen, egal wie unbedeutend es dir auch vorkommen mag?«
»Nur, daß sie sich einfach nicht wie afrikanische Diamanten ›anfühlen‹. Zum Beispiel, weil die Farben nicht stimmen. Das Rosa ist zu intensiv. Keine Spur von dem gelblichen Kapweiß. Einige der weißen Steine sind Doppelkristalle, für die Australien bekannt ist. Der grüne Diamant ist für Afrika ganz unwahrscheinlich; Brasilien vielleicht. Aber dieses Grün ist sowohl kräftiger als auch feuriger als bei dem ›Dresdner Diamant, dem besten Grünen aus Brasilien.«
Cole fuhr fort: »Wenn das Häufchen hier eine repräsentative Auswahl aus dem Besitz eines Diamantenprospektors ist, bezweifle ich, daß es aus Afrika stammt. Die einzige andere Quelle, die ConMin für Diamanten hat, ist die Sowjetunion, die eigentlich nicht bekannt ist für die Produktion von Schmucksteinen, noch weniger, wenn sie blauweiß sind. Ihre Steine haben eher einen leichten Stich ins Grünliche.«
»Also könnten diese hier wirklich aus Australien gekommen sein?«
»Möglich. In Ellendale gab es grüne Schmucksteine. Natürlich nicht so groß oder so intensiv grün wie dieser hier, sonst würde die australische Regierung sicher eher Ellendale als Argyle ausbeuten.«
»Du meinst also, es ist möglich, daß diese alle aus derselben Quelle in Australien stammen?«
Ein Blick in Wings Gesicht machte Cole klar, daß er ihm nicht mehr trauen konnte. Hier ging es um mehr als Profit. Er hatte Wing schon bei anderen Gelegenheiten arbeiten sehen. Jetzt erinnerte nichts mehr an den fröhlichen Unternehmer; er wirkte entschlossen, dringlich und bis zu den perfekt manikürten Fingernägeln wie ein Raubtier.
»Wie wichtig ist dir die Sache?«
»Nicht mir. Uns. Dir und mir.«
Coles Gesichtsausdruck wurde eine Spur härter. »Uns? Wir sind keine Partner mehr. Wir haben die BlackWing-Rohstoff- Gesellschaft vor fünf Jahren an deinen Onkel verkauft.«
»Ich glaube, es wäre gut, wenn wir wieder Partner würden«, sagte Wing und griff in einer anderen Schublade nach einem Stapel Papieren. »Das hier ist ein Partnerschaftsvertrag, ganz ähnlich wie der von BlackWing.«
Cole blickte zu den Papieren hin, schien sie aber nicht nehmen zu wollen. »Ich lese zu langsam, Wing«, log er leise. »Also, übersetz mir das Kauderwelsch in Umgangssprache. Aber nicht gleich rechtsanwaltsmäßig, sonst gehe ich da zur Tür raus und nehme das nächste Flugzeug zurück nach Brasilien.«
Ohne zu zögern, legte Wing die Papiere auf den Tisch, strich mit den Fingern darüber und begann, langsam und sorgfältig zu erklären.
»Vor zehn Jahren haben wir die Firma BlackWing auf der Basis deines geologischen Wissens und meiner finanziellen Möglichkeiten gegründet. Es war eine gute und einträgliche Verbindung, weil wir beide unterschiedliche Talente einzubringen hatten.«
»Es hat auch deshalb funktioniert, weil du Geologen angestellt hast, um meine Arbeit zu überwachen und ich Buchhalter, um deine durchzusehen«, stellte Cole trocken fest.
Wing nickte. »Unsere Partnerschaft basierte auf ebensoviel Intelligenz wie Vertrauen. Die Familie Chen braucht deine Intelligenz wieder. Wir brauchen dich.«
»Wofür?«
»Wir nehmen an, daß dir ein Teil der Lagerstätte gehört, wo diese Steine gefunden worden sind.«
Eine Weile lang machte die Klimaanlage das einzige Geräusch, während Cole Wing betrachtete.
»Ich habe in meinem Leben eine Menge Diamanten-Claims gekauft, verkauft und getauscht«, sagte Cole schließlich. »Willst du andeuten, daß ich etwas derart Gutes übersehen habe?«
»Unterschreibe den Partnerschaftsvertrag und ich beantworte deine Fragen. Ansonsten sage ich kein Wort mehr.«
Wing sammelte die Rohdiamanten ein und begann sie einen nach dem anderen in den abgegriffenen Samtbeutel zurückzustecken. Cole sah zu, bis der grüne Diamant verschwunden war. Dann nahm er die Papiere und fing an zu lesen.
Kapitel 2
Der Polarstern schien über Tundra, Fluß und Berge, er bildete die glitzernde Mitte der eisigen Nacht. Mondlicht tauchte den Fluß in Silber. Das Spiel des Lichtes war so ätherisch und kalt wie Schnee. Ein Wind wie aus einer unbekannten Zukunft strich durch das lange Tal und erzählte flüsternd von uralten Gletschern und der bevorstehenden Mitternacht, die keine Morgenröte kannte.
Das war es, was Erin Shane Windsor einzufangen hoffte, die Zerbrechlichkeit und Kälte der Ewigkeit, im Mondlicht auf einen Fluß gezeichnet, dessen Oberfläche sich langsam in Eis verwandelte. Ohne die Kälte ihrer Umgebung und ihre Einsamkeit in der Weite der Landschaft Alaskas zu spüren, machte Erin ihre letzte Einstellung an der Kamera und trat vom Stativ zurück. Sie drückte den Knopf des Auslösers mit so kalten Fingern, daß sie nicht spürte, wie er sich bewegte. Die Blende öffnete und schloß sich hörbar langsam, so wie sie es eingestellt hatte. Sicherheitshalber machte sie mehrere Aufnahmen. In der Stille der Arktis klang der Fotomechanismus unnatürlich laut.
Nach der letzten Aufnahme arbeitete Erin gleich an einem neuen Motiv. Während sie zum zweiten Mal die Einstellung veränderte, fluchte sie leise, wobei sich ihr Atem in ein silbriges Eiswölkchen verwandelte. Sie war ungeduldig. Es blieb nur wenig Zeit für die Aufnahme, die sie sich vorstellte. Im Augenblick stand der Mond genau im richtigen Winkel, um drei der Flußbiegungen zu beleuchten, deren Windungen sich am Relief der Berge zu wiederholen schienen.
Aber die Welt drehte sich weiter, und der Wind schob die Wolken zu einer geschlossenen Front zusammen. Jeder Augenblick veränderte unwiederbringlich das wichtigste Element am ganzen Bild – das Licht.
Erins Uhr piepste warnend. Sie kümmerte sich nicht darum. Es war nur der erste Warnton, den sie programmiert hatte. Das machte sie oft so, denn wenn sie fotografierte, vergaß sie völlig die Wirklichkeit. Ihre Fähigkeit sich zu konzentrieren war eine zweischneidige Angelegenheit, die es ihr schwer machte, mit einer Zivilisation zurechtzukommen, wo Zeit in immer präzisere Abschnitte unterteilt wurde.
»Los jetzt, Hände, verflucht«, murmelte Erin, während ihre gefühllos kalten Finger zu langsam die Schalter der Kamera bedienten.
Die Uhr piepste noch einmal.
Während Erin das Geräusch abstellte, begann ein Teil ihres Gehirns sich widerstrebend damit abzufinden, daß es noch eine Welt außerhalb ihrer Fotografie gab und daß sie in dieser Welt rechtzeitig am Flughafen sein mußte, um ein Flugzeug zurück in die Zivilisation zu nehmen. Die Zivilisation, der sie jetzt schon seit sieben Jahren aus dem Weg ging. So wie die Ufervögel in der Tundra und die Wale, die sie von Lederbooten aus fotografiert hatte, war Erin auf dem Weg nach Süden. Doch anders als die Tiere kehrte sie zurück in eine Zeit, die in Tage, Stunden, Minuten und Sekunden eingeteilt war.
Sie drückte auf den Auslöser, spannte den Film erneut, drückte wieder ab, stellte die Kamera neu ein und hörte zu, wie die Blende sorgfältig kleine Zeitabschnitte bemaß, die über Uhren und Herzschläge hinausgingen.
Versunken, geduldig, schaudernd vor Kälte, die sie nicht spürte, arbeitete Erin, hingerissen von den schwarzsilbernen Kontrasten der Landschaft, die sie liebte, von der sie sich mit diesen Fotos verabschiedete. Die Arktis besaß etwas Mythisches, das sie auf den ersten Blick angezogen hatte, etwas, das sich in der Lebensweise der Eskimos und der Jäger äußerte, die ihr begegnet waren und unter denen sie gelebt hatte.
Sie war auf der Waljagd mit Männern in Lederbooten durch sich verändernde Rinnen im Packeis gefahren. Draußen in den zerbrechlichen Booten hatte sie erfahren, daß die einfachen Menschen ihre Beute fürchteten, liebten und verehrten. Der moderne Mensch tötete einfach nur mit hochtechnisierten Waffen, wobei er für sich selbst nichts riskierte und darum über sich und seine Beute, über Leben und Tod nichts lernte. Erin hatte auch solche Menschen gekannt, moderne Menschen. Doch sie zog die unpersönliche Frostigkeit der Arktis vor.
Ihre Uhr piepste nun häufiger, bis sie einen Dauerton erklingen ließ, der Erin an die Dringlichkeit des Telegramms erinnerte, das ihr am Morgen über Kurzwellenradio vorgelesen worden war: KOMMEN SIE SOFORT ZURÜCK STOP DRINGENDE FAMILIENSACHE STOP GENAUERE ANWEISUNGEN FOLGEN STOP JAMES ROSEN ESQ.
»Sei ruhig«, murmelte sie. »Mensch ... sei ... still!«
Sie stieß mit taubem Zeigefinger kräftig nach dem Knopf an der Uhr und brachte sie zum Schweigen. Aber sie wußte, daß es zu spät war. Ihre Konzentration war unterbrochen, weil sie James Rosen Esquire nicht so leicht beruhigen können würde wie ihre Uhr.
KOMMEN SIE SOFORT ZURÜCK STOP
Erin verdrängte die Aufforderung. Sie hatte sich seit sieben Jahren nicht um die Zivilisation gekümmert. Noch sieben Minuten mehr würden keinen Unterschied machen.
Sie hätte den Ruf auch endgültig ignoriert, wenn ihr nicht klar gewesen wäre, daß ihre Zeit in der Arktis sich ohnehin dem Ende näherte. Sie hatte noch nicht alle denkbaren Fotos gemacht, aber alle Fotos, die sie für sich brauchte. Die Umstände, die sie vor sieben Jahren in die Wildnis vertrieben hatten, waren nicht mehr dieselben. Auch sie war nicht mehr dieselbe wie damals. Die Antworten, die ihr Alaska geben konnte, paßten nicht mehr zu den Fragen, die sie sich stellte.
Jeffrey wird durchdrehen, dachte sie, und wünschte, der Gedanke wäre tröstlicher. Jeffrey Fisher, ihr Verleger in New York, hatte nicht verstanden, warum sie einen Teil ihres Lebens in der Wildnis verbrachte. Und er verstand auch die Ruhelosigkeit nicht, mit der es sie zu Orten zog, an die andere Menschen kaum je kamen. Er liebte ihre fotografische Technik und ihren künstlerischen Blick, aber versuchte ständig, sie zu ›zivilisierten‹ Themen der Fotografie zu überreden, alte griechische Statuen und moderne Ferienorte am Mittelmeer.
Zuerst hatte Erin versucht, Fisher verständlich zu machen, weshalb sie seine europäischen Projekte ablehnte. Sie hatte versucht, ihm zu erklären, daß die Zivilisation zwar einerseits die Abgründe körperlicher Entbehrungen beseitigte, dabei aber auch die psychischen Höhenflüge des Überlebens einebnete. Fisher hatte das nicht verstanden. Ihre bevorzugte Welt der arktischen Wildnis und der fernen Kulturen war ihm einfach zu weit entfernt von Manhattan und auf keine Weise faßbar.
Unglücklicherweise waren Erin sämtliche denkbaren Entschuldigungen ausgegangen, warum sie seinen europäischen Projekten, den Bauernhäusern, den Weinkellern und dem Sterlingsilber bei Kerzenlicht noch länger ausweichen sollte.
Sie hatte ihren Terminplan gründlich durchgesehen, damit niemand in der Luft hing, wenn sie für mehrere Monate oder gar ein Jahr fortging. Sie hatte alles geregelt, es war ihr nur noch nicht gelungen, so etwas wie Begeisterung für Fotos aus Europa zu entwickeln. Jede beliebige andere Gegend wäre ihr willkommener gewesen.
Sie hatte schon oft den Kontinent besucht und war jedes Mal eher bedrückt als beeindruckt zurückgekommen. Teilweise kam das daher, daß ihr ehemaliger Verlobter Europäer gewesen war oder es wenigstens behauptet hatte.
WICHTIGE FAMILIENSACHE STOP
Teilweise kam es auch daher, daß Europa für sie mit der Arbeit ihres Vaters zusammenhing, mit Diplomatie, Geheimnissen und Betrug. Jener Art von Arbeit, die diejenigen, die sie überlebten, für den Rest ihres Lebens zeichnete.
GENAUERE ANWEISUNGEN FOLGEN STOP
Anweisungen, aber keine Wahrheit. Der Mensch hatte die Zivilisation hervorgebracht, um der Wahrheit der Natur auszuweichen, und hatte die Zeitmessung erfunden, um menschliche Lügen besser verpacken zu können.
WICHTIGE FAMILIENSACHE
Bewegungslos stand Erin in der strahlenden Stille der Natur, die eine überwältigende Mißachtung gegenüber menschlichen Ideen wie Wahrheit und Lüge, Leben und Tod, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu haben schien.
KOMMEN SIE SOFORT ZURÜCK
Das Leben war nicht gerecht oder ungerecht, es war einfach nur unberechenbar. Manchmal waren die Überraschungen des Lebens von atemberaubender Schönheit, wie die Arktis. Manchmal von atemberaubender Grausamkeit wie Hans. Aber die Bausteine des Lebens waren immer die Überraschungen. Erin hatte sich entschieden zu leben.
Sie brachte zum letzten Mal das Piepsen ihrer Armbanduhr zum Schweigen und begann, ihre Ausrüstung für die lange Reise nach Los Angeles einzupacken.
Kapitel 3
»Wie lange sind die beiden Chinesen jetzt schon tot?«
Die Stimme, die selbst durch die Satellitenverbindung und den Verzerrer ihren Ton von Herablassung behielt, war Jason Street zuwider. Hugo van Luik war ein breit gebauter Holländer mit einem runden Kopf voll weißer Haare. Seine Stimme klang für australische Ohren zischend und unangenehm. Street nahm einen tiefen Schluck Bier und stellte die große, kalte Dose auf seinen Schreibtisch. Dann antwortete er: »Zwölf Stunden, vielleicht etwas länger.«
»Warum hat sich Ihr Bericht verzögert?«
»Wollen Sie, daß ich unsere Angelegenheiten über ein öffentliches Telefon herausposaune?« gab Street zurück. »Denken Sie dran, hier ist Australien, verdammt. Jeder, der einen Empfänger hat, kann bei Funktelefongesprächen mithören. Ich habe die beiden Schläger begraben und Abes Haus auseinandergenommen. Von dort rufe ich an.«
Zwanzigtausend Kilometer entfernt, im fünften Stock eines grauen Gebäudes an der Pelikanstraat, der Hauptstraße des Diamantenhandels in Antwerpen, schloß Hugo van Luik die Augen, weil ihn rasende Kopfschmerzen überfielen. Im Augenblick war er allein in seinem Büro, also erlaubte er sich den Luxus, sich gehenzulassen. Übelkeit drehte ihm den Magen um und ließ urplötzlich wieder nach. Er holte dankbar tief Atem. Van Luik war ein mächtiger Mann, sowohl was seine Statur als auch seine berufliche Position betraf, aber er mußte den Preis der Macht bezahlen. In letzter Zeit schien der immer weiter zu steigen.
»Nun gut«, sagte van Luik. »Dann will ich zusammenfassen: Das handschriftliche Testament, der Samtbeutel und die Blechdose waren fort, als Sie ankamen. Zehn Jahre Arbeit – umsonst.«
»Verdammt richtig. Sie hätten zustimmen sollen, daß ich Abe Windsor auf meine Art zum Reden bringe. Dann hätte er sein Geheimnis schnell ausgespuckt.«
»Mag sein. Aber höchstwahrscheinlich hätte ein Mann in seinem Alter die Folter nicht überlebt und das Geheimnis seinen Erben hinterlassen. Damals schienen die Risiken zu groß.«
»Jetzt nicht mehr, mein Freund. Jetzt sind sie verflucht klein.«
»Ihre Einsicht in die Vergangenheit ist bewundernswert.«
Street antwortete nicht. Er haßte den korrekten Holländer, dessen Macht hinter dem einfachen, bedeutungslosen Titel Direktor für Sonderunternehmungen der Diamantenverkaufsorganisation DSD versteckt war. Aber er haßte ihn nicht nur, er fürchtete ihn auch.
»Nun denn«, sagte van Luik. »Dann gehen wir es noch einmal von Anfang an durch.«
Das war seine beliebteste Taktik bei einem so harten Typen wie Jason Street. Wiederholung verstärkte den Eindruck der Unterlegenheit und ließ gleichzeitig kleine Unstimmigkeiten erkennen, wenn Informationen zurückgehalten oder Lügen aufgetischt wurden.
Street kannte den Trick genausogut wie van Luik. Er trank noch einen Schluck Bier und rülpste ins Telefon. »Da gibt’s wirklich nicht viel zu sagen. Abe hatte schon seit ein paar Tagen gesoffen und war voll bis oben hin. Soweit nichts Neues. Vor drei Tagen dann ist er durchgedreht, hat sich eine Schaufel gegriffen und ist ab in den Busch. Dabei hat er gebrüllt, er würde sein eigenes Grab schaufeln gehen.«
»War das ungewöhnlich?«
»Nein, verflucht noch mal. Das kam bei ihm einmal im Monat vor, wie bei Frauen die Periode. Aber diesmal hat’s gestimmt. Er muß draußen im Busch gestorben sein. Seine Leiche sah aus, als hätte man sie langsam auf dem Spieß gegrillt. Tot wie Fisch in der Dose, roch aber viel strenger.«
Van Luik spürte wieder Übelkeit aufsteigen, allerdings nicht wegen Streets Schilderung. Tod und Verwesung machten dem Holländer nicht das geringste aus. Was ihm Übelkeit bereitete, war das Gefühl der Machtlosigkeit. »Wie ist die Leiche zurück zur Station gekommen?« fragte er.
»Die Powerpoints müssen ihn gefunden haben.«
»Powerpoints?«
»Chinks, Wogs, Chinesen«, sagte Street ungeduldig. Van Luik beherrschte vier Sprachen, konnte – oder wollte – sich aber einfach nicht den australischen Slang merken, den Street zu sprechen pflegte. »Sie haben ihn herausgeholt.«
»Woher wissen Sie das? Hat Ihr Informant auf der Station es Ihnen gesagt?«
»Sarah? Die war schon längst verschwunden. Sie hatte wie immer mit Abe zusammen gesoffen und war dabei umgefallen. Als sie wieder nüchtern war und Abe immer noch nicht zurück, hat sie mich angerufen und sich dann aus dem Staub gemacht.«
»Warum?«
»Sie wußte, daß ich sie umbringen würde, wenn Abe wirklich tot war.«
»Also woher wissen Sie dann, daß die Chinesen Windsor gefunden haben?«
»Es gab keine frischen Spuren zur Station. Der Koch muß den Hubschrauber gerufen haben, als Abe nicht zurückkam. Vielleicht ist er Abe auch gefolgt und hat ihn irgendwo in der Sonne zur Rede gestellt von wegen der geheimen Minen.«
Van Luik ließ sein Schweigen um die halbe Welt gehen.
Street sprach weiter. »Der verfluchte Koch muß ein Spitzel gewesen sein, genau wie Sarah. Eine Menge Leute wußten, daß Abe ein paar schöne Steine unter dem Kopfkissen hatte. Nicht nur wir waren hinter ihm her.«
Van Luik rieb sich den Nasenrücken, um den Kopfschmerz zu lindern. »Reden Sie weiter.«
»Die Powerpoints müssen Abe draußen im Busch gefunden und zurückgebracht haben. Danach haben sie die Station durchsucht, was bedeutet, daß Abe ihnen nichts erzählt hat, bevor er gestorben ist.«
»Das will ich auch sehr hoffen. Unglücklicherweise wußten die ›Powerpoints‹ ja wohl genug, um auch die Blechdose mitzunehmen, nicht nur die Diamanten, oder?«
Jason Street nahm einen kräftigen Schluck Bier und antwortete nicht. Er hatte gehofft, van Luik würde nicht so schnell begreifen, was es bedeutete, wenn auch die Blechdose fehlte.
»Oder?« fragte van Luik noch einmal etwas schärfer.
»Ja, sie haben die verdammte Dose mitgenommen.«
»Also müssen wir davon ausgehen, daß sie mindestens so gut informiert sind wie wir. Ihnen wird klar sein, daß der Inhalt des Beutels sicher nur einen Bruchteil des Wertes besitzt, den der Inhalt der Dose bei richtiger Anwendung haben könnte.«
Die verzerrte Satellitenverbindung summte und schien nur darauf zu warten, daß Street dem Offensichtlichen zustimmte.
»Ich nehm’s an«, erwiderte der Australier widerstrebend.
Van Luik blickte über die feuchten grauen Dächer hinaus, unter denen die geschicktesten Diamantenschleifer und die rücksichtslosesten Juwelenhändler der Welt zu Hause waren. Manchmal ließ das Stechen im Kopf nach, wenn er in die Ferne sah. Manchmal mußte er es einfach ertragen.
Er schloß die Augen und ertrug, versuchte über den blendenden Schmerz hinauszudenken, der hinter seinen Augen seinen Herzschlag spürbar machte. Jason Street war vor zehn Jahren mit den besten Empfehlungen zu ConMin gekommen, als er gerade erst dreißig war. Seitdem war nichts geschehen, das bei van Luik Zweifel an seinen Fähigkeiten oder seiner Loyalität gerechtfertigt hätte.
Bis jetzt. Jetzt stimmte etwas nicht. Street log oder hielt irgendeine wichtige Information zurück. Und van Luik wußte nicht, ob er das tat, um ConMins Zorn zu entgehen, oder ob es einen anderen, weniger offensichtlichen Grund dafür gab.
»Konnten Sie irgendetwas über den Hubschrauber in Erfahrung bringen?« fragte van Luik vorsichtig.
»Ich habe jeden, der in Westaustralien oder dem nördlichen Territorium Hubschrauber vermietet, überprüft. Ohne Erfolg. Auch keine Spur von derartigen Flügen bei der Luftüberwachung. Muß eine private Maschine gewesen sein.«
»Finden Sie den Hubschrauber!« Van Luik würgte fast wegen des plötzlich mit seinem Ausruf ins Unerträgliche gewachsenen Schmerzes. Einen Augenblick lang atmete er ganz flach durch den Mund. Als er wieder sprach, war seine Stimme beherrscht und ruhig. »Wir müssen herausfinden, wer die Gedichte und die Steine hat.«
»Bin schon bei der Arbeit, Kumpel.«
Van Luik nahm den Hörer in die linke Hand und massierte sich die rechte Schläfe. Licht glitzerte am kleinen Finger seiner rechten Hand, an dem er einen fünf Karat schweren, reinweißen, lupenreinen Diamanten im Smaragd-Schliff trug. Der Stein war in Platin gefaßt. Er war der einzige Schmuck, den van Luik trug. In Antwerpen war dieser Stein wie eine Visitenkarte und machte seinen Träger sofort als Mitglied der internationalen Diamanten-Bruderschaft erkennbar.
»Sie haben natürlich eine Kopie von ›Chunder from Down Under‹, oder?« fragte van Luik.
»Sarah hat sie noch eine Woche vor Abes Tod mit dem Original verglichen. Seit ich Ihnen das letzte Mal eine Kopie geschickt habe, hat er nichts mehr geändert.«
»Ich nehme nicht an, daß sie es geschafft hat, auch das Testament abzuschreiben, oder?« Van Luiks Stimme klang ruhig und fast vorwurfsvoll. Als Street nicht antwortete, fragte der Holländer: »Konnte sie es nicht wenigstens ansehen?«
Street holte tief Luft und nahm sich vor, van Luik zu sagen, was er schon wußte: »Abe hat ›Chunder‹ immer auf seinem Nachttisch liegenlassen, aber sein Testament war sein ganz persönliches verdammtes Geheimnis, das er sogar noch sorgfältiger hütete als die Steine um seinen Hals.«
Van Luik grunzte. Er öffnete die Akte auf dem Schreibtisch vor sich und sah sich einige Fotos an. Es waren grobkörnige Vergrößerungen von den winzigen Negativen einer Minox, Seite um Seite einer spinnenfeinen, altmodischen Handschrift auf grobem, liniertem Papier. Bedeutungslose Kritzeleien oder die klug versteckten Hinweise eines Toten auf die Lage einer unbekannten Diamantenmine? Immer noch war ihm nicht klar, was in diesen »Gedichten« eigentlich stand.
»Sie haben eine Kopie bei sich«, sagte van Luik.
Das war eine Feststellung, keine Frage. Street verkniff sich eine böse Antwort und antwortete nur: »Ja.«
»Anfängen.«
»Lassen wir das doch, van Luik. Wir sind das Ding schon so oft durchgegangen, daß –«
»Anfängen«, wiederholte van Luik kalt.
Schweigen, gefolgt von leisem Papierrascheln, während Street die Streifen mit Crazy Abes seltsam penibler Handschrift durchsah.
»Spricht irgendein spezieller Vers Ihre Phantasie an?« fragte Street mit beißendem Ton. Er wußte, daß ›Chunder‹ van Luik nicht nur ärgerte, weil es ihm nicht gelang, sein Geheimnis zu entschlüsseln.
»Ich denke, wir nehmen uns diesmal die vierzehnte Strophe vor.«
»Okay.« Street fing mit ungerührter Stimme an vorzulesen. »Find es, wenn du kannst/Wenn du zu gehen wagst/wo schwarze Schwäne ziehn/über eines toten Meeres Knochen/wo Männer Percys sind und Lady Janes aus Stein.« Street wartete, nachdem er zu Ende gelesen hatte.
Van Luik ebenfalls.
Mit einem gemurmelten Fluch begann Street die Zeilen zu erklären, die er vorgelesen und schon so oft erklärt hatte, daß er sie schon gar nicht mehr recht wahrnahm. »Die erste Zeile –«
»Erklärt sich von selbst«, warf van Luik ein. »Die zweite genauso. Fangen Sie mit der dritten an.«
»Also gut. Schwarze Schwäne gibt es überall da draußen im Outback, so wie es Koalas überall an der Ostküste gegeben hat. Er könnte von einem Fund in der Nähe eines Billabong reden.«
»Erklären Sie.«
»Ein Billabong ist eine tiefe Stelle in einem Fluß, die in der Trockenzeit zu einem Wasserloch wird, wenn die flacheren Flußteile austrocknen«, sagte Street mechanisch.
»Weiter.«
Streets Hand schloß sich fester um das Telefon. Keine Eigenheit van Luiks war so beleidigend wie diejenige, jemanden immer wieder dasselbe wiederholen zu lassen. Sie war aber auch die wirkungsvollste, wenn es darum ging, Lügen zu verhindern. Street verstand das gut und hatte es schon bei eigenen Untergebenen angewandt.
»Abe könnte in der Nähe eines Billabong eine Mine gefunden haben. Nur gibt es weder auf seinen Claims noch auf seiner Station irgendwelche Wasserlöcher, die groß genug sind, um sie ein Billabong zu nennen«, sagte Street monoton. »Die einzige das ganze Jahr über verläßliche Wasserstelle ist der Brunnen bei seinem Haus.«
Van Luik machte ein undefinierbares Geräusch. Street wußte, daß es ein Zeichen für ihn war, weiterzureden.
»Also als nächstes die verdammten ›Knochen eines toten Meeres‹ « fuhr Street tonlos fort. »Da es keinen Billabong gibt, in dem die verdammten Schwäne schwimmen könnten, haut es uns auch nicht um, daß es kein Wasserloch auf einem fossilen Meeresbecken gibt, um uns den Weg zur Mine zu zeigen.«
»Weiter.«
Street lächelte dünn. Er vermutete, daß van Luik Sex unappetitlich fand. Abe war da anders gewesen. Die einzige Zeit, wo er gerade nicht in einer Frau steckte, war, wenn er zu viel Bier trank und ihn der Rausch abschlaffen ließ.
»Also Abe erklärt uns, daß wir die Mine finden, wenn wir es wagen, dorthinzugehen, ›wo Männer Percys sind/und Lady Janes aus Stein‹ «, sagte Street gedehnt. »Australier nennen ihren Schwanz ›Percy‹. Raten Sie, was eine ›Lady Jane‹ ist.«
Van Luik grunzte. Er brauchte nicht zu raten. Er hatte das alles schon oft gehört.
»Also Abe meint, wir sollen dahingehen, wo Männer Schwänze haben und Frauen Steinmösen«, sagte Street. »Willkommen im Outback. Das reduziert die Möglichkeiten für den Standort der Mine auf ein paar tausend Quadratmeilen unbewohnten Landes.«
Als van Luik etwas sagen wollte, redete Street einfach weiter.
»In der nächsten Strophe wird mit einem ›bernsteinfarbenen Fluß‹ wohl Bier gemeint sein, oder? Wenn du genug davon trinkst, ›pinkelst du ein gelbes Meer‹. Dann ist da noch –«
»Machen Sie bei der nächsten Strophe weiter« unterbrach ihn Luik.
»Okay. ›Kriechet in mein Bett und auf mein Percy,/Bridget und Ingrid, Diana und Mercy,/Kewpie und Daisy und Kelly./ Knallen und lassen sich Liebe zahlen./Herrinnen der Lüge,/ Verflucht ihre heißen Schreie.‹ « Street holte tief Luft und fuhr sarkastisch fort. » ›Percy‹ haben wir schon entschlüsselt, bleiben also die anderen Namen. Es sind keine Städte, Siedlungen, Kreuzungen, Pisten, Pfade, Stationen oder irgendetwas anderes, sondern nur australischer Slang für Möse.«
Van Luik machte ein angewidertes Geräusch.
»›Knallen‹ heißt bumsen«, fuhr Street gnadenlos fort. »Mag sein, der alte Saukerl hat Bergbau als sexuelle Angelegenheit betrachtet, vielleicht aber auch nicht. Wie auch immer steht in der Strophe absolut nichts darüber, wo wir diese verfluchten Diamanten finden sollen.«
»Gehen wir zur neunten Strophe«, sagte van Luik.
»Das können Sie ja machen. Ich hab jetzt genug.«
»Fangen Sie mit der vierten Zeile an.«
Streets Hand schloß sich so fest um den Hörer, daß sie weh tat, und er sagte sich, daß dies nicht der richtige Zeitpunkt sei, die Geduld zu verlieren. Ihm war das Geheimnis der Sleeping Dog-Minen doch durch die Lappen gegangen. Wenn das nochmalige Studium von ›Chunder‹ seine einzige Strafe bleiben sollte, wäre das sein Glück.
» ›Steinerner Schoß, der mir Hoffnung gibt,/Geheimnisse schwärzer als der Tod/Und die Wahrheit zu sagen ist Tod.‹ « Street wartete, aber van Luik sagte nichts. » ›Steinerner Schoß‹ ist eine Mine, stimmt’s? Das hatten wir doch vor – na sechs, sieben Jahren beschlossen, als er ›Frau‹ in ›Schoß‹ abgeändert hat?«
Van Luik kümmerte sich nicht um Streets Sarkasmus. »Ja. Weiter.«
»Schöße, Frauen und Minen sind dunkle Plätze, und es hätte Crazy Abes Tod bedeutet, wenn er jemandem gesagt hätte, wo seine Mine ist, das wußte er verdammt gut.«
» ›Aber zu dir werde ich sprechen,/Höre mich, Enttäuschung.‹ «
Street sagte nichts, so überrascht war er darüber, daß van Luik die Rollen getauscht und es übernommen hatte, aus dem schrägen Gedicht vorzulesen, das sie inzwischen beide haßten.
» ›Laß die Geheimnisse schlafen,/Und warte auf den Sprößling des Verrats./Solang die Känguruhs es weiter treiben,/ Oben übern Boden springen,/Liegt eine Handvoll alter Bonbondosen/ganz unten, und sie rappeln und sie klingen.‹ «
Stille lag in der Leitung, während eine ungemütliche Ahnung in Street wuchs. »Er redet von einem Erben, stimmt’s? Nicht einfach von jedem beliebigen Kerl, der zufällig ›Chunder‹ liest, sondern von seinem verfluchten Erben!«
»Ich fürchte, Sie haben recht. ›Kind der Enttäuschung‹ können wir nicht mehr länger als Kommentar zum allgemeinen Unglück der Menschheit verstehen.«
»Verdammte Scheiße«, schnarrte Street. »Was soll sein Erbe schon aus diesem bescheuerten Gefasel lesen, das wir nicht auch verstehen könnten?«
Der Schmerz zwischen van Luiks Augen wurde mit jedem Herzschlag unerträglicher. Es wäre alles so viel leichter, wenn es einen eindeutigen Hinweis auf Streets Verrat gäbe, irgendeinen spürbaren Beweis für die Unzuverlässigkeit des Mannes am anderen Ende der Leitung. Da es aber nicht so war, mußte es irgendeine unbekannte und daher völlig unberechenbare Kraft geben, die versuchte, das sensible Gleichgewicht der Diamantenverkaufsabteilung DSD von ConMin durcheinanderzubringen. Und Hugo van Luik hatte sein Leben lang daran gearbeitet, es aufrechtzuerhalten.
Van Luik stellte sich das Geschehen in Australien vor und fragte sich, ob Abe Windsor, als er im Sterben lag, sein Geheimnis doch noch dem Wüstengras erzählt hatte. Das Einzige, was van Luik hatte, war die Tatsache, daß Jason Street von einem handschriftlichen Testament erzählt worden war und er seitenweise manische Dichtung zu sehen bekommen hatte; außerdem wußte er, daß Abelard Windsor, wenn er betrunken war, von Diamanten zu reden begann, die grün wie Billabongs im Schatten von Eukalyptusbäumen waren oder rosa wie die Brustwarzen eines weißen Mädchens oder so klar und hell wie destilliertes Wasser.
Sinnloserweise wünschte van Luik, es wäre ihm schon vor Jahren möglich gewesen, Street freie Hand zu geben, seine schnellen, grausamen Fähigkeiten anzuwenden. Street hätte den alten Mann aufgeschlitzt wie einen Stör und den glitzernden Kaviar der Wahrheit aus ihm herausgeholt.
»Niemand kann beweisen, daß die Mine überhaupt existiert«, sagte van Luik leise und ohne zu wissen, daß er überhaupt sprach. »Abe war schließlich ziemlich verrückt.«
»Träumen Sie nur ruhig weiter, Kumpel«, erwiderte Street. »Es gibt die Mine. Man hat ihn Crazy Abe genannt, und sicherlich war er auch etwas verrückt, aber nicht völlig. Diamanten waren seine Kinder, seine Frauen, seine Heimat und sein Gott. Ich habe in meinem Leben eine Menge Lügen gehört und verflucht selten die Wahrheit, aber wenn Abe von Diamanten redete, benahm er sich wie ein Priester bei der Beichte. Er sprach die Wahrheit, wie verrückt sie auch geklungen haben mag. Ich habe die Steine in dem Beutel nie in der Hand gehabt, aber ich würde mein Leben darauf verwetten, daß sie echt waren.«
Schweigen; dann: »Die sechzehnte Strophe. Lesen Sie.«
Diesmal machte Street keine Einwände. Bisher hatte er nur gefürchtet, Abe Windsor würde das Geheimnis der Mine jemand anderem hinterlassen als seinem alten Freund Jason Street. Jetzt war er sich langsam sicher.
» ›Es kann dir gehören, alles./Sag Mallee root auf wiedersehen,/Sag meiner Queen guten Tag,/Geh einen Meter für jeden Tag des Betrugs./Dreh dich um – siehst du’s?/Dumme Muschi./Kannst nicht mal Scheiße im Klo finden, stimmt’s?‹ «
Van Luik wartete.
»Mallee root ist Slang für Hure«, sagte Street matt, dem an der Zeile nichts Neues zu sein schien. »Es gibt keine Karte oder Orte auf Abes Claims, die einen solchen Namen beinhalten.
Und was seine ›Queen‹ betrifft, wird wohl seine Mine seine Königin sein, stimmt’s?«
Van Luik grunzte.
»Was den Rest betrifft: Wenn man nicht weiß, wo man stehen soll und wie viele Jahre lang Abe betrogen wurde, sind die Worte sinnlos. Das gleiche gilt für: ›Nimm eine Karte von Tasmanien,/Finde den kleinen Mann im Boot. / Dann weiter, immer weiter.‹ Die Karte von Tasmanien ist Slang für Möse, und der kleine Mann im Boot ist –«
»Ja, ja, ja«, unterbrach ihn van Luik ungeduldig. »Die Tatsache, daß Abe zu seinem Erben spricht, bringt Sie nicht auf neue Gedanken?«
Street zögerte und seufzte dann. »Keine Hoffnung, mein Freund. Nicht die leiseste. Aber ich bezweifle, daß die Chinesen mehr Glück haben werden, das Gedicht zu verstehen. Sie waren wahrscheinlich auf der Suche nach Karten oder Erzproben, was immer ihnen einen Hinweis gegeben hätte. Die Station ist groß, und Abe hatte auch an anderen Stellen noch Claims.«
»Aber für irgendjemanden muß das Ganze doch einen Sinn ergeben! Vielleicht wäre Windsors Erbe in der Lage, es zu verstehen«, sagte van Luik. »Diese Möglichkeit müssen wir jetzt in Betracht ziehen.«
»Wissen Sie, wer der Erbe ist?«
»Noch nicht. Aber das dürfte nicht schwierig sein.«
»Finden Sie es heraus«, sagte Street. »Ich kümmere mich dann um ihn. Und keine Sorge, wenn der Erbe tot ist und die Minen verlassen, wird die Regierung die Claims freigeben. Ich werde sie auf mich eintragen lassen, Sie starten eine richtige Untersuchung, und schließlich werden wir die Mine finden und unter Kontrolle haben. Keine Sorge.«
»Selbst wenn man die Claims hat, ist man der Mine noch nicht näher, als Sie es jetzt sind.«
»Ich werde das verdammte Ding schon finden. Ich brauche nur Zeit und Geld für die Ausrüstung.«
Van Luik lächelte schwach. Wenn es nur so einfach wäre. War es aber nicht. Nichts im Zusammenhang mit den Sleeping Dog-Minen war einfach gewesen. Die Diamanten waren sowohl Sirenengesang als auch Todesdrohung gewesen, seit sie entdeckt worden waren.
Der Sirenengesang hatte sich als falsch herausgestellt. Aber die Drohung war vielleicht allzu wirklich.
»Wir werden Ihren Vorschlag überdenken«, sagte van Luik.
»Überdenken Sie ihn nicht zu lange. Die Sache ist sowieso schon schwierig genug.«
Ein Summen ertönte in der Leitung, und Street war klar, daß van Luik aufgelegt hatte.
Kapitel 4
Obwohl der Partnerschaftsvertrag sehr kompliziert und juristisch formuliert war, brauchte Cole Blackburn ihn nur einmal zu lesen. Er besaß ein fast fotografisches Gedächtnis, eine Eigenheit seines Gehirns, die ihm schon manchmal geholfen, öfter aber schmerzliche Erfahrungen gebracht hatte. Ihm waren zu viele Dinge zugestoßen, die er lieber vergessen hätte.
Die Vereinbarung war klar. Der Vertrag sah vor, daß Cole die Hälfte der Firma BlackWing zum Preis von einem Dollar kaufen konnte. Als Gegenleistung überschrieb er der Firma seine Rechte an allen seinen australischen Claims und Minenpatenten. BlackWing war noch vor fünf Jahren, als Cole seine Hälfte der Familie Chen verkauft hatte, zehn Millionen U.S. Dollar wert gewesen. Seitdem hatte sich der Wert der Firma mindestens verdoppelt.
Zwischen all dem juristischen Firlefanz wurden Cole also 10 Millionen Dollar gegen den Einsatz von einem Dollar plus Minen-Claims geboten, die er gar nicht besaß. Der Vertrag war schon vollständig ausgeführt, es fehlte nur noch seine eigene Unterschrift.
Es war alles klar – nur nicht der Grund für dieses Angebot. Darum hatte Cole die letzten neunzehn Minuten damit verbracht, zwischen den Zeilen des Vertrags zu lesen. Zugegeben, die Umstände um die Auflösung seiner Partnerschaft mit Wing waren ungewöhnlich gewesen. Die Chens hatten Cole 5 Millionen Dollar teilweise auch dafür bezahlt, ihm den Verlust einer Geliebten zu ersetzen, die Mitglied der Familie, Wings Schwester, war. Aber jetzt schien der Clan, dem ein beträchtlicher Anteil von Hongkong und Macao gehörte, gewillt, seinen Fehler wieder auszubügeln.
Cole war kein Jurist, aber doch clever genug, um sich darüber klarzuwerden, daß in dem Partnerschaftsvertrag keine vieldeutigen Klauseln versteckt waren, die es der Familie Chen möglich gemacht hätten, sich den Differenzbetrag von 9 999 999 Dollar zurückzuholen.
Ohne zu unterschreiben, ließ er das Dokument wieder auf den Schreibtisch fallen. »Es ist doch noch gar nicht Weihnachten.«
Wing zuckte die Schultern. »Das ist kein Geschenk. Die Geologen von BlackWing sind entweder zu ungeschickt oder zu korrupt, um zu finden, wonach wir suchen.«
»Und was ist das?«
»Diamantenminen«, sagte Wing kurz.
»Warum wollt ihr die haben? Ihr habt doch schon ein halbes Dutzend anderer Unternehmen, die zudem eine viel bessere Rendite haben als eine durchschnittliche Diamantenmine.«