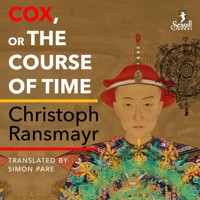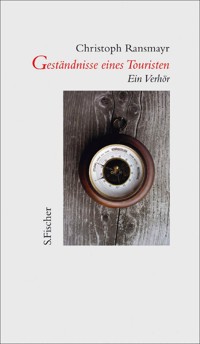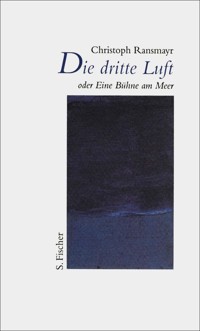9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Zwei Schriftsteller, eine Erzählung: Christoph Ransmayr und Martin Pollack führen an drei Geschichten aus Polen eine besondere Spielart des Erzählens vor: das Duett. Ein Jäger, der seinem Gott vorwirft, daß er den Wolf erschaffen hat; ein hingerichteter Held und Heiliger, der sich als unschuldiger Tor erweist, und ein Nachkomme, der die apokalyptische Geschichte seines Volkes überwinden soll: Vor dem Hintergrund der polnischen Zeitgeschichte erzählen Christoph Ransmayr und Martin Pollack gemeinsam vom Drama des Menschen. Mit dem Duett, der neuesten seiner Spielformen des Erzählens, die seit 1997 bei S. Fischer in loser Folge und eleganter Ausstattung erscheinen, stellt Christoph Ransmayr die Zweistimmigkeit in eine Reihe, in der er bereits Bildergeschichte, Festrede, Schauspiel, Monolog, Verhör und Tirade als Möglichkeiten des Erzählens vorgeführt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 62
Ähnliche
Christoph Ransmayr | Martin Pollack
Der Wolfsjäger
Drei polnische Duette
Fischer e-books
IDer Wolfsjäger
Fährtensuche in den polnischen Karpaten
Wie blutig die Herde war. Ein Dutzend Schafe drängten sich in einem abgezäunten Teil des morastigen Innenhofes so angstvoll aneinander, daß auf den ersten Blick zwischen verletzten und unversehrten Tieren nicht zu unterscheiden war. Die Bäuerin, auch ihr mit Blumen gemusterter Kittel war blutbefleckt, zerrte einen Widder aus der Mitte des Gedränges, der nach kurzem, panischem Widerstand unter den Händen der Frau in eine seltsame Apathie verfiel: Seine rechte Seite war aufgerissen, ein großes, rotes Fellstück hing als triefender Fetzen zu Boden, Brustkorb und Muskelstränge lagen bloß. An sieben weiteren Schafen waren ähnlich schwere Verletzungen zu sehen – durchbissene Gelenke, zerrissene Ohren, tiefe Fleischwunden.
Wenn Andrzej nicht mitten in der Nacht mit einer Pechfackel auf die Weide gelaufen wäre, sagte die Bäuerin, das schreckliche Schmerzgejaule des Hundes hätte den ganzen Hof aus dem Schlaf gerissen, lägen jetzt nur noch Kadaver im Gras. Die lodernde Fackel und Andrzejs Geschrei hatten die Wölfe vertrieben. Sie ließen neben den schwer verletzten drei tote Schafe zurück. Auch den Hund hatten sie umgebracht. Der lag noch draußen bei den anderen Totgebissenen unter den Bäumen. Der arme Bartek. Hunde, die Hüter einer Herde, waren oft die ersten Opfer dieser verfluchten Wölfe. Im vergangenen Herbst und Winter hatten sie allein in der Gegend von Cisna mehr als fünfzig Hunde, die ihre Herden verteidigen wollten, umgebracht.
Wölfe. Wir hatten eigentlich nur nach dem Weg nach Muczne gefragt. Eine schmale Straße mußte kurz hinter der Waldsiedlung Stuposiany dorthin abzweigen. Wölfe! Wir waren nicht hinter Raubtieren her, sondern suchten nach den Spuren von Menschen. Hier, in den Bieszczady-Bergen, einem nur noch dünn besiedelten Grenzgebiet zur Ukraine im äußersten Südosten Polens, lagen die überwucherten Reste zerstörter Dörfer und Weiler. Hohes Gras und Grauerlen verbargen aufgegebene Friedhöfe und die Fundamente niedergebrannter Kirchen. Obstgärten, Felder, Weideland waren an die Wildnis zurückgefallen und Nutzwald wieder zu Urwald geworden. In diesen vom Menschen geräumten Bergen, Ausläufern der Waldkarpaten, triumphierte nun ein artenreiches Wildleben mit Luchsen, Wildkatzen, Braunbären, Elchen, Stein- und Schreiadlern und Wisenten. Rudel von Karpatenwölfen durchstreiften das verlassene Land. Wir waren dabei, diese Menschenleere zu durchwandern, und wollten, zumindest in unserer Vorstellung, Lichtungen noch einmal schlagen, Dörfer neu errichten und Holzkirchen mit ihren bunten Ikonostasen und einem ungnädigen Gott geweihten Türmen aus der Asche wiedererstehen lassen.
In unserem Wanderführer waren alle diese Kirchen, alle diese Dörfer noch verzeichnet, allerdings mit dem Hinweis verschwunden.
Kirche in Chrewt, verschwunden.
Kirche in Stuposiany, verschwunden.
Kirche in Wołosate, verschwunden.
Die Waldsiedlungen Studenne, Sukowate, Potasznia, Szczerbanówka, Teleśnica Sanna, Tworylne, Tyskowa – alle verschwunden. Wie lang würde es dauern, bis nach den Fundamenten und aller Asche auch die alten Orts- und Flurnamen vergessen sein würden, aus den Karten gelöscht, verschwunden?
Die Bäuerin, die uns auf die Weide führen wollte, um uns dort zerrissene Kadaver zu zeigen, kannte zwar kaum einen Namen unserer Reiseziele, wußte aber, daß die Leute, die hier einmal gelebt hatten, Ukrainer gewesen waren. Lemken und Bojken, Waldarbeiter und kleine Bauern wie sie und ihr Mann, Leute aber mit fremden Liedern und eigenartigen Bräuchen, die von denen der orthodoxen Russen kaum zu unterscheiden waren.
Selbst unsere polnischen Reisehandbücher enthielten die Geschichte ihres Verschwindens: Für Lemken und Bojken, ukrainische Volksstämme, die jahrhundertelang in den Karpaten gelebt hatten, war nach dem letzten Krieg mit seinen Grenzverschiebungen, Umsiedlungen, Deportationen, erbitterten Partisanenkämpfen und der Vernichtung der Juden plötzlich kein Platz mehr in ihrer Heimat gewesen. Denn in den Beskiden und Bieszczady-Bergen hatte der Zweite Weltkrieg länger, viel länger gedauert als in den meisten Kampfgebieten Europas: Einheiten einer ukrainischen Untergrundarmee kämpften hier noch drei Jahre nach dem Sieg der Alliierten ebenso unversöhnlich wie vergeblich gegen einen übermächtigen Feind, das kommunistische Polen. Ihr Ziel, eine unabhängige Ukraine, sollte allerdings noch für Jahrzehnte Utopie bleiben. Und wie in allen militärischen Kämpfen waren auch diesmal Zivilisten die tragischen Verlierer. Als im März 1947 ein polnischer Vizeverteidigungsminister und Held des Spanischen Bürgerkrieges in einen Hinterhalt der ukrainischen Partisanen geriet und erschossen wurde, beschloß die kommunistische Führung des Landes, als Vergeltungsmaßnahme alle Angehörigen der ukrainischen Minderheit ohne Ausnahme aus ihren Bergdörfern in den Westen und Norden Polens umzusiedeln. Von dort waren soeben die deutschen Bewohner vertrieben worden.
Die Dörfer der am Partisanenkampf zumeist völlig unbeteiligten ukrainischen Bauern wurden umstellt und innerhalb weniger Stunden geräumt. Bis zum Sommer des Jahres 1947 wurden 140 000 Bewohner der südlichen Landesregionen deportiert und die verlassenen Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Der Name der exekutierenden Armeegruppe Weichsel wurde zum Decknamen der ethnischen Säuberung: Aktion Weichsel.
Wir waren auf unserem Weg nach Muczne einer alten Karte gefolgt, in der Lemken- und Bojkendörfer noch mit allen Kapellen, Mühlen, Waldbahnen und Wegkreuzen aufschienen, hatten uns dabei aber offensichtlich an einer verschwundenen Straße orientiert und waren so auf einen Feldweg und schließlich in den Morast vor jenem Gehöft geraten, das in der vergangenen Nacht von den Wölfen heimgesucht worden war.
Hatten denn die in Warschau und die in Przemyśl, fragte die Bäuerin, während sie sich am Hofbrunnen das Blut von Händen und Armen wusch, hatten denn die Behörden, hatten wir überhaupt eine Ahnung, wie es war, mit den Wölfen zu leben? Diese ständige Angst um das Vieh, die Angst um die Kinder auf ihrem stundenlangen Schulweg. Vor zwei Monaten war der beste Wachhund in der Wolfsfalle eines Wilderers verblutet, und jetzt war auch noch der zweite Hund, der beste Hüter, und mit ihm die halbe Schafherde gerissen worden. Und die Behörde glaubte dieser Plage mit ein paar läppischen Abschußgenehmigungen Herr zu werden. Um jeden Schuß mußten die Jäger betteln! Natürlich behalf sich da der eine oder andere mit verbotenen Schlageisen und Schlingen. Aber das machte die Wälder auch nicht sicherer. Fünfunddreißig zur Strecke gebrachte Wölfe im Jahr, das war zu wenig. Viel zu wenig.
Ob die Wölfe in den Bieszczady je gezählt worden wären? Wer sollte diese Bestien denn zählen? Die waren heute hier, morgen dort, die waren überall – in den Wäldern Polens wie der Ukraine und der Slowakei, die kannten keine Grenzen. Aber es mußten Hunderte sein, Aberhunderte. Gut, daß es nicht nur lahme Behörden und ahnungslose Tierschützer gab, sondern auch einen Mann wie Radek Szymczuk. Der war vor zwei Jahren in die Gegend gezogen, um Wölfe zu schießen. Seine Hütte lag unweit des alten Bukowska-Passes an der ukrainischen Grenze, aber man konnte ihm überall in den Bieszczady begegnen. Er streifte umher wie die Wölfe, immer auf ihrer Spur.
Als wir uns verabschiedeten, hörten wir einen Mann fluchen, der versuchte, einen schwer beladenen Handkarren die morastige Auffahrt zum Hof hochzuschieben. Die gerissenen Schafe waren auf dem Karren zu einem formlosen, blutgetränkten Fellbündel zusammengeworfen. Obenauf lag ein großer, schwarzbraun gefleckter Hund. Drei Kinder, von denen das größte dem Mann kaum bis zur Hüfte reichte, versuchten vergeblich, die Speichen der Karrenräder zu bewegen. Obwohl das hohe Gras auf den weitläufigen, baumlosen Bergrücken an diesem Herbstmorgen dicht bereift gewesen war und die Schlaglöcher unserer Straße dünne Eisschichten getragen hatten, waren die Kinder barfuß.
Der Bauer wollte uns die Hand nicht schütteln, er sei zu schmutzig dafür. Aber wenn wir Herrn Szymczuk begegneten, dem Wolfstöter, sollten wir ihn grüßen und ihm sagen, bei den Stasiaks gebe es Arbeit für ihn.