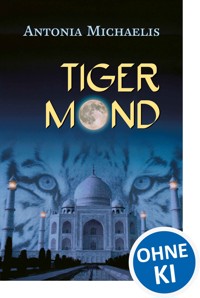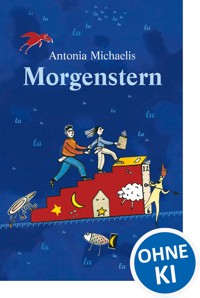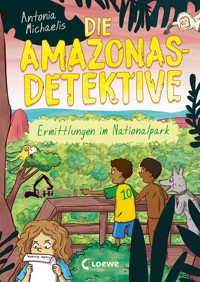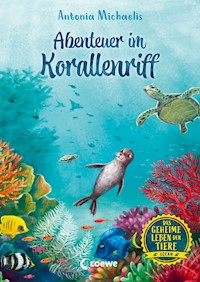6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe öffnet Akelei die Augen: Sie ist nicht mehr das junge Mädchen, dem die ganze Welt offen steht, sondern eine pummelige, mittelalte Frau im pastellgrünen Mantel. Als Finn, ihre Sandkastenliebe, als Spiegelung in der Scheibe hinter ihr auftaucht, kann sie es nicht glauben. Denn auf mysteriöse Weise verschwand er vor 18 Jahren aus Akeleis Leben. Sie erkennt ihre letzte Chance – auf Abenteuer, auf Glück, auf Liebe – und folgt Finn, ohne nachzudenken. Ohne zu wissen, wohin. So geht sie auch einen Weg zurück: in ihre Kindheit, in die Erinnerung und in die Allee der verbotenen Fragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Antonia Michaelis
Die Allee der verbotenen Fragen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ihr Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe öffnet Akelei die Augen: Sie ist nicht mehr das junge Mädchen, dem die ganze Welt offen steht, sondern eine pummelige, mittelalte Frau im pastellgrünen Mantel. Als Fin, ihre Sandkastenliebe, als Spiegelung in der Scheibe hinter ihr auftaucht, kann sie es nicht glauben: Auf mysteriöse Weise verschwand er vor 18 Jahren aus Akeleis Leben. Sie erkennt ihre letzte Chance – auf Abenteuer, auf Glück, auf Liebe – und folgt dem Jungen, der aussieht wie Fin, ohne nachzudenken. Ohne zu wissen, wohin. So geht sie auch einen Weg zurück: in ihre Kindheit, in die Erinnerung und in die Allee der verbotenen Fragen.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel: Oliven- und Zitronenblätter
2. Kapitel: Johannisduft
3. Kapitel: Brandnesseln
4. Kapitel: Grüne Wiese
5. Kapitel: Kordblumen
6. Kapitel: Holunderholz
7. Kapitel: Rotkastanien
8. Kapitel: Zitriliven und Olonen
9. Kapitel: Gummizellenbaum
10. Kapitel: Holzäpfelharmlosigkeit
11. Kapitel: Gefühlte Narzissen
12. Kapitel: Ligusterschatten
13. Kapitel: Musikveilchen
14. Kapitel: Scherbenblumen
15. Kapitel: Märchenbecher
16. Kapitel: Totgras
Nachwort
1. Kapitel: Oliven- und Zitronenblätter
Er fragte sich später, weshalb er nie hier gewesen war. Weshalb sie nie zusammen hergekommen waren. In all den Jahren. Er war fünf gewesen, als er das Dorf zuletzt gesehen hatte. Und er erinnerte sich nicht. An nichts.
Jetzt war er achtzehn.
Die Wellen waren grau. Wer hatte nur die Schaumkronen erfunden? Sonnenbeschienene, strahlend helle Schaumkronen, die sich auf den Wogen überschlugen, die Schaumkronen all jener Romane? Es gab sie ja gar nicht.
Er schlug seinen Kragen hoch und duckte sich unter dem leisen Nieselregen, der still in den Märznachmittag fiel. Das Fischerboot, das vom Bodden hereinkam, war nicht bunt angestrichen, die Möwen nicht weiß. Die Fischer in ihrer Ölkleidung dachten nicht an die Weite des Meeres und die Unendlichkeit des Himmels. Sie dachten, er sah es genau, an die nächste Zigarette.
Er schloss den obersten Knopf seiner Regenjacke und kehrte dem zu realen Meer den Rücken, schlenderte entlang der Mole zurück, die Hände tief in den Taschen vergraben.
»Dies ist der Ort meiner Kindheit«, sagte er laut. Was für eine lächerliche Formulierung. Es gab ein paar Bilder von seinen Eltern und ihm, hier am Strand und vor dem Haus, das war alles. Und der Ort seiner Kindheit war nicht dieses Dorf an der Ostsee. Die Orte seiner Kindheit lagen in England, weit von der Küste entfernt, dort, wohin sie gegangen waren, als er gerade fünf Jahre alt war. Seitdem hatten sie jedes Jahr Großelternbesuche in Deutschland gemacht, in Schwerin und Potsdam. Aber das Dorf, in dem seine Eltern bei seiner Geburt gelebt hatten, hatte er nie gesehen.
Das Dorf war – Deutschland war – nur der erste Punkt auf seiner Reise durch Europa, er hatte die Schule beendet und beschlossen, alles zu sehen, was es in Europa zu sehen gab. Berlin, Paris, Prag oder so ähnlich. Er hatte lange genug gejobbt, um sich dieses Reisejahr zu verdienen, er war achtzehn, und die Welt stand offen wie ein Tor. Aber zuerst war er hierhergekommen, in dieses Dorf, als müsste er hier den Anfang machen, weil die Welt ihren Anfang mit ihm hier gemacht hatte. Mit dem Kind, dem Menschen Johann Fin Paul Smith. Und auf eine merkwürdige Weise hatte er geglaubt, hier etwas zu finden, das er irgendwo verloren hatte. Noch wusste er nicht, was es war.
Doch er begann, es zu ahnen: die Wahrheit.
Das Dorf Wieck war winzig. Mitten hindurch führte eine Straße, auf deren Pflaster der Regen glänzte. Die Reetdächer hingen tief und dunkel wie Wolken. Winzige Fensteraugen unter herabgezogenen Strohdächern, dahinter Dunkelheit und staubige Dekorationsmöwen. Er suchte das Haus, in dem sie damals gewohnt hatten. Seine Eltern hatten ihm beschrieben, wo es stand, am Ende einer kleinen Seitengasse, und er kannte ja die Bilder: ein Haus mit Rosen im Garten hinter einem weißen Zaun. Ohne Dekorationsstaub.
Aber das Haus stand nicht mehr dort. An seiner Stelle gab es eine Gruppe schmaler, aneinandergedrängter Reihenhäuser: Ferienhäuser mit romantisch blau gestrichenen Balkonen und großen Glasfenstern. Durch die Fenster konnte man identische romantische Einrichtungen sehen. Er ging um die Ferienhäuser herum, um den romantischen Gartenzaun mit den romantischen Zierkugeln in den romantischen Beeten. Dort erhob sich der Deich, grün bewachsen mit nassem Gras wie mit Algen. An dem Pfad, der hinaufführte, wuchs eine Weide, sturmgeknickt, doch noch lebendig. Dass es Dinge gab, die im Liegen weiterwuchsen!
Hatte er dort oben als Kind gespielt? War er den Pfad vom Deich hinabgerannt?
Er hob den Kopf – und da sah er, dass oben auf dem Deich jemand stand. Eine Silhouette, beinahe schwarz vor dem grauen Himmel, eine Figur in einem dicken Wollpullover, irgendwie unförmig, aber warm. Johann dachte wieder an die Fischer. Womöglich war es einer von ihnen?
Obwohl er sein Gesicht nicht erkennen konnte, spürte er den Blick der Gestalt auf sich ruhen. Durchdringend. Er drehte sich um, um nachzusehen, ob jemand hinter ihm stand, dem dieser Blick galt, jemand, den die Person auf dem Deich kannte und dem sie etwas sagen wollte.
Da war niemand.
Als Johann sich wieder dem Deich zuwandte, war der Deich menschenleer. Er hastete den schlammigen Pfad hinauf, rutschte und stolperte beinahe, wollte dem Mann nach, der vielleicht ein Fischer war – und stand endlich oben. Auf dem unregelmäßig gepflasterten, schnurgeraden Weg ging niemand. Vielleicht war der im Pullover den Deich auf der anderen Seite wieder hinuntergegangen, über das Gras?
Aber dort kam nur noch der Schilfgürtel und dahinter das graue Meer. Warum sollte ein Fischer auf dem Deich herumstehen, einen Touristen anstarren und sich hinterher im Schilf verstecken?
Nein. Die Gestalt war nicht ins Schilf getaucht, und sie war auch nicht verschwunden.
Sie war gar nicht da gewesen.
Oder sie war da gewesen, nur nicht heute. Zu einer anderen Zeit. Damals, als er noch mit seinen Eltern hier gewohnt hatte. Was er gesehen hatte, war nicht mehr als ein Teil seiner eigenen Erinnerung. Und er begriff, dass es das war, was er verloren hatte: diese Erinnerung. Die Erinnerung an etwas, das er nie verstanden hatte. Vielleicht kam sie jetzt wieder. In Stücken.
Auf einmal fror er. Und er sehnte sich nach dem Chaos zu Hause, nach den Zeitungsstapeln seines Vaters, nach dem ungenießbaren Kuchen seiner Mutter, nach Bens Vorliebe dafür, angebissene Erdnussbutterbrote auf dem Fensterbrett über der Heizung liegen zu lassen. Nach Katies stundenlangen Sitzungen vor dem Badezimmerspiegel. Er lächelte. Ben und Katie, die unausstehlichsten kleinen Geschwister der Welt.
Er dachte auch an Jack und Martin, mit denen er die ganze Schulzeit über alles geteilt hatte, die nicht gemachten Hausaufgaben, die doch noch bestandenen Prüfungen, Glück und Unglück. Aber sie hatten nicht mit nach Europa kommen wollen, sie hatten andere Pläne gehabt. Erzähl uns alles, wenn du wieder da bist!
Auf einmal – auf einmal war er sehr allein.
Es gab nur eine Handvoll Sehenswürdigkeiten im Dorf. Da waren der Fluss, der hier in die Bucht mündete, die hölzerne Klappbrücke, die wenigen Schiffe im Hafen. Er sah sich ein paarmal um, doch die Figur im Pullover tauchte nicht wieder auf. Am Ende lenkte er seine Schritte zu der winzigen alten Kirche. Nach der Kirche würde Johann am Fluss entlang zurück nach Greifswald wandern, wo er aus dem Zug gestiegen war, und sich in der Jugendherberge unter eine warme Dusche stellen. Irgendwo in der Stadt eine Kneipe finden. Zu Hause anrufen. Beinahe erwog er, die Besichtigung der Kirche und des Friedhofs einfach zu lassen. Wen interessierte eine alte Kirche? Sicher hatte sie in seinem Leben als Fünfjähriger keine Rolle gespielt. Aber dann trat er doch durch das Tor.
Der Friedhof lag verlassen, wie zu erwarten an einem verregneten Dienstagnachmittag im März. Hohe dicke Buchen streckten ihre Wurzeln zwischen den Gräbern aus. Die Kirche war aus Backstein und verschlossen. Für diejenigen, denen der Regen nicht ausreichte, gab es eine Ansammlung hellgrüner Gießkannen neben einem Wasserhahn, dessen Rohr kahl aus der Erde ragte.
In einem plötzlichen Anfall von Albernheit füllte Johann eine der Gießkannen und goss ein Grab, auf dem nichts als Gras wuchs. Die Kanne in der Hand, wanderte er zwischen den Gräbern entlang und murmelte Jahreszahlen vor sich hin: »1848, 1849, 1942 …« Die Gräber auf diesem kleinen Friedhof waren alt, noch nicht Opfer der modernen Manie, die Toten nach ein paar Jahren wieder auszugraben, um Platz für neue Tote zu schaffen. Wenn man bedachte, wie viel mehr Tote es auf der Welt gab als Lebende! Tausende, Millionen, Milliarden – ein beunruhigender Gedanke. Man könnte eine ganz neue Bevölkerungspyramide erstellen, eine erdrückende Pyramide von Geschichten, von Geschichte, und wie vernichtend gering wäre der Teil der Lebenden an der wackeligen Spitze der Pyramide. Wenn die Toten Wahlrecht hätten, hätten die Lebenden nichts mehr zu sagen. Aber wen würden die Toten wählen?
»1899, 1943, 1945, 1905«, las Johann halblaut, seine Lippen nass vom Regen. »1907, 1990.«
Er blieb stehen. 1990. Hier war jemand im gleichen Jahr geboren worden wie er. Er beugte sich vor, um das Moos von dem schlichten, rechteckigen Grabstein zu kratzen.
1990–1990. Darunter: Gottes Wille ist dem Menschen unergründlich.
Ein Kind. Woran mochte es gestorben sein? Johann beseitigte weiteres Moos, und eine Zeile über den Jahreszahlen wurde sichtbar: 3.4. und 3.4. Nicht einmal einen Tag alt. Er schluckte. Der 3. April, das war sein Geburtstag. Vielleicht hatten seine Eltern die Eltern dieses toten Kindes gekannt, vielleicht hatte seine Mutter zusammen mit der Mutter dieses Kindes im Kreißsaal gelegen. Er lebte und der andere – die andere? – nicht. Da war noch eine Schriftzeile, kaum zu erahnen, bedeckt von Efeu. Mit regenklammen Fingern löste Johann die Ranken und las.
Johann Fin Paul.
Er schloss die Augen, hob das Gesicht zum nassen Himmel und atmete tief durch.
»Johann Fin Paul«, flüsterte er. »Das … das bin ich. Verrückt. Das … das muss ein Irrtum sein. Eine Verwechslung. Oder es ist jemand anderer, der genau so heißt wie ich und am selben Tag geboren ist. Und dessen Nachname nicht auf dem Grabstein steht.«
Aber er wusste mit nagender Gewissheit, dass es nicht so war. Dass er gekommen war, um dieses Grab zu finden.
Er war tot? Dafür fühlte er sich erstaunlich lebendig.
Jemand räusperte sich hinter ihm, und Johann öffnete die Augen. Sein Herz jagte sich selbst – ohne eine Chance, sich zu entkommen. Doch hinter ihm stand kein Sensenmann aus einem Cartoon. Kein Untoter. Kein Geist. Nur ein Mann in einer roten Regenjacke und Jeans. Der Regen hatte sich in feinen Tropfen in seinem grauen Haar gefangen.
»Kann ich dir helfen?«, fragte der Mann.
Johann sah sich um. »Mir? Meinen Sie mich?«
»Ist denn sonst noch jemand hier?«
Johann sah sich um. »Ich bin mir nicht sicher«, antwortete er leise. Seine Augen suchten wieder die Figur im dicken Pullover, die er auf dem Deich gesehen hatte. Er fand sie nicht, aber das hieß nicht, dass sie nicht da war. Vielleicht war sie zwischen den Zeilen, hinter den Dingen. Irgendwo.
Der Mann trat jetzt einen Schritt näher und betrachtete den freigekratzten Grabstein.
»Sehr schön«, sagte er. »Du scheinst einen Sinn für Ordnung zu haben. Vielleicht sollte ich dich anstellen, als Grabpfleger … Verzeih, ich muss mich vorstellen. Ich bin der Pastor hier.«
»Ach«, sagte Johann. »Ich … äh … kratze gewöhnlich keine Grabsteine frei. Es ist nur, auf diesem hier … steht mein Name. Johann Fin Paul. Das bin ich. Aber ich bin nicht tot. Ich verstehe nicht …«
»Vielleicht«, sagte der Pastor, »habe ich etwas für dich. Wenn das dein Name ist.«
»Für mich?« Johann folgte den Schritten des Pastors, Gummistiefelschritten. Er merkte, dass er noch immer die grüne Gießkanne in der Hand hielt. Und dass etwas in ihm einen kleinen Sprung machte, wie das Herz eines Kindes, das bei der Suche nach einem geburtstäglich versteckten Piratenschatz die erste Ecke der Schatzkiste entdeckte. Auch wenn er ein wenig Angst hatte, die Neugier war größer. »Wieso? Was haben Sie für mich?«
»Etwas«, antwortete der Pfarrer, »das ich gefunden habe. In der Erde, als ich die Blumen auf dem Grab erneuert habe. Ich bin nicht schlau daraus geworden, aber das hier ist ja auch nicht mein Grabstein, sondern deiner. Vielleicht wirst du schlau daraus. Komm mit!«
Es geschah vor dem Schaufenster von Haushalts- und Dekorationsartikel Schmidt, an einem Montag, an einer Ecke des Greifswalder Marktplatzes. Akelei hätte nicht damit gerechnet. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass überhaupt etwas geschehen würde. Es geschah selten etwas in ihrem Leben. Sie stand vor dem Schaufenster und überlegte, ob sie die Tischdecke mit dem eingewebten grünen Karo kaufen sollte. Sie würde die Decke draußen auf den Gartentisch legen und eine Vase mit Tulpen daraufstellen … Nein, es war noch zu kalt für den Gartentisch. Es war erst März.
Da waren noch diese Übertöpfe, poröser Ton, rustikal, mit einem kleinen Muster aus Olivenblättern am oberen Rand. Es gab sie auch mit Zitronenästen. Sie könnte, dachte Akelei, mehrere Übertöpfe kaufen, in jeden ein paar Narzissen pflanzen und sie an passenden Stellen im Haus verteilen. Als wäre der Frühling schon da.
»Boook«, sagte es aus der Plastiktragetasche an ihrem Arm.
»Sei ruhig!«, befahl Akelei.
In der Plastiktragetasche saß ein Huhn. Ein großes, weißes Huhn. Akelei dachte nicht gern daran. Es war ein quengeliges Huhn; es hatte auf dem ganzen Weg gequengelt, und außerdem war es schwer. Sie stellte das Huhn neben sich ab. Würde Hermann die Olivenblätter oder die Zitronenäste vorziehen? Wahrscheinlich, dachte sie mit einem kleinen Seufzer, waren Hermann Übertöpfe egal. Wahrscheinlich würde er sie nicht einmal bemerken. Wahrscheinlich hielt er es für selbstverständlich, dass es in seinem Haus schön war. Dass im Sommer frische Schnittblumen in den Vasen standen und im Winter geschmückte Fichtenzweige. Dass die Wäsche, gebügelt und gestärkt, in akkuraten Stapeln im Schrank lag. Dass der Boden glänzte und das Haus duftete. Akelei war mit der Luft sehr sorgfältig. Sie hätte jedes Molekül einzeln gebügelt und gestärkt und eventuell auch frische Schnittblumen hineingestellt. Aber sie war sich nicht sicher über die genaue Beschaffenheit der Luftmoleküle und darüber, ob sie beispielsweise hohl …
»Book?«, fragte es aus der Tragetasche. Ein weißer Kopf streckte sich neugierig an den Henkeln vorbei. Interessierte sich das Huhn für Haushalts- und Dekorationsartikel?
»Bleib, wo du bist!«, sagte Akelei und bemerkte einen ängstlichen Unterton in ihrer Stimme. »Sonst schließe ich den Reißverschluss ganz.«
Diese Sache mit den Hühnern war ärgerlich. Es waren Hermanns Hühner. Jeden Monat eines. Akelei kaufte sie bei dem Bauern in der Anklamer Straße, wo man auch Milch holen konnte. Es waren sehr ökologische Hühner und sehr ökologische Milch, doch darum ging es nicht.
Hermann schlachtete gerne selbst.
Hühner zu schlachten war vermutlich das Gegenteil seiner Arbeit im Büro, etwas irgendwie Urtümliches, Erdverbundenes, Archaisches. Oder vielleicht stellte er sich vor, die Hühner wären die Leute, die im Büro in der Hierarchie über ihm saßen und ihm das Leben schwer machten?
»Das Fleisch hat einen ganz anderen Geschmack«, hatte er ihr erklärt. »Du verstehst das nicht. Wenn man nicht damit aufgewachsen ist, versteht man das nicht.«
Akelei wollte es gar nicht verstehen. Sie lieferte die Hühner ab und tat etwas in einer entfernten Ecke des Hauses, wenn er mit dem jeweiligen Huhn in den Garten ging. Bisweilen fragte sie sich, ob man eigentlich zu Hause Hühner schlachten durfte. Hermanns Eltern hatten Hühner in ihrer Laube gehalten. Er hatte Akelei gezeigt, wie sie die Hühner rupfen und ausnehmen musste, ehe sie sie briet. Ihr wurde jedes Mal schlecht dabei. Herrmann hatte natürlich recht – den Hühnern war es egal, wer sie schlachtete und ob sie hinterher in einem Supermarkt herumlagen, ehe man sie aß. Dennoch zog Akelei eingeschweißte Hühner uneingeschweißten Hühnern vor. Man konnte sich vorstellen, die eingeschweißten Hühner hätten gar nicht sterben müssen, weil sie nie gelebt hatten. Sie waren einfach als Schenkel und Keulen irgendwo aus einer Art Hühnerfleisch-Urmasse produziert worden, blutlos und reinlich.
»Boo-hook?«, erkundigte sich das Huhn und blitzte sie unternehmungslustig aus seinen kleinen Augen an.
»Vergiss es!«, sagte Akelei. »Heute passiert nichts Aufregendes mehr. Du wirst lediglich geschlachtet.«
Das Huhn schien nicht überzeugt. »Bo-hoo-o«, machte es.
Eindeutig: Es widersprach. Stures Tier. Akelei beschloss, es zu ignorieren, und studierte die Schnörkelschrift, die aufs Schaufenster geklebt war. Haushalts- und Dekorationsartikel Schmidt. Es klang so sauber, so perfekt, so absolut richtig. Mindestens so gut wie »eingeschweißt«. Hermann hätte nie begriffen, was sie an solchen Worten fand. Worte waren für Hermann unwichtig. Er kümmerte sich um wichtige Dinge wie das Geldverdienen. Auch das Wort »Akelei« war für ihn unwichtig. Störend beinahe. Er nannte sie Elena. Dabei hieß sie wirklich Akelei. Wie die Blume. Elena war ihr zweiter Name.
»Elena hört sich vernünftiger an«, hatte Hermann gesagt, gleich damals, als sie sich kennengelernt hatten. Es stimmte. Akelei hörte sich nicht vernünftig an. Akelei klang nach dem Frühlingsduft, den Haushalts-und-Dekorationsartikel-Schmidt versprach – nach Pastellgrün und Schwerelosigkeit. Akelei betrachtete ihr Spiegelbild in der Scheibe. Sie trug einen pastellgrünen Mantel, doch sie war alles andere als schwerelos. Mit der Zeit hatte sie um die Mitte herum ein wenig Masse angesetzt, gerade so viel, dass man nicht mehr sagen konnte, sie wäre schlank. Womöglich sollte sie nicht diese halblangen Röcke tragen. Die unteren Stücke ihrer Beine ragten darunter hervor wie Schirmständer. Sie würde eine Frauenzeitschrift kaufen und die Frühlingsdiät darin ausprobieren. Sie probierte jedes Frühjahr zwei oder drei solcher Diäten aus, doch das Einzige, was sie dabei verlor, war die Lust, noch mehr Fotos von charmanten, spargeldünnen, modern frisierten Hausfrauen zu sehen, die ihren glücklichen Familien Spargel servierten. Die Hausfrauen in den Zeitschriften hatten immer zwei oder drei gut gekämmte Kinder, die alle ausnahmslos gerne Spargel aßen. Die Kinder regten Akelei am meisten auf. Manchmal riss sie sie aus den Hochglanzfotos heraus und zerknüllte sie.
Hermann und sie waren seit siebzehn Jahren verheiratet. Kinderlos verheiratet. Hätten sie Kinder gehabt, wäre sie dann schlank geblieben? Hätte Hermann sie dann liebevoll »Akelei« genannt? »allerliebste Akelei«, so wie damals ihre Eltern? Hätte er die Schnittblumen bemerkt?
Wenn sie Kinder gehabt hätte, dachte Akelei, wäre es ihr vermutlich egal gewesen, ob er die Schnittblumen bemerkte. Vermutlich wären ihr sogar die Schnittblumen egal gewesen. Vermutlich der ganze Hermann. Seit beinahe achtzehn Jahren versuchte sie, die Abwesenheit von Kindern durch verstärkte Anwesenheit von Perfektionismus in ihrer Haushaltsführung zu kompensieren. Denn es war ihre Schuld, dass sie keine Kinder hatten. Sie wusste es genau, auch wenn Hermann es vielleicht nicht wusste. Es lag daran, dass sie ihn nicht liebte. Sie mochte ihn nicht mal besonders. Er war in Ordnung, er war höflich und freundlich und meistens im Büro. Und wenn er eines Tages einfach dort geblieben wäre, hätte es sie nicht weiter gestört. Aber das waren gut verborgene Ideen, die sie nur entdeckte, wenn sie in den allerhintersten Ecken ihres Hirns Staub wischte.
Natürlich war Akelei nicht so dumm, dass sie wirklich daran glaubte, die Liebe habe etwas mit dem Kinderkriegen zu tun. Die Frauenzeitschriften erklärten ihr in regelmäßigen Abständen, dass man für einen Orgasmus keine Liebe und zum Schwangerwerden keinen Orgasmus brauchte. Und dennoch … weil … mit Hermann … also: nie. Kein einziges Mal in fast achtzehn Jahren. Sie hatte natürlich mit niemandem je darüber gesprochen, ihre Erziehung erlaubte das Wort Orgasmus nicht einmal. Tief in ihrem Herzen oder in einem anderen Organ war Akelei Elena Schulze dennoch fest davon überzeugt, dass es trotz allem und nur in ihrem Fall einen Zusammenhang gab. Wenn sie es schaffen könnte, Hermann zu lieben, würde sie plötzlich wundervollen, atemberaubenden, filmreifen Sex mit ihm haben, und dann würde sie schwanger werden. Akelei schüttelte den Kopf. Irgendwann war es zu spät, und dann war die Sache eh gegessen.
Das Spiegelbild mit den Schirmständerbeinen, das ihr aus dem Schaufenster entgegenblickte, war Mitte vierzig. Sie sagte dem Spiegelbild nicht, dass es unrecht hatte. Wozu auch.
Das Huhn zupfte jetzt an ihrem Rocksaum, als wollte es Akelei etwas mitteilen. Etwas Dringendes.
»Hör auf damit!«, zischte sie und nahm ihm den Rocksaum weg. Dann richtete sie sich auf, um wieder ins Schaufenster zu sehen. Und da – da geschah es.
In der Scheibe tauchte ein anderes Spiegelbild auf, hinter ihrem. Jemand ging dort vorbei. Und blieb jetzt stehen.
Es waren die ganze Zeit Leute vorbeigegangen; der Greifswalder Marktplatz wimmelte auch im März von Touristen, Studenten und einem gelegentlichen Anwohner. Bisher hatte Akelei die Spiegelschemen der Passanten nicht beachtet. Doch dieses eine Spiegelbild – es konnte nicht da sein. Akelei blinzelte. Das Spiegelbild blieb, wo es war. Es gehörte einem Jungen mit schwarzem, wirrem Haar. Darunter strahlten über einer zugegebenermaßen hakigen Nase zwei sehr grüne Augen. Beinahe türkis. Oder bildete sie sich das ein? Kann man in einem Schaufenster sehen, ob Augen beinahe türkis sind? Der Junge war vielleicht achtzehn oder neunzehn, er trug Jeans, Springerstiefel und eine speckige, dunkelbraune Lederjacke. Und einen kleinen Koffer. Er sah sich um, unternehmungslustig, aber ein wenig unschlüssig, vielleicht, weil er nicht wusste, was er zuerst unternehmen sollte. Akelei fühlte, wie sich ihr Herz in einen Übertopf mit Olivenmuster verwandelte vor Schreck. Wenn er sie sah … was, wenn er sie sah?
Er sah sie nicht. Er schien einen Entschluss gefasst zu haben und ging weiter. Jung. Beschwingt. Aufrecht und irgendwie furchtlos. Da endlich drehte sie sich um und blickte ihm nach.
»Das ist unmöglich«, sagte sie. »Das ist … Wahnsinn! Das geht nicht.«
Sie kannte den Jungen mit den schwarzen Haaren. Als sie ihn zuletzt gesehen hatte, hatte er dieselbe alte Lederjacke getragen. Dieselbe. Da war eine gewisse Stelle, wo sich der Kragen gelöst hatte. Er hatte in der gleichen Straße gewohnt wie sie, und sie hatte jede Stelle an seinem Kragen gekannt, obwohl sie kaum je mit ihm gesprochen hatte. Sie war fürchterlich in ihn verliebt gewesen. Damals. Mit achtzehn. Akelei hatte am Gartenzaun gestanden, in einer blassrosa Bluse, stumm, beobachtend. Er hatte ein Moped besessen und Freunde, die die Erwachsenen nicht gerne in der Straße sahen. Und dann war er verschwunden, eines Tages, unerklärlich und spurlos. Niemand hatte gewusst, wohin.
Und jetzt – jetzt war er wieder da, unverändert achtzehn Jahre alt. Und Akelei war, so stellte sie in einer Mischung aus Aufregung und Erschrecken fest, unverändert verliebt. Nur sie selbst, sie war gealtert, so wie es sich gehörte, denn sie tat immer alles, was sich gehörte.
Sie wandte sich wieder der Schaufensterscheibe zu, und auf einmal sah sie die Wahrheit darin. Sie sah eine mittelalte, pummelige, langweilige Hausfrau.
So also war das. In einem Moment war man ein junges Mädchen, die ganze Welt stand einem offen, alle Möglichkeiten, alle Abenteuer; fremde Kontinente warteten auf einen, waghalsige Liebesgeschichten, Karrieren und Universitäten, Schiffspassagen ins Unbekannte. Im nächsten stand man in einem pastellgrünen Mantel vor einem Schaufenster, neben sich eine Tragetasche mit einem Huhn, und das Wichtigste im Leben schienen Blumenübertöpfe.
War es zu spät? War die wahre, lebendige Akelei längst unter Bergen von gestärkter Wäsche und Hühnerfedern und Hermanns lauwarmem Körper erstickt?
»Jetzt«, wisperte Akelei. »Jetzt ist die letzte Chance.«
Sie lauschte ihren Worten nach, die in der Luft zergingen wie Rauch. Wie Zeit. Wie Leben. Dann hob sie die Tasche mit dem Huhn auf und ging dem Jungen nach, der nicht sein konnte, wer er war. Der zurückgekehrt war. Und ihr kam ein absurder Gedanke: War er am Ende nur zurückgekehrt, um ihr die Augen zu öffnen? Sie zu retten? Ein Messias mit schwarz gefärbtem, wirrem Haar und einer abgewetzten Lederjacke? Sie folgte ihm in gebührendem Abstand. Er brauchte sie nicht zu sehen. Noch nicht. Sie würde sich als Schatten an seine Fersen heften, ein pastellfarbener, pummeliger Schatten mit einer großen, geblümten Plastiktragetasche.
»Ho-boook«, sagte das Huhn. Es klang sehr zufrieden – als hätte es genau das erreicht, was es wollte.
2. Kapitel: Johannisduft
Einen Moment lang stand Johann nachdenklich am Greifswalder Hafen und drehte den Umschlag in der Hand. Es war ein leerer Umschlag. Vor ein paar Stunden hatte er nichts bei sich gehabt als seinen Rucksack mit ein paar Kleidern und sein Handy. Jetzt besaß er einen vollen Koffer und einen leeren Umschlag. Aber weder das eine noch das andere ergaben einen Sinn. Sein Kopf schien sich zu drehen. Hinten auf dem Umschlag stand: Absender: Fin Paul. Alter Kornspeicher am Hafen. Die Tinte war verblasst, kaum noch lesbar. Die Vorderseite des Umschlags war leer. Es gab keine Adresse. Er stammte also von Fin Paul. Von Johann Fin Paul Smith? Ihm selbst? Die ganze Sache war zu absurd.
Johann hatte den Pfarrer angesehen.
»Ich werde hingehen«, hatte er gesagt.
»Tu das«, hatte der Pfarrer gesagt. »Es ist nicht schwer zu finden. Der alte Kornspeicher ist das höchste Gebäude am Stadthafen. Du kannst ihn nicht verfehlen. Aber …«
»Ja?«
»Es wohnt niemand mehr darin. Es … es hat nie jemand darin gewohnt. Zumindest nicht …«, er schien zu zögern, »… offiziell.«
Johann war nicht gleich hergekommen. Die ganze Sache war zu neu, zu aufregend, um sofort damit anzufangen. Es war – und er dachte wieder an Geburtstage mit Piratenschatzsuche – wie ein Geheimnis, das man noch ein wenig aufbewahren wollte, ehe man es herausfand. Er hatte zuerst seinen Rucksack zur Jugendherberge gebracht, war dann durch die Stadt geschlendert und hatte versucht, sich auszumalen, was er finden würde. Einen verschollenen Zwillingsbruder? Quatsch, Zwillinge hatten keine gleichen Namen, sie sahen lediglich gleich aus. Aber was dann?
Er musste der Spur folgen, die man für ihn ausgelegt hatte. Diese Spur begann am alten Kornspeicher, und nun war er also hier. Heute Abend würde er seine Eltern anrufen und seine Geschwister und ihnen die ganze Sache erzählen. Ratet, würde er sagen, was ich erlebt habe. Ben und Katie hatten ihn immer angebettelt, ihnen Abenteuergeschichten zu erzählen, als sie alle noch jünger gewesen waren, er, der Älteste, war für die Geschichten zuständig gewesen. Nun, da sie zu groß dafür waren, hatte er vielleicht bald eine wirkliche gute Geschichte für sie. Oder alles war Unsinn. Dann würden sie heute Abend am Telefon zusammen darüber lachen.
Johann zog die abgewetzte Lederjacke an, die ganz oben im Koffer gelegen hatte, und steckte den Umschlag in die Tasche. Er wusste selbst nicht recht, warum er die Jacke angezogen hatte, aber es fühlte sich richtig an. Sie passte. Er ging darin langsam am Wasser entlang. Der Hafen war kein richtiger Hafen, mehr eine Ansammlung von alten Schiffen, die im Fluss lagen wie Schiffe auf Gemälden. Neben dem Kiesweg verkündeten Tafeln stolz, wie alt jedes Schiff war und was es in seinem Leben schon gesehen und getan hatte. Vielleicht, dachte Johann, hatten die Schiffe auch den Verfasser des verschwundenen Briefes hier vorübergehen sehen, vielleicht hatte er den Koffer geschlenkert, so wie er selbst jetzt. Vielleicht hatte er den stummen Schiffen seine Geschichte erzählt. Johann umrundete einen Backsteinturm, der mit großen Reklameplakaten für das örtliche Theater behängt war, ging an einem irgendwie deplaziert wirkenden Chinarestaurant vorüber – und stand vor dem alten Kornspeicher. Der Pfarrer hatte recht gehabt, man konnte ihn nicht verfehlen. Johann legte den Kopf in den Nacken und sah an dem Gebäude empor. Es bestand ebenfalls ganz aus Backstein, durchdrungen von altem, wurmstichigem Fachwerk, und ragte ein Dutzend Stockwerke weit in die Höhe. Doch die Augenhöhlen seiner Fenster waren tot und schwarz, Schwalben flogen durch die Öffnungen ein und aus.
Eine Möwe strich kreischend vorüber.
Ganz oben, unter dem spitzen Giebel, prangte das Stadtwappen, der Greif, aber er schien ins Ungreifbare, Unbegreifliche entrückt in seiner schwindelnden Höhe, und auch er sah traurig und verlassen aus. Johann packte den Koffer fester und kletterte über Bretterstapel und lose Steine ins Innere des Speichers, wo spärliches Frühjahrsgras Berge von Schutt und Müll überwucherte. Es gab keine intakten Treppen mehr, die in die Höhe führten. Ganz hinten lehnte eine Leiter. Er kletterte hinauf bis zum ersten Stockwerk. Hier oben war es kälter als unten; der Wind strich nervös durch die glaslosen Fenster, und irgendwo knatterte eine Plane. Unten, vor dem Speicher, unterhielten sich zwei Leute, aber ihre Worte waren unverständlich und weit fort. An einigen Stellen hatte jemand den halbherzigen Versuch gemacht, das Gebäude durch Eisenträger zu stützen, doch entweder fehlte der Stadt das Geld oder der Elan, es endgültig zu restaurieren. Johann ging vorsichtig, Schritt für Schritt, zu den Fenstern an der Flussseite hinüber, unsicher, ob der Boden noch überall hielt – und erschrak. Dort, in einer dunklen Ecke jenseits des letzten Fensters, kauerte jemand. Er blieb stehen, sein Puls rasend.
Verdammt, er war dumm gewesen zu glauben, dies wäre nur ein harmloses Spiel. Naiv. Zu naiv für seine achtzehn Jahre, auf einmal war ihm das völlig klar. Es war besser, umzukehren.
»Hallo?«, fragte er leise, bereit zu fliehen. Dann, noch einmal, etwas lauter: »Hallo?«
Und dann hatten seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt, und er sah, dass es kein Mensch war, der in der Ecke kauerte. Es war nur ein alter, kaputter Sessel.
Johann atmete auf und trat ans Fenster. Unten auf dem Kiesweg ging ein weißes Huhn spazieren. Es spazierte ein wenig näher an den Speicher heran, ins Holundergebüsch, aus seinem Blickfeld. Johann schüttelte den Kopf. Auf dem blauen Wasser des Flusses spielte jetzt ein Streifen Sonnenlicht, und in der Ferne, jenseits des Flusses, brummte hinter neuen, bunten Holzhäusern eine Straße. Es war, als läge dort draußen eine andere Welt, in der sich die Zeiger der Uhren drehten, in der jede Minute eine Minute verstrich, in der die Leute bunte Häuser bauten und antike Schiffe renovierten und an alten Türmen Reklameplakate für örtliche Theater aufhängten.
»Aber hier, hier hat sich nichts verändert«, flüsterte Johann. »Hier ist alles genau wie damals. Als er hier war.« Aber wer war er gewesen? Wer hatte den Umschlag in einen Koffer gelegt und diesen Koffer vergraben?
Johann ging zu dem Sessel hinüber und ließ sich hineinfallen. Die alten Federn quietschten, und als er sich auf eine der Armlehnen stützte, quoll ein wenig Füllmaterial heraus. Der Sessel, dachte Johann, bedeutete etwas: dass jemand ihn irgendwann die Leiter heraufgeschleppt hatte, um darin zu sitzen. Dass tatsächlich jemand hier gewohnt hatte, wenngleich nicht offiziell. Doch wie die Schiffe schwieg sich auch der Sessel darüber aus, wohin seine ehemaligen Besitzer verschwunden waren. Nur eine gewisse, unerklärliche Melancholie schien aus seinem Polster in den Nachmittag zu strömen wie der Schimmelgeruch seines Bezugs.
Und während er tiefer in das moderige weiche Polster sank, merkte Johann, wie müde er war. Unendlich müde. Ja, es war vielleicht dumm, hierherzukommen. Es war vielleicht naiv. Get the hell out of there!, hätte Katie gesagt. Mach bloß, dass du da rauskommst! Katie las allerdings zu viele Kriminalromane. Und sie hatte für ihre sechzehn Jahre eine erstaunlich blutrünstige Phantasie.
Gut, er würde den alten Speicher verlassen. Gleich. Sofort. Er wollte nur einen kleinen Moment sitzen bleiben. Er war erst am Morgen in Deutschland angekommen, hatte den Weg vom Berliner Flughafen hierher zurückgelegt – drei Stunden Stehen in einem überfüllten Zug –, war nach Wieck hinausgelaufen und zurück …
Johann gähnte, während er den kleinen, abgewetzten Koffer auf seine Knie stellte. Dann öffnete er den Deckel zum zweiten Mal an diesem Tag. Unter der Lederjacke und dem Umschlag befand sich eine Sammlung von Gegenständen, die scheinbar nichts miteinander zu tun hatten. Johann gähnte noch einmal und nahm den obersten Gegenstand heraus. Drehte ihn in den Fingern. Es war eine Pappschachtel, außen mit buntem Einwickelpapier beklebt. Er kam sich vor wie ein Voyeur, als er auch die Schachtel öffnete; als wäre er dabei, das Geheimnis einer Person zu lüften, deren Leben ihn nichts anging.
Doch in der Pappschachtel befanden sich keine Antworten auf seine Fragen. Darin befand sich lediglich eine Sammlung von gepressten Blumen und Federn.
Das, dachte er, konnte nun wirklich nichts Gefährliches sein, nicht einmal seine kriminalromanlesende Schwester hätte es gefährlich gefunden. Er drehte eine der Federn zwischen den Fingern, doch ehe er weiter über alles nachdenken konnte, war er eingeschlafen.
Akelei war dem schwarzhaarigen Jungen bis zum Museumshafen gefolgt. Sie fragte sich, was sie vorhatte. Würde sie ihn ansprechen? Was würde sie sagen? Sie schob seinen Namen in ihrem Kopf hin und her. Fin. Heute hießen eine Menge Kinder so, Kinder, die andere Ehepaare bekamen. Damals hatte niemand so geheißen. Fin. Sie hatte immer an Schnee gedacht, wenn sie seinen Namen gehört hatte, Schnee und Schlitten. Riesige, weite, weiße Flächen ohne Grenzen. Und an das Finden. An das Finden und Gefundenwerden. Manchmal hatte er so verloren gewirkt. Sie hätte ihn so gerne gefunden. Sie wäre so gerne von ihm gefunden worden, dort, hinter ihrem Gartenzaun.
»Hallo, Fin«, flüsterte sie. »Erinnerst du dich an mich?«
Nein. Natürlich erinnerte er sich nicht. Es war achtzehn Jahre her, dass sie sich gesehen hatten, und sie hatte nie mit ihm gesprochen. Aber er war nicht gealtert. Vielleicht war es für ihn nur fünf Minuten her?
»Hallo, Fin! Wie kommt es, dass du immer noch so alt bist wie damals?« Nein. »Hallo, Fin. Ich bin es, Akelei. Aus der Kastanienallee. Weißt du noch, wie die Kastanien jedes Frühjahr ihre weißen Dolden öffneten? Nur eine rote war dabei, aber die wurde erst später rot. Da waren wir schon fast mit der Grundschule fertig.«
Er war an den Schiffen entlanggegangen zum alten Kornspeicher, zielstrebig, als hätte ihn jemand dorthin bestellt. Ab und zu hatte er den kleinen Koffer geschlenkert. Was war in dem Koffer? Sein Gepäck? Etwas, das er zum Speicher bringen sollte? Oder – der Gedanke war absurd – die Vergangenheit? Schließlich war er über die Schuttberge in das verfallene Gebäude geklettert, dessen Vorderwand im unteren Stock komplett fehlte, da waren nur noch ein paar Eisenträger. Innen führte irgendwo eine Leiter hoch, und er war – tatsächlich – dort hinaufgeklettert. Akelei hatte es nur undeutlich gesehen von draußen, aber sie war ziemlich sicher, dass er auch dort hinauf den Koffer mitgenommen hatte. Es musste ein wichtiger Koffer sein. Drogen?, dachte Akelei. Geldscheinbündel? Goldbarren?
Und jetzt stand sie also vor dem alten Speicher und wusste nicht, was sie tun sollte. Ehe sie eine zündende Idee hatte, geschah ganz von selbst etwas, und zwar entkam ihr das Huhn. Vermutlich hatte es den ganzen Weg über an dem Reißverschluss gearbeitet, denn nun stand er weiter offen als zuvor, und es entwand sich der Tasche sehr bestimmt. Dann landete es auf dem Weg, schüttelte sein Gefieder und sah sich um. Schließlich reckte es sich, beäugte die Kieselsteine zu seinen Füßen, befand sie für nicht essbar und entschritt quer über den Weg in Richtung Wasser. Vielleicht plante es, dort zu fischen. Vielleicht plante es ein frühes Märzbad. Vielleicht plante es gar nichts.
»Kooomm!«, lockte sie leise. »Kooomm zurück, kommkommkooom!«
»Boook«, erwiderte das Huhn. Und dann drehte es sich um und kam tatsächlich. Dummes Huhn, dachte Akelei, fast mitleidig. Wenn es zu jedem Menschen kam, der es rief, musste es sich nicht wundern, in Rotweinsauce zu enden. Sie stopfte es zurück in die geblümte Plastiktragetasche und kletterte Fin nach, über die Schuttberge, die Leiter hinauf. Es war mühsam, mit der Huhntasche. Gut, dass niemand sie beobachtete – sie machte sicher keine besonders gute Figur bei dieser Kletterei, mit dem halblangen Rock und den Schirmständerbeinen. Oben wartete Akelei einen Moment, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Fin stand am Fenster, mit dem Rücken zu ihr. Sie schlich sich in eine Ecke, ließ sich auf dem Boden im tiefsten Schatten nieder, den sie finden konnte, und stellte die Tasche neben sich. Wehe, dachte sie mit solchem Nachdruck, dass das Huhn es eigentlich hören musste, wehe, du machst einen Mucks! Es gluckerte einmal leise wie eine Wasserleitung und schwieg.
Fin drehte sich jetzt um und machte zwei Schritte auf sie zu, und Akelei erschrak, doch er sah sie nicht. Er ließ sich in den alten Sessel fallen, der nahe bei den Fenstern stand, und sah eine Weile hinaus. Dann hob er den kleinen Koffer auf seinen Schoß, öffnete ihn und nahm etwas heraus. Akelei verrenkte sich den Hals, um zu sehen, was es war. Sie dachte, dass es dumm war, hier zu kauern wie ein Kind, das Verstecken spielte. Und dass ihr Mantel staubig würde. Und dass sie ihren Rock ausbürsten musste, wenn sie nach Hause kam … Hoffentlich, dachte sie, kam sie überhaupt rechtzeitig nach Hause, vor Hermann! Es war schon spät.
Dann dachte sie gar nichts mehr, denn dann sah sie, was Fin aus dem Koffer geholt hatte. Eine Pappschachtel, beklebt mit buntem Einwickelpapier. Akelei starrte die Schachtel an. Sie brauchte nicht genauer hinzusehen, um zu wissen, dass das Geschenkpapier lauter bunte Kinder zeigte, die sich an den Händen fassten. Nur auf dem Deckel klebte Papier mit violetten Sternen. Atemlos verfolgte sie, wie Fin den Deckel anhob. Ihre Lippen formten lautlos das Wort »Federn«. Er wird eine Handvoll Federn finden, erklärte sie dem Huhn in Gedanken. Eine ist dabei, die vom Schwanz eines Eichelhähers stammt, weiß und blau gestreift. Und gepresste Blätter. Johannisbeerblätter. Es war einmal mein Karton. Mein Schatzkarton. Ich hatte ihn hinten im Garten versteckt. Beinahe hätte ich ihn vergessen. Sie schloss die Augen und dachte sich zurück in die Vergangenheit, zurück in den Garten, zurück in die Kastanienallee.
Manche Leute sagten, die Kastanien in der Kastanienallee wären so alt, dass sie zwei Jahrhundertwenden erlebt hätten und noch erheblich mehr Kriege. Wie der Krieg, in dem der alte Dr. Birkholz gekämpft hatte, dessen Karabiner im Wohnzimmer des Hauses Nummer zwölf hing. Links davon hing ein gerahmter Lenin und rechts das schwarz-weiße Foto des alten Dr. Birkholz selbst. Er hatte seltsam stechende Augen, selbst in Schwarzweiß. Akelei, die ihren Großvater nicht gekannt hatte, stellte sich vor, wie er mit diesen Augen die Kastanien betrachtet hatte, bis sie aufgaben und vor ihm salutierten. Manche sagten, sie wären zu Zeiten der Schweden gepflanzt worden. Manche sagten, sie wären schon immer – vor der Stadt, vor den Straßen, vor den Menschen. Ihre Stämme waren dick wie Türme, und an einer von ihnen gab es eine runde Vertiefung wie ein Einschussloch, von dem die Leute behaupteten, es stammte aus irgendeinem jener Kriege. Aber Akelei vermutete, ihr Großvater hatte diese Stelle mit seinen stechenden Augen einfach zu lange angesehen. In jedem Fall wusste niemand, wie alt die Kastanien wirklich waren. Mit fünf Jahren setzte Akelei ihr Alter mit der Unendlichkeit gleich. Es gehörte zu den Dingen, die sie nicht begriff.
Genauso, wie sie nicht begriff, woher die Wolken kamen oder woher sie selbst kam oder warum man mit manchen Leuten in der Kastanienallee reden durfte und mit manchen nicht.
Man durfte mit der alten Frau Meier reden, die jeden Morgen ihren Hund in der Allee spazieren führte. Obwohl der Hund nur drei Beine hatte und Frau Meier nach verrotteten Rosen roch. Man durfte mit den Wenzlows reden, obwohl Frau Wenzlow schielte, wenn sie die Brille absetzte. Man durfte mit den Vierkes reden, obwohl Herr Vierke den ganzen Tag mit sich selbst sprach. Mit den Ewerts durfte man reden, wenn es dringend sein musste, denn sie glaubten an merkwürdige Dinge wie die Kirche. Aber mit den Pauls durfte man in keinem Fall reden, nicht einmal im Notfall, obwohl bei denen niemand schielte und alle die richtige Anzahl an Beinen hatten und keiner von ihnen an die Kirche glaubte.
Manchmal sah Akelei die Paulkinder am Zaun stehen, dort in ihrem wilden Garten, und die Paulkinder waren wild wie der Garten selbst. Es waren sechs, drei Mädchen und drei Jungen – der jüngste so alt wie Akelei, der älteste beinahe fertig mit der Schule. Das Haar der Kleineren war selten gekämmt und ihre Nasen selten geputzt, und wenn Akelei mit ihrem Springseil die Allee entlanghüpfte, spürte sie, wie ihr mindestens fünf Paar Augen folgten.
»Wollt ihr auch mal springen?«, fragte Akelei zaghaft. »Mein Papa hat die Griffe für das Seil selbst gemacht. Ihr dürft es mal ausprobieren.« Akeleis Vater war auch ein Dr. Birkholz, der junge Dr. Birkholz: Wilhelm. Er hatte die geschickten Hände des alten Dr. Birkholz geerbt, aber er benützte sie nicht dazu, Karabiner zu bedienen. Stattdessen machte er eine Menge Dinge selbst. Der Vater der Paulkinder, Frank, arbeitete als Lastwagenfahrer und die Mutter Paul in der Fabrik. Sie hatte feuerrotes Haar und trug zu kurze Röcke, und manchmal hörte sie verbotenes Radio in der Waschküche, das wusste Akelei von der alten Frau Meyer mit dem dreibeinigen Hund. Akelei hatte im Kindergarten gelernt, dass alle Menschen Brüder waren und sie einem Volk aus glücklichen Arbeitern angehörte. Auch die Ärzte waren glückliche Arbeiter. Aber bisweilen kam es ihr doch so vor, als gäbe es Unterschiede.
»Wie kommste denn drauf, dass wir dein Springseil leihen wollen?«, fragte der zweitälteste Paul. Er hieß irgendetwas mit H. Hannes? Hans? Henner!, dachte Akelei.
»Du hast ja keine Ahnung«, sagte eine seiner Schwestern, Marie oder Mareike – oder Martha?
»In unserem geheimen Schatzversteck haben wir ein Dutzend Springseile! Und noch eine ganze Menge Sachen, von denen du nur träumen kannst.«
Da blieb Akelei mit offenem Mund mitten in der Allee stehen und hörte sich an, was die wilden Paulkinder alles in ihrem geheimen Schatzversteck hatten, und ihre Augen wurden immer größer. Sie klebte am Zaun, bis ihre Mutter vorbeikam, sie an der Hand packte und nach Hause zerrte, weil man mit den Paulkindern nicht reden durfte, obwohl alle Menschen Brüder waren.
Am Abend erzählte Akelei Elsbeth von dem geheimen Schatzversteck. Elsbeth war die sanfte, freundliche kleine Frau des jungen Dr. Birkholz und Akeleis Mutter. Sie arbeitete halbtags in der Klinik und tat irgendetwas mit Akten und dem Telefon, was Akelei nicht ganz begriff. Aber die andere Hälfte des Tages war sie zu Hause, obwohl die meisten Mütter den ganzen Tag arbeiteten. Weil ja alle Menschen gleich waren, auch die Frauen. Elsbeth jedoch war nach zwei Uhr zu Hause, um für ihre allerliebste Akelei da zu sein und für das Haus, das auch immer sehr allerliebst aussah.
»Sie haben alles dort«, sagte Akelei an jenem Abend zu ihrer Mutter. »Gold und Edelsteine und Samt und Seide. Und tausend Millionen Silbermünzen. Und Marzipan. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Versteck. Wenn man ein Freund der Paulkinder ist, darf man das Schatzversteck sehen.«
»Allerliebste Akelei«, sagte ihre Mutter sanft. »Zufällig habe ich das Schatzversteck der Paulkinder gesehen. Und denk dir, als ich die Schätze anfassen wollte, da haben sie sich alle in Seifenblasen verwandelt.«
»Seifenblasen?«, fragte Akelei zweifelnd.
Ihre Mutter nickte. »Es sind nur ausgedachte Schätze, allerliebste Akelei«, sagte sie. »der einzig echte Schatz, den die Paulkinder besitzen, ist ein großer Vorrat an Läusen und ungesunden Ideen. Überhaupt musst du keine Freundin der Paulkinder werden, um ein Schatzversteck zu besitzen.«
Am nächsten Morgen fand sie den Schuhkarton auf ihrem Nachttisch.
»Allerliebste Akelei«, sagte ihre Mutter, die eben hereinkam, um die Vorhänge zurückzuziehen, »sieh in den Schuhkarton. Es ist nur ein kleiner Schatz drin, aber du kannst noch mehr Schätze dafür sammeln.« Der Karton war das schönste Versteck, das Akelei je gesehen hatte. Darin lag eine einzelne, blau-weiß gestreifte Feder. Ihre Mutter sagte, sie stammte von einem Eichelhäher, und sie hätte sie im Garten gefunden. Von diesem Tag an fand auch Akelei Dinge, die in den Schuhkarton wanderten: leere Schneckenhäuser und Blumen, die sie in den dicken Medizinbüchern ihres Vaters zwischen Zeitungspapier presste, bevor sie sie in die Schachtel legte, zwischen Seiten, in denen schon der alte Dr. Birkholz geblättert hatte. Sie fand runde Kieselsteine und bunte Zeitungsbilder. Manchmal verbarg sie den Karton unter dem Bett und manchmal hinten im Garten beim Zaun, hinter einem Stapel Bretter, wo er nicht nass werden konnte. Und obwohl ihre Mutter den Karton für sie beklebt hatte, kam es Akelei nach einer Weile so vor, als wäre er wirklich geheim und gehörte nur ihr, ihr ganz allein. Wenn die Paulkinder am Zaun standen und von ihren Schätzen sprachen, erzählte Akelei ihnen von ihren eigenen: von den grünen Smaragden, die unreife Kastanien waren, vom Samt der getrockneten Rosenblätter und den Kristallstücken, die nur aus Glasscherben bestanden.
»Allerliebste Akelei«, fragte ihre Mutter an einem Tag im Herbst, als die Kastanien zu Dutzenden reif auf das Pflaster der Allee fielen, um dort zu zerplatzen – neue Schätze, jetzt rotbraun und reif. Wie Rubine. »Allerliebste Akelei, bist du nicht glücklich, hier, in der Kastanienallee? Hast du nicht alles, was du brauchst?«
»Ja«, sagte Akelei, die sich manchmal nicht sicher war, ob »Allerliebste« ihr erster und eigentlicher Vorname war. »Ja, ich habe alles.«
Sie sagte nicht: Ja, ich bin glücklich. Sie war ein braves Kind, und brave Kinder lügen nicht. Selbst wenn die Edelsteine und Goldmünzen allesamt ausgedacht waren, so besaßen die Paulkinder doch einen echten Schatz, einen, den Akelei niemals zu ihrer Sammlung zählen würde: Sie waren zu sechst. Ihre Eltern hatten keine Zeit, ihnen das Blumenpressen in Büchern zu zeigen oder Kartons für sie zu bekleben, denn nach Feierabend hatten sie damit zu tun, sich anzuschreien. Niemand nannte sie »allerliebste Sonstwie«. Sie waren dreckig und ungekämmt und ungewaschen, aber sie waren zu sechst. Akelei in ihren sauberen, gestärkten Blusen und ihren adretten roséfarbenen Söckchen, die allerliebste Akelei war allein.
Als Johann aufwachte, wurde es draußen vor den Fenstern des alten Kornspeichers schon dunkel. Der Sonnenuntergang malte orange-rosafarbenen Kitsch über den Horizont, und vor diesem unwirklich filmreifen Licht stand jemand. Eine Frau. Sie hatte die Arme verschränkt und sah ihn an.
»Ha… hallo«, stotterte Johann, noch immer benommen vom Schlaf.
Die Frau neigte den Kopf zu einem stummen Gruß. »Du bist also wiedergekommen«, sagte sie. »Nach all der Zeit. Obwohl es natürlich nicht sein kann.«
Johann rappelte sich im Sessel hoch, in dem er halb versunken war wie in einem Grab aus alter Möbelpolsterung. »Wiedergekommen? Ich war nie hier. Wer sind Sie?«
Die Frau zündete sich eine Zigarette an und trat näher ans Fenster, so dass das orange-rosafarbene Licht auf ihr Gesicht fiel. Sie hatte kurzes, unecht kastanienrotes Haar und eine pinke Strähne im Pony. Sie sah alt aus, dachte Johann, auf die Art alt, bei der man weiß, dass derjenige in Wirklichkeit noch jung ist. Verbraucht. Ihre Haut war ein Zeugnis zu vieler Zigaretten und zu vieler Sorgen und zu vieler enttäuschter Hoffnungen. Oder vielleicht war es nur die Melancholie des verlassenen Kornspeichers und des Abends, die ihn das denken ließ. Er stand auf und trat zu der Frau mit der pinken Strähne ans Fenster.
»Erkennst du mich denn nicht?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete Johann. »Sollte ich Sie erkennen? Ich bin das erste Mal hier, wie gesagt.«
Sie lachte, ein rauhes Kettenraucherlachen. »Das erste Mal? Soso.«
Dann schnellte ihre freie Hand so plötzlich nach vorne, dass er erschrak. Sie griff nach seinem Kinn und drehte sein Gesicht zu sich.
»Aber du bist es doch, nicht wahr?«, murmelte sie. »Du hast geschrieben, dass du zurückkehren würdest, und du bist zurückgekehrt. Warum? Ich verstehe nicht … Warum bist du nicht gealtert? Als ich dich zuletzt gesehen habe, warst du achtzehn, und jetzt scheinst du auch ungefähr achtzehn zu sein. Das bist du natürlich nicht. Es ist nur dein Äußeres. Du bist doppelt so alt.«
Sie schüttelte den Kopf und ließ sein Kinn los, was ihn erleichterte.
Vielleicht war sie verrückt. Vielleicht hatte Katie recht, und es war keine gute Idee, bei Einbruch der Dunkelheit in einem verlassenen und vermutlich einsturzgefährdeten Kornspeicher mit Verrückten zu reden.
»Fin …«, begann sie.
»Ich heiße Johann«, sagte Johann.
Sie seufzte. Dann zog sie die gezupften Augenbrauen plötzlich zusammen. In der linken glänzte ein kegelförmiges silbernes Piercing. »Hast du alles vergessen? Ist es das? Aber du hast mir geschrieben.«
»Ich kann mich nicht daran erinnern, Ihnen geschrieben zu haben«, erklärte Johann sehr bestimmt. Beinahe lachte er. Dies hier war zu abstrus.
»Schön. Falls du dich nicht erinnern kannst oder nicht erinnern willst: Ich bin Paula.«
Sie zog an ihrer Zigarette und blies einen Rauchkringel in die Luft. »Und vor achtzehn oder neunzehn Jahren hast du mich neben dem Stamm einer Kastanie geküsst, gegenüber vom Haus Nummer zwölf in der Kastanienallee.«
»Ich denke, nicht.«
Sie lächelte. »Deine Augen, Fin«, sagte sie. »Du kannst niemanden darüber hinwegtäuschen, dass du du bist, solange du diese Augen hast. Es gibt wenige Leute mit solchen Augen. Dieses Türkis. Wie ein Swimmingpool, dort, wo er am tiefsten ist. Man kann darin ertrinken, wenn man sich nicht vorsieht. Oder wie dieser Cocktail. Grüne Wiese. Abgesehen davon siehst du aber auch sonst so aus wie damals«, meinte sie. »Deine Nase, dein Kinn, meine Güte, deine Haare! Und du trägst noch immer die alte Lederjacke, verdammt.«
Sie drückte die Zigarette auf der Fensterbank aus, zündete sich eine neue an und sah eine Weile auf den beinahe schwarzen Fluss hinaus. Sah ihn wieder an. »Du erinnerst dich wirklich nicht, was? Irgendetwas ist geschehen. Ich kann mir nicht erklären, was. Dein Brief kam vor zwei Tagen. Dieser Brief, Fin – wie auch immer du das angestellt hast, dass du so jung aussiehst, du bist natürlich so alt wie ich, unter der Fassade – aber ich habe mir wirklich Sorgen gemacht.«
»Ich. Bin. Nicht. Fin!«, sagte Johann noch einmal sehr, sehr langsam. Es war gelogen. Er war Fin. Fin war sein zweiter Name. Aber ich glaube, ich habe Fins Koffer bei mir, wollte er hinzufügen. Doch er ließ es.
»Gut.« Sie seufzte. »Tun wir so, als wärst du jemand anderer. Sprechen wir in der dritten Person über Fin Paul. Vielleicht erinnerst du dich dann. Er wohnte eine Weile im Kornspeicher, zusammen mit mir und den anderen aus der alten Truppe. Gleich nach der Wende. Wir wohnten schon eine Weile da. Fin … Fin hatte eigentlich andere Pläne, aber dann ist er zu uns gezogen. Hat für uns Gitarre gespielt, an den Abenden, draußen. Wir hatten kein Geld. Und trotzdem war immer genug Bier da und genug Musik. Ein paar wunderbare Monate, die wunderbarsten meines Lebens. Die Leute fingen an, die Mauer in Berlin stückchenweise auf Postkarten zu kleben, um sie an die Touristen zu verkaufen. Wir lachten plötzlich über den Stacheldraht, mit dem wir so lange gelebt hatten, es gab keine Grenzen mehr, schien keine Gesetze zu geben. Niemand scherte sich darum, ob ein paar junge Leute in einem alten Kornspeicher hausten. Alles war möglich. Oder jedenfalls dachten wir das. Wir Idioten. Später wurden die Dinge natürlich ganz anders, später kam die Arbeitslosigkeit und alles. Aber damals schien die Welt aus Gold zu bestehen. Zumindest für uns. Wir waren ganz am Anfang. Fin war am Ende.
Ich habe gesagt, er spielte Gitarre für uns, und das ist wahr, aber wenn er zu lange spielte, baten wir ihn aufzuhören. Seine Musik war wunderschön – und unendlich traurig. Man konnte daran ersticken. Irgendwann verließ er uns. Ging nach Berlin. Wollte weg, weg von hier, weg von allem. Einmal hat er geschrieben, ein einziges Mal. Ich habe geantwortet, aber es kam nie wieder ein Brief. Bis vor zwei Tagen. Das war seltsam genug. Achtzehn Jahre lang kein Wort – und dann dieser Brief. Er hat ihn an die alte Adresse meiner Eltern geschickt. Zum Glück wohnt meine Mutter noch dort. Seit ich diesen Brief gelesen habe, komme ich jeden Tag hierher. In dem Brief stand, dass er zurückkommen würde. Zurück nach Greifswald, zurück nach Hause.«
»Das … das war alles?«
»Nein«, antwortete Paula. »Er schrieb, er käme zurück, um zu sterben.«
Johann sog die Luft scharf durch die Nase ein. Die Luft schmeckte nach Paulas Rauch.
Aber der Johann Fin Paul, dem der Koffer gehört hat, war nur einen Tag alt gewesen.
Wenn man dem Grabstein glaubte. Und dem Pfarrer.
»Vielleicht hat er es nicht mehr geschafft«, sagte Johann. »Hierherzukommen, meine ich.«
»Vielleicht.«
Er sah ihr an, dass sie ihm noch immer nicht glaubte. Dass sie noch immer der Meinung war, er spielte ein Spiel mit ihr. Dass er Fin war, der andere Fin, der vor achtzehn Jahren nach Berlin ging und jetzt zwar älter war, jedoch aus einem unerklärlichen Grund genauso jung aussah wie damals. Und er ahnte, dass es nur eine Möglichkeit gab, herauszubekommen, was es mit dem Koffer auf sich hatte und mit dem leeren Umschlag. Und mit einer besonderen Augenfarbe, die bisher nur die seine gewesen war und jetzt plötzlich jemand anderem zu gehören schien. Er musste diesen anderen finden.
»Wissen Sie … wissen Sie Fins Adresse in Berlin noch?«
Sie nickte. »Aber er ist nicht mehr dort. Ich bin mal vorbeigegangen, als ich sowieso in Berlin war. Jahre später. Die Unberechenbar.«
»Die – was?«
»Die Unberechen-Bar. Eine Kneipe. Berlin-Mitte. Das war wohl auch seine Adresse. Stand auf dem Brief, damals. Die Straße habe ich vergessen.« Sie zündete sich eine dritte Zigarette an.
»Womöglich«, sagte Johann, »sollte ich dort nachfragen. Womöglich muss ich Fins Spur folgen, von Anfang an.«
»Ja«, bestätigte Paula und seufzte. »Tu das! Tu das, und wenn du am Ende der Spur angekommen bist und dich selbst gefunden hast, sag mir Bescheid! Ich werde hier warten. Jeden Abend. Nur, hör mal, stirb nicht in der Zwischenzeit, ja? Ich wüsste nicht, warum, denn du siehst verflixt gesund aus, und, wie gesagt, achtzehn Jahre sind zu jung. Aber es stand in dem Brief, und man weiß nie.«
Damit tauchte sie in die Schatten des Speichers ein, und Johann hörte sie die Leitersprossen hinunterklettern. Kurz darauf erschien sie unten vor dem Speicher und ging am Fluss entlang in Richtung Stadt davon. Und da fiel ihm noch etwas ein. Etwas, das er schon vorher hatte fragen wollen und dann in seiner Verwirrung vergessen hatte.
»Warten Sie!«, rief er Paulas magerer, verbrauchter Gestalt nach. »Sie haben gesagt, als er in den Speicher zog, dieser Fin, da war er am Ende. Warum? Warum war seine Musik so traurig, dass man daran ersticken konnte?«
Doch Paula war schon außer Hörweite. Oder jedenfalls tat sie so.
3. Kapitel: Brandnesseln
Paula, dachte Akelei verbittert. Paula wäre das nicht passiert.
Paula aus Fins Truppe. Sie sah sie noch vor sich, Paula, die neben Fin durch die Kastanienallee schlenderte, in einem skandalös kurzen Rock. Paula, hinten auf Fins Moped. Paula, die am Zaun lehnte, an einer Kastanie gegenüber vom Haus Nummer zwölf lehnte, die an Fins Schulter lehnte, eine Zigarette zwischen den Fingern. Ha, aber wie alt sie geworden war! Wie alt jemand in achtzehn Jahren werden konnte! Jedenfalls hätte Paula nicht den halben Tag jemanden verfolgt, mit dem sie nicht zu sprechen wagte – nur um dann festzustellen, dass er in der unerreichbaren Welt hinter den Glastüren einer Jugendherberge verschwunden war, in der mittelalte Hausfrauen nichts zu suchen hatten.
Akelei fror. Ihr Rücken schmerzte von der merkwürdigen Haltung, in der sie eine solche Ewigkeit im Schatten des alten Kornspeichers gekauert hatte wie ein Privatdetektiv im Anfängerkurs. Sie setzte die geblümte Tasche ab und stellte fest, dass es daraus stank. Sie war unendlich müde, so müde, dass sie sich hier mitten auf den Asphalt hätte setzen und einschlafen können, trotz der Kälte, trotz der Schmerzen in ihrem Rücken, trotz des Gestanks aus der Tasche. Irgendwie war alles außer Kontrolle geraten.
Sie hätte jetzt nach Hause gehen müssen. Spätestens jetzt. Aber sie konnte nicht.
Sie öffnete den Reißverschluss der Tasche und wedelte die Hühnergeruchswolke mit einer Hand beiseite. Das Huhn blinzelte sie schläfrig an.
»Hilf mir!«, bat Akelei. »Hier hast du die Fakten: Es ist mitten in der Nacht. Ich stehe vor einer Jugendherberge, die ich noch nie gesehen habe, obwohl sie sich in meiner eigenen Stadt befindet. Mein einziges Gepäck ist eine stinkende geblümte Plastiktragetasche, und … ich spreche mit einem Huhn.« An dieser Stelle brachte die Märznachtkälte Akelei zum Niesen, und sie zog ein Taschentuch aus der Manteltasche, um sich zu schneuzen. Ein gestärktes Taschentuch mit ihren Initialen in blassgelber Stickerei. »Wenn ich ein Taxi nehmen würde«, fuhr Akelei fort, »wäre ich in einer Viertelstunde zu Hause bei dem Mann, mit dem ich seit beinahe achtzehn Jahren verheiratet bin. Er ist ein guter Mann. Sehr ordentlich. Reinlich. Pflichtbewusst. Aber in der Jugendherberge schläft heute Nacht der einzige Mensch, in den ich je verliebt war. Entschuldigung, das klingt furchtbar kitschig. Ich werde es bei Gelegenheit anders formulieren, nur gerade jetzt bin ich zu müde.« Sie ging in die Knie, so dass ihr Gesicht beinahe auf Huhnhöhe war.
»Sag mir, was ich tun soll«, flüsterte Akelei. »Immerhin habe ich dafür gesorgt, dass du nicht geschlachtet wirst. Nicht heute.«
Da schien das Huhn zu gähnen – konnten Hühner gähnen? –, reckte seinen weiß befiederten Hals und stieg aus der Tasche. Es hüpfte ein paar hühnerhafte Trippelschritte auf die Jugendherberge zu, drehte sich nach Akelei um und sah sie aus seinen kleinen Glitzeraugen an.
»Du meinst …?«, fragte sie.
Da! Hatte es nicht eben genickt? Oder hatte sie sich das eingebildet? Jetzt wandte es sich ab und lief einfach weiter, genau auf den Eingang zu, ein Huhn mit einem Ziel. Natürlich, dachte Akelei. Auch das Huhn wollte endlich schlafen. Und wenn man vor einer Jugendherberge steht und schlafen möchte, ist die logische Konsequenz, in die Jugendherberge hineinzugehen, um zu schlafen. Sie folgte dem Huhn, sammelte es wieder ein und steckte es zurück in die Tasche.
»Es ist nur für kurz«, wisperte sie. »Bis wir an der Rezeption vorbei sind.«
»Ach so«, sagte das Huhn. Aber das, dachte Akelei, hatte sie sich ganz bestimmt eingebildet.
Akelei rüttelte eine Weile an den verschlossenen Türen der Jugendherberge, zunächst zaghaft, dann verzweifelter. Wie kam man nachts in Jugendherbergen? Akelei war noch nie in einer Jugendherberge gewesen. Während sie in ihrem pastellfarbenen Haushalt Vorhänge umgenäht und Blumen in Übertöpfe gestopft hatte, schien sich die Welt draußen mit dreifacher Geschwindigkeit weitergedreht zu haben. Sie befand sich in ihrer eigenen Stadt, und dennoch hätte sie im Dschungel in Mittelamerika nicht fremder sein können. Vielleicht gab es einen Trick? Vielleicht musste man die Klinken von Jugendherbergen auf eine bestimmte Art verbiegen oder gegen die Tür treten oder ein geheimes Wort sagen, das alle Leute auf der Welt kannten außer ihr?
Das Fenster zu ihrer Rechten war nur angelehnt. Sie könnte versuchen, ihren Arm durch den Spalt zu zwängen, den Griff von innen umzulegen und es ganz zu öffnen. Ehe sie jedoch damit anfing, samt Mantel und Tasche durch ein fremdes Fenster einzusteigen, entdeckte sie einen kleinen schwarzen Knopf neben der Tür. Nachtklingel stand auf einem kleinen angeklebten Zettel daneben. Nur in Notfällen zu benutzen. Akelei atmete auf. Sie entschied, dass dies ein Notfall war.
Als sie den Knopf drückte, kroch aus dem Inneren des stillen Gebäudes ein gedämpftes Summen an ihr Ohr. Sonst geschah nichts. Akelei stellte die Tasche mit dem Huhn ab und drückte den Knopf noch einmal, diesmal länger. Jemand würde ärgerlich werden. Jemand, der schlief und nicht mit Notfällen rechnete, würde schließlich aufwachen und sehr, sehr ärgerlich werden. Ihre Finger kribbelten vor schlechtem Gewissen, als sie den Knopf ein drittes Mal drückte. Diesmal ging drinnen ein Licht an, und jemand schlurfte durch die kahle Halle, die hinter der Tür lag. Es war ein klobiger, junger Koloss mit gebeugtem Nacken, kugeligem, beinahe kahlem Kopf und breiten Schultern – und obwohl er zunächst nur verschlafen aussah und nicht ärgerlich, so konnte sich das doch jeden Moment ändern. Der Mann wirkte beunruhigend kräftig. Er trug ein Netzhemd und hatte eine Tätowierung auf dem linken Oberarm, irgendeine Sorte Drache oder Schlange oder eine ungesunde Kreuzung aus beidem. Akelei hob die Tasche wieder auf und stellte sich etwas gerader hin. Vielleicht wäre es eine gute Idee, sich jetzt auf der Stelle umzudrehen und sehr schnell wegzulaufen.
Zu spät.
Der Koloss schloss die Tür auf und blinzelte sie aus schmalen, winzigen Augen an. Er holte Luft, öffnete den Mund, vermutlich, um sie anzuschnauzen – doch dann schloss er den Mund wieder, und sein rundes Gesicht verformte sich zu einem breiten Lächeln.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er. »Scheint mir, als bräuchten Sie dringend Hilfe.«
»Ja«, antwortete Akelei erleichtert. »Ich brauche ein Bett. Ich meine, ich kann es bezahlen. Es tut mir leid, dass ich Sie geweckt habe, ich weiß, die Nachtklingel ist eigentlich nur für Notfälle.«
»Sie sehen aus wie ein Notfall«, sagte der Koloss.
Er sprach wie zu einem Kind. Vermutlich standen selten nachts Hausfrauen in pastellgrünen Mänteln vor dieser Tür. Der Koloss ließ sie herein, öffnete die Rezeption für sie und kramte in einer Schublade voll Papier.
»Sind Sie Mitglied?«
»Mitglied?«, fragte Akelei.
»Also nicht«, meinte der Koloss seufzend. »Irgendwie dachte ich mir das. Sie müssen das Formular hier ausfüllen. Beim DJH kann man nur schlafen, wenn man Mitglied ist.«
»DJH?«, wiederholte Akelei. Sie hatte keine Ahnung, was das Wort bedeutete und ob es eine gute Idee war, dort Mitglied zu werden. Vielleicht war es eine Art Sekte. Vielleicht verpflichtete sie sich mit dem Ausfüllen des Formulars dazu, ihr Leben lang an irgendwelchen Straßenecken zu stehen und Zeitschriften zu verkaufen. Doch sie war zu müde, um sich darum zu scheren. Sie füllte das Formular aus. Erst, als sie damit fertig war und ihre Unterschrift daruntersetzte, merkte sie, dass sie es verkehrt ausgefüllt hatte. Akelei Elena Birkholz