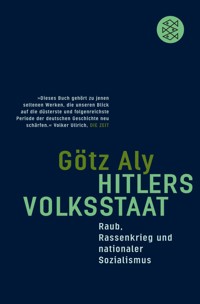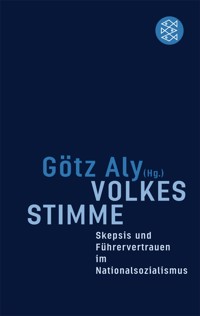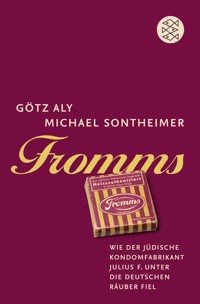9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
****Die »Euthanasie-Morde« - und wie wir bis heute damit umgehen***** Götz Aly zählt zu den einflussreichsten und kontroversten NS-Historikern - dieses von der Süddeutschen Zeitung als bemerkenswert und unbequem bezeicnete Buch ist wohl sein eindringlichstes und persönlichstes. Schonungslos legt er offen, wie weit die nationalsozialistische »Euthanasie« in die Gesellschaft hineinwirkte und welche Spuren sie bis heute hinterlassen hat. 200.000 Deutsche wurden zwischen 1939 und 1945 ermordet, weil sie psychisch krank waren, als aufsässig, erblich belastet oder verrückt galten. Nicht wenige Angehörige nahmen den Mord an ihren behinderten Kindern, Geschwistern, Vätern und Müttern als Befreiung von einer Last stillschweigend hin. Die meisten Familien schämen sich bis heute, die Namen der Opfer zu nennen. Beklemmend aktuell lesen sich die Rechtfertigungen der vielen Beteiligten: Erlösung, Gnadentod, Lebensunterbrechung, Sterbehilfe. Götz Aly bringt mit seinem neuen Buch Licht in ein düsteres Kapitel der deutschen Gesellschaftsgeschichte: Heute ist von den erwachsenen Deutschen jeder achte direkt mit einem Menschen verwandt, der den ›Euthanasie‹-Morden zum Opfer fiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Götz Aly
Die Belasteten
›Euthanasie‹ 1939–1945. Eine Gesellschaftsgeschichte
Über dieses Buch
Von den heute lebenden Deutschen, die älter als 20 sind, ist jeder achte direkt mit einem Menschen verwandt, der zwischen 1940 und 1945 ermordet wurde, weil er psychisch krank, epilepsiekrank oder behindert war. Die damals Beteiligten beschönigten das Verbrechen als Erlösung, Gnadentod, Lebensunterbrechung, Euthanasie oder Sterbehilfe. Nicht wenige Angehörige fühlten sich nach dem stillen, halb geheimen Verschwinden ihrer hilfsbedürftigen Nächsten erleichtert - der Staat hatte eine Lebenslast, eine schwere Sorge von ihnen genommen. Die meisten Familien schwiegen hernach; viele schämten sich, die Namen der Opfer zu nennen. Erst heute, nach bald 70 Jahren, löst sich der Bann. Langsam tauchen jene Vergessenen wieder auf, die sterben mussten, weil sie als verrückt, lästig oder peinlich galten, weil sie unnormal, chronisch krank, gemeingefährlich, arbeitsunfähig oder pflegebedürftig waren, weil sie ihre Familie mit dem Makel »erbkrank« belasteten.
Götz Aly beschreibt, wie die Euthanasiemorde in der Mitte der deutschen Gesellschaft als öffentlich bekanntes Geheimnis vonstattengingen. Er lässt die Opfer sprechen, zeigt, wie sich die Anverwandten verhielten und wie Ärzte das Töten in den therapeutischen Alltag übernahmen und zugleich reformerische Ziele verfolgten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402043-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Henry K. und Louise S. – Tote ohne Namen
Schweigen mit Rücksicht auf die lebenden Verwandten
Hinweise zur Lektüre
Um eine Gewissenslast erleichtert
Sterbehilfe, Idee einer säkularisierten Welt
Für die Angehörigen: eine amtsgeheime Maßnahme
Für die Ärzte: ein Gesetzentwurf zur Sterbehilfe
Wie die ledige Mutter Frida Weiss ihren Sohn rettete
Aktion T4, getarnt und wohlbekannt
Die »planwirtschaftliche Erfassung« der Kranken
Die kleine Mordbehörde in der Tiergartenstraße 4
Eines schönen Tages kommt ein Paket mit einer Urne
Ein zugewandter Arzt, Reformer und Massenmörder
Die materialistischen Motive der Mörder
Verlegt, verschwunden, vergessen in Berlin
Die Kranken waren zu zeichnen wie die Schweine
Entlassungsanträgen ist in jedem Fall zu entsprechen
Elastisch und effizient: Die geteilte Macht der Mörder
Willfährigkeit, Ausreden, Schweigen und Protest
Berichte aus dem Archipel Gaskammer
Uns wollen sie auf die Seite schaffen
Ich befand mich in einem Totentransport
Ich komme nicht hinter die Eisentür
Die meisten haben »geahnt und gemerkt, was los ist«
Heute ist ein schwerer Tag
Später »wird man den Schleier dieser Anstalt lüften«
Umsiedlung, Krieg und Krankenmorde
Anstalten als Zwischenunterkünfte für Umsiedler
550 kirchliche Anstalten für volksdeutsche Umsiedler
Feste Winterquartiere für die Wehrmacht
Erfassung missgestalteter Neugeborener
Früherkennung für eine tödliche Behandlung
Todesurteil: Lebensalter 14,8, Intelligenzalter 8,6
Massenmörder planen freundliche Kinderkrankenhäuser
Kindergehirne für exzellente Wissenschaft
»Reichsausschussmaterial«, begehrt und verwertet
Die Max-Planck-Gesellschaft und Hallervorden
Euthanasie im Alltag einer Kinderklinik
»Das Kind eignet sich zur Behandlung durchaus«
Tödliche Spritzen als Teil fachärztlicher Ausbildung
Auch die Schwesternschülerinnen wussten Bescheid
Riskante Therapie: ein Angebot für Eltern
Kinderärzte erkunden den Willen der Mütter und Väter
Ein letzter Versuch? Ja, probieren Sie es!
Letzte kindliche Lebenszeichen
Sein Gesichtsausdruck ist immer sehr lebhaft
Für wissenschaftliche Zwecke am selben Tag ermordet
Ich habe keine Freude in dieser Anstalt
Freut sich, ist allgemein beliebt
Ich habe Heimweh
Die jähe Unterbrechung der Aktion T4
Bischof Galen und Gottes Strafgericht
Der Reichsbeauftragte für die Heil- und Pflegeanstalten
Forschen an Lebenden und Toten
Eine neue Zeit mit neuen Menschen versehen
Heidelberger »Absterbeordnung für Idioten«
Grundlagenforschung, eine Aufgabe der Aktion T4
Asoziale, Kriminelle, Tuberkulosekranke
»Die Vernichtung asozialen Lebens«
Rummelsburg – Fragebogen für Gemeinschaftsfremde
»Asoziale Tuberkulöse« in Stadtroda
Denunzianten, Mörder und die Wahrheiten der Verrückten
Hilfe den Verletzten, Tod den Verrückten
Bestmögliche Ausnutzung vorhandener Betten
Schwestern und Pfleger richten über Patienten
Krematorien für die Heilanstalten
Was wussten die Leute über das Morden?
Nachrichten aus den Sterbehäusern
Hier kann man uns unauffällig verhungern lassen
Kein Einziger kommt mehr zurück
Ein Überlebender berichtet im Herbst 1945 aus Hadamar
Ich möchte nicht verbrannt werden
Wir kennen keine Liebe mehr
Reportage nach der Nacht der Vernichtung
Die Botschaften der Ermordeten
Die vergessenen Urnen vom Bodensee
Die mitbeteiligten Angehörigen
Im Bannkreis des Bösen
Anhang
Nachbemerkung
Endlich, nach 32 Jahren
Ein gut begründeter, gescheiterter Vorschlag
Gelungene geschichtspolitische Aktionen
Die Lust am Abschreiben
Abkürzungen
Literatur
Für Karline
Henry K. und Louise S. – Tote ohne Namen
Schweigen mit Rücksicht auf die lebenden Verwandten
Den Euthanasiemorden fielen zwischen 1939 und 1945 etwa 200000 Deutsche zum Opfer. Die vielen Beteiligten sprachen beschönigend von Erlösung, Lebensunterbrechung, Gnadentod, Sterbehilfe oder eben von Euthanasie. Sie agierten halb geheim, doch inmitten der Gesellschaft. Viele Deutsche befürworteten den gewaltsamen Tod der »nutzlosen Esser«, zumal im Krieg; nur wenige verurteilten das Morden deutlich, die meisten schwiegen schamhaft, wollten es nicht allzu genau wissen. Das setzte sich nach 1945 fort. Nur ausnahmsweise erinnerten sich Familien ihrer ermordeten Tanten, Kleinkinder, Geschwister oder Großväter. Erst heute, nach rund 70 Jahren, löst sich der Bann. Langsam tauchen jene Vergessenen wieder auf, die sterben mussten, weil sie als verrückt, lästig oder peinlich empfunden wurden, weil sie unnormal, gemeingefährlich, arbeitsunfähig oder dauernd pflegebedürftig waren, weil sie ihre Familien mit einem Makel belasteten.
Noch in der Gegenwart werden bei Veranstaltungen, in Büchern und auf Denkmälern die Namen der Ermordeten zumeist nicht genannt. Mit verklemmter Diskretion ist von Henry K. und Louise S. die Rede, oder es werden alberne Ersatznamen vergeben. Warum nur? Nach dem Bundesarchivgesetz dürfen sämtliche in den Akten genannten Namen der vor dem 8. Mai 1945 auf welche Weise auch immer Verstorbenen veröffentlicht werden. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes teilte mir mit: Für Tote gilt kein Datenschutz. Er gab jedoch zu bedenken, man möge Rücksicht auf die heute lebenden Verwandten nehmen. Sie könnten sich beeinträchtigt fühlen. Ähnlich antwortete 2012 der Präsident des Bundesarchivs auf meine Anfrage.[1]
Wer aber, so ist zu fragen, hat nicht im weiteren Familienkreis einen, der von der Norm abweicht? Ist das eine Schande? Ist es nicht vielmehr schändlich, die Namen von Opfern der Gewaltherrschaft zu unterschlagen? Ich meine, es sind vor allem die Namen der Toten, an die heute erinnert werden muss. Die Behinderten, Geistesschwachen und Krüppel, die alleingelassen wurden und sterben mussten, waren keine anonymen Unpersonen, deren Namen unterhalb der Schamgrenze liegen oder unter das Arztgeheimnis fallen. Sie waren Menschen, die vielleicht nicht arbeiten, aber lachen, leiden und weinen konnten – jeder Einzelne von ihnen eine unverwechselbare Persönlichkeit.
Es ist an der Zeit, die Ermordeten namentlich zu ehren und ihre Lebensdaten in einer allgemein zugänglichen Datenbank zu nennen. Erst dann wird den lange vergessenen Opfern ihre Individualität und menschliche Würde wenigstens symbolisch zurückgegeben. Die wehrlosen, heimtückisch getöteten, chronisch kranken, die verwirrten, die körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen, die aus vielerlei Gründen, oft einfach wegen ihrer Armut und Verlassenheit, in Anstalten leben mussten, sollten nicht länger der Geheimhaltung unterworfen werden. Als eine der wenigen hat Sigrid Falkenstein das verschämte Schweigen im Jahr 2012 gebrochen und in ihrem beeindruckenden Buch »Annas Spuren. Ein Opfer der NS-›Euthanasie‹« das Schicksal ihrer Tante Anna Lehnkering beschrieben, die am 7. März 1940 in der Gaskammer Grafeneck sterben musste.
Dem entspricht, dass einzelne Nachfahren der Ermordeten immer häufiger Nachforschungen anstellen. So verdoppelte sich die Zahl der Nachfragen von Familienangehörigen, die an die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein gerichtet wurden, vom Jahr 2011 zum Jahr 2012 von 48 auf 95.[2] (Im Keller der Anstalt Sonnenstein wurde seinerzeit eine Gaskammer eingebaut, in der zwischen Juni 1940 und August 1941 insgesamt 13720 psychisch Kranke starben.) Gemessen an den vielen Toten mögen manche die Zahl der Anfragen für gering halten, aber das Interesse und die innere Haltung beginnen sich merklich zu verändern. Dazu beigetragen hat gewiss auch, dass in der einschlägigen Literatur nicht mehr hauptsächlich die Mörder im Vordergrund stehen, sondern immer stärker die Ermordeten. Als Beispiel kann das liebevoll gemachte Buch von Boris Böhm und Ricarda Schulze gelten »› … ist uns noch allen lebendig in Erinnerung‹. Biografische Porträts von Opfern der nationalsozialistischen ›Euthanasie‹-Anstalt Pirna-Sonnenstein« (2003), ebenso der bewegende, im Selbstverlag veröffentlichte Lebensbericht von Elvira Manthey (geborene Hempel) »Die Hempelsche. Das Schicksal eines deutschen Kindes, das vor der Gaskammer umkehren durfte« (1994). Aus beiden Büchern zitiere ich im Kapitel »Berichte aus dem Archipel Gaskammer«.
Von solchen Lektüren angeregt, fragte ich die Leserinnen und Leser der Berliner Zeitung und der Frankfurter Rundschau in einer Kolumne vom 1. September 2012: »Wissen oder ahnen Sie etwas von einem solchen ermordeten Verwandten in Ihrer Familie? Wäre es nicht gut, Sie könnten einfach in einer Gedenkdatei nachschauen und sich Gewissheit verschaffen? Ist es nicht ein Gebot der Menschlichkeit, den Ermordeten wenigstens ihre Namen zurückzugeben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung.«
Ich erhielt ausnahmslos positive Antworten. Einige davon seien hier wiedergegeben. Die Leserin Maili Hochhuth schrieb: »Die Kolumne hat mich nachdenklich gemacht. Mir fiel ein, dass mein Vater vor Jahren von der Ermordung einer Großtante erzählte, die in einer psychiatrischen Klinik gelebt hatte. Nachforschungen in den Familienunterlagen brachten keine Hinweise auf das Schicksal dieser Großtante. Auch in unserer Familie sprach und schrieb man offensichtlich nicht darüber. Ich möchte es sehr unterstützen, dass eine allgemeine Gedenkdatei mit Namen (ähnlich der für jüdische Menschen) für Opfer der ›Euthanasie‹ eingerichtet wird.«
Lothar Wiese berichtete: »Auch ich stamme aus einer Familie, welche in der NS-Zeit ganz direkt und mit aller Brutalität von diesen Euthanasiemordaktionen betroffen war. Das Opfer war meine Großmutter mütterlicherseits. Sie litt an Schizophrenie. Leider weiß ich bis heute nur sehr wenig aus dem Leben dieser Frau, das wenige, von dem ich da Kenntnis habe, hat meine Mutter mir vor vielen Jahren mal erzählt. Meine Großmutter hieß Hilde Ströver, geboren wurde sie in Dortmund, so zwischen 1905 und etwa 1908 als das älteste von zwei Kindern einer Bergarbeiterfamilie. (…) Irgendwann, so Anfang der 1940er-Jahre muss sie dann psychisch krank geworden sein, sie veränderte sich zusehends, sie begann auffällig zu werden. So weckte sie einmal spätnachts ihre beiden Kinder und rannte in Panik nur im Nachthemd mit den völlig verängstigten zwei Mädchen auf einen Friedhof. Ähnliche Dinge wiederholten sich, und natürlich fielen solche Vorkommnisse auch den Nachbarn irgendwann auf. Und dann dauerte es nicht mehr sehr lange, bis gewisse Ämter und Behörden aktiv wurden. Sie wurde letztendlich eingewiesen, in eine entsprechende ›Klinik‹, angeblich irgendwo in der Nähe von Regensburg. Dort endete ihr Leben, gerade einmal mit Mitte 30 irgendwann im Laufe des Jahres 1943. Ihr Vater hat noch versucht, seine Tochter aus dieser Todesklinik herauszubekommen, es war vergeblich.«
Rainer Assmann teilte über seinen Urgroßvater Emil Saefkow mit: »Nach Recherchen zu meinem Urgroßvater, der 1943 in der Nervenheilanstalt Ueckermünde offensichtlich diesem Programm zum Opfer fiel, nach Kontakten zur heutigen Klinik und ihrem Chefarzt Dr. Kliewe, der uns half, alte Krankenakten ausfindig zu machen, haben wir uns zum 65. Todestag auf den Weg nach Ueckermünde gemacht und mit unseren 16- und 18-jährigen Söhnen sowie den Eltern an Ort und Stelle an ihn gedacht – eine sehr tiefgehende und eindrückliche Erfahrung.«
Der Blogger »sg« schrieb zu meiner Frage: »Ich bin sehr dafür, auch diesen – in der Tat von vielen Familien wenig gewürdigten – Opfern der Nazi-Diktatur einen Namen zu geben. Ich habe das in dem Artikel beschriebene Verhalten in meiner eigenen Familie erlebt beziehungsweise erlebe es noch. Eine Schwester meiner jetzt 98-jährigen Mutter wurde 1942 im Alter von knapp 30 Jahren wegen manisch-depressiven Verhaltens zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik bei Berlin gebracht. Nach vier Tagen erhielten ihre Eltern die Nachricht, dass sie an Herzversagen verstorben sei. Da sie aber körperlich völlig gesund war, liegt der Verdacht eines Euthanasiemordes außerordentlich nahe. Allerdings wollte damals niemand in der sehr weitläufigen Familie (meine Mutter hatte elf Geschwister) diesem Verdacht nachgehen. Auch die Eltern meiner Tante, zermürbt von Bombenangriffen und der Sorge um die depressive Tochter, wollten (soviel ich weiß) keine Untersuchungen des plötzlichen Todes in die Wege leiten – aus einem Gefühl der Schande heraus, aus Überforderung oder aus berechtigter Angst? Das wissen wir nicht. Von den zahlreichen Nachkommen in dieser Familie hat meines Wissens bisher noch niemand meiner Generation Nachforschungen angestellt, obwohl es uns allen bekannt und selbstverständlich erscheint, dass unsere Tante von den Nazis ermordet wurde. Ich selbst habe das – unter anderem aus Rücksicht auf meine Mutter, die das Thema immer abwehrte – auch nicht getan. Erst jetzt hat ihre Enkelin (unsere Tochter) sich bemüht, Fakten und Erinnerungen zu sammeln und das Geschehen aufzuarbeiten. Meine Mutter hat trotz ihres hohen Alters noch ein sehr gutes Gedächtnis und steht ihr für Interviews zur Verfügung, und es gibt Unterlagen beziehungsweise Listen, auf denen das Opfer und ihr Transport von einer Klinik zu einer weiteren namentlich verzeichnet ist. Jetzt endlich überlegen wir (verschiedene Nachkommen des Opfers), auf welchem Weg und mit welchen Mitteln wir unserer Tante gedenken können. Eine Gedenkdatei, wie im Artikel vorgeschlagen, wäre eine Möglichkeit, die Verlegung eines Stolpersteines eine weitere.«
Jürgen F. Bollmann teilte mit: »Unsere Großmutter, Hedwig Minna Schuster, ist nach den Recherchen der Gedenkstätte Sonnenstein am 12. November 1940 dort vergast worden (in der Sterbeurkunde steht als Datum der 21. November – neun Tage, für die das Regime länger die Zahlung der Krankenkasse eingesteckt hat, was wohl in solchen ›Fällen‹ üblich war). Bis 1995 haben meine Eltern und Tanten darüber mit uns Kindern nicht gesprochen. Erst nach ihrem Tod bin ich einer Intuition folgend den Dingen nachgegangen. 1995 konnte ich aus Dresden keine Auskunft über Sonnenstein als Euthanasiestation erhalten. Eine Zeitungsnotiz über die Eröffnung der Gedenkstätte 2001 und mein anschließender Besuch dort haben mir dann Gewissheit verschafft, dass meine Großmutter wie die Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler und der als Kriegsdienstverweigerer inhaftierte Justitiar der Bekennenden Kirche, Martin Gauger, in Sonnenstein noch am Tag ihrer ›Anlieferung‹ aus Tschadraß (bei Leipzig) ermordet worden ist. Das einzige Papier, das wir von ihr neben der Sterbeurkunde gesehen haben, ist der ›Lieferschein‹ über den Transport.«
Solche Briefe und zuvor schon Gespräche mit Nachkommen von Opfern der Euthanasiemorde bestärkten mich bei der Arbeit an diesem Buch. Es reicht nicht, auf der einen Seite die vielen Opfer zu beklagen und auf der anderen rund 500 Nazitäter als gewissenlose Ideologen, Bösewichte oder Mörder im weißen Kittel zu verteufeln. Auf Dauer bedeutsam, vielleicht lehrreich bleibt die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen, nach jener Vielzahl von Menschen, die zwischen den unmittelbaren Mördern und den Ermordeten standen. Deshalb entschied ich mich für den mehrdeutigen Buchtitel »Die Belasteten«. Das Wort deutet nicht auf die Mörder, sondern auf die Ermordeten. Es führt zum »erblich« oder »psychisch Belasteten« und zu dessen »belasteter Familie«; es enthält Anklänge an Begriffe wie »Lästige«, »Ballastexistenzen« und »Soziallasten«, aber auch an Menschen, die jemandem »zur Last fallen« oder – heutzutage überwiegend umgekehrt formuliert – »niemandem zur Last fallen möchten«. Der Titel »Die Belasteten« umfasst die Ermordeten, aber auch die »Lebenslast« der Angehörigen und das damit verschwisterte Bedürfnis nach »Entlastung«, nach individueller und kollektiver »Befreiung von einer Last«.
Aus dem Umkreis meiner Familie weiß ich von zwei gegensätzlichen Geschichten, die mit den Euthanasiemorden zusammenhängen. Die eine handelt von Martha Ebding, geboren 1906, gestorben 1957 in den Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. Sie litt an schweren, ihr Wesen verändernden epileptischen Anfällen. Ihren Nichten erschien sie als »schmale, graugekleidete, düstere, unheimliche Gestalt«. Sie war in den Korker Anstalten untergebracht. Die Schwestern dort warnten die Verwandten rechtzeitig vor den Abtransporten, und ihr Bruder, Pfarrer Friedrich Ebding, reagierte sofort, nahm sie aus der Anstalt und brachte sie später zurück. Ende 1944 schrieb er: »Unsere liebe Martha konnten wir am 22. September 1944 nach Bethel bei Bielefeld bringen. Bethel ist einzig, und wir waren immer wieder froh, Martha so gut untergebracht zu wissen …« Des ungeachtet blieb das Thema Tante Martha nach der familiären Überlieferung »stets tabu«.
Die zweite Geschichte erzählte mir meine Mutter kurz vor ihrem Tod 2008. Mit aller Absicht kam sie auf ihre verstorbene Freundin Annemarie zu sprechen. Diese habe seinerzeit ihr behindertes Baby in eine Euthanasieanstalt gegeben, auf Druck ihres Ehemanns, und immer sehr darunter gelitten. Ich weiß nicht, ob das Kind ein Mädchen oder Junge war. Es hieß mit Nachnamen Kröcher. Bislang sind meine Nachforschungen gescheitert.
Beide, Tante Martha, die Schwester eines angeheirateten Onkels, und das Kind Kröcher fallen nicht in die Kategorie engere Verwandtschaft. Wählt man nur letzteren Bezugspunkt, dann ist zumindest jeder achte heutige Deutsche oder Österreicher, der älter als 25 ist und dessen familiäre Wurzeln im ehemaligen Reichsgebiet bis 1900 zurückreichen, mit einem Menschen direkt verwandt, der zwischen 1939 und 1945 als »nutzloser Esser« ermordet wurde. Welche – konservativ gewählten – Faktoren führen zu einem solchen Ergebnis? Die 200000 Opfer der Euthanasie starben zwischen 1940 und 1945; sie waren im Durchschnitt 45 Jahre alt.[3] Das heißt, sie waren um 1897 geboren worden. Mithin gehört ein 25-jähriger Nachkomme im Jahr 2012 der vierten Generation an. Aus dessen Sicht wurde ein Urgroßverwandter ermordet.
Nehmen wir ein konstruiertes Beispiel. Ich nenne den fiktiven 1897 geborenen Vorfahren Wilhelm und schreibe diesem drei Geschwister zu. Alle vier bilden die erste Generation. Diese Generation brachte es auf durchschnittlich 2,1 Kinder. Der unschöne statistische Fachbegriff heißt Kohortenfertilität. Demnach besteht die zweite, durchschnittlich 1927 geborene Generation aus 8,4 Personen. Deren durchschnittliche Nachkommenschaft betrug ebenfalls 2,1, also 18 weitere Nachkommen von Wilhelm. Die durchschnittliche Nachkommenschaft der dritten, um 1957 geborenen Generation sank auf 1,4 Kinder. Um 1987 wurden demnach 25 Urenkel, Urgroßnichten und -neffen Wilhelms geboren. Ich unterstelle, dass die Angehörigen der vierten und dritten Generationen noch leben, desgleichen noch zwei aus der zweiten, um 1927 geborenen Generation, und dass die 25-Jährigen der vierten Generation im Jahr 2012 noch keine Kinder hatten. Zu dieser Zeit lebten demnach 45 direkte Nachkommen des Euthanasieopfers Wilhelm. Geht man von 200000 Menschen aus, die diesen Morden zum Opfer fielen, dann sind diese mit rund zehn Millionen heute lebenden (nicht später zugewanderten) Deutschen (und Österreichern) in gerader Linie verwandt.
Das Ergebnis der vorsichtig kalkulierten Modellrechnung vervielfachte sich sofort, würde man nicht nur Wilhelms drei Geschwister, sondern auch noch dessen um 1896 gleichfalls geborenen zehn Cousinen und Cousins einbeziehen und, wie im Fall der ausnahmsweise geretteten Tante Martha, die angeheirateten Familienmitglieder. Bis heute sprechen die wenigsten Familien über die verschwundenen Verwandten, oft sind sie schon lange vergessen.
Inzwischen geben viele psychiatrische Kliniken Auskünfte aus ihren alten Akten, andere Informationen sind in öffentlichen Archiven zugänglich. Dort, wo einst Gaskammern standen, erstellen und ergänzen die Mitarbeiter der Gedenkstätten Hadamar, Bernburg, Pirna-Sonnenstein, Grafeneck und Hartheim Datenbanken mit den Namen der Toten. Solche Namen werden bereits in Büchern auch für einzelne, oft katholische Anstalten sorgfältig verzeichnet. Stellvertretend sei die beeindruckende Dokumentation von Herbert Immenkötter genannt: »Menschen aus unserer Mitte. Die Opfer von Zwangssterilisierung und Euthanasie im Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg«. Auch auf der Internetseite www.gedenkstaettesteinhof.at findet man die Namen und Lebensdaten von 789 Kindern, die zwischen 1941 und 1945 in der Abteilung Am Spiegelgrund der Wiener psychiatrischen Klinik Am Steinhof ermordet wurden, darunter auch Kinder aus Deutschland.
Zu einer derart schlichten, jedoch klaren Form, den Opfern Respekt und Anerkennung zu zollen, konnte sich der Präsident des deutschen Bundesarchivs bis Ende 2012 noch nicht entschließen. Die Namen und Geburtsdaten von 30076 Menschen, die in der ersten Phase der Morde, also bis August 1941, in Gaskammern starben, kann man auf der Webseite www.iaapa.org.il/46024/Claims#german nachsehen. (Vorsicht, die alphabetische Reihenfolge wird nicht immer exakt eingehalten.) Die Krankenakten zu den in dieser Datei aufgeführten Namen verwahrt das Bundesarchiv im Bestand R 179. Wie eine Sprecherin des Archivs mitteilte, stellte Hagai Aviel aus Tel Aviv die Daten illegal ins Netz. Doch könne ein Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz, diese Daten zu entfernen, nicht umgesetzt werden, weil es kein Rechtshilfeabkommen mit Israel gebe.[4] Der Staat Israel hat dafür viele gute Gründe. Auf der genannten Internetseite erläutert Aviel, warum er ein deutsches Gesetz wegen höherrangiger Rechtsgüter breche. (Dieselbe Erklärung auf Deutsch: www.psychiatrie-erfahrene.de/explanation.html.)
Ich empfehle, die Piraterie Aviels um ihrer Legitimität willen nachträglich zu legalisieren. Das heißt, die Daten der Toten offiziell ins Netz zu stellen und laufend zu ergänzen. Dann könnten interessierte Familien, Historiker und Heimatforscher Unterlagen und Fotos beisteuern, die ebenfalls mit der Datei zu verbinden wären. So würde mit der Zeit ein sich frei entwickelndes Denkmal für die Toten entstehen. Doch wahrt der Präsident des Bundesarchivs noch Zurückhaltung und teilt mit, die »kompletten persönlichen Angaben« der ermordeten Kranken könnten nur dann veröffentlicht werden, sofern die nächsten Verwandten zustimmten. Das zu erfragen sei jedoch verwaltungstechnisch unmöglich.
Eine solche in Deutschland keinesfalls allgemeine Haltung zwingt zum Einspruch, wie die zitierten Leserbriefe beweisen. Schließlich bleiben die Ermordeten Personen eigenen Rechts. Sie sind Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Sie wurden getötet, weil sie als »leere Menschenhülsen«, als »Wesen auf niedrigster tierischer Stufe« galten. Sie sollten möglichst spurlos verschwinden. Ihr Tod wurde von Standesbeamten mit falschen Angaben beurkundet, die Todesursache von Ärzten gefälscht. Es gilt, die Würde der am Ende nurmehr mit Nummern gezeichneten, vorsätzlich entpersönlichten, vergasten und verbrannten Menschen wiederherzustellen. Sie sollen nicht länger von Amts wegen totgeschwiegen werden. Dazu gehört zuallererst die öffentliche Nennung ihrer Namen. Das steht den Toten als individuelles Grundrecht zu, unabhängig davon, was ihre Nachfahren dazu meinen könnten.
Gewidmet ist dieses Buch meiner Tochter Karline. Kurz nach ihrer Geburt 1979 erkrankte sie an einer Streptokokkeninfektion, der heute mit Hilfe einer Routineuntersuchung vorgebeugt wird. Karline bekam eine Gehirnentzündung und erlitt einen schweren zerebralen Schaden. Bei aller Hilfsbedürftigkeit lacht und weint sie, zeigt Freude und schlechte Laune, liebt Musik, gutes Essen, gelegentlich etwas Bier und Gäste. Doch einfach hat sie es im Leben nicht. Karline brachte mich bald nach ihrer Geburt auf das zeitgeschichtliche Thema »Euthanasiemorde«, das mich seither immer wieder beschäftigt hat.
Hinweise zur Lektüre
Das vorliegende Buch entstand im Verlauf von 32 Jahren. Dazu teile ich in der Nachbemerkung einige Einzelheiten mit. Die vollen Namen, manchmal auch die Lebensdaten derer, die den Euthanasiemorden zum Opfer fielen, nenne ich, sofern sie mir bekannt sind, nur dann nicht, wenn sie unauffindbar blieben oder ausdrückliche Verbote bestehen. Ich handhabe die Namensfrage genauso, wie das im Fall ermordeter Juden oder politisch Verfolgter üblich ist.
Die Schreibweise in den Zitaten gleiche ich den derzeit gültigen Regeln an, offenkundige Schreibfehler korrigiere ich stillschweigend, Abkürzungen schreibe ich aus. Abweichend davon glätte ich Selbstzeugnisse von Anstaltsinsassen nur insoweit, als es der Lesbarkeit dient, gebe in Klammern gesetzte Verständnishilfen und ergänze die Interpunktion.
Solche Texte enthalten Lebensäußerungen von Menschen, die ihre Verfolger als »geistig tot« einstuften, die es jedoch vermochten, ihre Wahrnehmungen, Ängste und Nöte in bewegender Weise aufzuschreiben. Andere Insassen psychiatrischer Einrichtungen konnten zwar nicht schreiben, sich jedoch so klar ausdrücken, dass andere Menschen aufschrieben, was die später Ermordeten mitgeteilt und gefühlt hatten. Quellen, in denen die Ermordeten zu Wort kommen, sind mir wichtig. Ich versammle sie in den Kapiteln »Berichte aus dem Archipel Gaskammer«, »Letzte kindliche Lebenszeichen« und »Nachrichten aus den Sterbehäusern«.
Seinerzeit gebräuchliche Begriffe wie Euthanasie, Aktion T4, Krüppel, Idiot, Schwachsinniger, Erbgesundheit, Irrer, Geisteskranker usw. setze ich im Vertrauen auf meine Leserinnen und Leser nicht in Anführungszeichen. Den Begriff Euthanasie verwende ich an keiner Stelle im Wortsinn von »schöner Tod«. Zu meinem Bedauern verfüge ich über kein Wort, das ich unbeschwert benutzen könnte, um die Ermordeten insgesamt und frei von negativen Beiklängen zu bezeichnen. Deswegen behelfe ich mich mit Wörtern wie Opfer, Behinderte, psychisch Kranke, Demente, geistig Gebrechliche oder von Geburt an Geschädigte. Solche Umschreibungen sind nicht wesentlich besser als Geisteskranker, Idiot oder Schwachsinniger – Begriffe übrigens, die man in den Zeiten, als sie eingeführt wurden, stets als Versuch verstand, derbe umgangssprachliche Bezeichnungen im Geiste von Wissenschaft und Humanität zu ersetzen. Doch vereinnahmte der Volksmund die neuen, zunächst neutral erscheinenden Fachtermini schnell und konnotierte sie mit verächtlichen Untertönen. In der Gegenwart werden die Begriffe Opfer, Spastiker und Behinderter zunehmend in Schimpf- und Schmähwörter verwandelt.
Ich halte nichts davon, von Menschen zu sprechen, »die als schizophren, manisch-depressiv oder epilepsiekrank diagnostiziert wurden«, oder andere gewundene, scheinbar korrekte Ausdrucksweisen zu erfinden. Die meisten Opfer der Euthanasie litten an realen, nicht an herbeidiagnostizierten Problemen, die allermeisten erfüllten das zentrale Kriterium der Morde: Sie konnten nicht hinlänglich produktiv arbeiten, sie verbrauchten Gelder, banden Ressourcen und Arbeitskräfte. Deshalb mussten sie sterben. Als Klaus Hartung und ich 1987 den Text für das Berliner Denkmal entwarfen, mit dem seit 1989 die Toten der Euthanasie geehrt werden, umschrieben wir diese so: »Die Opfer waren arm, verzweifelt, aufsässig oder hilfsbedürftig. Sie kamen aus psychiatrischen Kliniken und Kinderkrankenhäusern, aus Altersheimen und Fürsorgeanstalten, aus Lazaretten und Lagern.« Der Text kann sich, denke ich, noch sehen lassen, ein Wort, das die Ermordeten insgesamt in freundlicher Weise umschließt, ist damit nicht gefunden.
Wien und Berlin, November 2012
Für die Angehörigen: eine amtsgeheime Maßnahme
Des Weiteren wandte sich Morell der Frage zu, wie das Projekt durchgeführt werden könne. Er empfahl eine »staatliche Aktion« und die volle Übernahme der Kosten seitens der Berliner Zentralbehörden. Zwar hatte er seine Empfehlungen mit dem Paragraphen 1 eines künftigen Gesetzes zur aktiven Sterbehilfe begonnen, doch konzipierte er an dieser Stelle nicht etwa den Paragraphen 2, sondern warf die grundsätzliche Frage auf, ob ein Euthanasiegesetz überhaupt zweckmäßig sei: »Soll die Maßnahme zur Grundlage ein veröffentlichtes Gesetz haben« oder besser »im Wege amtsgeheimer Anordnung durchgeführt werden?« Die Antwort hatte er bereits parat: »Der letztere Weg erscheint zunächst unverständlich. Ich halte es aber doch für gerechtfertigt, ihn in diesem Zusammenhang zu behandeln. Er berührt ein Moment, das in Meltzers Statistik zum Ausdruck kommt.«
Wer war Meltzer? Was hatte es mit dessen Statistik auf sich? Obermedizinalrat Ewald Meltzer (1869–1940) leitete knapp 30 Jahre lang den Katharinenhof, eine sächsische Landespflegeanstalt für bildungsunfähige schwachsinnige Kinder in Großhennersdorf (Oberlausitz). In dieser Eigenschaft, aus freien Stücken, aber aus gegebenem Anlass hatte er 1920 eine Befragung zum »Problem der Abkürzung ›lebensunwerten‹ Lebens« durchgeführt und die Ergebnisse fünf Jahre später veröffentlicht. Unmittelbar vor der Umfrage war die bereits genannte, damals viel diskutierte Streitschrift »Die Vernichtung lebensunwerten Lebens« erschienen. In dieser Situation schickte Meltzer den Eltern der 200 ihm anvertrauten Kinder den folgenden Fragenkatalog:
»1. Würden Sie auf jeden Fall in eine schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres Kindes einwilligen, nachdem durch Sachverständige festgestellt ist, dass es unheilbar blöd ist?« Wer diese Frage mit Nein beantwortete, hatte sich den beiden folgenden Zusatzfragen zu stellen: »2. Würden Sie diese Einwilligung nur für den Fall geben, dass Sie sich nicht mehr um Ihr Kind kümmern können, zum Beispiel für den Fall Ihres Ablebens? 3. Würden Sie die Einwilligung nur geben, wenn das Kind an heftigen körperlichen und seelischen Schmerzen leidet?« Die vierte und letzte Frage lautete: »Wie stellt sich Ihre Frau zu den Fragen 1–3?« In einem Nachsatz versicherte Anstaltsdirektor Meltzer den Eltern, die Fragen seien theoretischer Natur: »Ihr Kind selbst ist so weit gesund und munter. Sollten Sie durch vorstehende Fragen etwa Sorge um das Leben Ihres Kindes haben, so sei Ihnen zur Beruhigung gesagt, dass den hier verpflegten Kindern auch weiterhin die gleiche gewissenhafte Pflege zuteilwird wie bisher.« Selbst wenn später einmal ein Gesetz ergehen sollte, so fuhr Meltzer fort, »das es gestatten würde, das Leben solcher Kinder abzukürzen, so könnte dies doch nie ohne Einholung der Genehmigung der Eltern geschehen«. Das Leben eines Menschen abkürzen – diese beschönigende Wendung hatten Binding und Hoche in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeführt.
Von den 200 Befragten sandten 162 den Fragebogen ausgefüllt zurück. Davon antworteten 73 Prozent (119) auf die erste Frage mit Ja und 27 Prozent (43) mit Nein. Doch waren unter den 43 Eltern, darunter einige wenige Vormünder, die hinter die erste Frage (Zustimmung »in jedem Fall«) ein Nein setzten, nur 20 Personen, die auch die beiden folgenden spezifizierten Fragen mit Nein beantworteten. Ausdrücklich und uneingeschränkt lehnten es lediglich zehn Prozent der Befragten ab, in die »schmerzlose Abkürzung des Lebens« ihres in der Anstalt gut untergebrachten Kindes einzuwilligen. Ewald Meltzer, der in den 1920er-Jahren die Sterilisierung behinderter und geisteskranker Pfleglinge befürwortete, wollte mit seiner Umfrage Argumente gegen den modisch gewordenen Euthanasiegedanken gewinnen. Angesichts der Resultate stellte er irritiert fest: »Das hatte ich nicht erwartet. Das Umgekehrte wäre mir wahrscheinlicher gewesen.«
Einige Befragte begründeten ihre Haltung und auch ihre Zweifel. Darunter hob Meltzer eine Gruppe ähnlich argumentierender Eltern hervor, deren Aussagen knapp 20 Jahre später jene Männer besonders interessierten, die in der Kanzlei des Führers über Maß und Form der geplanten Euthanasiemorde und deren gesellschaftliche Implementierung nachdachten. »Sehr zu denken gibt doch auch die Tatsache«, heißt es in Morells Text, »dass eine ganze Reihe der Jasager folgendermaßen sich ausdrückt: ›Was soll ich als alleinstehende Frau machen; stelle es zu Ihrer Verfügung, machen Sie, was Sie für am besten halten! Richtiger hätten Sie mir das gar nicht gesagt und hätten das Kind einschlafen lassen.‹« Eine andere Mutter präzisierte ihre Zustimmung mit dem Hinweis: »Als frühere Krankenpflegerin halte ich die Anfrage für verfehlt, da es den Eltern dadurch nur schwer gemacht wird«; »ihr Beruf und christliches Gefühl« sagten dieser Frau, »dass alle unheilbaren Patienten von ihren Leiden schmerzlos erlöst werden sollten und den Angehörigen dann nur das Ableben mitgeteilt werden sollte«. Ähnlich sprachen sich andere Angehörige aus: »Wären lieber nicht mit dieser Frage behelligt worden. Bei einer plötzlichen Todesnachricht würden wir uns drein ergeben haben. Wie wohl wäre dem Kinde schon lange, wenn im Anfangsstadium etwas dafür getan worden wäre.« »Lieber wäre mir’s gewesen, ich hätte nichts davon gewusst.« »Im Prinzip einverstanden; nur dürften Eltern nicht gefragt werden; es fällt ihnen doch schwer, das Todesurteil für ihr eigen Fleisch und Blut zu bestätigen. Wenn es aber hieße, es wäre an einer x-beliebigen Krankheit gestorben, da gibt sich jeder zufrieden.«
Meltzer hatte zu diesen Antworten bemerkt: »Gern will man sich selbst und vielleicht auch das Kind von der Last befreien, aber man will seine Gewissensruhe haben.« Selbst unter den wenigen Eltern, die alle drei Fragen mit Nein beantwortet hatten, entdeckte Meltzer in den schriftlichen Begründungen noch manche, die »diese ganze Gewissensfrage auf andere Schultern abwälzen« wollten. Zu den Gründen, die hinter solchen Antworten selbst der entschiedenen Neinsager standen, bemerkte er: »Der Arzt mag es tun, wenn er seiner Sache sicher ist, und mag uns dann benachrichtigen, dass das Kind an der oder jener Krankheit gestorben ist; wir aber wollen unsere Hände in Unschuld waschen.«
Morell folgerte daraus in seiner Vorlage für Hitler: Selbst unter den wenigen Neinsagern hätten die meisten »nichts gegen die Tötung selbst einzuwenden, sie wollen nur ihr Gewissen nicht belasten!!!«. Die große Mehrheit der Jasager brauchte Morell nicht weiter zu kommentieren, doch interessierten ihn jene Angehörigen, die eigentlich für die »Erlösung« ihres Kindes waren, aber andererseits nicht über Leben und Tod entscheiden wollten: »Mehrere Eltern bringen zum Ausdruck: Hätten sie es nur gemacht und gesagt, dass unser Kind an einer Krankheit gestorben sei.« Morell folgerte: »Das könnte man hier berücksichtigen« und man dürfe »nicht denken, dass man keine heilsame Maßnahme ohne das Placet des Souveräns Volk ausführen« könne.[1]
Später legitimierten die Organisatoren der Euthanasie ihr Morden immer wieder mit Meltzers Umfrage. Das belegen zahlreiche Dokumente. Eines davon findet sich in dem 1942 fertiggestellten Film »Dasein ohne Leben«, der für den Massenmord warb, im Auftrag der Kanzlei des Führers gedreht worden war, aber niemals öffentlich gezeigt wurde. Neben Dokumentaraufnahmen aus verschiedenen Irrenhäusern enthielt er Spiel- und Trickpassagen, darunter die folgende:
Der Direktor einer großen Heil- und Pflegeanstalt lehrt im Nebenamt als außerplanmäßiger Professor an einer Universität. Während einer Vorlesung verwandelt er sich gewissermaßen in Ewald Meltzer und berichtet von seiner früheren Umfrage unter den Eltern unheilbarer Pfleglinge. Mit ansteigender Stimme verkündet er, dass 73 Prozent der Befragten für die »Erlösung« ihrer Kinder votiert hätten. Zum weiteren Aufbau der Szene heißt es im Drehbuch: Der Kopf des Professors wird herangezoomt, »kommt nah und näher, wird überlebensgroß, jetzt füllen nur noch Augen und Stirn das Bild, darauf blendet eine Montage Sätze aus der Originalumfrage ein, vermischt mit handschriftlichen Antworten: ein Stoß von Briefen. Aus dem Durcheinander springt ein Satz auf in flammender Schrift: ›Eine Mutter schrieb: Nicht fragen – handeln!‹ Hinter der Montage steht der Kopf des Professors. (Die Musik endet in einem Furioso.)«[2]
Der Direktor einer Hamburger Kinderklinik, der zwischen 1941 und 1945 mindestens 56 geschädigte kleine Kinder hatte töten lassen, verteidigte sich hernach mit dem Hinweis auf dieselbe Umfrage. Die bei Meltzer angeführten Antworten und Prozentzahlen führte er während seiner Vernehmung im Januar 1946 fehlerfrei an und leitete daraus zu seiner Entlastung ab: »Erwähnen möchte ich nochmals, dass viele Eltern von sich aus den Wunsch zur Erlösung aussprachen.« Doch sei es seiner Ansicht nach »als unmenschlich abzulehnen«, den Eltern, speziell den Müttern, »eine solch schwierige Entscheidung in voller Konsequenz zu übertragen«, deswegen müsse der Arzt einen erheblichen Teil der Verantwortung auf seine Schultern laden, um die Gewissensnot der Mütter zu lindern.[3]
Neben den insgesamt eindeutigen Willensbekundungen der Eltern ließen zwei weitere Faktoren die Umfrage für den 1939 vorgesehenen Staatsgebrauch als hilfreich erscheinen. Meltzer hatte erstens Eltern befragt, deren Kinder in einer evangelischen Anstalt untergebracht waren. Demnach konnte für die Angehörigen angenommen werden, dass sie zumindest Reste religiöser Bindung aufwiesen. Zweitens waren die Väter der Pfleglinge überwiegend sächsische Arbeiter, die, so durfte vermutet werden, während der Weimarer Jahre eher links gewählt hatten. Von dieser Seite war demnach wenig Widerspruch zu erwarten, vorausgesetzt, die Väter und Mütter würden nicht mit Gewissensfragen konfrontiert, die sie lieber anderen zuschieben wollten. In diesem Sinn hatte zum Beispiel ein Bergarbeiter, dessen beide Söhne im Katharinenhof gepflegt wurden, auf Meltzers Fragen erwidert: »Ich gestehe offen, dass, als vor zweieinhalb Jahren unsere hochveranlagte zwölfjährige Luise nach dreitägiger Diphterie an Herzlähmung gestorben war und auch die beiden Knaben erkrankten, sowohl ich wie auch meine Frau den beiden zu ihren Gunsten den gleichen schmerzlosen Heimgang gewünscht haben, wenn wohl wir gleichzeitig alles taten, um sie am Leben zu erhalten. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass für alle diese Kinder der Tod eine Wohltat bedeutet.«[4]
Für die Zwangssterilisierungen hatte die Regierung 1933 ein Gesetz veröffentlicht und eigenständige Erbgesundheitsgerichte einschließlich einer zweiten Instanz geschaffen. Über die dritte Instanz, einen Reichsgerichtshof für Erbgesundheit, wurde immer wieder debattiert. Im Fall der Euthanasie entschied sich Hitler anders. Nicht zuletzt auf Anraten Morells wollte er die Morde in gesetzlich nicht legitimierter und in nicht öffentlicher Weise durchführen lassen. Doch zielte das Verfahren nicht auf Geheimhaltung im Sinne strengster Abschirmung – es bestand in einem Angebot an das Volk, speziell an die Verwandten der künftigen Opfer, diese staatliche Maßnahme nicht näher zu hinterfragen, sie mit einem Schulterzucken in Kauf zu nehmen oder ihr stillschweigend zuzustimmen.
Die Todesursachen, die auf den Totenscheinen der alsbald Ermordeten standen, fälschten die Vollstrecker phantasievoll. Sie taten das, um den Angehörigen das Leben zu erleichtern. Desgleichen wollten sie den Angestellten von Krankenkassen und Fürsorgeverbänden, von Sterbegeld- und Krankenversicherungen und den sonst am Tod eines Menschen beteiligten Personen den Ausweg zwischen Nicht-Wissen-Wollen und Nicht-Wissen-Müssen offenhalten. Zu diesen Zwecken stand auf den Sterbeurkunden wahlweise: Grippe, Pneumonie, Hirnlähmung, Pneumonie bei Grippe, Erschöpfung, fieberhafte Bronchitis, akute Pneumonie, Lungenentzündung, Herzschwäche bei tobsüchtiger Erregung, Darmgrippe, genuine Epilepsie, progressive Paralyse, Arteriosclerosis cerebri, Pleuritis, Darmkatarrh, Marasmus, Enterokolitis, Darmverschlingung, Gesichtsfurunkel, Marasmus-Paralyse, Blutsturz, Schlaganfall, Altersschwäche, Bauspeicheldrüsenentzündung, Herzmuskelentartung, kruppöse Pneumonie, Herzmuskelschwäche, Angina, Blutvergiftung, Diphterie, Masern, Sepsis nach Masern, Miliartuberkulose der Lunge, Wasserkopf, Erschöpfung nach Anfällen, Tbc, allgemeine Leberschwellung, Entkräftung, Status epilepticus, doppelseitige Pleuritis, Bronchialkatarrh, Durchfall, Herzschwäche.
Für die Ärzte: ein Gesetzentwurf zur Sterbehilfe
Die frei erfundenen Angaben über die Todesursachen machten es Eltern, Geschwistern, Ehegatten und anderen Anverwandten einerseits leichter, den plötzlichen Tod eines Familienmitglieds als natürlich oder gottgegeben zu akzeptieren und sich andererseits in aller Stille zu sagen: Endlich hat unser schwer leidender Hans seinen Frieden gefunden und ist von allen Leiden erlöst. Auf solche Weise fanden sich die meisten Familien mit dem Tod ihrer oft schwierigen, immer wieder die Aufmerksamkeit und Kraft bindenden Lieben ab, ohne viel zu fragen. Von den Mördern verfasste Trostbriefe bestärkten den halb angebotenen, halb gewollten Selbstbetrug. In den standardisierten Schreiben hieß es an zentraler Stelle, sofern der Brief beispielsweise an die Eltern eines jungen Mannes ging: »Bei der geistigen, unheilbaren Krankheit Ihres Sohnes ist der Tod eine Erlösung für ihn und seine Umwelt.«[1]
Wie vage, doch hinreichend deutlich die Organisatoren der Euthanasie die arbeitsteilig mitwirkenden Ärzte und Pflegekräfte einwiesen, zeigt das Tagebuch einer jungen Ärztin, die in der Anstalt Andernach arbeitete: »Die Gerüchte wurden immer zahlreicher. Dienstlich erfuhren wir über die Aktion nichts, inoffiziell wurde vorausgesetzt, dass alle irgendwie bereits genügend orientiert seien. Pflegerinnen brachten aus Hadamar von ihren dortigen Verwandten (die Nachricht) mit, dass 60 bis 80 Kranke verbrannt wurden. Ein pharmazeutischer Vertreter erzählte, dass im ehemaligen Österreich nur noch eine Anstalt bei Graz existiere.« Hadamar war eine der sechs Anstalten, in denen Patienten mittels Gas ermordet und in einem Krematorium verbrannt wurden.
Als diese Ärztin selbst die Fragebögen ausfüllen und somit die Daten für die am Ende tödliche Auswahlprozedur liefern sollte, schrieb sie: »Da der Verdacht auftauchte, es handle sich hier – die Zettel kamen vom Ministerium des Inneren – um Dinge, die vielleicht oder wahrscheinlich mit der Beseitigung der Kranken zusammenhingen, wurde eines Tages die Lesart verbreitet, die ganze Sache sei eine rein statistische Angelegenheit, gewissermaßen zur Bestandsaufnahme der Kranken, womit vorderhand keine praktischen Folgerungen verbunden seien.«[2] Auch im Fall der Ärzte setzten die Berliner Geschäftsführer des Mordens auf Ausflüchte, auf Angebote zum Selbstbetrug und zur Betäubung des Gewissens – und das mit Erfolg.
Die Geheime Reichssache Euthanasie, die doch öffentlich war, bestand in einer Offerte an jeden einzelnen Volksgenossen, an die Verwandten der Opfer und an die mittelbar beteiligten Ärzte, Pfleger, Schwestern und Verwaltungsangestellten, sich individuell aus der Verantwortung zu stehlen. So konnten Millionen Deutsche ein uneingestandenes, nirgends dokumentiertes und das Gewissen erleichterndes Komplizentum eingehen. Allerdings verlangten nicht wenige Ärzte, die direkt mit der Exekution der Kranken und Behinderten befasst waren, nach Rechtssicherheit. Von Werner Catel, der als einer der führenden Pädiater über Leben und Tod Tausender Kinder entschied, ist das Wort überliefert: »Was wir hier tun, ist Mord.« Er und andere Ärzte drängten auf Legalität und gesetzlich verankerte Normen, während es den von Gefühlsschwankungen und Todeswünschen angefochtenen engeren Verwandten potentieller Opfer darauf ankommen musste, dass das Morden hinter angeblich kriegsbedingten Verlegungen, gefälschten Todesursachen und amtlichen Beileidsschreiben verborgen blieb.
Hitler und seine Mitarbeiter vermochten es, diesem nicht zu lösenden Konflikt über Jahre hinweg eine für alle Seiten erträgliche Form zu geben: Sie ließen das Sterbehilfegesetz von interessierten Ärzten diskutieren und ausformulieren, setzten es jedoch nicht in Kraft.[3] Entsprechend der Präambel betraf es »Menschen, die wegen einer unheilbaren Krankheit ein Ende ihrer Qual herbeisehnen oder infolge unheilbaren chronischen Leidens zum schaffenden Leben unfähig sind«. Die ersten beiden Paragraphen lauteten: »(1) Wer an einer unheilbaren, sich oder andere stark belästigenden oder sicher zum Tode führenden Krankheit leidet, kann auf sein ausdrückliches Verlangen mit Genehmigung eines besonders ermächtigten Arztes Sterbehilfe durch einen Arzt erhalten. (2) Das Leben eines Kranken, der infolge unheilbarer Geisteskrankheit sonst lebenslänglicher Verwahrung bedürfen würde, kann durch ärztliche Maßnahmen, unmerklich für ihn, beendet werden.«
So existierte das fertige Gesetz für die Vollstrecker und deren Gehilfen in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, Gesundheits- und Fürsorgeämtern und ließ diese ruhig schlafen. Umgekehrt schliefen die nächsten Verwandten der Opfer sehr viel eher ruhig und vermieden den Gewissenskonflikt mit ihrer weithin christlich geprägten Herkunftsmoral, wenn es kein veröffentlichtes Gesetz gab. Nur auf dieser Grundlage konnte gegenüber Eltern behinderter Kinder von Behandlung die Rede sein, wenn Todesspritzen gemeint waren, konnte gegenüber Ehefrauen von Syphilitikern oder Säufern von Verlegung aus Gründen der Reichsverteidigung gesprochen werden, wenn die Gaskammer das Ziel war. Wörter wie töten und morden mussten um der einverständlichen Beschönigungen willen vermieden werden. Die derart von Volk und Führung gemeinsam errichteten und mehrheitlich respektierten Tabus wurden in den meisten deutschen Familien für viele Jahrzehnte gewahrt.
Nachdem die Organisatoren der Euthanasie zwischen Januar 1940 und August 1941 mehr als 70000 wehrlose Menschen ermordet hatten, inspizierten sie im Herbst 1941 die deutschen Heil- und Pflegeanstalten, um Unterlagen für die Reorganisation des Anstaltswesens zu gewinnen. Dabei notierten sie auch, wie die Medizinaldezernenten und Anstaltsdirektoren die vorangegangene »Aktion«, also das Morden, bewerteten. Relativ häufig äußerten sich die Verantwortlichen ähnlich wie Ernst Lüdemann, über den es in einem Bericht heißt: »Während des Aufenthaltes in Rickling (Anstalt der Inneren Mission in Schleswig-Holstein) lernte ich auch den dortigen Anstaltsarzt Dr. Lüdemann kennen. (…) Er wies darauf hin, dass die Schwierigkeit eben deshalb entstünde, weil die ganze Aktion nicht durch ein Gesetz untermauert sei, (…) die Aktion sei ihm aus nordisch-germanischer Einstellung und seiner ärztlichen Tätigkeit verständlich und in vielen Fällen begrüßenswert, doch wie gesagt, mangelndes Gesetz, unzureichende Erfassung usw. Zu fördern wäre eine bessere Unterstützung im Volk durch die Propaganda der Bewegung.«[4]
Im Winter 1942/43 überprüfte eine siebenköpfige Kommission von Ärzten 110 sächsische Anstalten und deren Insassen und versuchte auch hier herauszufinden, wie weit »die Aktion« von den jeweiligen Leitern akzeptiert, abgelehnt oder begrüßt wurde. Im Abschlussbericht heißt es dazu: »Während unserer monatelangen Tätigkeit (…) gewannen wir den Eindruck, dass die Leiter der Anstalten beziehungsweise Heime, abgesehen von wenigen Klerikalen, zum Beispiel am katholischen Antoniusstift in Kamenz und der Epileptikeranstalt der Inneren Mission in Klein-Wachau, und von einzelnen Leitern der kleineren Heime im Zittauer Bezirk, dem Euthanasieproblem durchaus positiv gegenüberstehen. Nirgends wurden uns irgendwelche nennenswerten Schwierigkeiten gemacht; überall unterstützten uns die Anstalts- beziehungsweise Heimleitungen bei unserer Tätigkeit und stellten uns bereitwillig die vorhandenen Aktenunterlagen und Krankengeschichten (…) zur Verfügung. (…) Auch dort, wo man der Euthanasiefrage gegenüber aus religiösen Bedenken heraus negativ eingestellt ist, fanden wir keine nennenswerte Obstruktion.«[5]
Wie die ledige Mutter Frida Weiss ihren Sohn rettete
In den Berichten der Planungskommissionen findet sich eine Ausnahme: Hausvater Heinrich Hermann. Er leitete die Taubstummenanstalt Wilhelmsdorf bei Ravensburg und brachte die ärztlichen Kommissare als Einziger aus der Fassung. Empört rapportierten sie an ihre Berliner Vorgesetzten: »An der alten Anstalt, die nichts Besonderes bietet, interessiert nur der Hausvater. Dieser schickte die zuerst gesandten Meldebogen zurück, da er früher in der Anstalt Stetten war und daher Bescheid wusste, dass die Kranken ›getötet‹ – sein dauernder Ausspruch – werden sollten. Daraufhin veranlasste der Vorstand, da der Hausvater dies nicht mit seinem Wissen getan hätte, eine Beantwortung der Fragebogen durch diesen. Der Hausvater füllte daraufhin 69 aus. Verlegt wurden aus seiner Anstalt 19, von denen 18 ›getötet‹ wurden. (…) Im Oktober 1941 war Dr. Straub in der Anstalt und stellte fest, dass zehn noch arbeitsunfähig seien. Von den Übrigen würde nun niemand mehr ›getötet‹ werden. Dies die eigene Aussprache des Hausvaters. Der Hausvater Heinrich Hermann ist fanatischer Euthanasiegegner. Dabei ist wichtig, dass er Schweizer Staatsangehöriger ist. Dies ist absolut unmöglich! Denn auf diesem Posten, der mitverantwortlich in der Euthanasiefrage zeichnet, darf doch kein Ausländer stehen – noch dazu ein negativ eingestellter.«[1]
Der Konfrontation mit dem nackten Wort »töten« waren die approbierten Ärzte und beamteten Mörder nicht gewachsen. Hermanns Angriff traf sie unvorbereitet. Ein Schweizer benannte frank und frei, was deutsche Anstaltsdirektoren, Stationsärzte und Amtsleiter nicht über die Lippen brachten – zumeist nicht über die Lippen bringen wollten, weil sie sich als »mitverantwortlich in der Euthanasiefrage« ansahen. Hermann geschah nicht das Geringste. Er blieb bis 1947 Leiter der Zieglerschen Anstalten. Seine ablehnende Haltung zu den Euthanasiemorden hatte er bereits am 6. August 1940 dem Reichsinnenministerium mitgeteilt: »Ich habe einfach die Überzeugung, dass die Obrigkeit mit der Tötung gewisser Kranker Unrecht begeht. (…) Es tut mir leid, aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich bin bereit, Folgen dieses meines Ungehorsams auf mich zu nehmen.«[2]