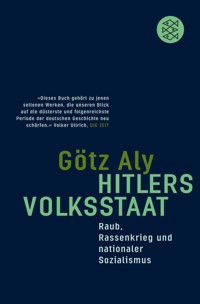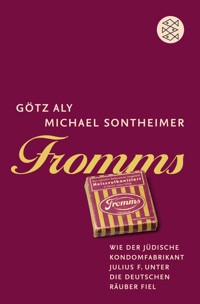9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aufschlussreiche Essays über die Deutschen und ihre Vergangenheit von dem vielfach ausgezeichneten Historiker Götz Aly: In »Volk ohne Mitte. Die Deutschen zwischen Freiheitsangst und Kollektivismus« zeigt er, wie der Antisemitismus schon früh die Weichen zur Katastrophe nach 1933 stellte, wie sich während des Nationalsozialismus der Staat und die Menschen bereicherten und warum wir keinen Schlussstrich ziehen können. Der Mangel an Selbstbewusstsein und gemeinsamen Werten, die Suche nach dem eigenen Vorteil und ein starker Aufstiegswille führten dazu, dass die Deutschen dem nationalen Sozialismus in Massen folgten. Götz Aly eröffnet überraschende Einsichten in die geschichtlichen Konstellationen, welche die ungeheuerlich destruktive Energieentladung der zwölf kurzen Hitler-Jahre möglich machten. Er schildert individuelle Bereicherungen, zeigt, wie die Staatskasse und damit alle Deutschen von dem beispiellosen Raubzug in Europa profitierten, und belegt den Hang der Deutschen, nach dem Krieg Schuld und Verantwortung zu verlagern. Er zeigt, wie sehr nach 1945 der Korpsgeist und Karrierismus selbst in der Max-Planck-Gesellschaft und an historischen Instituten die Erforschung dieser Vergangenheit noch lange behinderten. Ein unbequemes Buch, das zum Weiterdenken anregt. »Das ist die große bittere Pointe von Alys monumentalem Forschungswerk: dass zu den Resultaten der nationalsozialistischen Zeit nicht nur Judenmord, Vertreibung und Kriegsverheerung gehören, sondern der Gesellschaftsaufbau der Bundesrepublik.« Jens Jessen, Laudatio zur Verleihung des Ludwig Börne-Preises 2012 an Götz Aly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Götz Aly
Volk ohne Mitte
Die Deutschen zwischen Freiheitsangst und Kollektivismus
Über dieses Buch
Erhellende Essays des vielfach ausgezeichneten Historikers Götz Aly über die Deutschen und ihre Vergangenheit – denn einen Schlussstrich können wir nicht ziehen
Der Mangel an Selbstbewusstsein und gemeinsamen Werten, die Suche nach dem eigenen Vorteil und ein starker Aufstiegswille führten dazu, dass die Deutschen dem nationalen Sozialismus in Massen folgten. In glänzend geschriebenen Essays eröffnet Götz Aly überraschende Einsichten in die geschichtlichen Konstellationen, welche die ungeheuerlich destruktive Energieentladung der zwölf kurzen Hitler-Jahre möglich machten. Er schildert individuelle Bereicherungen, zeigt, wie die Staatskasse und damit alle Deutschen von dem beispiellosen Raubzug in Europa profitierten, und belegt den Hang der Deutschen, nach dem Krieg Schuld und Verantwortung zu verlagern. Er zeigt, wie sehr nach 1945 der Korpsgeist und Karrierismus selbst in der Max-Planck-Gesellschaft und an historischen Instituten die Erforschung dieser Vergangenheit noch lange behinderten. Ein unbequemes Buch, das zum Weiterdenken anregt.
»Geschichte erfordert Demut und hält nur die eine Lehre bereit: Niemand steht auf der sicheren Seite.«
Götz Aly
»Das ist die große bittere Pointe von Alys monumentalem Forschungswerk: dass zu den Resultaten der nationalsozialistischen Zeit nicht nur Judenmord, Vertreibung und Kriegsverheerung gehören, sondern der Gesellschaftsaufbau der Bundesrepublik.«
Jens Jessen, Laudatio zur Verleihung des Ludwig Börne-Preises 2012 an Götz Aly
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401418-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Wie haben die Deutschen 1945 so enden können?
Immer dabei und stets anständig geblieben
Sonderweg, Verspätete Nation, Volk ohne Mitte
Hitlers Blick auf die »Masse der Mitte«
Knechtssinn und Freiheitsangst
Frivoler Jude, schamlos und frech
Die Deutschen, gedrückt und mutlos
Wechselnde Motive des Judenhasses
Die Langweiler gegen die Tüchtigen
Machet sie zu Pulver!
Eine Geschichte, die 1871 übergangen wurde
Von der Reform zum rechtsförmigen Pogrom
Ethnisch säubern, sozial aufsteigen
Judendeportationen als Teil ethnischer Politik
Hilflos gegen den Geist des Hasses
Vertreibung als politisches Ziel
Parzellierte Erinnerung vervielfältigt die Opfer
All dieses Böse kommt von innen
Du sollst nicht stehlen
Wer war es gewesen? – »Niemand oder alle«
Die Nutznießer des Mordens
1938 drohte der Staatsbankrott
Raubzüge im besetzten Europa
Kriegslasten, beglichen mit dem Gold der Juden
Schütze Heinrich Böll im Kaufrausch
Gemeinschaftstiftender Raub als Staatsprinzip
Hitlers räuberische Kunsthändler
Beutestücke in deutschen Wohnzimmern
Wilhelm Röpke gegen Volk und Führer
Extrem humanistisch-weltbürgerlich eingestellt
Standhaft gegen den Nationalkollektivismus
Der Massencharakter des Nationalsozialismus
Röpke, ein Meister politischer Prognosen
Die Kritik des Exilierten an der NS-Herrschaft
Rückblicke auf den Albtraum des Kollektivismus
Die Deutschen in der Stunde null
Man hängte die Großen und ließ die Kleinen laufen
Larmoyanz und Selbstmitleid
Die heilsame Wirkung des Kalten Krieges
»Wieder eine eigene deutsche Wehrmacht« – wie schön
Ein vereinigtes Deutschland? Unerträglich!
Nachtrag zum 3. Oktober 2014
Was wusste Walter Jens?
Schneller Verdacht – schlechte Beweise
Jens 1944: »Thomas Mann, du großer Dichter«
Nachträge 2014
Arbeit an den »Vorstufen der Vernichtung«
Staatstragender, staatsschaffender Historismus
Forschen für die »deutsche Sendung«
Zeitgeschichte für den geheimen Dienstgebrauch
Das jüdische Element
Sozialismus des guten Bluts
Rasse und Raum, Volk und Heimat
Selbstgewisses Euphemisieren
Was danach geschah – Rückblick 2014
Weitere Elaborate Alys verhindern!
Neuroanatomen morden für die Wissenschaft
»Willkürliche und rechtswidrige« Verbote der MPG
Archivleiter Henning und das »Ansehen« der MPG
»Gesamtvernichtung bzw. würdige Bestattung«
Vergraben auf dem Münchner Waldfriedhof
Der Mord an drei verwandten Kindern
Jürgen Peiffers Gedächtnislücke
Begegnung mit dem diebischen Professor Peters
Register
[Lieferbare Titel von Götz Aly]
Einleitung
Fretwurst, der Deutsche
Unter allgemeinem Gejohle versteigerte Alfred Fretwurst 1968 die Habseligkeiten von Elise Bock. Sie war aus dem mecklenburgischen Gneez heimlich in den nahen Westen übergewechselt; nunmehr galt sie als Republikflüchtige und wurde zum Vorteil der Allgemeinheit enteignet. Die Bieter ergatterten dies und das. Die Erträge flossen in die kommunale Kasse. Von der Auktion und von den vielen verschlungenen Lebenswegen der Beteiligten erzählt Uwe Johnson in seinem literarisch-zeitgeschichtlichen Großwerk »Jahrestage«.
Fretwurst diente der Sozialistischen Einheitspartei (SED) als kleiner Funktionär und gehörte zu jenen Ortsansässigen, die schon während der nationalsozialistischen Jahre gut zurechtgekommen waren. Gemessen an seinen Verhältnissen war ihm seinerzeit ein beträchtlicher Aufstieg gelungen: vom ungelernten Arbeiter im Klärwerk zum beamteten Justizwachtmeister. Anschließend, in der DDR, kletterte er auf der sozialen Stufenleiter weiter nach oben. Darin lag nichts Außergewöhnliches. Als erste unter den neu- und wiedergegründeten Parteien Deutschlands hatte die SED einstigen NSDAP-Leuten den Weg in die Mitgliedschaft geebnet. Nur »un- oder minderbelasteten«, versteht sich. Aber dazu gehörten die allermeisten. Der Beschluss datiert vom 15. Juni 1946. Fortan konnten nationale Sozialisten sanft in den volksdemokratischen Sozialismus hinübergleiten. Alfred Fretwurst »gehörte zu den Entnazifizierten der ersten Stunde«, bald engagierte er sich für die Kampagne »Junkerland in Bauernhand«, »spielte eindringlich den Bürger, den die anderen ihm wegen des guten Auskommens abnahmen«. Fretwurst – diese Figur und ihre unzähligen Mit- und Wiedergänger stehen im Mittelpunkt der folgenden Kapitel.
Neben neuen Texten versammelt das Buch Essays und Reden, die ich für bestimmte Zwecke schrieb – zum Beispiel für die Predigtreihe zu den Zehn Geboten in der Stadtkirche von Darmstadt. Pfarrer Martin Schneider hatte mir das Gebot »Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus« zugedacht und nahegelegt, in der althergebrachten sakralen Form öffentlicher Rede über die Arisierung des Eigentums zu sprechen, das den geflohenen, vertriebenen oder in die Todeslager verbrachten Darmstädter Juden genommen worden war.
Überraschend verhalf mir der Brief eines pensionierten Justitiars der Max-Planck-Gesellschaft dazu, den Band abzurunden. Der Schreiber drohte, mich zu verklagen. Angeblich hatte ich ihn 2013 in meinem Buch »Die Belasteten«, das von den Euthanasiemorden handelt, falsch zitiert. Das gab mir den Anstoß, im Berliner Archiv seines früheren Arbeitgebers viele hundert Blatt Papier zu lesen, die er und andere leitende Herren dieser ehrenwerten, reiner Wissenschaft verpflichteten Gesellschaft zwischen 1983 und 1991 mit einer einzigen Absicht über mich verfertigt hatten: Sie wollten meine Nachforschungen über das verbrecherische Treiben einiger ihrer Vorgänger während der 1940er-Jahre unterbinden. In ihrer Masse, Unbeholfenheit und Niedertracht übertrafen die Schriftstücke jedes mir vorstellbare Maß. Trotz allem hatte ich es damals geschafft, die zähen Widerstände der Max-Planck-Gesellschaft zu brechen – dank der Hilfe des Bundesarchivs, des Hessischen Datenschutzbeauftragten, nordamerikanischer Wissenschaftler und zuletzt, wie ich erst jetzt aus den Akten erfuhr, des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Die im Rückblick gewonnenen autobiographischen und mentalitätsgeschichtlichen Einsichten finden sich im letzten Kapitel unter der Überschrift »Weitere Elaborate Alys verhindern!«.
Die Abschnitte über die Max-Planck-Gesellschaft und über die Geschichtswissenschaftler Werner Conze und Theodor Schieder werfen ein Licht darauf, wie schleppend die Erforschung der nationalsozialistischen Vergangenheit in der Bunderepublik selbst noch in den späten 1980er-Jahren verlief. Dünkel, Korpsgeist und Gruppenzwang, Unterwürfigkeit und Karrierismus der Jüngeren sowie institutionelle Selbstbeschönigung ließen überall schmeichelhafte Legenden wuchern. Sie umrankten das unschöne Gestern blickdicht, hübsch und abweisend. Sie versperrten die Wege zur Einsicht.
Wie haben die Deutschen 1945 so enden können?
Trotz unterschiedlicher Ausgangspunkte folgen die Abschnitte dieses Buches denselben zentralen Fragen. Wie haben die Deutschen 1945 so enden können? Wie lässt sich die extrem kurze, exzessiv verbrecherische Phase des Dritten Reichs im Kontinuum der deutschen Geschichte verstehen? Wie konnten – je nachdem – unsere Väter, Großväter oder Urgroßväter derartige Grausamkeiten begehen, hinnehmen oder einfach nicht sehen wollen? All das, obwohl sie weder vorher noch nachher kriminell oder psychisch auffällig geworden waren, obwohl sie moralisch und intellektuell nicht wesentlich anders ausgestattet waren, als wir Heutigen es sind. Wie verhielten sie, wie verhielt sich die Gesellschaft hernach? Kurz: Warum wurden Millionen Deutsche zu Fretwursts?
Ich verstehe meine Überlegungen als Versuche, aus unterschiedlichen Perspektiven vorläufige Antworten auf diese Fragen zu geben. Besonders am Herzen liegt mir der Aufsatz über die zeitgenössischen Analysen der NS-Herrschaft, die der 1933 vertriebene ordoliberale Ökonom und Staatswissenschaftler Wilhelm Röpke (1899–1966) im Exil vorlegte. Ähnlich wie Johnson übersah er die Fretwursts nicht, sondern betonte den Massencharakter des Nationalsozialismus und die grassierende geistige Korruption der deutschen Intelligenz. Intensiv beschäftigte Röpke die Frage, warum die verschiedenen Formen des Kollektivismus untereinander anschlussfähig sind, warum viele Deutsche, die vor 1932 sozialdemokratisch oder kommunistisch gewählt hatten, sich plötzlich für Hitlers Partei und Politik erwärmten und nach 1945 wieder für Sozialdemokraten oder Kommunisten stimmten.
Auf den folgenden Seiten erscheint der Typus Fretwurst in vielerlei Gestalt: mal als Anhänger von Turnvater Jahn, mal als demokratischer Abgeordneter von 1848/49, als Schaulustiger oder Jubeldeutscher anno 1510, 1933, 1942 oder 2013, als Schütze Böll, Kunsthändler Gurlitt oder Hirnforscher Hallervorden, als Herrschaftshistoriker, Propagandist oder IME Sänger, als Redakteur einer führenden Zeitung, Archivar Henning, ewiger Rechthaber, als kleine, mal materielles, mal geistiges Eigentum stehlende Diebin oder als handfester Dieb. Bei allen Unterschieden wollten und wollen die Fretwursts stets das Gleiche: ihren sozialen Status mit entschiedener Rücksichtslosigkeit verbessern und dabei ihre biedermännische Reputation wahren.
In den Gedenkstätten, Geschichts- und Schulbüchern kommt diese Millionenfigur nicht vor. Sie gilt als banal oder peinlich. Folglich genießt Fretwurst das Privileg des Inkognitos und lebt munter weiter. Aussterben wird er nie. Im wohlverstandenen Eigeninteresse behauptet er, besonders schwere Verbrechen seien von abartig veranlagten oder gar dämonischen Menschen begangen worden und müssten auf besonders komplizierte Ursachen zurückgeführt werden, auf solche, die völlig außerhalb des Normalen lägen. Seine Schutzbehauptungen verbreitet er in allerlei Varianten, und das mit schönem Erfolg. Falls doch jemand daran zweifelt, beteuert Fretwurst in Windeseile, er gehöre einer der vielen deutschen »Opfergruppen« an.
Um den Kreis der Verantwortlichen klein zu halten, läuft die deutsche Geschichts- und Erinnerungspolitik seit nunmehr sieben Jahrzehnten darauf hinaus, den Massencharakter des Nationalsozialismus zu leugnen. Das entspricht dem sehr verständlichen – eine genaue Ursachenforschung jedoch versperrenden – menschlichen Bedürfnis, die Schuld an den in ihrer Intensität unvergleichlichen Verbrechen möglichst wenigen und dem eigenen gesellschaftlichen Ort fernen Menschen anzulasten: Aus österreichischer Sicht waren es die Reichsdeutschen; aus sozialistischer oder sozialdemokratischer Sicht die Großkapitalisten, Monopole, Konzerne, die Bourgeoisie und die Kleinbürger; aus konservativer Sicht entwurzelter Pöbel, Verrückte, Gottlose und charakterschwache Parvenüs.
Lernen lässt sich aus solchen Fiktionen nichts. Gleiches gilt für die gängigen Faschismustheorien. Sie verkleinern den Rassenmord zum Rückfall in vorzivilisatorische Barbarei, vernebeln ihn hinter systemischen Leerformeln (»… all das geschah im ideologischen Kontext einer rassistischen Diktatur«), schieben die geschichtliche Last auf einen deutschen Sonderweg oder auf angeblich genau zu bestimmende, besonders vorgeprägte Personengruppen. Zu diesem Zweck halten Historiker und Pädagogen ein spezielles Repertoire von Wortschablonen bereit, die stets mit dem bestimmten Artikel, im Einzelnen jedoch nach persönlichen Vorlieben zu gebrauchen sind: »die Nationalsozialisten«, »der charismatische Führer«, »der Erlösungsantisemitismus«, »der Antisemitismus der Sachlichkeit«, »die Generation des Unbedingten«, »die Herrschaft der Extreme«, »die SS-Schergen«, »der Diktator«, »die Diktatur«, »die völkischen Ideologen«, »das NS-Regime« …
Angeblich haben die derart an Anzahl reduzierten, dem Durchschnittsmenschen unbekannten, angenehmerweise nicht mehr existenten Personen, Gruppen, Institutionen oder politischen Programme (»Ideologien« lautet die beliebteste Distanzvokabel) die nationalsozialistischen Jahre auf dem Gewissen – nicht die Fretwursts. Schließlich wären diese mit den meisten heutigen Deutschen verwandt oder verschwägert (sofern deren Familien schon vor 1945 im Land lebten). Das aber wird sehr ungern akzeptiert.
Die genannten Abstraktionen verhelfen den Nachgeborenen zu dem Gefühl, sie hätten mit dem Geschehenen nichts zu tun, stünden selbst auf der besseren Seite der Menschheit. Wem das nicht ausreicht, der identifiziert sich mit den Opfern des Unrechts. Darüber lässt sich vergessen, dass die Großeltern oder Urgroßeltern die Partei Hitlers gewählt, der sozialdemokratische Großonkel und seine Frau sie nicht gewählt hatten, sie jedoch 1938 bejubelten und zwei Jahre später überlegten, ob sie ihr Glück lieber als Neusiedler im Elsass oder im annektierten Warthegau versuchen sollten.
Die menschlich ebenfalls verständliche, doch im Sinne historischer Aufklärung hinderliche symbolische Umarmung der Verfolgten und Ermordeten des 20. Jahrhunderts wird mitunter bis ins Absurde gesteigert. So forderte die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft am 13. März 2013 in der Berliner Zeitung einen »zentralen Ort des Gedenkens« zugunsten auch all jener, »die unter der SED-Herrschaft berufliche Nachteile erlitten haben«. Als »Vorbild« für einen solchen Ort des Gedenkens nannte der Sprecher – wie zuvor Erika Steinbach in Bezug auf ein »sichtbares Zeichen« für zwölf Millionen Heimatvertriebene – ausgerechnet das Denkmal für die ermordeten Juden Europas am Brandenburger Tor.
Immer dabei und stets anständig geblieben
Welche Triebkräfte stecken hinter derart unverfrorenen Gleichsetzungen? Die Antwort ist leicht gefunden. Nur so können schier alle heutigen Deutschen zu Nachfahren von »Opferfamilien« werden. Viele finden einen Nazivater, den später die Kommunisten einsperrten oder die Russen holten, andere einen Judenmörder, der hernach Heimatvertriebener wurde, einen stalinistischen Großonkel, den SA-Männer folterten, oder einen Vetter, einstmals Leutnant der großdeutschen Wehrmacht, der in der DDR als sogenanntes Bürgerkind nicht studieren durfte. So lässt sich Hitlers Volksgemeinschaft Stück für Stück in tadellose Opfergruppen auflösen. Übrig bleiben wenige »Täter«, die seltsame Uniformen trugen und unangenehm aussahen.
Wie die meisten anderen könnte auch ich mich einer solchen Konkurrenz mühelos stellen. Schließlich lebte mein 1904 geborener Onkel Otto Schellhass (alias Karoline von Homosalien oder Baronin Schneehase) seine Homosexualität derart freudig aus, dass die Wehrmacht freiwillig auf seinen Ehrendienst verzichtete. Auf Uniformierte stand er besonders. 1940 musste er wegen eines Verstoßes gegen Paragraph 175 des Strafgesetzbuches für einen Monat ins Gefängnis (nicht ins KZ, wenn ich ehrlich Auskunft gebe). Im Mai 1944 erwischte man ihn auf einer Parkbank abermals. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilte den einschlägig Vorbestraften »wegen Unzucht mit einem Mann in zehn Fällen« zu sieben Monaten. Als U-Häftling landete Otto zunächst im Gefängnis Lehrter Straße. Dort gehörte sein Mitgefühl den politischen Häftlingen und den geschnappten Deserteuren, die es wesentlich härter traf als ihn. Die Strafhaft saß er im Gefängnis Spandau ab. Im November 1944 wurde er pünktlich und unversehrt entlassen.
Ich hätte noch weitere Opfer zu bieten: einen vertriebenen Schlesier, einen Großonkel, der im Bombenkrieg den Tod fand, einen Verwandten, der im DDR-Gefängnis Rummelsburg einsaß, und – etwas ziemlich Seltenes – meine Tante, die Theologin Renate (Rena) Scherer, geboren 1910. Sie durchlebte die NS-Zeit mit ihrer Freundin glücklich, weil sie, was ihr seinerzeit nur der Krieg ermöglichte, eine Stelle als Gemeindepfarrerin zugewiesen bekam und sich nicht länger nur als Religionslehrerin herumplagen musste. (Leider kam der Herr Amtsbruder, den sie vertreten hatte, 1945 schnell zurück.) Früher meinte meine Mutter, »Rena fand nicht den Richtigen«, später, 2001, nach Renas Beerdigung auf dem Heidelberger Bergfriedhof, bemerkte sie: »Heute würde man sagen, sie war lesbisch.« Obwohl wir das damals nicht ahnten, wissen Aktivistinnen der heutigen deutschen Schwulen- und Lesbenbewegung ganz genau: Gleichgültig, was ihre Mitglieder in den NS-Jahren getan hatten – hier trauerte eine Opferfamilie; sie trug eine »wegen ihrer sexuellen Präferenz Verfolgte des Nazi-Regimes« zu Grabe.
Wann soll derartiger Unsinn enden? Statt historischer Tatsachen haben angenehme Selbstbilder Konjunktur, gemalt nach diesen Mustern: Hitler meinte es mit den Frauen nicht gut, verfolgte Schwule, Gewerkschafter, Arbeiter, Konservative, Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberale, adelige Offiziere, Bummelanten und chronisch Kranke, er hasste Juristen, Diplomaten und Generalstabsoffiziere, war intellektuellenfeindlich, kein Freund der Moderne und der christlichen Kirchen. Auf diese Weise lassen sich im Handumdrehen zwei, drei familiengeschichtliche Anknüpfungspunkte finden, mit denen es sich fast jeder Gegenwartsdeutsche gemütlich machen kann.
Wenn es wenigstens dabei bliebe! Doch der nationale Putzfimmel fordert immer neue Aktivitäten. Wer zu den Guten gehören möchte, der muss das hin und wieder beweisen. Nichts leichter als das. Man nehme einen preußischen General, Minister oder Historiker, dessen Name auf einem Straßenschild steht, sodann lege man sogenanntes bürgerschaftliches Engagement an den Tag, stelle fest, dass der Namensgeber zu den Bösen unserer Vergangenheit zählt, und fordere, die fragliche Straße umgehend nach einer frühvollendeten schwarzafrikanischen Schriftstellerin umzubenennen, wahlweise nach einer Vorkämpferin der Frauenbewegung oder einer jüdischen Zwangsarbeiterin – und schon empfinden sich die »zivilgesellschaftlich« Beteiligten als geschichtlich wohlriechende Deutsche.
In den 1960er-Jahren mussten für solche Zwecke noch gröbere Mittel eingesetzt werden, zum Beispiel die berühmte Ohrfeige, die Beate Klarsfeld 1968 Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger versetzte, wobei sie zischte: »Nazi! Nazi! Nazi!« Die Tat entlastete jüngere Deutsche im Eiltempo von der damals noch schier unaussprechlichen »jüngsten Vergangenheit«, auch mich und, nicht zuletzt, Frau Klarsfeld selbst – 1939 geborene Künzel, aufgewachsen in Berlin-Wilmersdorf. Wie verhielten sich Vater und Mutter Künzel zwischen 1933 und 1945? Die Frage erscheint berechtigt, weil die Tochter ihren Angriff auf den Bundeskanzler hinterher mit einem seltsamen Satz erläuterte: »Für ein Deutschland, befreit von jeglichem Hang nach Sühne.«
Der in dem Kapitel über die kleinen Nutznießer des Kriegführens und Mordens ausführlich geschilderte einstige Wehrmachtssoldat Heinrich Böll (hier) schickte der Klarsfeld einen Strauß roter Rosen, der spätere Holocaustleugner Horst Mahler verteidigte sie im Strafprozess, Angehörige linker Grüppchen, die bald darauf den »Kampf gegen den Zionismus« entdeckten, warfen beteiligten Gerichtspersonen die häuslichen Fensterscheiben ein. Wie viel Falschheit den Protest beflügelte, bezeugt der Offene Brief an Kiesinger, den Günter Grass 1966 verfasst hatte: »Wie sollen wir«, fragte der Mann, der so gerne die Richtlinien der Moral bestimmte und über seine Zugehörigkeit zur Waffen-SS weitere 30 Jahre schwieg, »der Toten von Auschwitz und Treblinka gedenken, wenn Sie, der Mitläufer von damals, es wagen, heute hier die Richtlinien der Politik zu bestimmen?« Grass und Beate Künzel-Klarsfeld behaupteten von sich, im Sinne der Ermordeten zu handeln. Daraus bezogen sie ihre Legitimation, auf den westdeutschen Nachkriegsstaat verbal oder in »direkter Aktion« einzuschlagen.
Übrigens: Im Kabinett Kiesinger/Brandt, das von 1966 bis 1969 regierte, saßen sieben Mitglieder, die einst der NSDAP angehört hatten. Einer von der CSU, drei von der CDU und drei von der SPD.[1] Bei der vorangegangenen Bundestagswahl hatte die SPD 40 und die CDU/CSU knapp 50 Prozent der Stimmen errungen. Relativ und rein quantitativ betrachtet, stand die SPD auf dem Minister-Nazometer nicht wesentlich besser da als die Konservativen. Ihr antifaschistisches Selbstbild beeinträchtigte das nicht. Die linken und linksliberalen Empörer erhoben »Altnazi Kiesinger« zum Generalfeind, weil sie die Fretwursts in den eigenen Reihen nicht sehen wollten.
Um sich aus der nationalen Geschichte zu stehlen, hatte der junge Hans Magnus Enzensberger 1964 einen äußerlich etwas vornehmeren Weg als Beate Klarsfeld beschritten. Seinen bei Suhrkamp erschienenen Sammelband »Politik und Verbrechen« leitete er mit dem Text »Reflexionen vor dem Glaskasten« ein und erweckte den Anschein, als denke er über den Jerusalemer Eichmannprozess und die ihm zugrundeliegenden Tatvorwürfe nach. Die ersten 15 Seiten dieses Textes füllte er mit allerlei Montagen, nur nicht mit Gedanken zu Eichmann, erst dann kam er mit den folgenden vier, durchaus prägnanten Sätzen zur Sache: »Planspiel. Im April 1961 wurde vor dem Landgericht in Jerusalem der Prozess gegen den ehemaligen Obersturmbannführer A. Eichmann eröffnet. Die Anklage ging nicht dahin, dass der Beschuldigte die Gasöfen mit eigener Hand bedient hätte. Eichmann hat den Mord an sechs Millionen Menschen gewissenhaft und minutiös geplant. Ebenfalls im Jahre 1961 ist in Princeton, New Jersey, ein Werk aus der Feder des Mathematikers, Physikers und Militärtheoretikers Herman Kahn Über den thermonuklearen Krieg erschienen.«
Ausführlich referierte der Autor die gefühlskalt formulierten Todesszenarien, die Kahn für den Fall eines Atomkriegs durchgespielt hatte. Seine Prognosen bezog der amerikanische Forscher sowohl auf die US-Bürger, falls diese von einem atomaren Angriff heimgesucht würden (was Enzensberger verdeckte), als auch auf die russischen Bürger, falls diese »für ihre Aggression« bestraft werden müssten. Am Ende fragte Enzensberger: »Kann man K. und E. vergleichen?«, und antwortete: »Die ›Endlösung‹ von gestern ist vollbracht worden. Die Endlösung von morgen kann verhindert werden.« Aber welcher Unterschied bestand nach H.M.E. zwischen E. und K.? Immerhin habe der eine »seine Opfer noch mit eigenen Augen gesehen«, aber »den Planern des Letzten Weltkrieges«, allen voran Herman Kahn, werde dieser Anblick erspart bleiben.
Dem Grundzug dieses apokalyptischen Essays folgend, nahmen seit 1967 hunderttausende junge Deutsche Reißaus vor der nationalen Vergangenheit. Sie suchten und fanden das »faschistische« Böse immer seltener im eigenen Land. Stattdessen wälzten sie die nationale Last auf andere ab, verwandelten sie zur Protestaufgabe der Gegenwart und skandierten bald auf hunderten Demonstrationen »USA-SA-SS«. Die »Faschisten« saßen jetzt nicht länger zu Hause, sondern in Teheran, Saigon, Lissabon, Madrid oder Washington. Weit weg.
Im Februar 1968 gab Enzensberger eine Gastdozentur in den USA auf, wechselte von dort, wie er mitteilte, zum »kubanischen Volk« und begründete seinen Schritt in einem Offenen Brief an Präsident Lyndon B. Johnson: »Die Lage (der USA) erinnert mich in mehr als einer Hinsicht an die Lage meines eigenen Landes Mitte der Dreißigerjahre. Ehe Sie diesen Vergleich zurückweisen, bedenken Sie bitte, dass zu diesem Zeitpunkt noch niemand an Gaskammern gedacht oder von ihnen gehört hatte; dass respektable Staatsmänner Berlin besuchten und dem Reichskanzler die Hand schüttelten; und dass die meisten Leute sich weigerten zu glauben, dass Deutschland darauf ausginge, die Welt zu beherrschen. Natürlich konnte jeder beobachten, dass es Rassendiskriminierung und Rassenverfolgung gab; der Rüstungsetat verzeichnete eine alarmierende Zuwachsrate; und die Einmischung in den Krieg gegen die spanische Revolution nahm ständig zu. Aber hier versagt meine Analogie. Unsere augenblicklichen Herren verfügen nicht nur über Zerstörungskräfte, von denen die Nazis nicht einmal träumen konnten; sie haben auch einen Grad von Gerissenheit und Fälschung erreicht, der in der alten rohen Zeit unbekannt gewesen ist.«[2]
Beate Klarsfeld berichtete später von ihren Eltern: »Sie haben Hitler gewählt, waren aber keine Nazis.« Ihr Patenonkel war Nazifunktionär. Dank dessen Fürsorge verbrachte die kleine Beate »einige glückliche Monate« statt im bombenbedrohten Berlin im besetzten polnischen Łódź. Auf die Frage »Wie standen Ihre Eltern zum Nationalsozialismus?« antwortete Enzensberger 2007: »Ich hatte Glück mit ihnen. Sie hielten nichts von der NSDAP.« Aber warum war sein Vater, Andreas E., am 1. Mai 1933 als Mitglied Nummer 2714911 einer Partei beigetreten, von der er angeblich nichts hielt? Fretwurst lässt grüßen. Immer dabei, hinterher stets dagegen gewesen – und anständig geblieben.
Die Ohrfeige der Klarsfeld, der Offene Brief von Grass, Bölls Rosen, Enzensbergers ins Wahnwitzige gesteigerte Gleichsetzung der »augenblicklichen Herren« der USA mit Hitler dürfen als verzweifelte Schuldabwehr verstanden und deshalb mit Nachsicht bedacht werden – Heldentaten waren sie nicht. Es geht mir nicht darum, Einzelne zu schmähen. Gezeigt werden soll die Vielfalt der Fluchtversuche, die 20 oder 25 Jahre nach dem Untergang des Dritten Reiches selbst von nachdenklichen, in anderer Hinsicht sehr verdienstvollen Deutschen unternommen wurden, um der noch sehr nahen Vergangenheit zu entkommen. Für die Angehörigen der Generation, die als Erste und noch ohne gesellschaftlichen Rückhalt in die Abgründe von Babi Jar, Treblinka und Auschwitz blicken musste, bestand ein hohes, vielfach wohl unvermeidliches Risiko, dabei Fehlreaktionen, Panikattacken, Abwehrreflexe und Verwirrtheitszustände zu erleiden.
Sonderweg, Verspätete Nation, Volk ohne Mitte
Wie sehr die Schönen Künste einer steril gewordenen Geschichtsschreibung, eintönigen Präsentationen »der nationalsozialistischen Täter« oder den sich wandelnden Techniken der Schuldreduktion überlegen sein können, bewies neben Uwe Johnson der Maler und Bildhauer Wolfgang Mattheuer. In der DDR schuf er 1984 einen in Bronze gegossenen Kraftprotz, mit dessen Wesen er sich jahrelang beschäftigt hatte, sei es in Zeichnungen, Holzschnitten oder Ölgemälden. Er nannte die Skulptur »Der Jahrhundertschritt«. Ich sah sie 1985 erstmals, gab ihr im Stillen den Beinamen »Fretwurst, der Deutsche« und interpretiere sie so:
Nackt und bloß, die übergroßen Füße scharf zum Hakenkreuzstummel abgewinkelt, setzt der Kerl zum Riesenschritt an – barfuß, mit dem rechten, weit vorgestreckten Bein. Es gehört einem Hungerleider, der sich Schuhe nicht leisten kann, aber schnell vorankommen will, vorwärts strebt. Der Fuß des linken, in Knie und Ferse hart abgewinkelten Sprungbeins steckt im gewichsten Soldatenstiefel. Der rechte, zum Hitlergruß gereckte Arm weist ins Nichts, der linke als rechtwinkliger Haken nach oben, die Hand zur Kommunistenfaust geballt.
Seinen kleinen Kopf, sein winziges Gehirn trägt der Jahrhundertschrittler tief zwischen den Uniformkragen gezogen. Er möchte bei seinen Taten nicht gesehen, nicht ertappt werden, sie hernach nicht begangen haben und vergessen. Die eigenen Absichten sind ihm nicht geheuer. Er blickt scheel, entschlossen und ängstlich zugleich, wirkt stumpf, tatendurstig und überspannt. In seiner Brust klafft eine tiefe Wunde. Sein derart versehrter Rumpf ist viel zu klein, zu schwach ausgebildet, um die wild ausfahrenden Bewegungsaktionen der überlangen Gliedmaßen auszubalancieren.
Dem nicht sehr alten, dynamisch wirkenden Mann fehlt die das Gleichgewicht sichernde Mitte. Er bedarf der Stütze, verlangt innerlich richtungslos nach Führung, öffnet seinen verwirrten, engen Geist einer Weltanschauung, die ihn zum neuen, der Zukunft zugewandten Menschen erhebt, einfache Erklärungen bietet, Freund und Feind scharf unterscheidet. Wer sich den Jahrhundertschrittler in Ruhe ansieht, spürt durchaus gemischte Gefühle. Er droht, ungemein aggressiv auf den Betrachter loszugehen, und weckt doch Mitleid, weil er jeden Moment auf fürchterliche Weise stürzen könnte.
Mit diesem so aussagekräftigen Kunstwerk bilanzierte Mattheuer das 20. Jahrhundert. Ein Gegenstück hatte Marc Chagall im optimistischen Vorgriff 1917 gemalt. Sein Bild »En avant les voyageurs« zeigt in munteren Farben einen modern und städtisch gekleideten jungen Juden, der zielbewusst voranstürmt. Über den Bildrand hinaus legt er all sein Gewicht nach vorn, kann unmöglich zurück, aber er kennt die Richtung und wird sicher aufsetzen. Er atmet frei, strahlt Neugier aus und gute Laune. Mit einem Satz lässt er das Vergangene zurück. Zu seinen Füßen versinken die grünen Holzhütten des osteuropäischen Stetls im tief gelegten Horizont. Der zukunftsfreudige, zielbewusste Jude und der desorientierte, aber gesinnungstüchtige Deutsche treten in diesem Buch immer wieder auf.
Der Jahrhundertschritt von Wolfgang Mattheuer, 1984
Marc Chagall, »En avant les voyageurs«, 1917
Eine gemalte Variation des Jahrhundertschritts nannte Mattheuer »Ohne Mitte«. Rumpf-, kopf- und bodenlos kreisen die beschriebenen Gliedmaßen im Nichts. Als Reproduktion hängt dieses Gemälde seit langem in meinem Arbeitszimmer, ihm verdanke ich den Titel »Volk ohne Mitte«. Unter dem Druck der Moderne, der rasend schnellen sozialen und wirtschaftlichen Umbrüche seit 1870, verwandelten sich zuvor verschlafene, dem Althergebrachten zugetane Deutsche in verspannte, mit sich unzufriedene, innerlich tief unsichere, feindselige Menschen. Erst recht nach dem Krieg von 1914 und der Niederlage von 1918, nach der Inflation von 1923 und dann in der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 schwankten sie hin und her. Taumelnd nach vermeintlicher Sicherheit greifend, folgten sie extremen Parteien mit Gleichschritt, Uniform und Paukenschlag, voranflatternder Fahne, Feindbild, Führer, Gefolgschaft und großen, ja gigantischen Zielen.
Mein Arbeitsbegriff »Volk ohne Mitte« ist mit dem Begriff »Verspätete Nation«, den Helmuth Plessner 1935 ins Spiel brachte, durchaus verwandt, ebenso mit der Vorstellung vom »Sonderweg«, die für die jüngere deutsche Geschichte geläufig ist. Jedoch verschiebt das interpretatorische Modell »Volk ohne Mitte« den Akzent auf die Fragen, mit denen die soziale Dynamik des Nationalsozialismus besser gefasst werden kann. Der zuvor meist positiv gebrauchte Terminus »deutscher Sonderweg« wird seit 1945 rein negativ im Sinne von Irrweg verstanden. Metaphorisch bezeichnet er die (von einzelnen Autoren unterschiedlich gewichteten) Bedingungen, die die spätere Machtübernahme Hitlers begünstigt haben. Dazu zählen das lange vergebliche Streben nach nationaler Einheit, die dann 1870/71 »von oben« vollzogen wurde; die Schwäche deutscher Demokraten einerseits, die Stärke von Militarismus, (speziell protestantischem) Untertanengeist und wenig elastischen Bürokratien andererseits; ebenso die spät einsetzende, jedoch überaus stürmisch verlaufende Industrialisierung und die fehlende Kraft der Deutschen, ihr verfassungsrechtliches Gefüge beizeiten dem rapiden wirtschaftlichen und sozialen Wandel anzupassen. Für sich genommen sind die genannten Argumente nicht falsch. Doch setzen die Interpreten unglücklicher deutscher Einzigartigkeit einen europäischen Normalweg voraus, den es zwischen Moskau, Prag und Lissabon, zwischen London, Belgrad und Athen jedoch nicht gab. Den Maßstab für den angeblichen Normalweg bilden allein die beiden westlichen Demokratien Frankreich und England.
Mein Haupteinwand gegen die Denkfigur vom Sonderweg lautet: Damit werden die Verbrechen, die Deutsche zwischen 1933 und 1945 begingen, auf Umstände zurückgeführt, die (wie etwa der preußische Militarismus) als angeblich dunkle oder böse Teile der deutschen Geschichte gelten und in der Gegenwart zumindest stark an Bedeutung verloren haben. Meist unausgesprochen geht damit die geschichtsoptimistische Annahme einher, dass sich gute von bösen Entwicklungslinien unterscheiden und voneinander trennen ließen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Alle Prozesse, die auf den Sonderweg führten, gehören in den verhängnisvollen Kreis der Fehlentwicklung und müssten folglich überwunden werden. Wer so denkt und nach solchen Maßstäben Geschichte betrachtet, irrt gründlich.
Das Böse entsteht nicht allein aus dem Bösen. Auch das Gute kann ungemein Böses bewirken: Gute Bildungspolitik, schnelle wirtschaftliche Mobilisierung, massenhafter Aufstiegswille, sozialpolitischer Fortschritt, selbst der erfolgreiche Kampf gegen Kindersterblichkeit und Seuchen trugen zu den Ängsten, Brüchen und national-sozialen Revolutionen und Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts entscheidend bei. Das späte Kaiserreich und vor allem die Weimarer Republik ermöglichten hunderttausenden eine bessere Schul- und Berufsausbildung. Diese neu Aufsteigenden, die angesichts der Weltwirtschaftskrise dann in ihrem Aufstieg bedrohten Jahrhundertschrittler, stellten 1933 die überaus junge, unsichere, jedoch tatendurstige Elite des Dritten Reichs. Das heißt: Gute, keinesfalls abzulehnende Politik kann zu extrem negativen Ergebnissen führen.[1] Wer sich derart ungemütlichen Einsichten versperrt, kann die Ursprünge des Nationalsozialismus und seine ungeheuerlich zerstörerische Kraft nicht verständig erklären.
Heute sprechen die meisten Deutschen nicht ohne Stolz von ihren demokratischen Errungenschaften. Aber jene Demokraten, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das schwarz-rot-goldene Banner gegen Knechtschaft, Kleinstaaterei, Pfaffen und Junker erhoben, für Pressefreiheit und bessere Volksbildung stritten, waren zum erheblichen Teil Antisemiten. Ausgerechnet Metternich, Inbegriff der Reaktion, schützte die Juden vor deutschen Demokraten. Letztere träumten vom nationalen Zentralstaat, und deshalb bejubelten viele der Revolutionäre von 1848 im reiferen Alter das von Bismarck mittels dreier Angriffskriege geschaffene wilhelminische Kaiserreich. Umgekehrt versuchten die Kräfte des Alten, die katholische Kirche und der regionale Adel, den für die spätere Bundesrepublik glücklicherweise konstitutionellen Föderalismus zu verteidigen.
Die Deutschen waren jahrhundertelang kulturell gespalten in Regionen diesseits und jenseits des einstigen römischen Limes; später zudem geteilt – bis heute an der kolonialen ostdeutschen Siedlungs- und Agrarstruktur leicht erkennbar – entlang der karolingischen Reichsgrenze, die an der Elbe verläuft; sprachlich zwischen Nieder- und Oberdeutschen, seit der Reformation getrennt in Katholiken und Protestanten, zergliedert in immer wieder, oft kriegerisch erweiterte oder zerschlagene Kleinstaaten, deren Regenten nicht selten mit Hilfe fremdländischer Verbündeter gegen deutsche Nachbarn vorrückten. Blutig zerstörte der Dreißigjährige Krieg das Land und traumatisierte die Überlebenden für lange Zeit. Napoleon nutzte die fehlende Einheit mit rücksichtsloser Härte aus. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts folgte die scharfe Spaltung in Bürgertum und Proletariat, in alte und neu aufsteigende Eliten.
In den Jahrzehnten zwischen dem Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation (1806) und dem Ersten Weltkrieg fand die Nation nur dann zu brüchiger Einheit, wenn sie gegen äußere Feinde Krieg führte: 1812 bis 1814 in den sogenannten Freiheitskriegen gegen die französische Besatzung, 1864, 1866, 1870/71 in den preußisch geführten Kriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich, die deshalb auch Reichseinigungskriege genannt werden, und schließlich 1914/18. Jenseits dessen blieben die Deutschen eine Gruppe unterschiedlich verfasster und entwickelter Völkerschaften, was sich bis heute im kulturellen Reichtum des Landes spiegelt. Ein in sich ruhender Staat wurde daraus nicht. So blieb nur der Rückgriff auf die geschichtlich-geistige Gemeinschaft, auf Sprache und Kultur, auf Sitte und Boden, Dichter und Denker – auf das Volk mit seinen tiefen, weit in die Vergangenheit reichenden Wurzeln. Auf diese Weise wurde das Wort Volk, wie Plessner hervorhebt, zum Protestbegriff. Er war gerichtet gegen formales römisches Recht, gegen den unpersönlich verwaltenden Staat, gegen die Institutionen der Verfahrensdemokratie, gegen die übernationalen Ideen der Aufklärung, des Liberalismus und des Individualismus. Die »Schicksalsgemeinschaft« Volk stand gegen den Verfassungsstaat.
Hitlers Blick auf die »Masse der Mitte«
Den Deutschen fehlte, worüber Briten und Franzosen schon in aller Selbstverständlichkeit verfügten: ein staatlicher und institutioneller Rahmen. Auch deshalb erscheint mir der analytische Fluchtpunkt »Volk ohne Mitte« passend. Wie wenig das 1871 geschaffene Deutsche Reich und dann die Weimarer Republik die innere Zerrissenheit überwinden konnten, zeigt ein immer wieder beeindruckender Umstand: Albert Einstein wurde 1934 als Preuße ausgebürgert, nicht als Deutscher; erst Hitlers Innenminister Wilhelm Frick verfügte am 5. Februar 1934, dass seither das Wort »deutsch« und nicht die Staatsangehörigkeit »Preußen«, »Sachsen« oder »Bayern« in den Reisepässen steht.
Weitere elf Jahre später, mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg, wurden die Außengrenzen Deutschlands zwangsweise so gezogen, wie sie heute akzeptiert sind. Über eine gemeinsame, weithin anerkannte Verfassung, ein allgemein geachtetes Rechtssystem, entsprechende öffentliche Institutionen und Verfassungsorgane verfügen die Deutschen seit 1990. Bis dahin blieben sie in wechselnder staatspolitischer Gestalt ein Volk ohne Mitte.
Dem schon vorgegebenen inneren Misstrauen folgend, entstand nach dem Waffenstillstand von 1918 sofort die Dolchstoßlegende. Derzufolge hatten nicht gegnerische Soldaten das »im Felde unbesiegte« kaiserliche Heer niedergerungen. Es waren ruchlose Geschäftemacher, vaterlandslose Agitatoren und Defätisten, die den Sieg verspielt hatten und den eigenen, standhaft kämpfenden Soldaten feige in den Rücken gefallen waren. Hinzu kam, dass der Krieg den für das Funktionieren moderner Demokratien so bedeutsamen Mittelstand ins Mark getroffen hatte. Mit seiner 1879 vollzogenen Wende zur Schutzzoll- und Subventionspolitik hatte schon Bismarck die Entwicklungschancen für eine selbstbewusste Mittelklasse entscheidend geschwächt. Er begünstigte die ostelbischen Großgrundbesitzer, die Kohle- und Stahlbarone. Einen weiteren schweren Schlag erlitt die gesellschaftliche Mitte in der Hyperinflation von 1923. Binnen Wochen entwertete diese die Kriegsanleihen, die deutsche Bürger aus vaterländischem Pflichtgefühl zuhauf gezeichnet hatten. Die Inflation machte den Staat schuldenfrei und beraubte im selben Ausmaß die mittelständischen Gläubiger ihrer Vermögensgrundlage, ihres produktiven Handlungsspielraums und ihrer das soziale und politische Gefüge stabilisierenden Rolle.
Die Agitation der NSDAP zielte von Anfang an auf die fehlende, zumindest schwache, ungenügend strukturierte, stets gefährdete Mitte, psychologisch gesprochen: auf das mangelhafte Selbst- und Nationalbewusstsein der Deutschen. Ein Blick in Hitlers autobiographisch unterlegtes Programm- und Bekenntnisbuch »Mein Kampf« mag das belegen. Seit den frühen 1920er-Jahren thematisierte Hitler die erst noch zu schaffende, im Grunde jedoch »ewige« Gemeinschaft der Deutschen. Er betrachtete die in Wien verwahrten Kaiserinsignien als Unterpfand für den »elementaren« Wunsch des deutschösterreichischen Volkes »nach Vereinigung mit dem deutschen Mutterland«.[1] In archaischen Metaphern umschrieb er, woran es den seit jeher unter »innerer Zerrissenheit« leidenden Deutschen mangele: »Jener sichere Herdeninstinkt, der in der Einheit des Blutes begründet« sei, der anderen, glücklicheren Völkern so sehr genutzt und sie »besonders in gefahrdrohenden Momenten vor dem Untergang bewahrt« habe.[2] Er meinte damit die westlichen Siegermächte des eben verlorenen Krieges.
Der in den Programmschriften der NSDAP skizzierte nationale Sozialismus bezweckte nicht die Expropriation kapitalistischer Expropriateure, wohl aber das Überwinden der Kluft zwischen den Krupps und den Krauses, um ein Mindestmaß an innerer Einheit zu erreichen. Er richtete sich gegen »unwürdige Unternehmer«, denen es an sozialem »Rechts- und Billigkeitsgefühl« gebreche. Kapitalisten, die sich nicht als »Glied der ganzen Volksgemeinschaft« verstünden, sondern »ihrer Habsucht« folgten, sollte im Dritten Reich Mores gelehrt werden.[3] Als gesellschaftspolitisches Staatsziel nannte Hitler die »Bildung menschlicher Gemeinschaften« anstelle der kalten, unpersönlichen »wirtschaftlichen Organisation«.[4] Er kontrastierte das Idealbild einer nach innen solidarischen Volksgemeinschaft mit den real existierenden »Interessengemeinschaften«, die er als egoistische Machtmittel der »›Bourgeoisie‹-Gilde«, »bestimmter Berufsgruppen und Standesklassen« verdammte.[5]
Unter der Rubrik »Herrschaft des Geldes« erklärte er, wie mit der rasanten Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert das soziale »Gleichgewicht vollständig verloren« gegangen sei. Genau das habe, »bei aller wirtschaftlichen Blüte«, zu Erbitterung und politischer Klassenspaltung geführt. Überdies sei mit dem neu aufgekommenen anonymen, frei handelbaren Aktienkapital »zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer« jene »innere Entfremdung« eingetreten, die »zur späteren politischen Klassenspaltung« geführt habe.[6] Folglich mussten auch Industrielle und Banker »das eigene Ich zugunsten der Erhaltung der Gemeinschaft« zügeln und lernen: »Nationalsozialistische Arbeitnehmer und nationalsozialistische Arbeitgeber sind beide Beauftragte der gesamten Volksgemeinschaft.«[7] Spätestens an dieser Stelle lässt sich leicht ermessen, und muss hier nicht weiter dokumentiert werden, welche verschiedenen Rollen des hinterhältigen Schufts »dem Juden« in diesem Programm zugeschrieben wurden.
So grob Hitler mit sogenannten Feinden, Volksverderbern, Rassenfremden oder Verrätern umsprang, so viel Vorsicht ließ er walten, wo es um landsmannschaftliche, soziale und religiöse Animositäten innerhalb seines blutsdeutschen Volkes ging. Scharf wandte er sich gegen bayerische »Preußenhetze« und Partikularismus.[8] Die Agitation gegen den anationalen, an Rom orientierten Katholizismus betrachtete er prinzipiell als Mittel, »die unselige Kirchenspaltung« zu überwinden, weil so »die innere Kraft« der Deutschen »auf das Ungeheuerlichste gewinnen« könne.[9] Jedoch stellte er die Konfrontation aus taktischen Gründen zurück, gewarnt von der fehlgeschlagenen antiklerikalen Propaganda deutschnationaler Kräfte in Österreich: »Denn das Bekämpfen von Wesenseigenheiten einer Konfession innerhalb unserer einmal vorhandenen religiösen Spaltung führt in Deutschland zwangsläufig zu einem Vernichtungskrieg zwischen beiden Konfessionen.« Weil der spätere Führer des deutschen Volkes befürchtete, dass die gegensätzlichen religiösen Ressentiments »noch tiefer« saßen »als alle nationalen und politischen Zweckmäßigkeiten«, verkündete er pragmatisch: Der Nation solle eine Zukunft geschenkt werden, »die in ihrer Größe allmählich auch auf diesem Gebiet versöhnend wirken würde«.[10]
Die Mühen der Deutschen um ihre nationale Einheit deutete Hitler als Kampf gegen die »Zerrissenheit ihres Wesens« und damit gegen die »Zerrissenheit ihres Blutes«, die überwunden werden könnte, sofern man sich auf das folgende Ziel verständigte: »Erhaltung und Förderung einer Gemeinschaft physisch und seelisch gleichartiger Lebewesen«.[11] Zur Therapie des zentralen Problems der Zerrissenheit in soziale Klassen empfahl Hitler zweierlei: zum einen das »Hinaufheben« der unteren »für ihre Gleichberechtigung kämpfenden« Klasse; zum anderen den Austausch der »volks- und vaterlandsfeindlichen« Gewerkschaftsführungen durch »fanatisch national« eingestellte Sozialisten. Auf dieser Basis könnten »die gleichen Gewerkschaften« weiterhin alle »rein wirtschaftlichen« Kämpfe austragen und »Millionen Arbeiter zu wertvollen Gliedern ihres Volkstums machen«.[12]
Das Vertrauen, das Hitler in die Struktur der vorhandenen Gewerkschaften setzte, begründete er mit den Erfolgen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, die auf der »werbenden Kraft« des von ihr vertretenen Prinzips unverbrüchlicher Einheit beruhten. Demnach musste der ältere Gedanke von der Einheit der Arbeiterklasse auf behutsame Weise erweitert werden, und zwar um die im Ersten Weltkrieg gründlich vorgebahnte Idee von der Einheit des Volkes. Das vorausgesetzt, konnte es nach Hitler gelingen, »das Herz der Massen zu erobern«, insbesondere der traditionell sozialdemokratisch orientierten Arbeiterschaft.[13] Gelang die nationalsozialistische Überformung sozialistischer Weltanschauungen, dann würde Klassensolidarität in Volkssolidarität umschlagen und Klassenkampf gegen Klassenfeinde in Volkskampf gegen Volksfeinde. Die sozialistische Maxime »Vom Ich zum Wir« konnte ohne Retusche übernommen werden.
Anders als die an beruflichen Positionen orientierte soziologische Bevölkerungsstatistik teilte Hitler sein Volk in drei geistig-moralisch definierte Kategorien auf. Ganz oben standen einige wenige Leute – wie der Führer selbst – als »Extrem des besten Menschentums«, ganz unten das Extrem des »schlechtesten Menschenauswurfs«, dazu zählten als »Elemente der Gemeinheit und Niedertracht« auch alle politischen Feinde, insbesondere »die Sturmbataillone des revolutionären Marxismus« einschließlich der jüdischen »Drahtzieher«.
Zwischen den beiden positiven und negativen Polen der Extreme lag »als dritte Klasse die breite mittlere Schicht«. Ihr – der übergroßen Mehrheit der Deutschen – schrieb Hitler die »Passivität der Staatserhaltenden« zu, Wankelmütigkeit und innere Strukturlosigkeit. Er betrachtete sie als politisch verfügbaren menschlichen Wackelpudding: »Im Fall des Dominierens der Besten wird die breite Masse diesen folgen, im Fall des Emporkommens der Schlechtesten wird sie ihnen mindestens keinen Widerstand entgegensetzen; denn kämpfen wird die Masse der Mitte niemals.« Wobei Hitler den mehr als zehn Millionen Anhängern der Sozialdemokratie beschied, mit ihnen habe »man nicht länger ein Extrem der Aktivität vor sich, sondern die breite Masse der Mitte, also die Trägheit«.
Hitler setzte nicht auf das edle, arische, rassenreine Herrenvolk, sondern auf den deutschen Massentypus Alfred Fretwurst. Aus seinem Sozialcharakter, seinen offenen und geheimen Wünschen, seinem Hang zur Gefolgschaft, relativem Wohlergehen und kollektivistischer Kuhwärme leitete er seine Revolutionstheorie ab: Die Masse der Mitte, die Millionen Fretwursts, träten nur dann als ordnungsliebende Mehrheit »fühlbar in Erscheinung, wenn die beiden Extreme« – wie zwischen 1918 und 1923 – »selbst sich im gegenseitigen Ringen binden«. Siege jedoch eines der Extreme, so werde sich die Masse der Mitte »stets dem Sieger willfährig unterordnen«. Daraus folgte für Hitler eine klare Doppelstrategie für das Gelingen der nationalen Revolution: »die geschlossene Zusammenarbeit brutaler Macht mit genialem politischen Wollen«. Als Vorbilder verwies er auf die Französische Revolution, die bolschewistische in Russland und die faschistische in Italien.[14]
Die Wendung vom »Volk ohne Mitte« verweist auf ein zentrales Vakuum, das Hitler unter ihm günstigen äußeren Umständen fluten konnte. Diese metaphorische Umschreibung weist auf das Jahr 1933 und generell auf die nationalsozialistische Herrschaftstechnik. Mit der Machtergreifung vom 31. Januar 1933 erhöhte die nunmehr regierende NSDAP das Tempo staatlichen Handelns in atemberaubender Weise. Massenaufmärsche und Blitzentscheidungen, außenpolitische Aktionen, Verhaftungen und Wohltaten folgten einander Schlag auf Schlag, später immer neu inszenierte internationale Krisen, kolossale Bauten und Blitzkriege. So betrachtet, können die immer neuen, immer ausgreifenderen Aktionen der deutschen Führung als Selbstzweck interpretiert werden, um die amorphe »Masse der Mitte« weiterhin in Atem zu halten.
Getreu seinem Plan ließ Hitler die Gruppe seiner militanten Gegner sofort gewaltsam und mit Hilfe der Ermächtigungsgesetze niederschlagen. Für die »Masse der Mitte« verhieß er Wohltaten und Einigkeit. Die Gleichschaltung aller staatlichen Institutionen und privaten Vereine, die rassische und wirtschaftliche Autarkie, der Feiertag der nationalen Arbeit am 1. Mai, die »Verreichlichung« preußischer Ministerien, das Ende des Föderalismus und die Gliederung des Landes in vorgeblich gleichberechtigte Gaue (nach dem Modell französischer Départements), das Soldatische, insofern Egalitäre, die Einheitspartei und ihre vielfältigen Massenorganisationen, der Kampf gegen Individualismus, Kritik und Liberalismus, die machtvollen Demonstrationen neugewonnener militärischer Stärke – mit all diesen Maßnahmen und Angeboten füllte die NSDAP die in ihren gesellschaftlichen und staatlichen Zuständen poröse, höchst instabile Mitte und verhalf so den aufstiegsorientierten Fretwursts aller sozialen Klassen zu Glücksgefühlen.
In seinem Entnazifizierungsverfahren redete sich der höhere Postbeamte Andreas Enzensberger so heraus wie Millionen andere: »Ich hielt es für richtig« der Partei aus »Sorge um meine Familie« beizutreten, aus »Pflichtgefühl meiner Verwaltung und meinen Arbeitskammeraden gegenüber«. »Gewiss«, so schränkte er hernach ein, »es gab Punkte im Parteiprogramm, die unerfreulich waren.« Zu seinem Schutz behauptete er, der SD habe ihn sechs Tage vor dem Einmarsch der US-Truppen, in Nürnberg verhaftet. Im Sommer 1946, als die Produktion von Persilscheinen in höchster Blüte stand, bestätigten ihm zwei Arbeitskollegen diese Geschichte. Beide wollten aus zweiter Hand davon gehört haben. Die Spruchammer verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 500 Mark. Enzensbergers Gehalt hatte sich zwischen 1934 und 1944 verdoppelt. 1933 waren auch bei der Oberpostdirektion Nürnberg attraktive Planstellen arisiert worden.
»Mein Vater saß im Gefängnis«, erzählte der Sohn später, »als die Amerikaner kamen. Die haben ihn rausgeholt.« Eine hübsche Fiktion mit der geleugnet wird, dass sich die Herrschaft Hitlers nur auf der gesellschaftlichen Basis millionenfachen Mitläufertums entfalten und stabilisieren konnte.[15]
Was auch geschah, stets auf ihren Vorteil bedacht, nahmen die Fretwursts an allen vier 9. November-Aktionen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert teil. Am 9. November 1918 hatten sie als revolutionäre Matrosen das Ende der kaiserlichen Herrschaft herbeigeführt; am 9. November 1923 klatschten sie dem Putschversuch der Hitlerpartei Beifall, damit endlich wieder Ordnung herrsche, und am 9. November 1938 während des Judenpogroms plünderten sie zertrümmerte Geschäfte. Wenn auch in letzter Sekunde, halfen die Fretwursts am 9. November 1989 dabei, die Mauer zu schleifen. Wer weiß, was sie in einigen Jahren treiben. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts lehrt pragmatische Skepsis – keine Gewissheiten.
Knechtssinn und Freiheitsangst
Ludwig Börne mit Vergnügen gelesen[1]
Ludwig Börne starb 1837 in Paris und liegt auf dem Friedhof Père Lachaise begraben. Als berühmter Toter wird er auf dem Lageplan nicht geführt. Auf dem Bronzerelief seines Grabobelisken reichen die Freiheitsgöttinnen Deutschlands und Frankreichs einander die Hände. Geboren wurde er 1786 als Löw Baruch in der Frankfurter Judengasse. Später legte er sich den seine Herkunft verschleiernden Namen zu und trat zum Protestantismus über – einfach um Ruhe zu haben. Vergeblich. Für ungezählte Hofschreiber, Karrieristen, Ehrabschneider und Neidhammel blieb er in Deutschland, was in Frankreich damals niemanden interessierte – Jude.
Fußnoten
[1]
Rede, gehalten zur Verleihung des Ludwig-Börne-Preises in der Frankfurter Paulskirche am 3. Juni 2012, in leicht gekürzter Fassung zuerst veröffentlicht in Die Welt vom 9.6.2012. Die beigefügten Texte von Börne und Goethe hatte ich zur Lesung während des Festakts ausgesucht.
Frivoler Jude, schamlos und frech
In der Stuttgarter Hofzeitung pöbelte im Dezember 1831 ein Rezensent, der sich hinter dem Kryptonym »ein Frankfurter Bürger« versteckte, gegen den ersten Band von Börnes zeitdiagnostischen »Briefen aus Paris« und brachte diese Werturteile in Stellung: frivoler Jude, herzloser Spötter, elender Schwätzer, erbärmliche Judenseele, ehrlos, seichtes Geschwätz, schamlose Frechheit, jüdische Anmaßung, elende Schmeißfliege. Am Ende rief der Anonymus zur Maßnahme auf: »Kein Deutscher, dem die Ehre seines Landes heilig ist, wird Börne fortan mehr in seiner Gesellschaft dulden können.«[1]