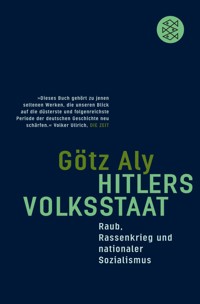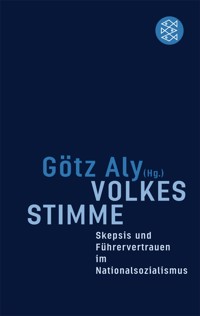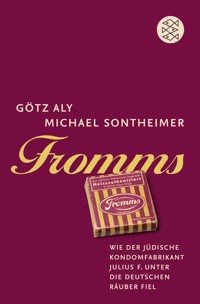9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner großen Gesamtdarstellung des europäischen Antisemitismus von 1880 bis 1945 zeigt der bekannte Historiker Götz Aly, dass der Holocaust nicht allein aus der deutschen Geschichte heraus erklärbar ist. Sowohl in West- als auch in Osteuropa hatten Antisemitismus und Judenfeindschaft seit 1880 sprunghaft zugenommen – angetrieben von Nationalismus und sozialen Krisen. Erstmals stellt Götz Aly hier den modernen Antisemitismus als grenzüberschreitendes Phänomen dar. Ohne die Schuld der deutschen Täter zu mindern, zeigt er, wie Rivalität und Neid, Diskriminierung und Pogrome seit Ende des 19. Jahrhunderts vielerorts dazu beigetragen haben, den Boden für Deportationen und Völkermord zu bereiten. Während des Zweiten Weltkriegs ermordeten die nationalsozialistischen Besatzer schließlich sechs Millionen Juden, die meisten in Osteuropa, teils unter Mithilfe lokaler Polizei und Behörden. Mit seinem gesamteuropäischen Blick ermöglicht Götz Aly ein neues, umfassendes Verständnis des Holocaust. Ausgezeichnet mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2018.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Götz Aly
Europa gegen die Juden
1880–1945
Über dieses Buch
Erstmals ein gesamteuropäischer Blick auf den Antisemitismus und den Weg in den Holocaust
Der Holocaust ist nicht allein aus der deutschen Geschichte heraus erklärbar. Sowohl in West- als auch in Osteuropa hatte die Judenfeindschaft seit 1880 sprunghaft zugenommen - angetrieben von Nationalismus und sozialen Krisen. Ohne die Schuld der deutschen Täter zu mindern, zeigt der Historiker Götz Aly, wie Rivalität und Neid, Diskriminierung und Pogrome vielerorts dazu beigetragen haben, den Boden für Deportationen und Morde zu bereiten. Erstmals wird so der moderne Antisemitismus als grenzüberschreitendes Phänomen dargestellt und damit ein neuer, umfassender Blick auf die europäischen Vorgeschichten eröffnet, die zum Holocaust beitrugen.
»Götz Aly ist einer der innovativsten und findigsten Gelehrten im Bereich der Holocaust Studien.«
Christopher Browning, The New York Times Book Review
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Götz Aly ist Historiker und Journalist. Er arbeitete für die »taz«, die »Berliner Zeitung« und als Gastprofessor. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt. 2002 erhielt er den Heinrich-Mann-Preis, 2003 den Marion-Samuel-Preis, 2012 den Ludwig-Börne-Preis. Zuletzt veröffentlichte er bei S. Fischer 2011 »Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800-1933« sowie 2013 »Die Belasteten. ›Euthanasie‹ 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Covergestaltung: kreuzerdesign | München Rosemarie Kreuzer
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401419-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Von der Judenfrage zum Holocaust
Welches Heim hat der Jude?
Tatherrschaft der Deutschen
Judenfeindschaft in Europa
Hinweise zur Darstellung
2. Die Rückkehr der Unerwünschten 1945
In Wien hartherzig und stumm
Rückkehrer aus Schanghai und Karaganda
Spurlos verschwunden in Wilna
Jüdische Friedhöfe, eingeebnet 1948 und 1961
Falschheit und Einsicht in Ungarn
»Das Kino ist schon wieder voll von Juden«
Nichts wie weg aus Europa!
3. Propheten künftiger Schrecken um 1900
Zionismus: Wir sind ein Volk!
Das politische Manifest »Der Judenstaat«
Zwischen Revolution und »furchtbarer Geldmacht«
Staatsgestor Theodor Herzl
»Der Jude wird verbrannt!«
Hoffnungen auf den Erfolg der Zionisten
Vom Völkerhass zum Völkermord
Deutsche Studenten, »bedroht von Wanzenvölkern«
4. Die Behäbigen hassen die Rührigen
Juden und das russische Elend
Staatlich gewollte Pogrome und Sondergesetze
1903: Das Pogrom von Kischinew
Die Ungebildeten gegen die Bildungshungrigen
Protektion christlicher Rumänen
Jüdische Schüler werden zu »Ausländern«
»Die letzten Sklaven Europas«
Frankreich: Dreyfus und danach
Wenige Juden – immer mehr Antisemiten
Saloniki: Griechen gegen Juden
Niedergang infolge griechischer Gewalt
5. Frieden, Bürgerkrieg, Pogrom 1918–1921
Selbstbestimmung der Völker
Selektion im Elsass 1918–1923
Frankreichs geordnete Vertreibung
Ein Beispiel findet verschiedene Nachahmer
Neue Freiheit – polnisches Wüten
Das Freiheitspogrom in Lemberg
Eine vom Chauvinismus vergiftete Gesellschaft
Massenmorde in der Ukraine
Umfang und Soziologie der Pogrome
Nationalukrainischer Blutrausch gegen Juden
Proskurow: 1600 ermordete Juden in vier Stunden
»Die Haidamaken«, eine ukrainische Blutballade
Im Krieg verfeindet, im Judenpogrom vereint
6. Gegen Minderheiten und Migranten
Das Ende der Wanderungsfreiheit
Die US-amerikanische Wende
Nationalistisches Zweiklassenrecht
Ethnisches Homogenisieren seit 1923
Obligatorischer Bevölkerungsaustausch
Ethnische Gewaltpolitik macht Schule
Wie Saloniki von 1923 bis 1943 hellenisiert wurde
»Juden sind keine Griechen«
Juden flüchten nach Frankreich
Protektionisten entrechten jüdische Zuwanderer
Verbotener Hass in der Sowjetunion
Das »jüdische Problem des zu großen Erfolgs«
Vom tradierten zum sozialistischen Antisemitismus
1936: Großer Terror und Elitenwechsel
7. Nationen entrechten Juden 1918–1939
Das Projekt »Litauen erwache!«
Litauen den Litauern
Rumänien: Judenhass und Volkswille
Judenmörder werden Volkshelden
225222 Juden werden zu Staatenlosen
Polnische Nationalisten in Aktion
Diskriminierung der Juden zum Vorteil der Polen
»Ghetto-Bänke« für jüdische Studenten
Katholischer Nationalantisemitismus
Gedemütigte, dünkelhafte Ungarn
Magyarisch-antisemitische Gleichstellung
Judendiskriminierung als Akt sozialer Gerechtigkeit
8. Vertreiben und Deportieren 1938–1945
Évian: Wohin mit den Juden?
Die Konferenz, ein Anfang ohne Ende
Krieg, Ethnopolitik und Holocaust
Die südosteuropäischen Verbündeten
Großbulgarien, freigeträumt von allen Fremden
Ethnische Politik in Ungarn
Ethnische Politik in Rumänien
Deportation aus der Slowakei, Massenmord in Kroatien
Der Feind löst die Judenfrage
Litauische, lettische und ukrainische Helfer
In Belgien »kein Verständnis für die Judenfrage«
Als ausländischer Jude gefährdet in Frankreich
Staatsbürger »luxemburgischen Bluts«
Deutsche und Griechen ghettoisieren Juden
Italienische und spanische Diplomaten reden Klartext
Polen und Sowjetunion: Deutscher Terror und Judenmord
Im Krieg erlosch der Judenhass in Polen nicht
Auch in der Sowjetunion unerwünscht
1945: Angst und Schrecken in Polen
9. Zivilisation und Zivilisationsbruch
Nationaler und sozialer Aufstieg
Von der Diskriminierung zur »Entjudung«
Demokratie, Revolution und Judenhass
Juden als beneidete Vorbilder
Aus mentalen Unterschieden werden materielle
Der Krieg ermöglichte den Mord
Partizipation an den Früchten des Verbrechens
Goebbels: »Wer A sagt, muss auch B sagen«
Das Gute begünstigte das Böse
Literatur
Register
1.Von der Judenfrage zum Holocaust
Welches Heim hat der Jude?
Mit stürmisch steigender Tendenz wanderten bis 1914 mehr als zwei Millionen osteuropäische Juden nach Amerika aus. Sie suchten nach Sicherheit und Glück. Polen, Italiener, Chinesen oder Deutsche schickten ihre jungen Männer voraus, damit sie die Lage erkunden und gegebenenfalls zurückkehren konnten. Juden aber machten sich mit Kind und Kegel auf den Weg ins Ungewisse, auf Nimmerwiedersehen. Denn sie wichen kollektiver Verfolgung. Israel Zangwill, Sohn jüdisch-russischer Einwanderer in London, prägte dafür den Begriff Vertreibungsemigration: »Der [in die USA eingewanderte] Italiener oder Chinese trachtet, mit seinem Gewinne wieder heimzukehren. Welches Heim hat aber der Jude, in das er zurückkehren könnte? Er hat alle seine Boote verbrannt; oft war er gezwungen, ohne Pass zu fliehen, er kann nicht zurückkehren.«
Im Sommer 1907 erschütterte eine schwere Wirtschaftskrise die USA. In der Folge reisten 300000 italienische Immigranten binnen weniger Wochen in die Heimat zurück. In Anbetracht dieser Tatsache konfrontierte der aktive Zionist Zangwill sein Publikum im Dezember desselben Jahres mit dem Gedankenspiel: »Stellen Sie sich einmal vor, es kämen 300000 Juden zurück!«[1]
Wie sich ein solcher Fall abspielen konnte, demonstrierten Deutschland und Polen 1938. Im Sommer hatte die Regierung in Warschau Regularien erlassen, um schon länger im Ausland lebenden Juden die Staatsbürgerschaft zu entziehen, sie zu besonders geächteten Staatenlosen zu machen. Daraufhin verhaftete die deutsche Polizei in den letzten Oktobertagen auf einen Schlag 17000 polnische Juden, transportierte sie an die Ostgrenze und jagte sie auf die andere Seite. Dort hieß niemand die eigenen Staatsbürger willkommen. Sie waren Juden! Polnische und deutsche Grenzwachen trieben die Abgeschobenen tagelang zwischen den Linien hin und her. Schließlich wurden sie auf polnischer Seite in hastig errichtete, streng bewachte Lager gesperrt. Das größte, mit mehr als 8000 Männern, Frauen und Kindern belegt, entstand nahe dem Grenzübergang Neu-Bentschen im polnischen Zbąszyń (Alt-Bentschen), das zwischen Frankfurt (Oder) und Posen liegt. Es blieb bis zum Sommer 1939 in Betrieb.
Über die Zustände dort berichtete der aus Berlin deportierte Geiger Mendel Max Karp: »Der Ort ist von der Polizei streng abgeriegelt, auch am Bahnhof ist Polizeikontrolle. Nur Flüchtlingsleute über 65 Jahre können nach dem Inneren Polens weiterfahren. Wir anderen müssen eben zusehen, wie wir hier aus diesem Käfig herauskommen können, und da das nur durch ein Einreisevisum anderswohin möglich ist, erwarten wir mit Sehnsucht Hilfe von draußen.« Karp sandte den Hilferuf an seinen Cousin Gerhard Intrator, der bis 1933 Referendar am Berliner Kammergericht gewesen war und sich 1937 aus Hitlerdeutschland in die USA hatte retten können. Seither hatte Karp unentwegt versucht, ihm zu folgen. Vergeblich.[2]
Nach zwei Wochen, Mitte November 1938, kürzte die polnische Regierung die Lebensmittel für die Internierten. Parallel dazu verlangte sie in Washington, London und beim Völkerbund in Genf energisch, andere Staaten sollten die aus Deutschland vertriebenen polnischen Staatsbürger aufnehmen. Aber warum? Graf Edward Raczyński, polnischer Botschafter in London, drückte sich so aus: »Diese Menschen« besäßen zwar polnische Pässe, »aber keine weiteren Bindungen an Polen«. Wenig später drohte Raczyńskis Stellvertreter Graf Jan Baliński-Jundziłł im britischen Außenministerium, »bislang« habe man in Polen »jeder Aktion gegen die Juden widerstanden«. Bislang! Falls die westliche Staatenwelt nicht helfe und die aus Deutschland Vertriebenen aufnehme, »werde man in Polen daraus schließen, dass nur ein Weg zur Lösung des jüdischen Problems gangbar sei – die Verfolgung der Juden«.[3]
Dank internationaler Interventionen und deutsch-polnischer Absprachen erhielt Max Karp am 29. Juni 1939 die Erlaubnis, aus dem Lager Zbąszyń nach Berlin zurückzureisen. Allerdings hatten ihm die deutschen Behörden auferlegt, das Land bis zum 24. August endgültig zu verlassen. Er plante, nach Schanghai auszuwandern. Die für die Schiffspassage erforderlichen Devisen beschaffte die Verwandtschaft in den USA. Auf den Tag genau, am 23. August, hatte Karp tatsächlich alles beisammen: ein noch nicht datiertes, mit US-Dollars bezahltes vorläufiges Ticket, allerlei mit Gebührenmarken und Stempeln autorisierte Papiere und eine Aufenthaltsverlängerung der Gestapo bis zur Ausreise. Zu spät. Am 1. September begann der Krieg. Am 13. September 1939 verschleppte die Berliner Polizei Max Karp als lästigen staatenlosen Ostjuden ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Dort erhielt er die Häftlingsnummer 009060, wurde zusammen mit anderen aus demselben Grund Verhafteten in das sogenannte Kleine Lager gesperrt und am 27. Januar 1940 auf unbekannte Weise zu Tode geschunden oder ermordet.
Die Sterbeurkunde fertigte der Oranienburger Standesbeamte Otto Griep aus. Laut seiner – gewiss erlogenen – Eintragung hatte eine Grippe den Tod des Häftlings Karp früh um 7.00 Uhr herbeigeführt – »eingetragen auf schriftliche Anzeige des Lagerkommandanten des Lagers Sachsenhausen in Oranienburg«. Das KZ verfügte erst später über ein eigenes Standesamt; noch fehlte auch das lagereigene Krematorium. So wurde der Leichnam des Ermordeten im Berliner Krematorium Baumschulenweg eingeäschert. Am 22. Februar 1940 ließ Rachel Intrator, die am Kurfürstendamm 185 wohnte, die Urne mit den sterblichen Überresten ihres Neffen auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beisetzen – im Grab ihrer Schwester Anna Karp, die ihren Sohn Mendel Max 1892 im galizischen, damals österreichischen, seit 1918 polnischen Dorf Ruszelczyce zur Welt gebracht hatte.[4]
Für das Thema »Europa gegen die Juden« und die notwendigen Differenzierungen steht die Lebens- und Sterbegeschichte dieses Mannes exemplarisch. Die deutsche Regierung diskriminierte ihn, nahm ihm seine Anstellung als Musiker, machte ihn zum Hausierer und hetzte ihn schließlich mittellos über die Grenze, weil ihm die polnische Regierung die staatsbürgerlichen Rechte aberkennen wollte. Diese weigerte sich, den Vertriebenen aufzunehmen. Sie verstieß ihn als unerwünschtes Element und beraubte ihn der Freiheit. Am Ende ermordeten Deutsche Mendel Max Karp – nicht Polen. Doch hatte die polnische Regierung dazu beigetragen, seine Überlebenschancen zu mindern.
Tatherrschaft der Deutschen
Das Deportieren und Morden geschah auf Initiative der Deutschen. Deutsche steuerten die bürokratischen Routinen des Erfassens, Ghettoisierens und Enteignens. Sie entwickelten die technischen Mittel des Mordens. Sie organisierten die Deportationen, die Massenerschießungen und Todeslager. Sie entfesselten die Gewalt gegen Juden in den besetzten und verbündeten Staaten. Keine Frage: Die Regierung Hitler übte die Tatherrschaft aus.
Doch kann ein Völkermord nicht allein von den Initiatoren begangen werden. Wer die Praxis der Judenverfolgung in verschiedenen Ländern untersucht, stößt unweigerlich darauf, wie geschickt die deutschen Eroberer überall in Europa bereits vorhandene nationalistische, national-soziale und antisemitische Bestrebungen einbezogen, um ihre Ziele durchzusetzen. Ohne zumindest passive Unterstützung, ohne die vielen arbeitsteilig helfenden Verwaltungsbeamten, Polizisten, Politiker und tausende einheimische Mordgesellen in manchen Staaten hätte sich das monströse Projekt nicht mit der atemberaubenden Geschwindigkeit verwirklichen lassen. Der Holocaust kann weder in seinen schnellen noch in seinen stockenden Abläufen begriffen werden, wenn man nur die deutschen Kommandozentralen im Blick hat.
Beispielsweise äußerte der rumänische Staatsführer Ion Antonescu zur Judenfrage, nachdem er von Hitlers Kriegsplan gegen die Sowjetunion erfahren hatte: »Rumänien muss energisch, methodisch und nachhaltig von dem ganzen Geschmeiß befreit werden, das die Lebenssäfte des Volkes ausgesaugt hat. Die internationale Lage ist günstig, und wir dürfen den Moment nicht verpassen.«[1] Antonescu – und nicht nur er – wollte die Ausnahmesituation nutzen. Herbeigeführt worden war sie von Deutschland. Erst dann zerbrachen die zivilen, moralischen und rechtlichen Normen an so vielen Orten Europas endgültig.
Wie sehr der Krieg aus zuvor zwar vorurteilsbeladenen, aber halbwegs friedlichen Menschen Mörder machen kann, mussten hunderttausende Juden bereits zwischen 1918 und 1921 erfahren. Deshalb ist eines der Kapitel dieses Buches den osteuropäischen Freiheitspogromen, Bürger- und Nationalitätenkriegen gewidmet, die dem Ersten Weltkrieg folgten. Damals ermordeten Soldaten und Milizionäre verschiedener Konfliktparteien mehr als hunderttausend keiner Kriegspartei angehörende Juden – Männer, Frauen und Kinder. Weitreichende kriegerische Destruktion bildete den Ausgangspunkt für den Massenraubmord an einer seit langem neidisch beäugten, drangsalierten, diskriminierten, von Zeit zu Zeit terrorisierten und zugleich überheblich verachteten Minderheit. Diese von nationalistischen Polen, Ukrainern und Russen, von roten, weißen, anarchistischen oder einfach marodierenden Truppen verübten Schreckenstaten fanden in den Hauptsiedlungsgebieten der Juden statt – ausgelöst vom Krieg, begangen an einer von den anderen Bevölkerungsgruppen deutlich unterschiedenen, besonders wehrlosen Minderheit. Saul Friedländer hat in seinem monumentalen Werk über den Holocaust darauf hingewiesen, dass sich in den Jahren 1939 bis 1945 »nicht eine einzige gesellschaftliche Gruppe« in Europa mit den verfolgten Juden solidarisch erklärt habe, und folgerte: »So konnten sich nationalsozialistische und ihnen verwandte politische Strategien bis zu ihren extremsten Konsequenzen entfalten, ohne dass irgendwelche nennenswerten Gegenkräfte sie daran gehindert hätten.«[2] In diesem Buch geht es um die Vorgeschichten. Wie, warum und in welchen unterschiedlichen Formen nahm der Antisemitismus in Europa seit 1880 in einer Weise zu, die es den deutschen Verfolgern und Mördern schließlich ermöglichte, in fast allen besetzten und verbündeten Ländern Unterstützung für ihr Projekt »Endlösung« zu finden?
Ursprünglich hatte die Berliner Wannseekonferenz am 9. Dezember 1941 stattfinden und sich mit der Deportation der deutschen Juden befassen sollen. Dazu eingeladen hatte Reinhard Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamts. Doch sagte er den Termin kurzfristig ab. Gründe nannte er nicht, stellte jedoch eine neue Einladung in Aussicht. Sie erfolgte für den 20. Januar 1942. Zwischenzeitlich hatten die Führer des Deutschen Reichs das Thema stark erweitert. Jetzt stand statt der deutschen die »Endlösung der europäischen Judenfrage« auf der Tagesordnung.[3] Heydrich erläuterte den Versammelten das Vorhaben und warb um konstruktive Mitarbeit – um die »Parallelisierung der Linienführung«. In einigen der besetzten und verbündeten Länder vermutete er gewisse Widerstände gegen das Großprojekt »Endlösung«, in anderen nicht. Davon etwas abweichend trug auch Unterstaatssekretär Martin Luther vom Auswärtigen Amt vor, wie er die Bereitschaft in einzelnen Staaten beurteilte, die Juden zu verhaften und die Todestransporte abzufertigen – im Protokoll umschrieben als »tiefgehende Behandlung des Problems«.
Heydrich: »Die Behandlung des Problems in den einzelnen Ländern wird im Hinblick auf die allgemeine Haltung und Auffassung auf gewisse Schwierigkeiten stoßen. (…) In der Slowakei und Kroatien ist die Angelegenheit nicht mehr allzu schwer, da die wesentlichsten Kernfragen in dieser Hinsicht dort bereits einer Lösung zugeführt wurden. In Rumänien hat die Regierung inzwischen ebenfalls einen Judenbeauftragten eingesetzt. Zur Regelung der Frage in Ungarn ist erforderlich, in Zeitkürze einen Berater für Judenfragen der ungarischen Regierung aufzuoktroyieren.« Mit seinem italienischen Kollegen wollte Heydrich selbst verhandeln. Im besetzten und unbesetzten Frankreich, so verbreitete er optimistisch, werde »die Erfassung der Juden zur Evakuierung aller Wahrscheinlichkeit nach ohne große Schwierigkeiten vor sich gehen können«. Als »Kernfragen«, die das Projekt »Endlösung« erleichtern würden, betrachtete Heydrich die Entrechtung, Enteignung und soziale Isolierung der Juden auf Initiative oder mit Hilfe der jeweiligen nationalen Autoritäten. Was die eroberten Gebiete der Sowjetunion anging, verwies er auf die bereits gesammelten Erfahrungen: Deutsche Einsatzkommandos hatten bis zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit rumänischen, ukrainischen, lettischen und litauischen Helfern bereits 800000 Juden ermordet.
Staatssekretär Luther schränkte ein, »dass bei tiefgehender Behandlung dieses Problems in einigen Ländern, so in den nordischen Staaten, Schwierigkeiten auftauchen werden«. Daher sei es ratsam, »diese Länder vorerst noch zurückzustellen«, was »in Anbetracht der hier in Frage kommenden geringen Judenzahlen« nicht ins Gewicht falle. »Für den Südosten und Westen Europas« sah er »keine großen Schwierigkeiten«. Wie Adolf Eichmann protokollierte, wurden abschließend »die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen, wobei sowohl seitens des Gauleiters Dr. Meyer [Ministerium für die besetzten Ostgebiete] als auch seitens des Staatssekretärs [der deutschen Zivilverwaltung im besetzten Polen] Dr. Bühler der Standpunkt vertreten wurde, gewisse vorbereitende Arbeiten im Zuge der Endlösung gleich in den betreffenden Gebieten selbst durchzuführen, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse«.
Unter »vorbereitenden Arbeiten« verstanden die 15 versammelten Herren, acht davon mit Doktortitel, den bereits begonnenen Aufbau von Vergasungseinrichtungen und Experimente mit unterschiedlichen Methoden des Massenmords. Bald nach der Konferenz notierte Joseph Goebbels Ende März 1942: »Es wird hier ein ziemlich barbarisches, nicht näher zu beschreibendes Verfahren angewandt, und von den Juden selbst bleibt nicht mehr viel übrig.«[4]
Das war der Plan. Die Durchführung wich davon ab. In Belgien fielen 45 Prozent der Juden den deutschen Eindringlingen in die Hände, allerdings mit erheblichen regionalen Unterschieden. Im flämischen Antwerpen wurden unter tätiger Mitwirkung der städtischen Polizei von 30000 jüdischen Einwohnern 65 Prozent gefasst, im wallonischen Brüssel von 22000 nur 37 Prozent, weil Behörden und nichtjüdische Nachbarn dort deutlich weniger kooperierten.
In Ungarn deportierten etwa 20000 einheimische Gendarmen 437402 Juden mit Hilfe der ungarischen Staatsbahn Richtung Auschwitz. Das geschah zwischen dem 15. Mai und dem 9. Juli 1944. Erst an der slowakischen Grenze übernahmen Deutsche die Transporte. Die Todgeweihten stammten aus den Provinzen, hatten überwiegend traditionell gelebt, die meisten sprachen untereinander Jiddisch. Budapester Politiker und Bürger verachteten sie als »Galizier«. Von den Deportierten überlebten ungefähr 60000 als Zwangsarbeiter die letzten Kriegsmonate. Anfang Juli 1944 leitete Eichmann den bis dahin zurückgestellten Abtransport der etwa 150000 gut assimilierten Budapester Juden ein. Jetzt verweigerte die ungarische Regierung die Mitwirkung. Allein auf sich und seinen Stab gestellt, konnte Eichmann nur noch drei Züge mit zuvor schon ghettoisierten Juden abfertigen lassen. Drei Tage später reiste er nach Berlin zurück, weil er ohne ungarische Beihilfe nichts mehr ausrichten konnte. So überstand die große Mehrheit der Budapester Juden die Zeit des Mordens.[5]
Am Krieg gegen die Sowjetunion beteiligte sich das mit Deutschland verbündete Rumänien. Von Deutschen gedeckt, ermuntert und manchmal von der Einsatzgruppe D unterstützt, töteten rumänische Polizeikräfte, Einwohnermilizen und Soldaten in den rumänisch besetzten Gebieten mindestens 250000 Juden oder trieben sie in den Tod. Diese staatlich gewollten Verbrechen ereigneten sich in den national umstrittenen Gebieten Moldawien (Bessarabien), Transnistrien und in der Bukowina. Doch schützte dieselbe Regierung die allermeisten der 315000 Juden Zentralrumäniens vor dem Zugriff der Deutschen, seit 1943 sogar Juden, die aus den deutsch beherrschten Gebieten nach Rumänien fliehen konnten.[6] Auch in Bulgarien verschonte die Regierung die 48000 Juden des Kernlandes. Aber mit eigenen Polizeikräften ließ sie die Juden, die in den 1941 von Bulgarien annektierten Gebieten Thrazien und Mazedonien lebten, ins deutsch besetzte Polen verbringen – mehr als 11000 Menschen, die in Treblinka ermordet wurden.
Aus Saloniki verschleppten Deutsche 45000 Juden mit griechischer Beihilfe nach Auschwitz und ermordeten dort fast alle. Dagegen entkamen mehr als zwei Drittel der insgesamt 3500 jüdischen Athener den deutschen Häschern, sowohl dank griechischer Untätigkeit als auch aktiver Hilfe für die Bedrohten. Anders als die Juden von Saloniki waren die Juden in Athen assimiliert. Zudem galt der erst 1912 annektierte Norden des Landes der griechischen Bevölkerung und ihrer Regierung noch als national umkämpftes, zu hellenisierendes Gebiet.
Die Beispiele deuten an, um welche Fragen es in den folgenden Kapiteln gehen wird. Erstens soll untersucht werden, warum die in die jeweiligen nationalen Mehrheitsgesellschaften integrierten Juden deutlich bessere Überlebenschancen hatten als diejenigen, die traditionell gekleidet waren und den jiddischen oder sephardischen »Jargon« sprachen. Zweitens soll dargelegt werden, in welchem Umfang Funktionsträger der verbündeten oder von Deutschland besetzten Staaten die Judendeportationen guthießen, weil sie das Ziel verfolgten, die Bevölkerungen an den national umstrittenen Rändern des eigenen oder gerade erweiterten Staates »ethnisch zu säubern«. Drittens steht zur Debatte, wie sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts antisemitische Zielsetzungen mit der allgemeinen Politik ethnischer Homogenisierung verbanden. Daraus folgt die vierte Frage, wieweit viele europäische Regierungen (einschließlich der Kollaborationsregierungen) und erhebliche Teile der jeweiligen Mehrheitsgesellschaften die Deportation der Juden unterstützten oder wenigstens tolerierten, weil sie sich davon neue wirtschaftliche Chancen für das jeweilige sogenannte Staatsvolk versprachen. Zusammengefasst ergibt sich daraus die Frage: Inwieweit machte die Mixtur aus positiv verstandenen und negativen Programmpunkten – aus nationalem Aufbauwerk und Antisemitismus – die »Entfernung der Juden« besonders verlockend und beförderte das Mittun und Wegsehen?
Um die Voraussetzungen für die mörderische Praxis der Deutschen besser zu verstehen, muss der in Europa weitverbreitete Nationalismus vor und nach dem Ersten Weltkrieg in die Analyse einbezogen werden. Deshalb gehören nicht nur antisemitische Gesetze und Gewalttaten zur Thematik dieses Buches, sondern auch die vielfältigen Bestrebungen zur ethnischen Homogenisierung, ebenso die Praktiken einzelner Staaten, Minderheiten generell zu benachteiligen, um ihren namensgebenden Mehrheitsvölkern Vorteile zu verschaffen – seien es Polen, Slowaken, Magyaren, Ukrainer, Kroaten oder Rumänen. Dazu zählten Beschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, der Berufswahl und der staatsbürgerlichen Rechte, forcierte Assimilation, Vertreibungen und vertraglich geregelte Zwangsumsiedlungen. In dieses europäische Panorama fügen sich die in Kapitel 5 beschriebenen, von Frankreich praktizierten Zwangsumsiedlungen Deutscher aus Elsass-Lothringen in den Jahren 1918 bis 1923 und die obligatorischen »Transfers« hunderttausender Menschen zwischen Griechenland, der Türkei und Bulgarien, die bald nach dem Ersten Weltkrieg einsetzten. Für sich genommen, berührten beide Ereignisse Juden allenfalls zufällig, aber sie erhoben die Zwangsausweisung von Minderheiten zu einem akzeptierten Verfahren europäischer Politik. Als die französischen Behörden 1919 in Elsass-Lothringen die »épuration« (Säuberung) von Zuwanderern aus dem Deutschen Reich begannen, entwickelten sie dafür ein bürokratisch leicht handhabbares Kriterium – die Geburtsorte der Eltern, gegebenenfalls der vier Großeltern.
Die einzelnen Länder Europas gewichte ich in der Darstellung unterschiedlich. Dafür gibt es einen klaren Grund: Etwa 85 Prozent der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden stammten aus Polen, Russland, Rumänien, Ungarn und den baltischen Staaten. Deshalb muss der Schwerpunkt meiner Darstellung auf den europäischen Regionen liegen, in denen die allermeisten Juden lebten und gewaltsam starben. Aus der Gruppe der genannten Staaten kann Ungarn insofern als westlich gelten, als die Judenemanzipation dort, wie in der gesamten Habsburgermonarchie, 1867 vollzogen wurde. Obwohl in Griechenland vergleichsweise wenige Juden lebten, beschreibe ich die Entwicklung des Antisemitismus dort ausführlich, beispielhaft für eine sich territorial langsam konsolidierende Nation als Prozess, der mit vielerlei Formen von Gewalt verbunden war. Die Parallelen zu anderen Nationalismen sind unübersehbar. Stellvertretend für westeuropäische Staaten steht Frankreich. Trotz aller seit 1791 kodifizierten (unter Napoleon vorübergehend eingeschränkten) Rechtsgleichheit entwickelte sich selbst dort seit den 1880er Jahren ein moderner Antisemitismus.
Als die Vertreter der Siegermächte 1919/20 in Paris die noch heute weithin vertraute Welt der Nationalstaaten schufen und in Europa neue, tausende Kilometer lange Grenzen zogen, spitzte sich ein Problem zu, das die untergegangenen Imperien so nicht gekannt hatten: das der nationalen Minderheiten. Wer von den neuen Regierungszentralen als Minderheit definiert wurde, hatte vielerlei Nachteile zu befürchten; wer dem Mehrheitsvolk angehörte, genoss Protektion und Privilegien. Deshalb setzten England, Frankreich und die USA 1919/20 Minderheitenschutzverträge und Optionsrechte durch. Sie führten zu einer Fülle unsäglicher Streitigkeiten. Vor allem aber bedachten die Schöpfer der Pariser Friedensordnung nicht, wie Hannah Arendt schrieb, dass es schon bald »ganze Gruppen von Menschen in Europa geben könne, die undeportierbar waren, weil sie in keinem Land der Welt Aufenthaltsrecht hatten«.[7]
Lange vor 1939 wurde in verschiedenen Staaten Europas lebhaft diskutiert, wie die jüdischen Minderheiten in absehbarer Zeit »zur Auswanderung gebracht werden« könnten. In diesen Zusammenhang ordnet sich das Kapitel »Das Ende der Wanderungsfreiheit« ein. Es handelt von den 1921 und 1924 verfügten Sperren, mit denen die USA vielen Europäern und besonders osteuropäischen Juden den so wichtigen Ausweg nach Übersee abschnitten. Infolgedessen wurde in Europa bald die politisch aufgeladene Frage erörtert: Wohin mit den überzähligen Juden? Wie kann man sie loswerden? Nach den Krisen und Bürgerkriegen, die dem Ende des Ersten Weltkriegs gefolgt waren, erzeugte zehn Jahre später die Weltwirtschaftskrise weitere innere Verwerfungen in der europäischen Staatenwelt. Überall marschierte der mittlerweile antirepublikanisch formierte Nationalismus voran. Zudem zerstörte das nationalsozialistische Deutschland seit 1933 die fragile, doch immerhin noch aufrechterhaltene europäische Ordnung mit dem eindeutigen Ziel, Europa mit einem weiteren Krieg zu überziehen. Allerdings wirkten Nationalsozialismus und Faschismus auch ansteckend auf eine Vielzahl europäischer Parteien, Politiker und Wählerschaften. Sie fühlten sich vom Erfolg autoritären Regierens in Italien und Deutschland angezogen, von der staatlich gesteuerten Wirtschafts- und Sozialpolitik, von der Massenmobilisierung eines normalerweise lethargischen Volkes, von der kompromisslosen Bevölkerungspolitik, von den Maßnahmen zum Wohle des eigenen Volkes und zum Nachteil von Minderheiten, insbesondere von Juden.
Nicht selten ähnelten die Formen der Diskriminierung jüdischer Minderheiten einander. Daher erscheint es mir nicht sinnvoll, für jedes Land eine in sich geschlossene Geschichte des Antisemitismus nachzuzeichnen. Das müsste zu Wiederholungen führen. Litauen und große Teile Polens gehörten bis 1918 zum Russischen Reich. Aus diesem Grund streife ich die nationalistisch-judenfeindliche Vorgeschichte nur kurz und lege für diese beiden Länder den Akzent auf die Zwischenkriegszeit.
Judenfeindschaft in Europa
In den meisten europäischen Staaten blieben nach 1945 Fragen an die eigene Geschichte während des Zweiten Weltkriegs tabu, soweit sie das weitgefächerte Zusammenwirken mit der Besatzungsmacht hätten berühren können. In aller Regel statuierte man an sogenannten Kollaborateuren ein drakonisches Exempel, um die Mehrzahl der Mittäter, der Denunzianten, der großen und der kleinen Profiteure in Ruhe zu lassen. Nach dem entsetzlichen Krieg hielten sich viele Menschen lieber und verständlicherweise an wenig verfängliche Teilerinnerungen und an Legenden vom massenhaften Widerstand als an Tatsachen.
Diese Welt- und Trugbilder blieben bis in die 1980er Jahre im Wesentlichen stabil. Das änderte sich erst nach dem Ende des Kalten Krieges. Im März 1995 entschuldigte sich der litauische Präsident Algirdas Brazauskas im israelischen Parlament, der Knesset, für diejenigen Litauer, »die Juden gnadenlos ermordeten, sie erschossen, sie deportierten und sie beraubten«. Der gerade gewählte französische Staatspräsident Jacques Chirac erinnerte am 16. Juli 1995 an die Ereignisse vom 16. Juli 1942. Damals hatten 4500 französische Polizisten und Gendarmen, die unter französischem Kommando standen, im Auftrag der deutschen Besatzungsmacht eine Razzia durchgeführt.
»Am frühen Morgen dieses Tages wurden in Paris und Umgebung«, so schilderte Chirac den Ablauf, »knapp 10000 jüdische Männer, Frauen und Kinder in ihren Wohnungen festgenommen und in den Polizeikommissariaten gesammelt. Entsetzliches geschah. Familien wurden auseinandergerissen, Kinder von ihren Müttern getrennt, Greise – von denen einige im Ersten Weltkrieg für Frankreich geblutet hatten – in Busse der Pariser Verkehrsgesellschaft und Mannschaftswagen der Polizei geworfen. (…) An diesem Tag beging Frankreich – die Heimat der Aufklärung und der Menschenrechte, Hort der Zuflucht und des Asyls – das Unentschuldbare: Es verriet seine Prinzipien und lieferte seine Schutzbefohlenen den Henkern aus. Die Opfer wurden ins Stadion Vélodrome d’hiver gepfercht. Dort mussten sie unter fürchterlichen Bedingungen ausharren, bis sie in die Transitlager Pithiviers oder Beaune-la-Rolande verbracht wurden. (…) Anschließend erfolgten weitere Aktionen zur Festnahme von Juden in Paris und in der Provinz. Insgesamt fuhren 74 Züge nach Auschwitz. 76000 deportierte französische Juden kamen nicht zurück. Wir stehen für immer in ihrer Schuld.«[1]
Verzögert und nicht immer derart eindringlich folgten viele Oberhäupter Europas diesen Beispielen. Jacques Chirac wird es leichter gefallen sein als vielen seiner europäischen Kollegen, vom Versagen des eigenen Landes zu sprechen. Trotz der anfänglich geschmeidig kollaborierenden Vichy-Regierung, der bereitwillig mitwirkenden französischen Gendarmerie und der bald von Frankreich erlassenen Sondergesetze gegen Juden konnten die deutschen Verfolger nur jeden Vierten der etwa 320000 französischen Juden abtransportieren – weit überwiegend solche, die im Ausland geboren waren. Die große Mehrheit der französischen Juden war in der Lage, sich dank der Hilfe oder Passivität von Franzosen zu retten.
Nicht selten dauerte es Jahrzehnte, bis sich die Einwohner einzelner Städte der Vergangenheit stellten. Das geschah oft aufgrund der Hartnäckigkeit weniger Bürger. Stellvertretend sollen dafür zwei Beispiele genannt werden. 1943 entfernten die Einwohner der mährischen Kleinstadt Prostějov die 2000 Grabsteine des jüdischen Friedhofs, verwandelten das Gelände in ein Fußballfeld und später in einen kleinen Park. Die Grabsteine verwendeten sie als Bau- und Pflastermaterial. 2015 machte sich Tomáš Jelinek daran, die entweihten Steine zu suchen und den Friedhof wieder sichtbar werden zu lassen.[2] Die Hauptsynagoge in Posen bauten die Deutschen 1940 zum Hallenbad um. Bei dieser Nutzung blieb es im polnischen Poznań bis 2011. In anderen Städten herrscht weiter das Vergessen vor. Im heute weißrussischen Brest sind Gartenwege noch immer mit den Grabsteinen jüdischer Friedhöfe gepflastert. Die einstige Hauptsynagoge im lettischen Daugavpils (Dünaburg) ist äußerlich perfekt renoviert – genutzt wird sie als beliebter Elektronikmarkt.[3]
Warum habe ich den Zeitraum 1880 bis 1945 gewählt? Für das Ende der zu besprechenden Epoche besteht mit dem Jahr 1945 eine klare Zäsur, die nicht begründet werden muss. Für den Ausgangspunkt 1880 sprechen keine zwingenden, aber einige mir plausibel erscheinende Gründe. 1882 wurden in Russland, Russisch-Polen eingeschlossen, harte gegen die fünf Millionen Juden des Landes gerichtete Gesetze erlassen. Sie prägten die folgenden 35 Jahre und wirkten nach. Rumänische Politiker erließen 1864 Gesetze zur besseren Integration der Juden. Doch zehn Jahre später erfolgte die antisemitische Kehrtwende der Bukarester Deputierten. Infolge der russischen Pogrome von 1881 bis 1884 begann die große Drift russischer, polnischer und rumänischer Juden nach Westen, vor allem in die USA.
Zur selben Zeit ergriffen Nationalideen die europäischen Massen. Ursprünglich demokratische und emanzipatorische Bewegungen warben jetzt mit separatistischen, andersnationale Menschen ausschließenden, die eigene Nation vergötternden militanten Programmen. Wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus schritt die Industrialisierung in großen Teilen Europas beschleunigt voran, verbunden mit Krisen, allgemeiner Unsicherheit, nackter Not, erzwungener und freiwilliger sozialer Mobilität. In Mittel- und Westeuropa, wo die mosaischen Minderheiten spätestens seit 1867 weitgehende Rechtssicherheit genossen, kam um diese Zeit der Gedanke auf, sie hätten zu viele Rechte erhalten, würden die christlichen Mehrheiten mit ihrem Bildungseifer, Geschäftsgeist und ihrer Klugheit übervorteilen.
Als Antwort auf den anschwellenden Nationalismus entstand die jüdische Nationalbewegung, der Zionismus. Dessen Vertreter handelten ausdrücklich nach der Devise, wenn sich alle als exklusive Nation verstehen, dann müssen wir, ob wir wollen oder nicht, denselben Weg einschlagen. Das erste bedeutende Manifest des Zionismus, verfasst von Leo Pinsker, erschien 1882 in Berlin und trug den Titel »Autoemanzipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden«. Parallel dazu veröffentlichte Nahum Sokolow in Warschau seine ersten zionistischen Manifeste.
Just 1880 entstand das bis dahin unbekannte Wort Antisemitismus, und zwar in Deutschland. Von hier wurde es ins Weltvokabular exportiert. Der neugeschaffene Begriff beinhaltete eine neue Art von Judengegnerschaft. Sie basierte nicht länger auf religiösen Vorurteilen und Obsessionen, die als altmodisch galten, sondern auf national, sozial und wirtschaftlich hergeleiteten Argumenten. Hinzu kamen Begründungen, die zu ihrer Zeit als wissenschaftlich und daher modern verstanden wurden, übernommen aus der Anthropologie, Ethnologie, Biologie und Bevölkerungswissenschaft. Der Erfinder des Begriffs Antisemitismus, Wilhelm Marr, ein in Magdeburg gebürtiger Linksaußen der demokratischen Revolution von 1848, sagte es so: »Wir sind diesem fremden Volksstamme nicht mehr gewachsen.« Für ihn und seine schnell wachsende Anhängerschaft stand »das flinke, kluge Israel« gegen »die bärenhäutige germanische Indolenz«, standen die Juden, die mit ihren »Talenten wuchern«, gegen den »sittlichen Ernst« der im Durchschnitt deutlich langsameren christlichen Deutschen. Marrs Zeitgenosse Adolf Stoecker bezeichnete das Voranstreben der Juden immer wieder als Grund für die »Verschärfung der sozialen Frage«. 1882 fand in Dresden der erste »Internationale Antijüdische Kongress organisierter Antisemiten« statt.[4]
Die neuen, an die Gegenwart und deren Nöte gebundenen Inhalte machten den Antisemitismus in den 1880er Jahren für moderne, säkulare Staaten politisch anschlussfähig. Parteien konnten ihn bekämpfen oder als Ziel in ihre Programme aufnehmen. Nicht zufällig fand die wild bewegte, zwei Tage dauernde und dann berühmt gewordene Sitzung des Preußischen Abgeordnetenhauses zur Judenfrage am 20. und 22. November 1880 statt. Aus den genannten Gründen erscheint es mir plausibel, das Jahr 1880 als Ausgangspunkt zu nehmen. So entschied sich auch Simon Dubnow, als er den 1929 erschienenen zehnten und letzten Band seines Großwerks »Weltgeschichte des jüdischen Volkes« mit dem Jahr 1880 beginnen ließ.
Hinweise zur Darstellung
Quellentechnisch greife ich im Wesentlichen auf gedruckte Materialien zurück. Sie gliedern sich in drei Gruppen. Erstens sind es zeitgenössische Dokumentationen, Streitschriften und Memoranden wie »Der Lemberger Jugenpogrom«, verfasst von dem jüdischen Zeugen Joseph Tenenbaum, die kurz nach dem jeweiligen Ereignis erschienen. Zu dieser Quellengattung gehört auch Theodor Herzls programmatische Schrift »Der Judenstaat«. Solche Texte sind mir wichtig, weil die Autoren das Ende nicht kannten. Sie standen nicht unter dem Zwang, das geschichtlich beispiellose Ereignis Holocaust erklären zu müssen.
Zweitens benutze ich gründlich ausgearbeitete, mit einigem Abstand verfasste Darstellungen und wissenschaftliche Untersuchungen wie den umfassenden und differenzierten Untersuchungsbericht »Judenpogrome in Russland«, der 1910 in London auf Deutsch herausgegeben wurde. Das Buch »La campagne antisémite en Pologne«, erschienen 1930 in Paris unter der Redaktion von Leo Motzkin, enthält Texte, die als möglichst gut begründete Beschwerden beim Völkerbund eingereicht worden waren. Zu dieser Gruppe zählen wissenschaftliche Werke und Quellensammlungen, etwa zur Dreyfus-Affäre, und Lebenserinnerungen. Aus methodischen Gründen bevorzuge ich auch in diesem Fall Werke, die vor 1939 entstanden.
Dennoch gehört auch die dritte Gruppe der von mir herangezogenen Materialien zu den wesentlichen empirischen Voraussetzungen für dieses Buch: die Fülle neuerer Quelleneditionen und wissenschaftlicher Studien. Seit dem Epochenbruch 1989/90 entstand eine vielfältige, auch vielfältig geförderte Literatur über die Geschichte der Juden und deren Verfolgung in den einzelnen Staaten Europas. Ich stütze mich auf eine Auswahl und konzentriere mich auch hier auf die Quellenfunde aus der Zeit vor 1939. Mein Dank und Respekt geht an die Verfasserinnen und Verfasser, die solche Studien und Dokumentationen erarbeitet haben. Zu diesen zählt die Quellenedition »Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945«, in den Anmerkungen abgekürzt als VEJ, die ich 2003 mitbegründet und fünf Jahre lang als Mitherausgeber begleitet habe. Bis Anfang 2017 waren von den geplanten 16 Bänden bereits zehn erschienen. Dieses Projekt und die Selbstverständlichkeit, mit der meine Kolleginnen und Kollegen europäische Aspekte einbezogen, haben mich bestärkt, dieses Buch zu schreiben.
Die Rechtschreibung folgt den derzeit gültigen Regeln auch in den Zitaten. Darin enthaltene orthographische und grammatikalische Fehler werden stillschweigend korrigiert, Flexionen gelegentlich dem Satzfluss angepasst. Fremdsprachige, aus anderen Büchern in deutscher Übersetzung übernommene Zitate übersetze ich hin und wieder etwas flüssiger, gebe aber das von mir benutzte Werk als Quelle an. Auch wenn mein Text leicht abweicht, steht in der Anmerkung »Zit. nach«. Sachverhalte, die sich im Internet leicht finden lassen, bedürfen keiner Quellenangabe. Für die Schilderung größerer, im Grunde unstrittiger Zusammenhänge weise ich nicht jedes Zitat einzeln nach. In diesen Fällen genügen Sammelanmerkungen.
Da man im Deutschen der oder das Pogrom sagen kann, entschied ich mich für das Pogrom. In verschiedenen Ländern und Zeiten jeweils gebräuchliche, politisch konnotierte Wörter setze ich im Vertrauen auf meine Leser nicht in Anführungszeichen, auch wenn sie uns Heutigen befremdlich erscheinen. Dazu gehören Begriffe wie Mischling, Judenfrage, Neugriechenland, Neurussland, rumänisches Altreich, ethnische Säuberung, Arisierung, Hellenisierung oder Polonisierung, Selektion und Säuberung. Hingegen setze ich die Wörter Freiheitskämpfer oder Befreier manchmal in Anführungszeichen. National- und sozialrevolutionäre Milizen und Freikorps jeder Couleur bezeichneten sich (und bezeichnen sich noch immer) stets als Freiheitskämpfer. Doch verdienen sie diesen Ehrentitel nicht, sofern erwiesen ist, dass sie ihre Vorstellung von Freiheit mühelos mit Morden an unbeteiligten Zivilisten verbanden. Dennoch verwende ich den Begriff manchmal, um an das Selbstverständnis der Verfolger zu erinnern – an das Rauben und Morden im Namen sozialer und nationaler Freiheit.
Wenn ich von Juden spreche, meine ich im Allgemeinen auch Jüdinnen. Ich weiß, dass Juden französische, polnische oder griechische Staatsbürger waren und deshalb die Unterscheidung Jude/Grieche usw. falsch sein kann, sich streng genommen in der antisemitischen Optik bewegt. Das lässt sich aus Gründen darstellerischer Ökonomie nicht ändern. Historiker müssen auch mit den Begrifflichkeiten der fraglichen Zeit arbeiten. Die Leserinnen und Leser dürfen davon ausgehen, dass ich niemandem seine staatsbürgerlichen Rechte abspreche, wenn ich schreibe, eine bestimmte Maßnahme sei gegen die Juden in Saloniki gerichtet gewesen. Ich meine damit griechische Staatsbürger mosaischer Religion. Ein ähnliches Problem besteht für den Terminus »jüdisches Unternehmen«. Es gibt Unternehmen, die irgendetwas herstellen und einem Menschen jüdischer Religion gehören, dennoch verwende ich hin und wieder der Kürze wegen die unkorrekte Bezeichnung. Auch die Kollektivbezeichnung Juden steckt voller Tücken. Sie entspricht jedoch insofern der Realität, als Antisemiten von »den« Juden sprachen und entsprechend handelten. Diese gewissermaßen erfundene Wirklichkeit ist Gegenstand des vorliegenden Buches. Selbstverständlich gab und gibt es arme und reiche Juden, zionistische und antizionistische, gottlose, konvertierte oder national assimilierte, solche, die ihre sprachlichen, religiösen und kulturellen Besonderheiten beharrlich pflegten, und alles dazwischen. Der ungewöhnlich hohe Grad differenten Verhaltens innerhalb des Judentums provozierte die Gegner besonders.
Ähnlich unbefriedigend sind auch die im Folgenden gebrauchten Kollektivbegriffe des europäischen Nationalismus: Deutsche, Polen, Griechen beziehungsweise das französische Judengesetz, die russischen Pogrome. Alle diese Termini sind falsch, insofern viele einzelne Menschen und beachtliche Gruppen ganz anders dachten und handelten. Umgekehrt haben sich vielfach reduktionistisch beschönigende Bezeichnungen eingebürgert: antisemitischer Mob, die Nationalsozialisten, die rumänischen Faschisten, ultranationalistische Kräfte, das deutsche, slowakische, rumänische usw. Regime. Sofern es um den Antisemitismus geht, waren davon nicht allein »die« Nationalsozialisten befallen; an Pogromen und Raub des Eigentums von Juden beteiligten sich Menschen aus allen sozialen Schichten; die als »Regime« bezeichneten Regierungen im Europa des 20. Jahrhunderts verfügten den Antisemitismus nicht diktatorisch, sie griffen ihn auf, um ihre Massenbasis zu erweitern. Prinzipiell übernehme ich Ortsnamen so, wie sie in dem jeweiligen Zeitabschnitt auf dem Ortsschild standen. Abweichend davon gilt das Venedig-Prinzip, demzufolge für Straßburg, Warschau, Lodz, Brünn, Bukarest usw. die im Deutschen gebräuchlichen Namen und Schreibweisen gelten. Auch wenn sich der Sprachgebrauch in Zukunft sicherlich wandeln wird, bezeichne ich Vilnius noch als Wilna oder Lviv als Lemberg. Thessaloniki bezeichne ich durchgehend als Saloniki.
In den Ländern Europas, in denen die christlich-orthodoxen Kirchen eine tragende Rolle spielen, wurde der Julianische Kalender im 20. Jahrhundert zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgeschafft und durch den in den westkirchlichen Regionen üblichen Gregorianischen Kalender ersetzt. Da die Daten in der Literatur manchmal der heute allgemeingültigen Zeitrechnung angepasst sind und manchmal nicht, nehme ich gewisse Unschärfen in Kauf. (Für das 20. Jahrhundert beträgt die Differenz 13, für das 19. Jahrhundert zwölf Tage, um die der Julianische Kalender nachläuft.) Die Transkription kyrillisch geschriebener Namen in die lateinische Schrift wurde zu unterschiedlichen Zeiten verschieden gehandhabt, im Englischen anders als im Deutschen usw. Ich verzichte daher auf ein festes System. Für Vertreibungen, Umsiedlungen und Massenmorde werden häufig beträchtlich voneinander abweichende Zahlen angegeben. Ich versuche, mich auf die mir zuverlässig erscheinenden oder in der neueren Literatur überwiegend genannten Angaben zu stützen. Doch werden viele Zahlenangaben umstritten bleiben.
Große Teile des Buches habe ich in der Bibliothek von Yad Vashem geschrieben. Den stets hilfreichen und zugewandten Mitarbeitern dieser Gedenk- und Forschungsstätte gilt mein besonderer Dank. Diskutiert habe ich meine Texte mit Freunden in Berlin, Wien, Tutzing und Jerusalem. Stellvertretend geht mein spezieller Dank an Yehuda Bauer. Israelische Historiker beziehen die europäischen Kontexte seit langem in ihr Nachdenken über die Shoah ein.
In diesem Sinn bearbeite ich das Thema »Europa gegen die Juden« als eine von mehreren notwendigen Perspektiven geschichtlicher Annäherung. Folglich handelt das Buch nicht vom Widerstand gegen Judendiskriminierung und -verfolgung, sondern vom Aufstieg des modernen europäischen Antisemitismus. In meinem 2011 erschienenen Buch »Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800–1933« habe ich die deutsche Vorgeschichte untersucht. Ich betrachte diese Studie als notwendige Vorarbeit, um über das Thema »Europa gegen die Juden« zu schreiben. Beide Bücher gehören zusammen, sind teilweise parallel entstanden. Jeden einzelnen meiner Versuche, die Verbrechen Hitlerdeutschlands in ihren historischen Kontexten zu analysieren, verstehe ich nicht als umfassende Antwort auf die vielen Fragen nach dem Warum und Wie, sondern als Möglichkeit, das nicht selten für unbegreiflich Erklärte aus jeweils unterschiedlich gewählten Blickwinkeln etwas begreifbarer zu machen. Vielleicht lässt sich daraus auch im präventiven Sinn lernen.
Historiker untersuchen die Vorstufen und Zeitumstände, die zu bestimmten geschichtlichen Ereignissen führten, sie erforschen Interessenlagen und Verhaltensweisen der vielen Beteiligten und sollten sie als politische Prozesse so darstellen, dass man sie sich vorstellen und die Handlungen einzelner Menschen oder Gruppen nachvollziehen kann. Das hat mit den Methoden des Faches zu geschehen. Andere gibt es nicht. Der Versuch, mit diesen Mitteln das Menschheitsverbrechen Holocaust einzuordnen, wird immer an Grenzen stoßen. Er bleibt fragmentarisch. Jede Antwort wird zu weiteren Fragen führen. Aber eines steht fest: Wer etwas von den vielen Voraussetzungen verstehen möchte, sollte den mit Abstand erschreckendsten Genozid des 20. Jahrhunderts nicht aus dem Kontinuum der deutschen und der europäischen Geschichte herauslösen.
Berlin, November 2016
2.Die Rückkehr der Unerwünschten 1945
Dank einer griechischen Widerstandsgruppe konnte Frederic Kakis Anfang 1943 in Griechenland untertauchen. Nachdem die deutschen Truppen abgerückt waren, kehrte er im Spätherbst 1944 per Schiff nach Saloniki zurück. Kaum angekommen, geriet er zwischen tausende prokommunistische Demonstranten. Sie schwangen rote Fahnen und besangen den legendären Führer der bulgarischen Kommunisten Georgi Dimitrow. Ein alter Mann beruhigte den Heimkehrer: »Demnächst werden britische Truppen eintreffen und Lebensmittel verteilen, dann werden dieselben Leute rufen, ›Lang lebe der König!‹.« So geschah es.
Zusammen mit seiner gleichfalls geretteten Mutter ging Kakis zu den Häusern, die seine Großeltern in Saloniki besessen hatten. »Was wir vorfanden, war niederschmetternd.« Fensterläden waren verschwunden, ebenso Dachziegel, dennoch wohnten verschiedene Familien darin. »Die Deutschen hatten die Leute ermutigt, in die leeren Häuser der Juden einzuziehen. Nachdem wir uns als Eigentümer vorgestellt hatten, wurde uns in feindseligem Ton erklärt: ›Wir waren zuerst hier. Verschwindet und sucht euch etwas anderes!‹«[1]
Als der britische Historiker Cecil Roth Saloniki 1946 besuchte, berichtete er niedergeschlagen: »Überall konnte man die Spuren der Beutemacherei erkennen. Ich sah ein Kind am Straßenrand. Es saß auf einem Synagogenstuhl mit kunstvoll eingelegter hebräischer Inschrift. Jemand überreichte mir ein Fragment der Sefer Thora, das zu einem Paar Schuhsohlen zurechtgeschnitten worden war. Auf dem Friedhof sah ich Pferdefuhrwerke, auf die – vom Direktor des Amtes für Denkmalschutz geleitet – jüdische Grabsteine geladen wurden, um damit alte Kirchen zu reparieren.«[2]
Die Erlebnisse der wenigen, die den Holocaust überlebt hatten, veranschaulichen, wie verroht ihnen Nichtjuden in einzelnen Städten die Türe wiesen, nicht allein in Saloniki, sondern fast überall: im österreichischen Wien, im litauischen Wilna, im tschechischen Oderberg oder im ungarischen Eger. Millionen Europäer hatten das Verschwinden der Juden gewünscht, zu den Deportationen geschwiegen und von den Hinterlassenschaften der Ermordeten profitiert. Deshalb beginnt dieses Buch am Ende – 1944/45. Man muss den Nichtjuden der von Deutschland besetzten und terrorisierten Länder zugutehalten, dass auch sie vom Krieg schwer geschädigt und traumatisiert wurden, oftmals nicht Herr ihres Handelns waren. Doch weil sich überall die gleichen Szenen der Zurückweisung abspielten, enthalten die Erzählungen der Rückkehrer eine allgemeine Wahrheit: Sie zeigen, dass die Juden nicht unverhofft, sondern völlig unerwartet und als Unerwünschte vor den Türen standen. Diejenigen, die sich ihr Eigentum angeeignet hatten, wähnten sie tot. Damit hatten sie fest gerechnet.
Die Grundlage dafür hatten die deutschen Oberherren des Kontinents mit Absicht geschaffen. Indem sie den mobilen und immobilen Besitz der Deportierten von Einheimischen an Einheimische verteilen ließen, zogen sie diese unwiderruflich in den Sog des Verbrechens, brachten sie zum Schweigen, machten sie zu tatbeteiligten Hehlern und Stehlern. In ungarischen Archiven werden unzählige vorgedruckte Listen verwahrt, auf denen jedes einzelne Kleidungsstück verzeichnet ist, jedes Paar Kinderstrümpfe, das 1944, in der Zeit des extremen Mangels, von einer namentlich genannten jüdischen Familie an eine namentlich genannte nichtjüdische Familie übereignet wurde. Nur vereinzelt fanden Menschen aus ihrer innerlichen und materiellen Verstrickung in den Judenmord heraus und bekannten ihr Unrecht gegenüber den Entronnenen.
In den Tagen der Befreiung 1944/45 wussten die jüdischen Überlebenden noch nicht, dass sie dem Morden fast immer als Einzige ihrer Familien entkommen waren. Also reisten sie unter schwierigen Umständen nach Hause. Sie klopften an die Türen ihrer ehemaligen Wohnungen. Sie erwarteten ein freudiges, vielleicht sogar tränenreiches Wiedersehen wenigstens mit einigen früheren Freunden und Nachbarn. Sie erwarteten Obdach, Kleidung, Erinnerungen, menschliche Wärme und vor allem Nachrichten über die Schicksale von Eltern, Geschwistern und Kindern.
Aber sie trafen auf verzweifelte, vom Krieg geschädigte Menschen, die versuchten, in den Trümmern des ausgebluteten Europa zurechtzukommen, dazwischen die vielen kleinen Gewinnler, die im allgemeinen Durcheinander und Sterben den einen oder anderen Vorteil ergattert hatten. Sie hatten die Wohnungen der Deportierten bezogen, die Geschäfte übernommen, das Inventar vom Kochlöffel bis zum Wäscheschrank untereinander verteilt. Den seelisch schwerbeschädigten Rückkehrern schlugen Verstocktheit und faule Ausreden entgegen, Habsucht und nicht selten Hass. Binnen Stunden wurden die Heimkehrer zu jüdischen DPs, Displaced Persons, zu buchstäblich Deplatzierten – zu Heimatlosen in ihrer früheren Heimat.
In Wien hartherzig und stumm
Als deutsche Soldaten am 12. März 1938 in der österreichischen Hauptstadt einzogen, lebten dort 190000 Juden. Etwa 2000 von ihnen überstanden die Zeit bis zum 30. April 1945. Sie verdankten das zumeist der Treue und Standhaftigkeit ihrer »nach Hitler so genannten ›arischen‹ Frauen«. Im Laufe der Monate kehrten bis Ende 1945 zudem knapp 3000 Überlebende aus den Konzentrationslagern zurück. Als zermürbte, kaum arbeitsfähige Menschen bedurften sie »erst eines Genesungsprozesses, um die Arbeitskraft wiederzuerlangen«. So beschrieben es die Verantwortlichen der Israelitischen Kultusgemeinde Wien in ihrem »Tätigkeitsbericht für die Jahre 1945 bis 1948«. Er bildet die dokumentarische Grundlage für den folgenden Abschnitt.[1]
Schwierigkeiten türmten sich auf. Bombentreffer im März, Artilleriebeschuss im April 1945 hatten manches Gebäude, das Archiv und die Registratur der Gemeinde stark beschädigt, auf dem jüdischen Friedhof 2250 Grabstätten und 53 Grüfte verwüstet. Kaum schwiegen die Kanonen, verständigten sich die christlich-arischen Österreicher im Stillen darauf, ebenfalls zu schweigen und sich selbst als die ersten, die eigentlichen Opfer der nazideutschen Diktatur zu bemänteln. Im Mai 1947 beklagte der Präsident der Kultusgemeinde, David Brill, dass »unsere Wohnungen und all das Unsere noch immer von den Räubern besetzt« gehalten werde. Auch gelang es dem Gemeindevorstand zunächst nicht, die »österreichische Regierung für die Rückkehr unserer Brüder aus den Asylländern zu interessieren«, sofern sich diese, trotz allem, nach der alten Wiener Heimat sehnten. Dennoch versuchten die Männer des zunächst kommissarischen, im April 1946 gewählten Gemeindevorstands den Neubeginn. Auf den Ruinen der alten errichteten sie die neue Israelitische Kultusgemeinde – »unverdrossen«, wie es im Rechenschaftsbericht heißt.
Zuerst musste der neue Vorstand jene Funktionäre entlassen, die als Mitglieder des Eichmann’schen Schattengremiums Ältestenrat der Wiener Judenschaft »nur allzu willig« mit der Gestapo und der SS zusammengearbeitet hatten. Händeringend suchten die Oberhäupter der Gemeinde nach Ersatz, »das Reservoir, aus welchem man schöpfen konnte, war sehr klein«. Bis Anfang 1938 hatte die Kultusgemeinde dutzende Schulen und Krankenanstalten ihr Eigen genannt, Altenheime, Bibliotheken, Waisenhäuser und öffentliche Küchen unterhalten. Sie hatte den Armen unter den Juden Obdach gewährt, Kultur und Ritus gepflegt und über einen »geschulten und ausgezeichnet eingespielten Apparat« von 600 Beamten und Angestellten verfügt. All das war am 12. März 1938 zerbrochen.
Mit überwältigender Mehrheit hatten die christlichen Österreicher damals ihre Eingliederung in das nunmehr Großdeutsche Reich begrüßt. Nicht wenige feierten die Märztage des Anschlusses mit wüsten antisemitischen Umtrieben, bei denen Juden die Straßen möglichst mit der Zahnbürste schrubben mussten und hernach das Schmutzwasser über den Kopf geschüttet bekamen. Reibpartien nannten die Wienerinnen und Wiener ihre bürgerschaftlich bewerkstelligten Kleinpogrome.
Auf dem derart bestellten gesellschaftlichen Feld gingen Adolf Eichmann und seine Helfer mit der ihnen eigenen Systematik ans Werk. Stück für Stück zerschlugen sie die Substanz der Kultusgemeinde, zuletzt die menschlich und materiell entleerte Hülle. Für die formelle Auflösung beriefen sich die Machthaber 1942 auf das von Kaiser Franz Joseph 1890 erlassene Gesetz zur Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft.[2] 1948 charakterisierte das Gemeindepräsidium diesen Rechtsakt präzise: »Das Gesetz bestimmt nämlich, dass eine Gemeinde aufgelöst werden kann, wenn sie aus materiellen Gründen nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und das war der Fall bei der Israelitischen Kultusgemeinde. Wie das herbeigeführt wurde, ist ein Kapitel für sich.«
Während des Novemberpogroms 1938 legte die Avantgarde sogenannter Volkswut 94 Wiener Synagogen und Bethäuser in Schutt und Asche. Ein glücklicher Zufall bewahrte den zentralen Gemeindetempel in der Seitenstettengasse vor der völligen Vernichtung. Das Gehäuse blieb erhalten, im Inneren bot es »das Bild eines Trümmerhaufens«. Mitten in aller Niedergeschlagenheit und Not gelang den Überlebenden die erste befreiende Tat: Am 2. April 1946, am 120. Jahrestag seiner Errichtung, weihten sie ihren Tempel zum zweiten Mal. Über das Portal setzten sie auf Hebräisch den vierten Vers des 100. Psalms: »Kommet mit Dank durch seine Tore, mit Lob in seine Höfe.«
Einen Rabbiner gab es nicht mehr. Inspektor Isidor Öhler sprang als Prediger ein. Der Wiener Bürgermeister, Dr. Theodor Körner, gab sich die Ehre; der Rundfunk übertrug die Feier für die Hörer im europäischen Ausland und in Übersee. In der anschließenden Haskarah, der Seelengedächtnisfeier für die Gründer der Synagoge enthüllten die Versammelten eine Marmortafel mit dem gleichfalls in Hebräisch gehaltenen Text: »Dem Gedenken der Männer, Frauen und Kinder, die in den schicksalsschweren Jahren 1938–1945 ihr Leben ließen.« Am ersten Sederabend, dem Auftakt des Pessachfestes, eröffnete die Gemeinde eine koschere Küche; im Oktober 1946 folgte die Mikwe.
Am Ende des ersten Nachkriegsjahrs stand die Heimkehr von 802 Wiener Juden an, die 1938/39 nach Schanghai emigriert waren. Die langwierigen Vorbereitungen oblagen dem Wanderungsreferat der Kultusgemeinde. Es arbeitete mit einem Komitee zusammen, in dem sich Angehörige und Freunde der Wiener Schanghai-Flüchtlinge gefunden hatten. Gemeinsam mussten sie bürokratische Bedenken im Innenministerium überwinden und im österreichischen Außenministerium »antisemitisch gefärbten Widerstand«. Zu guter Letzt konnte Michael Kohn, der Leiter des Wanderungsreferats, das Ergebnis der Kampagne mit ruhigem Sarkasmus zusammenfassen: »Es wurde erreicht, dass unsere Regierung ihre Bereitschaft aussprach, den österreichischen Staatsbürgern die Einreise zu gewähren.«
Rückkehrer aus Schanghai und Karaganda
Im Gegenzug verlangte sie Unterwerfung. Vor dem Verlassen Chinas bekamen die Rückreisewilligen ein eigens gedrucktes Formular vorgelegt, das sie ausfüllen mussten, um sich am Ende per »Unterschrift zu Österreich zu bekennen«. Erst dann erteilte ihnen der aus Wien angereiste Konsularbeamte das Visum. Österreicher, die sich mit großer Mehrheit Hitlerdeutschland freudig dargebracht, die Juden verjagt und sich am Mord der Nichtverjagten prominent beteiligt hatten, erzwangen nun – 18 Monate nach dem Ende des mit Deutschland gemeinsam gewollten Großdeutschen Reichs – von den gedemütigten, beraubten und ausgestoßenen Juden die schriftliche Loyalitätserklärung.
Nachdem die zur Heimkehr Entschlossenen die Unterschriften geleistet hatten, gingen sie an Bord zweier amerikanischer Truppentransporter. Einige Wochen später betraten sie in Marseille und Neapel europäischen Boden. Von dort reisten die Repatrianten mitten im Winter in ungeheizten Viehwaggons, doch leidlich versorgt, zum Grenzübergang Tarvis. Die Fahrt dauerte eine Woche.
Ungeduldig warteten in Wien Freunde und Verwandte, einige »waren an die Grenze vorgesendet, andere wochenlang Tag und Nacht in einem ständigen Bereitschaftsdienst eingesetzt« worden. Mitte Februar 1947 war es so weit: Die Kultusgemeinde empfing ihre Angehörigen mit Jubel. Der Wiener Bürgermeister Körner ging von Waggon zu Waggon, begrüßte jeden persönlich und sagte stets, dass »man jeden Einzelnen zum Wiederaufbau der so schrecklich zerstörten Stadt« brauche.[3] Indes weigerten sich die Beamten des städtischen Wohnungsamts, den aus dem chinesischen Exil heimgekehrten Österreichern Wohnungen zu verschaffen, und ließen die Bittsteller der Kultusgemeinde wissen, die Rückwanderer »könnten ganz ruhig in irgendwelchen Massenherbergen untergebracht werden«.
Unangekündigt kamen im Juni 1947 weitere 208 Wiener Juden an. Auch sie waren 1938/39 aus Wien geflohen, und zwar ins Baltikum oder in die Sowjetunion. Dort waren sie, kaum dass Großdeutschland, Rumänien und Ungarn den Russlandfeldzug im Sommer 1941 begonnen hatten, von sowjetischen Sicherheitskräften festgenommen und als feindliche Ausländer ins Hinterland abtransportiert worden. Es folgten Odysseen durch verschiedene Lager, tagelange Fahrten in Güterwagen. Am Ende erreichten die Internierten den kasachischen Lagerkomplex Karaganda. Kohlegruben, schneidende Kälte im Winter, erbarmungslose Hitze im Sommer bestimmten die äußeren Verhältnisse. Im Lauf der Jahre verschwanden hunderttausende Menschen in Karaganda: sowjetische Kriminelle und angebliche Staatsfeinde, kommunistische Funktionäre und deportierte Polen, Zigeuner und Rumänen, Angehörige sogenannter bestrafter Völker, Unangepasste und Verdächtige aller Art, deutsche Kriegsgefangene und eben auch deutsche, polnische, baltische, russische und österreichische Juden.
Alexander Solschenizyn bezeichnete den Ort als die »größte Provinzhauptstadt des Archipel Gulag«. Der aus Weißrussland stammende jüdische Gefangene Joseph Kuszelewicz, der dem Holocaust entflohen und dann Soldat der Roten Armee geworden war, wurde 1946 aus heiterem Himmel verhaftet und nach Karaganda überstellt. Zunächst landete er in einem dreigliedrigen Gefängnisbahnhof. Dort wurden die Deportierten, wie Kuszelewicz später berichtete, in verschiedene Gruppen selektiert und dann in eine Unzahl von Stacheldrahtkomplexen dirigiert, hinein in eine undurchschaubar unterteilte, trostlose Lagerwelt, die sich über Dutzende von Kilometern erstreckte.[4]
Die Wiener Juden gehörten zu den bessergestellten Gefangenen. Systematisch ermordet wurden sie nicht. Dennoch starben nicht wenige an den Folgen von Hunger und Frost, Typhus, Ruhr, Malaria und Tuberkulose. Aber an der Alternative gemessen, in deutsche Hände zu fallen, erhöhte sich ihre Überlebenswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches. Auch der spätere israelische Ministerpräsident Menachem Begin wurde 1940 aus dem sowjetisch annektierten Litauen nach Sibirien verschleppt, weil ihn der sowjetische Staatssicherheitsdienst »als Agenten des britischen Imperialismus« eingestuft hatte. Rückblickend bekannte Begin: »Verglichen mit der allgemeinen kolossalen Katastrophe hat mein Unglück keine Bedeutung. Während dieser Katastrophe erwies die Sowjetunion den Juden unerwartet eine unschätzbare Hilfe. Ich werde mich immer daran erinnern, und kein Jude hat das Recht, dies zu vergessen.«[5]
Als die Wiener Juden in Karaganda am 9. Mai 1945 von der deutschen Niederlage erfuhren, fielen sie einander in die Arme, weinten vor Freude, glaubten sich in Freiheit – und irrten. Hart und knapp teilte ihnen der Politruk mit, jetzt hätten sie erst recht Zwangsarbeit zu leisten, und zwar als besiegte Deutsche: »Das ist für euch kein Tag zur Freude. Ihr werdet durch eure Arbeit gutmachen müssen, was euer Volk den Russen zugefügt hat.«[6] Die Tortur dauerte noch knapp zwei Jahre.
In Wien wurden die Ankömmlinge »in einige sehr schlechte Obdachlosenheime« eingewiesen, Schlafsäle mit 40 Betten waren die Regel. Verantwortlich dafür zeichnete das Wohnungsamt, das bis Ende Februar 1948 von insgesamt 1393 jüdischen Heimkehrern nur 17 Prozent in normalen Wohnungen als Hauptmieter unterbrachte. Aus diesen Zahlen spricht blanker Hohn. Verständlich wird er erst, wenn man sich eines vergegenwärtigt: Die nationalsozialistisch geführte Stadtverwaltung hatte 1938 bis 1942 rund 50000 von Juden gemietete oder Juden gehörende Wohnungen an nichtjüdische Wiener umverteilen lassen und so, wie Hitler zufrieden beobachtete, »die Wiener Wohnungsnot gelöst«. Jetzt fanden dieselben, mittlerweile sozialdemokratisch geführten Beamten praktisch niemanden, der zu Unrecht in einer solchen Wohnung lebte. Wie der Vorstand der Kultusgemeinde bekümmert zur Kenntnis nahm, weigerten sich die demokratischen Parteien, »den nazistischen Wohnungsraub durch ein anständiges Gesetz aus der Welt zu schaffen«.
Der Gelehrte Walter Grab reiste 1956 erstmals wieder in seine Heimatstadt Wien, die er 1938 als Neunzehnjähriger hatte verlassen müssen. Jetzt, 18 Jahre später, besuchte er das Haus, in dem er aufgewachsen war. Von den vormals sechs Mietern wohnte dort nur noch einer: der damalige tschechische Hausmeister, allerdings nicht mehr im Parterre, sondern im dritten Stock. Er klingelte. Die frühere Hausmeistersfrau öffnete: »Jessas, der Herr Grab is z’ruckkomma!« Nach einigen Schrecksekunden bat sie ihn herein. Der Besucher nahm im Wohnzimmer Platz und fragte, wer früher hier gewohnt habe – der Architekt Theodor Gießkann. Als der Name fiel, begriff Grab schlagartig, dass die Hausmeistersleute von einst »jetzt die Möbel von Gießkanns benutzten«. Die Frau bemerkte das und erklärte, die Familie Gießkann sei »irgendwie weggekommen« und »die Nazis hätten ihnen dann die schöne Wohnung zugewiesen, samt der Möbel«. Dann »drehte sich der Schlüssel in der Wohnungstür, und ihr Mann, der ehemalige Hauswart, kam herein«. Auch er erkannte den Besucher sogleich und zischte seiner Frau zu: »Red’ kein Wort!«[7]
In den Jahren 1947/48, zu Beginn des Kalten Krieges, entließ die sowjetische Regierung die meisten Kriegsgefangenen, die aus Österreich stammten. Jetzt erlebten die wenigen verbliebenen und zurückgekehrten Juden, wie engagiert sich die Wiener Ämter um die einstigen Wehrmachtsoldaten kümmerten: »Die Behörden beginnen den sonderbaren Standpunkt einzunehmen«, so die Vertreter der Kultusgemeinde, »die Kriegsgefangenen seien die Heimkehrer, für die alles getan werden müsse, die alle Privilegien in Anspruch nehmen können, während unsere Leute nur Rückwanderer seien, die freiwillig zurückgekommen sind, die es lieber nicht hätten machen sollen und die keinesfalls Ansprüche auf besondere Vorzugsbehandlung machen dürfen. Dass es sich dort zum Teil um Nazis oder um ihre Helfershelfer, in unserem Falle aber um Naziopfer handelt, will man vergessen.«
Im Dezember 1947 zählte die Israelitische Kultusgemeinde doppelt so viele Mitglieder wie noch 18 Monate zuvor: knapp 9000 Männer, Frauen und auch Kinder. Das religiöse Leben kam wieder in Gang. Ende April 1947 konnte in der Synagoge ein feierliches Requiem für den dänischen König Christian X. abgehalten werden – in tiefer Dankbarkeit für den Toten, der 1943 dazu beigetragen hatte, die 5000 Juden seines Landes zu retten. »Wenn Sie den gelben Davidstern in Dänemark einführen«, so war er – als einziges Staatsoberhaupt im besetzten Europa – den deutschen Besatzungsgewaltigen entgegengetreten, »werde ich und das ganze Königshaus ihn mit Stolz und Würde tragen.« Am 8. Juni 1947 fand in der Wiener Synagoge die Gedenkfeier zum 43. Todestag von Theodor Herzl statt, dem Gründervater der zionistischen Bewegung. Am 10. November 1947 versammelten sich die Überlebenden zur Trauerfeier für die Opfer des Novemberpogroms von 1938 und sammelten für die »Pflanzung eines Österreichwaldes in Palästina«. Am 6. Dezember 1947, »anlässlich des Beschlusses der Vereinten Nationen, einen unabhängigen Staat in Palästina entstehen zu lassen«, strömte die »überaus zahlreiche, begeisterte Gemeinde« zum Dankgottesdienst herbei.
Spurlos verschwunden in Wilna
Seit der Teilung Polens im Jahr 1795 gehörte Wilna (Vilnius, Wilno) zum Russischen Reich. Zwischen 1914 und 1921 kennzeichneten Kriege und Revolutionen, Nationalitätenkämpfe und Pogrome den Alltag, danach Wirtschaftskrisen und Minderheitenstreit. Hier wie vielerorts ruinierten gewaltsame Umbrüche das traditionelle Mit-, Neben- und Gegeneinander verschiedennationaler Einwohner: Polen, Litauer und Juden. Im Ersten Weltkrieg hatten deutsche Truppen die Stadt besetzt. In den unmittelbar darauf folgenden Nationalitätenkriegen errang Polen die Oberherrschaft. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt fiel Wilna 1939 an die Sowjetunion und wurde im Sommer 1940 Bestandteil der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Im Juni 1941 eroberte sie die Wehrmacht. Drei Jahre später, wieder im Juli, hatte sich die Rote Armee bis Wilna zurückgekämpft. Von den 220000 litauischen Juden konnten im Sommer 1941 etwa 8000 ins Innere der Sowjetunion fliehen. Mehr als 210000 wurden ermordet, 1000 bis 2000 Juden überlebten in Litauen in Verstecken oder als Partisanen.
Eine von ihnen war Zahava Zuckermann-Stromsoe. Im Herbst 2009 fragte sie der israelische Journalist Koby Ben-Simhon, wie ihr Tarantinos Film »Inglourious Basterds« gefallen habe, in dem Juden Nazis foltern, abstechen, totprügeln, verbrennen oder skalpieren. In dem Film stehen die Verhältnisse auf dem Kopf. Frau Zuckermann-Stromsoe fand den blutrünstigen, während jeder Sekunde spannungsgeladenen Film »superb gemacht«. »Es hat mir gutgetan zu sehen, wie Nazis um ihr Leben betteln, wie sie ein wenig von der Bitterkeit schmecken.« Doch sei ihre Lebensgeschichte anders verlaufen.
Als Teenager hatte sie den Terror im Ghetto von Wilna und in anderen Lagern durchgemacht. Auf den Todesmärschen hatte sie vergebens um das Leben ihres Vaters gefleht, sich im Abwasserkanal verborgen und, wie die Familie in Tarantinos Film, die Stiefeltritte über sich gehört: »Wir waren wie Ratten. Niemand, der nicht durch den Holocaust gegangen ist, kann das verstehen, aber genau so war es.« Kaum befreit, nahm sie Reißaus. So schnell sie konnte, verließ sie Europa. In Tel Aviv begann sie ein neues Leben und zog zwei Kinder auf. 2009 freute sich Zahava Zuckermann an ihren vier Enkeln: »Das ist meine wahre Rache!«[1]
Von den 60000 Juden, die 1939 in Wilna gewohnt und die Stadt mitgeprägt hatten, tauchten im Sommer 1944 einige hundert wieder auf. Die Rückkehrer feierten 1944 und 1945 ihre Gottesdienste in der stark beschädigten, aber benutzbaren Hauptsynagoge. Ihren religiösen Geboten gehorchend, setzten sie die zerrissenen und entweihten Thorarollen bei. Im Herbst 1944 eröffneten sie eine Volksschule, bald darauf ein Museum, in dem Schriften, Bilder und Skulpturen gezeigt wurden, die Juden, den eigenen Tod vor Augen, vergraben oder eingemauert hatten, um sie für die Nachwelt zu retten.
Andere Vorhaben scheiterten am Widerstand lokaler Behörden. So durfte das Jüdische Wissenschaftliche Institut YIVO nicht wiedererrichtet werden, Zeitungen und Rundfunksendungen in jiddischer Sprache blieben verboten, ebenso öffentliche Auftritte des Gemeindechors. Im Sommer 1945 lebten wieder 4500 Juden in der Stadt. Wenig später wurde die leidlich hergerichtete Synagoge auf Anordnung der sowjetisch-litauischen Stadtverwaltung abgerissen. Das eingeebnete Gelände nutzte man zunächst als Parkplatz und hernach, seit 1964, als Baugrund für einen Kindergarten. 1948 musste die Jüdische Volksschule schließen. Weiter bezeugte Solomon Atamuk: »Am 10. Juni 1949 wurde laut Beschluss des Ministerrates der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik das Jüdische Museum in Vilnius geschlossen. Manche Exponate wurden an andere litauische Anstalten geleitet, viele jüdische Bücher wurden als Altpapier in die Papierfabriken gebracht. 1950 wurden die jüdischen Kindereinrichtungen in Litauen geschlossen.«[2] Die lokalen Funktionäre argumentierten: »Jüdisch braucht man nicht, das ist keine Nationalität, das ist nichts! Die jüdische Kultur ist auch nichts!«