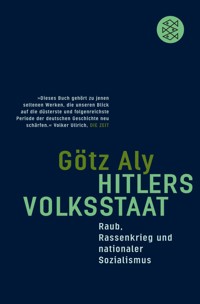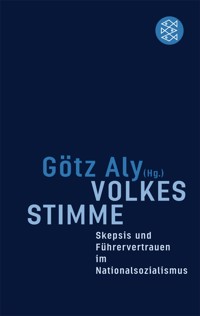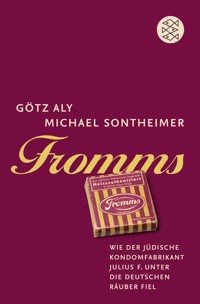9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Träge Deutsche, rege Juden und das Gift des Neides: Götz Aly über die Vorgeschichte des Holocaust. Warum die Juden? Warum die Deutschen? Fragen, die sich seit dem Holocaust immer wieder stellen. Der bekannte Historiker Götz Aly findet in seinem neuen Buch provokante Antworten. Er beschreibt die Modernisierungsscheu und Freiheitsangst vieler christlicher Deutscher während des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dagegen begeisterten sich viele deutsche Juden für das Stadtleben, für höhere Bildung; sie wussten den gesellschaftlichen Wandel zu nutzen. Und die gemächlichen Nicht-Juden sahen ihnen mit zunehmendem Neid hinterher. Daraus erst konnte ihr nationaler Dünkel und ein neuer, am Ende mörderischer Antisemitismus erwachsen. Götz Aly gelingt es erneut, der Deutung der deutschen Geschichte eine überraschende Wendung zu geben. »Auch ich habe nie auf die Frage, wie es ausgerechnet in Deutschland im 20. Jahrhundert zum organisierten Judenmord kam, eine plausible Antwort gefunden. Götz Aly hat mir endlich eine einleuchtende Erklärung vermittelt. Ich betrachte sein Buch als den wohl wichtigsten Beitrag in der unendlichen Literatur zu diesem Thema. Seine Analyse eines geschichtlich verwurzelten Prozesses hat mir vieles klarer und das Unverständliche verständlich gemacht.« W. Michael Blumenthal, Direktor des Jüdischen Museums Berlin » Ich war wirklich überzeugt ich verstünde etwas von deutschem Antisemitismus, und habe von Ihnen gelernt, dass ich ziemlich wenig weiß.« Yehuda Bauer, Yad Vashem »Götz Aly stellt gute Fragen. Und schreibt en passant eine spannende Geistes- und Sozialgeschichte Deutschlands im 19. und frühen 20. Jahrhundert.« Ulrich Gutmair, taz »Wo [Götz Aly] schreibt, wird es radikal, an die Wurzel gehend – also interessant. [..] Alys Begründungen sind luzide und facettenreich; seine Quellenfunde ebenso zahlreich wie eindringlich. […] Sein Buch ist anstößig im besten Sinn, liefert Denkanstöße in viele Richtungen und damit deutlich mehr als die meisten Arbeiten zum Thema.« Gerhard Lechner, Wiener Zeitung »Aly geht dahin, wo es wehtut. […] Die wissenschaftlichen, technischen und künstlerischen Leistungen der späten Nation Deutschland waren beeindruckend, ihr gesellschaftliches Versagen auch. Wer verstehen will, der muss Götz Alys Buch lesen.« Thomas Andre, Hamburger Abendblatt »[eine] Darstellung, die glänzend geschrieben ist und durch die Vielfalt ihrer demografischen, soziologischen, ökonomischen und literarischen Bezüge beeindruckt« Jürgen Kaube, Deutschlandradio Kultur – Radiofeuilleton Kritik »glänzend formuliert, temperamentvoll argumentiert und provokativ überspitzt« Micha Brumlik, Die ZEIT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Götz Aly
Warum die Deutschen? Warum die Juden?
Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800–1933
Fischer e-books
Die Frage aller Fragen
Warum die Deutschen? Warum die Juden?
Warum ermordeten Deutsche sechs Millionen Männer, Frauen und Kinder, und das aus einem einzigen Grund: weil sie Juden waren? Wie war das möglich? Wie konnte ein zivilisiertes und kulturell so vielschichtiges und produktives Volk derart verbrecherische Energien freisetzen? Das bleibt die Frage aller Fragen, die Deutsche beantworten müssen, wenn sie ihre Geschichte verstehen wollen, wenn sie versuchen, die darin eingebundenen Geschichten ihrer Familien sich und ihren Kindern zu erklären.
Juden, die im 19. Jahrhundert aus den östlichen Nachbarstaaten zuwanderten, waren froh, wenn sie die deutsche Grenze überschritten hatten. Sie schätzten die Rechtssicherheit, die wirtschaftliche Freiheit und die Bildungschancen für ihre Kinder, die ihnen Preußen seit 1812 und später das Kaiserreich boten. Pogrome, wie sie bis ins 20. Jahrhundert hinein in den Ländern Ost- und Südosteuropas verbreitet waren, kannte man in Deutschland nicht mehr. Jenseits aller Hemmnisse hatten Juden hier, zumal in Preußen, gute Möglichkeiten, ihre Selbstemanzipation schwungvoll voranzutreiben. Paradox, aber das vergleichsweise hohe Maß an Freiheit, das den Juden gewährt wurde, schürte einen speziellen Antisemitismus.
Im Jahr 1910 wohnten in Deutschland mehr als doppelt so viele Juden wie in England, fünf Mal so viele wie in Frankreich. Als Deutschland die Provinz Posen 1919 an das neu erstandene Polen abtreten musste, flohen die dortigen jüdischen Deutschen »in geradezu pathologischer Angst vor den neuen polnischen Herren des Landes Hals über Kopf« in Richtung Berlin.[1] Einer, der zeitlebens über seine Existenz als Deutscher und Jude nachdachte, war Siegfried Lichtenstaedter, seines Zeichens 1932 pensionierter höherer bayerischer Beamter und nebenberuflich Schriftsteller. Er bemerkte 1937: Wer um 1900 in Deutschland vorhergesagt hätte, »dass vom Jahre 1933 ab Tausende von uns nach Palästina fliehen würden, um nicht unterzugehen, wäre zweifellos als reif für das Irrenhaus betrachtet worden«.[2] Solche Tatsachen verbieten einfache Antworten auf die beunruhigende, geschichtlich zu beantwortende Doppelfrage: Warum die Deutschen? Warum die Juden?
Im heutigen Deutschland rücken wir die Opfer in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen und ermuntern zur Identifikation. Das demonstrieren die vielen Denkmäler, Museen, Forschungen, literarischen und pädagogischen Anstrengungen eindrucksvoll. Parallel dazu stilisieren wir die Täter zu schier außerirdischen Exekutoren. Mit einer Distanziertheit, die oft die eigene Familiengeschichte ignoriert, bezeichnen wir sie vorzugsweise als »die Nationalsozialisten«, »die Nazi-Schergen«, das »NS-Regime«, »fanatische Rassenideologen« oder wir sprechen vom »paranoiden Weltbild der Rassenantisemiten« und von der »völkischen Bewegung«. Mit solchen Terminologien ist wenig Einsicht zu gewinnen. Ich versuche auf den folgenden Seiten zu zeigen, was geschichtlich hinter solchen Begriffen stand.
Auch verschiedene Theorien über Faschismus, Diktaturen im Allgemeinen oder die Logik von Inklusion und Exklusion dienen meines Erachtens dazu, der Nachwelt den Holocaust in sorgfältig einhegender Weise auf Distanz zu halten. Letztlich blasse Begrifflichkeiten vernebeln den Rassenmord hinter marxistischen Gesetzmäßigkeiten oder verharmlosen ihn zum Rückfall in vorzivilisatorische Barbarei oder schieben die Last der Verantwortung auf einen deutschen Sonderweg oder auf eine bestimmte, angeblich genau einzugrenzende Generation von Tätern, auf eine spezielle Ideologie oder einen allgemein verbreiteten Hang zur totalitären Staatsform. So logisch solche Gedankenspiele in sich aufgebaut sein mögen, so wenig erklären sie den Verlauf der deutschen Geschichte, der am Ende zum Massenmord führte. Auf solche, nur scheinbar erklärenden Ansätze darf getrost mit Goethe entgegnet werden, dass die Theoretikerzunft »die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt«.[3] Ein neues Wort erschließt nicht unbedingt eine neue Wahrheit.
Wer aus dem Mord an den europäischen Juden lernen will, sollte als Erstes damit aufhören, die Vorgeschichte mit Hilfe eines bipolaren Schemas in »gute« und »böse« Entwicklungslinien aufzuspalten. Geschichtsoptimisten mögen solche Konstruktionen. Sie sehen ihre Gegenwart an der Spitze der Zivilität und wärmen das Publikum an der Illusion, dass alles, was uns Heutigen richtig oder falsch erscheint, in der Vergangenheit ebenso richtig oder falsch gewesen sei. Analytisch führt solches Geschichtsdenken in die Irre. Es schafft Abstand und erklärt nichts.
Ziel dieses Buches ist es, einige Sichtblenden wegzuschieben, die den Blick auf die Vorgeschichte derart verengen, dass der Nationalsozialismus zum Fremdkörper, zum im Grunde unbegreiflichen Fehltritt im Gang deutscher Geschichte wird. Deswegen nehme ich auch Männer in den Blick, die zwar als Reformer und Vorkämpfer freiheitlicher Ideen berechtigtes Ansehen verdienen, aber als Judengegner, ja Judenhasser hervortraten: zum Beispiel Karl vom Stein, Ernst Moritz Arndt oder Friedrich Ludwig Jahn, Peter Christian Beuth, Friedrich List oder Franz Mehring – darunter nicht wenige schwarz-rot-goldene Demokraten, auf die sich die heutige Bundesrepublik beruft. Ferner erscheint mir für das Verständnis des deutschen Antisemitismus wichtig zu sein, die von verschiedenen Seiten gespeisten antiliberalen Strömungen in Deutschland in Betracht zu ziehen: die von Konservativen gestützte antiliberale Wende Bismarcks; das kollektivistische, schließlich volkskollektivistische Denken deutscher Sozialisten; die Selbstzerstörung des Liberalismus unter der Ägide von Friedrich Naumann.
Im Jahr 1933 versuchte Siegfried Lichtenstaedter die künftigen Aussichten der deutschen Juden zu analysieren. Seit Jahren schon studierte er den Völkischen Beobachter aufmerksam – ein »vielgelesenes Blatt, Organ der ›Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei‹«, wie er bereits 1922 bemerkt hatte.[4] Lichtenstaedter fragte sich: Warum die Juden? Einerseits, so meinte er, stehen sie dem Verhalten, dem Aussehen und der Religion nach den europäischen Mehrheitsgesellschaften nahe, andererseits sei ihr »kollektives Ich« deutlich unterscheidbar. Im Gegensatz zur Antisemiten-Bewegung müsse eine Antilinkshänder-Bewegung scheitern, weil die verbindenden Eigenschaften der Linkshänder zu schwach sind, um ein kollektives Linkshänder-Ich zu begründen. Ist das Einigende – wie im Fall der Juden – hinreichend stark, ergibt sich das kompakte Bild einer Gruppe, dem weitere Merkmale zugeschrieben werden können.[5]
Lichtenstaedter betrachtete die NSDAP als Partei sozialer Aufsteiger. Daraus schloss er 1933 auf seine eigene Zukunft und die der anderen deutschen Juden. Im Durchschnitt, so stellte er fest, bekleideten die Juden in Mittel- und Westeuropa höhere soziale Stellungen; das kreideten ihnen die hinterherhinkenden Nichtjuden zunehmend an. Deren nachholendes Aufstiegsstreben verschaffte den Gegnern der Juden enormen Zulauf. Nach Lichtenstaedters Eindruck hielten derart motivierte Antisemiten die mosaische Religion und die jüdische Herkunft für »praktisch belanglos«: Sie konkurrierten um »Nahrung, Ehre und Ansehen«. Seiner Meinung nach bezog der Antisemitismus seine aggressive Dynamik aus Sozialneid, Konkurrenz und Aufstiegsdrang: Wenn die Gruppe der Juden »im unverhältnismäßigen Maße anscheinend ›glücklicher‹« als andere ist, »warum sollte dies nicht ähnlich Neid und Missgunst, Sorgen und Bekümmernis um die Zukunft im Kopfe und Herzen der anderen erregen, wie es im Verhältnis zwischen Individuen nur allzu oft der Fall ist?«.[6]
Lichtenstaedter unterschied das kollektive Ich der Juden, also die Distinktionsmerkmale, von den Motiven der Judenfeinde. Er differenzierte zwischen den äußeren Anknüpfungspunkten des Antisemitismus und den Zielen der Antisemiten. Statt die Nationalsozialisten zu dämonisieren, analysierte er die politischen Kräfte, die ihn existentiell bedrohten – nicht nur ihn, nicht nur seine Glaubensgenossen, sondern alle, die als Angehörige der jüdischen Rasse galten. Lichtenstaedter wollte seine nationalsozialistische Umwelt verstehen. Ihm lag an Vorhersagen und daraus abzuleitenden Verhaltensregeln. Er stellte in Rechnung, dass Hitler das Judentum als »ein Volk mit besonderen Wesenseigenheiten« ansah, die es »von allen sonst auf der Erde lebenden Völkern scheiden« würde.[7] Doch speiste sich der deutsche Antisemitismus nach seinem Eindruck nicht aus einer speziell ausgedachten Ideologie, sondern aus materiellen Spannungen und Interessen – letztlich aus derjenigen unter den sieben Todsünden, die anders als Wollust, Völlerei, Hoffart, Habgier, Zorn oder Faulheit überhaupt keinen Spaß macht: dem Neid.
Neid zersetzt das soziale Miteinander. Er zerstört Vertrauen, macht aggressiv, führt zur Herrschaft des Verdachts, verleitet Menschen dazu, ihr Selbstwertgefühl zu erhöhen, indem sie andere erniedrigen. Der tückische, scheele Blick auf den Rivalen, die üble Nachrede und der Rufmord gelten dem Erfolgreichen, erst recht dem Außenseiter. Dabei vergiften sich die Neider selbst, werden immer unzufriedener und noch gehässiger. Sie wissen das nur zu gut. Deshalb verstecken sie diesen Charakterzug schamhaft hinter allerlei vorgeschobenen Argumenten – zum Beispiel hinter einer Rassentheorie. Neider brandmarken die Klügeren als zwar schlau, aber nicht tiefsinnig; sie zernagt der Erfolg der anderen, sie schmähen die Beneideten als geldgierig, unmoralisch, egoistisch und daher verachtenswert. Sich selbst erheben sie zu anständigen, moralisch superioren Wesen. Sie bemänteln das eigene Versagen als Bescheidenheit und werfen dem Beneideten vor, er spiele sich lärmend in den Vordergrund.
Der Neider strebt nicht unbedingt danach, es dem Beneideten gleichzutun. Nicht selten lehnt er dies lauthals ab. Er richtet seine Energie »auf Zerstörung des Glücks anderer«, wie Immanuel Kant beobachtete. Büßen diese anderen ihre Vorzüge und Vorteile ein, geht es ihnen an den Kragen, bereitet das dem Neider stilles Vergnügen, er genießt Häme und Schadenfreude. Verdienen die Beneideten dann Mitleid oder gar Beistand? Nein! Sie wussten doch stets alles besser! Hatten immer die Nase vorne! Mögen sie sich selber verteidigen! So beruhigt der Neider seine moralischen Restskrupel, steckt die Hände in die Tasche und gibt die verfolgte Unschuld. Wenn andere den Beneideten drangsalieren, sagt sich der kleine Neider: »Was geht mich das an!« Sein Gewissen bleibt ruhig. Er ist es nicht gewesen.
Aus welchen Quellen sprudelt der Neid? Aus Schwäche, Kleinmut, mangelndem Selbstvertrauen, selbstempfundener Unterlegenheit und überspanntem Ehrgeiz. »Der Deutsche sagt von sich ganz extra, dass er deutsch sein soll«, monierte Julius Fröbel, 1848/49 Parlamentarier in der Paulskirche, und erkannte darin Minderwertigkeitsgefühle: »Der deutsche Geist steht gewissermaßen immer vor dem Spiegel und betrachtet sich selbst, und hat er sich hundert Mal besehen und von seinen Vollkommenheiten überzeugt, so treibt ihn ein geheimer Zweifel, in welchem das innerste Geheimnis der Eitelkeit beruht, abermals davor.«[8]
Ganz anders Engländer, Franzosen oder Italiener. Letztere errichteten ihren Staat 1870 nach drei Kriegen, die sie im eigenen Land gegen die Fremdmächte Frankreich und Österreich und gegen den päpstlichen Kirchenstaat geführt hatten, und bestätigten die Gründung per Volksabstimmung. Währenddessen marschierte der von Preußen geführte deutsche Staatenbund zwischen 1864 und 1870 ohne plausible Gründe in Dänemark, Österreich und Frankreich ein, um den Anschein nationaler Selbstgewissheit zu erlangen. Der Historiker Heinrich von Treitschke jubelte: »Der Krieg ist die beste Arznei für ein Volk.« Das Ergebnis der mit Blut und Eisen zusammengeschmiedeten Einheit blieb brüchig, und 1933 beobachtete der italienische Diplomat Carlo Sforza: »Die Deutschen fragen sich in jedem Augenblick, was ›Deutschtum‹ sei oder nicht sei.«[9]
Die dem deutschen Nationalismus eigene Selbstunsicherheit führte zwischen 1800 und 1933 zu den bekannten Auswüchsen nervöser Prahlerei. Man denke an die Proklamation des zweiten Kaiserreichs. Sie musste 1871 auf dem Boden des Erbfeindes im Spiegelsaal von Versailles über die Bühne gehen, weil das neue Reich über kein allgemein anerkanntes Staatszentrum verfügte. Man denke auch an die Ansprache, mit der Kaiser Wilhelm II. im Sommer 1900 deutsche Marinesoldaten zur Niederschlagung eines Aufstandes nach China verabschiedete: »Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen!« Und zwar so, »dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!«[10] Zu Hitlers 44. Geburtstag 1933 ließen sich die Deutschen als »das erste Volk des Erdballs« umschmeicheln.[11] Wer so redet, dem fehlt die innere Balance.
Gleichheitssucht und Freiheitsangst
Neidgetriebene Menschen sprechen ausgiebig von eigener Benachteiligung, fürchten die Freiheit und neigen zum Egalitarismus. Sie, die andere verächtlich machen, sehen sich als die Schwachen und bevorzugen den Schutz einer Gruppe Ähnlichfühlender. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die so ansteckende Parole der Französischen Revolution, nahmen die deutschen Vorkämpfer des demokratischen Fortschritts eigentümlich verdreht auf. Mit der in Frankreich an erster Stelle genannten Freiheit wussten sie deutlich weniger anzufangen als mit der Idee der Gleichheit. Später brachten die Deutschen die wichtigsten Theoretiker des Kommunismus und des Sozialismus hervor, sie erfanden die Systeme der Sozialversicherungen, den nationalen Sozialismus Hitlers, die in der DDR beschworene Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und die in der Bundesrepublik gepflegte soziale Marktwirtschaft. Deutsche verstümmelten den Begriff Gesellschaft zum Synonym für Staat und erkoren sich diesen zum »Vater Staat«.
Im Sinne von 1789 bezeichnete Egalité jedoch nicht mehr und nicht weniger als die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz. Nicht Antisemiten, sondern die überwältigende Mehrheit der Deutschen reduzierten das so wertvolle Prinzip zur Unkenntlichkeit. Sie machten daraus von Staats wegen zu garantierende materielle Gerechtigkeit. Fortan riefen sie bei jeder Gelegenheit: »Ungerecht! Wir fordern auch unseren Platz an der Sonne!« und badeten in dem Gefühl der ewig Zukurzgekommenen. Je mehr sich die so verstandene Gleichheit im allgemeinen Bewusstsein einnistete, desto ausgeprägter wurde der Differenzaffekt (Arnold Zweig), die Abstoßung nicht gleicher Gruppen, zumal dann, wenn diese Schnelligkeit, Witz, Klugheit und Erfolg auszeichneten. Polar ergänzend gesellt sich zum Differenzaffekt der Zentralitätsaffekt, »die Überbetonung und Wichtigkeit der eigenen Gruppe«.[12]
Zur missverstandenen Gleichheit fügten deutsche Nationalrevolutionäre seit Anbeginn ihr merkwürdig kollektivistisches Verständnis von Freiheit. Schon den Krieg gegen die napoleonische Besatzung nannten sie Freiheitskrieg. Das heißt, viele von ihnen fassten Freiheit nicht als individuelle Möglichkeit, als Ansporn für jeden Einzelnen auf, sondern als Abgrenzungsbegriff, gerichtet gegen tatsächliche oder vermeintliche Feinde. Auf dieser mentalitätsgeschichtlichen Basis veröffentlichte Richard Wagner sein Pamphlet »Das Judentum in der Musik« 1850 unter dem Pseudonym K. Freigedank; 1912 benutzte der alldeutsche Antisemit Heinrich Claß das Pseudonym Daniel Frymann. Hitler bezeichnete sein politisches Zerstörungswerk früh als »Freiheitsbewegung« gegen die Fesseln des Versailler Friedensdiktats von 1919. Im Sommer 1922 stellte der spätere Reichskanzler eine grobschlächtige antisemitische Hetzrede unter die Überschrift »Freistaat oder Sklaventum?«. Die Parteizeitung, die der junge Joseph Goebbels 1924 im Ruhrgebiet redigierte, hieß Völkische Freiheit, Ende 1926 gründete er in Berlin den Nationalsozialistischen Freiheitsbund.[13] Von derart definierter Freiheit gelangten deutsche Beamte auf direktem Weg zu dem Verwaltungsbegriff »judenfrei«. Hitlers Kriegsreden erschienen unter dem Titel »Der großdeutsche Freiheitskampf«. Die politischen Ziele hießen »Wehrfreiheit«, »Nahrungsfreiheit« und »Raumfreiheit«, mit anderen Worten: Krieg, Massenmord, Herrschaft über die Kornkammer Ukraine und über solche Länder, die über wichtige Rohstoffe verfügten.
Um 1880 offenbarte die erstarkende antisemitische Bewegung einerseits das Ressentiment gegen Juden, andererseits das noch immer nachwirkende politische Elend der Deutschen: ihre Angst vor Freiheit und eigener Courage, ihre Neigung, das eigene Versagen anderen anzulasten. Der Neidhammel sucht den Sündenbock. Zumal in Krisenzeiten verbanden sie mit Freiheit das Gefühl von Unbequemlichkeit, Ungewissheit und Überforderung, während ihnen Gleichheit gemütliche Geborgenheit, Daseinsvorsorge und minimiertes individuelles Risiko bedeutete. Das verhinderte das politische Erwachsenwerden. Im Schatten der Gemeinschaftswerte verkümmerte die Freiheit. Die Begriffe Gleichheit, Neid und Freiheitsangst ermöglichen es, die Eigenart des deutschen Antisemitismus zu erkennen.
Bemerkungen zur Arbeitsweise
Den größten Teil dieses Buches schrieb ich während mehrerer Forschungsaufenthalte in Jerusalem, und zwar in der Bibliothek der Gedenkstätte Yad Vashem. Nirgendwo sonst stehen die einschlägigen Bücher so zahlreich beieinander. Das Katalogprogramm ist superb. Die Such- und Kombinationsmöglichkeiten übertreffen die der Berliner Bibliotheken bei weitem. Regelmäßig saß Michal in der Bibliothek. Sie wurde 1921 in Tübingen als Liselotte geboren. 1935 wanderte sie mit der Jugendaliah nach Palästina aus. Ihre Eltern starben in Auschwitz. Mit der Lupe in der Hand schreibt sie Inhaltsangaben deutscher Dokumente auf Hebräisch für die Archivverzeichnisse. Michal spricht gepflegtes Schwäbisch. Eines Morgens reicht sie mir ein Dokument. Es handelt von »Wachtmeister X«, einem Angehörigen der Waffen-SS. Er hatte – 1943 in Grodno – »einem Befehl zur Erschießung von Nichtariern und Häftlingen« nicht Folge leisten wollen und sich mit seiner Dienstpistole erschossen. Jahrelang erhielt die hinterbliebene Ehefrau deshalb keine Witwenrente.[14] »Es ist das erste Mal, dass ich so etwas lese«, sagt Michal.
Anregend wirkte auf mich auch die gelegentlich massive Unruhe im Lesesaal von Yad Vashem. Plötzlich brechen dort Gruppen von Schülern und Lehrern herein und beginnen zu arbeiten, zu diskutieren und zu suchen. Vor allem verursachen schwerhörige ältere Besucher Krach und Aufregung. Satzfetzen und Ortsnamen fliegen durch den Raum: Pinsk, Auschwitz, Będzin, Ghetto, 1943, Kaufering, Dachau; that’s my father! No, that’s my brother Chaim, he perished; DP camp Föhrenwald; Bahnhofstraße 5, Lager Mühlenberg; Samuel Gleitman, that’s my mother’s side … Eine ältere Dame sucht für eine noch ältere nach Daten im Register der Ermordeten. Es enthält mittlerweile vier Millionen genaue Personenangaben. Plötzlich ruft sie durch den Lesesaal: »Lilly, komm her, hier findest du deine Leute!« Die Entflohenen und Überlebenden kommen fast jeden Tag aus vielen Ländern. Sie suchen nach Dokumenten über ihren eigenen Leidensweg und nach Spuren, die wenigstens etwas vom Schicksal ihrer ermordeten Geschwister, Großeltern oder Tanten mitteilen. Sie wollen die Todesdaten und -orte von Verschollenen wissen, finden sie oft und sagen dann leise: »Nun können wir das Kaddisch beten.«
Das Wort Holocaust verbirgt, was Deutsche anrichteten. Sie trieben die Juden Europas, deren sie habhaft werden konnten, in Judenhäuser, Lager und Ghettos. Hunderttausende verhungerten dort, erlagen Kälte und Krankheiten. Die anderen deportierten die Deutschen und ihre Helfer – zu Fuß, auf Lastwagen oder in Zügen. Am Zielort warteten Erschießungs- oder Gaskammerkommandos. Einige der Todgeweihten hatten die Massengräber auszuschachten, die Krematorien zu befeuern und zu füllen.
Manchmal, gegen Kriegsende häufiger, sortierten deutsche SS-Männer, Beamte der Arbeitsverwaltung und Ärzte die Kräftigen unter den Deportierten zur Arbeit aus. So überlebten mehrere Zehntausend die Zeit des Schreckens. Hunderttausende Juden, die unter deutsche Herrschaft gerieten, konnten untertauchen, in letzter Minute fliehen oder wurden von den Verantwortlichen ihrer Heimatstaaten nicht an die Deutschen ausgeliefert. Letzteres gelang insbesondere in den Staaten, in denen der deutsche Zugriff aus unterschiedlichen Gründen sofort oder nach einiger Zeit gehemmt werden konnte: in Dänemark, Frankreich, Ungarn, Rumänien, Belgien, Italien und Bulgarien. Doch ermordeten die Deutschen innerhalb von nur drei Jahren 82 Prozent der jüdischen Bevölkerung ihres Herrschaftsraums. Insgesamt sechs Millionen Menschen.[15]
Im Herbst 1932 ahnte der wortgewandte Königsberger Zionist Kurt Blumenfeld das Kommende klarer als die meisten seiner Zeitgenossen; ich werde im Schlusskapitel darauf zurückkommen. Später machte Blumenfeld die gewalttätige Trostlosigkeit des Mordes an den europäischen Juden sprachlos. Er wusste viel über die Jahre der Verzweiflung, viel von den seelischen Wunden der Überlebenden; doch als er im Jahr 1961 seine Lebenserinnerungen niederschrieb, beendete er sie abrupt mit dem 28. Februar 1933, dem Tag seiner Abreise aus Deutschland nach Palästina. Damals hatte eine »neue Wirklichkeit begonnen«, so begründete er sein Schweigen. »Seit jenen Tagen sind über 28 Jahre vergangen. Seit 28 Jahren versuche ich, das Unsagbare zu sagen. Es zeigte sich, dass die Phantasie der Menschen niemals so groß ist wie ihre Grausamkeit. Was immer einer von uns auszudrücken vermag, es genügt nicht.«[16]
Kurt Blumenfeld starb 1963, 30 Jahre nach dem Beginn der neuen Wirklichkeit. Seither ist wieder ein halbes Jahrhundert vergangen. Die Spätfolgen des Unsagbaren sind nicht überwunden. Leicht wird es nie sein, einigermaßen angemessene Sätze für den deutschen Zerstörungswillen zu finden, der schließlich, und dann fast ungebremst, zur physischen Ausrottung der angefeindeten Juden führte.
Im Vergleich zu 1961 konnten mittlerweile einige Tausend Staatsanwälte, Kriminalbeamte, Richter, Journalisten, Historiker und die zur Zeugenschaft und zum Erinnern entschlossenen oder später ermutigten Überlebenden das Wissen über den Holocaust erheblich vermehren. Über die Tatumstände, über die wichtigsten Fakten und Indizien streiten die vielen nicht mehr, die über das Großverbrechen forschen und nachdenken. Die unmittelbaren Gründe, aus denen heraus die deutsche Führung die »Endlösung der Judenfrage« betrieb, sind im Wesentlichen klar; Meinungsverschiedenheiten bestehen in der Gewichtung einzelner Faktoren. Alle an der Diskussion Beteiligten betonen die eminente Bedeutung des Geschichtsbruchs Holocaust. Wohl deshalb wird noch lange strittig bleiben, worin die Bedeutung eigentlich liegt und welches die tieferen Ursachen waren. Die Antworten werden immer fragmentarisch bleiben, aber Historiker müssen danach suchen. Die Grenzen des Erklärbaren überwinden sie nicht.
In Anbetracht des großen Zeitrahmens, den die folgende Untersuchung umfasst, benutze ich fast ausschließlich gedruckte Quellen, seien es Streitschriften, Petitionen, Lebensbeschreibungen, Zeitungsartikel oder Parlamentsprotokolle. So unterschiedlich und oft gegensätzlich diese Texte sind, so verbindet sie eines: Sie wurden von Zeitgenossen verfasst, die nicht wussten, was Deutsche den Juden Europas zwischen 1933 und 1945 antun würden. Das erscheint mir methodisch ratsam. Die Autoren, die 1820, 1879, 1896 oder 1924 über den Antisemitismus und die Minderwertigkeitsgefühle von Deutschen schrieben oder den Judenhass und die Selbsterhöhung der arischen Rasse propagierten, die 1930/32 die politisch bedrohlichen Folgen von Wirtschaftskrisen oder die Anziehungskraft Hitlers und seiner Partei analysierten, kannten die Folgen nicht. Diejenigen, die damals lebten, beobachteten und urteilten, standen – anders als die Nachgeborenen – noch nicht unter dem doppelten Zwang, ein schier unbeschreibliches Verbrechen zu erklären und zugleich – in menschlich verständlicher Weise – Distanz herzustellen.
Nur ausnahmsweise ziehe ich ungedruckte Quellen heran, namentlich solche aus dem sieben laufende Meter umfassenden Archiv der Familie Aly. Ich habe die Papiere 2007 geerbt und neu geordnet. Einige Urkunden reichen bis zum Dreißigjährigen Krieg zurück. Doch enthält das Archiv vor allem Briefe, Tagebücher, Lebensbeschreibungen und Fotos, überwiegend aus der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Meine Frage an diese Quellengattung lautet: Wenn der deutsche Antisemitismus eine Massenerscheinung gewesen ist, die man vor 1933 nicht verstecken musste, dann muss er in den Briefen oder Lebenserinnerungen deutscher Familien seinen Niederschlag gefunden haben. In den Hinterlassenschaften meiner Vorfahren konnte ich einige einschlägige Dokumente finden. Ich integriere sie als gesellschaftsgeschichtliche Zeugnisse in den Text. Indem ich Quellen privater Provenienz einbeziehe, widerspreche ich Darstellungen, in denen so getan wird, als ließe sich die deutsche Judenfeindschaft und damit die Vorgeschichte des Holocaust in bestimmte Namen einzelner deutscher Institutionen, Verbände oder bekannter Antisemiten bannen.
Wer sich vergangenen Verhältnissen annähern will, dem bleibt nur übrig, sich die Handlungsbedingungen und Denkgewohnheiten im zeitlichen Horizont der damals Lebenden zu vergegenwärtigen. Das Verfahren erlaubt, geschichtliche Tendenzen zu konturieren, die hernach mit anderen – nicht zwingend negativen – Faktoren zusammentrafen und so verstärkt wurden. Deshalb ziehe ich über die lange strittige Judenemanzipation hinaus die Geistesverfassung der deutschen Nationalrevolutionäre des frühen 19. Jahrhunderts in Betracht, ebenso das Scheitern des Liberalismus und den Siegeszug des Kollektivismus. Zudem nehme ich die Folgen von Kriegen, Krisen und wirtschaftlichen Kraftakten, aber auch die beachtliche Bildungsreform der Weimarer Jahre in den Blick.
Für sich genommen erklären judenfeindliche Äußerungen die Vorgeschichte des Holocaust nicht. Wer den Antisemitismus in der deutschen Mehrheitsbevölkerung verstehen will, muss auch über die Gewandtheit und den Bildungswillen, die Geistesgegenwart und den schnellen sozialen Aufstieg so auffällig vieler Juden sprechen. Erst dann wird der Kontrast zur insgesamt trägen deutschen Mehrheitsbevölkerung, werden die Ansatzpunkte des Antisemitismus sichtbar. Erst dann wird verständlich, warum Antisemiten von Missgunst und Neid bestimmte Menschen waren. Die Judengegner verlangten immerzu nach »mehr Gleichheit« für sich, obwohl die Juden bis 1918 faktisch keine volle Gleichberechtigung genossen.
Ich begrenze meine Darstellung auf die Zeit, in der sich das moderne Deutschland formierte, beginne also mit den Jahren um 1800 und betrachte die Verhältnisse zwischen deutschen Juden und deutschen Christen für die dann folgenden 130 Jahre. Die Chronik antisemitischer Vereinigungen und die Mechanik der Judengesetzgebung in den einzelnen deutschen Ländern streife ich nur gelegentlich. Es kommt mir nicht darauf an, das Prädikat »rassenantisemitisch« möglichst oft zu verteilen, vielmehr gehe ich der Frage nach, wie und warum eine besonders aggressive Form des Antisemitismus in Deutschland entwickelt wurde und schließlich in allen Schichten des Volkes so viele Anhänger fand. Wie, wann und warum wurden Deutsche zu tatbereiten Antisemiten? Welche Motive, welche psychosozialen Dispositionen, welche inneren und äußeren Faktoren begünstigten diese Entwicklung? Wer einfach Schuld verteilt, um sich selbst auf der vermeintlich besseren Seite der deutschen Geschichte sicher zu fühlen, wird die Frage nicht beantworten können, warum sich die Deutschen mehrheitlich auf das Staatsziel verständigten »Fort mit den Juden!«, warum sie der »kalten Grausamkeit der rationalen Pedanterie« zum Durchbruch verhalfen, dem »biologischen Materialismus, der keine moralischen Kategorien kannte«, wie es Theodor Heuss 1949 ausdrückte.[17]
Die Deutschen folgten dieser Bahn, die im Abgrund der Unmenschlichkeit endete, zu keinem Zeitpunkt zwingend – aber am Ende waren sie diesen Weg gegangen. Ziel meiner Arbeit ist keine Forschungskontroverse über Einzelfragen. Ich versuche, den geschichtlichen Prozess, der zum deutschen Schreckensregiment der Jahre 1933 bis 1945 und zum Mord an den europäischen Juden führte, aus seiner inneren Logik zu begreifen, um einige Antworten auf die beiden Fragen zu geben, die so viel Ratlosigkeit erzeugen: Warum die Deutschen? Warum die Juden?
Die Rechtschreibung folgt auch in den Zitaten den heute gültigen Regeln. Kursiv gedruckte Wörter in den Zitaten entsprechen stets einer Hervorhebung im Original. Weil die verwendete Literatur einen Zeitraum von rund 200 Jahren umfasst, gebe ich in den Fußnoten zum Kurztitel das ursprüngliche Erscheinungsjahr und gegebenenfalls das Erscheinungsjahr der von mir benutzten späteren Ausgabe an, um die zeitliche Einordnung der Texte zu erleichtern. Ist die zitierte Druckschrift wenig umfangreich oder insgesamt für den im Text behandelten Zusammenhang von Interesse, gebe ich keine Seitenzahl an. Einige Absätze entnahm ich einer kleinen, 2007 von mir verfassten Vorstudie, die 2008 als Teil einer namentlich nicht gekennzeichneten Einleitung erschien (Band 1 der von mir mitbegründeten und bis Band 2 mitherausgegebenen Quellenedition »Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945«).
Seinerzeit gebräuchliche Begriffe wie Judenfrage, Bastard, Führer, Ausmerze, Arisierung, Blutschutz, Judenstämmling, minderwertige oder hochstehende Rasse usw. setze ich im Vertrauen auf meine Leserinnen und Leser nicht in Anführungszeichen. Die Schriften jüdischer und nichtjüdischer Autoren ziehe ich gleichermaßen heran. Sie eröffnen unterschiedliche, der Fragestellung nützliche Blickrichtungen. Welcher Religion die Einzelnen angehörten, vermerke ich nicht immer. Meistens gibt der Inhalt, manchmal geben die Namen Hinweise; aber Vorsicht: weder Karl Kautsky noch Matthias Erzberger oder Wilhelm Liebknecht waren Juden.
Die bis 1933 in Deutschland ansässigen Juden waren zu mehr als 80 Prozent deutsche Staatsbürger, also Deutsche. Sie verstanden sich weithin so, nicht selten waren sie stolz darauf. Ich begrenze den Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden auf religiöse Traditionen. Der Text handelt jedoch von einer Epoche, in der zumeist schlicht und kunterbunt von Deutschen, Christen und Juden gesprochen wurde, gleichgültig, ob der religiöse, nationale oder rassische Unterschied gemeint war, ob die Staatsbürgerrechte für Juden erstritten oder später deutschen Juden abgesprochen werden sollten.
Folglich verzichte ich auf die theoretisch wünschenswerte sprachliche Präzision, die ich nur um den Preis geschichtsfremder Künstelei durchhalten könnte. Auch würde ich auf diese Weise das Selbstverständnis der vielen verletzen, die sich in zunehmender Zahl als nicht religiös gebundene Bürger verstanden. Deshalb rufe ich den am ehesten korrekten Sprachgebrauch christliche Deutsche und jüdische Deutsche nur gelegentlich in Erinnerung. Im Mittelalter war die Kollektivbezeichnung Judenschaft gebräuchlich (ähnlich der Handwerkerschaft oder Bauernschaft); das Wort Judenheit kam im frühen 19. Jahrhundert auf, um die bloß religiöse Differenz zur Christenheit hervorzuheben; im Sinne des Nationalismus entsprach der Begriff Judentum dem des Deutschtums. Er enthält die Anschauung von je eigenständigen Nationen und wurde mit dem Erstarken des Nationalismus immer beliebter. Wobei diejenigen, die in der Zeit zwischen 1800 und 1933 solche Wörter gebrauchten, das meistens in wechselndem, nur ausnahmsweise im strengen Sinn taten.
Die S. Fischer Stiftung (Berlin) förderte das vorliegende Buch großzügig, ebenso das International Institute for Holocaust Research in Yad Vashem (Jerusalem). Dort konnte ich dank des Baron Carl von Oppenheim Stipendiums zur Erforschung des Rassismus, des Antisemitismus und des Holocaust, das mir Christopher von Oppenheim gewährte, in aller Ruhe arbeiten. Die stets mitdenkenden, diskussionsfreudigen, hilfsbereiten und gastfreundlichen Kolleginnen und Kollegen in Yad Vashem erleichterten meine Arbeit in liebenswürdiger Weise.
Wie schon sechs andere meiner Bücher betreute Walter Pehle auch dieses. In stiller Hintergrundarbeit hat er im Laufe seiner 35 Jahre währenden Tätigkeit beim S. Fischer Verlag mehr als 250 Bücher zur Geschichte des Nationalsozialismus und insbesondere zur Verfolgung der Juden in den Druck gegeben. Er führte seine Autoren mit Geduld, Bestimmtheit und Nachsicht. Er warb für ihre Werke, wo er nur konnte. Walter Pehle produzierte ununterbrochen Bücher über entsetzliche Verbrechen und wahrte seinen rheinischen Witz. Das Manuskript zu diesem Buch war das letzte, das er bearbeitete, bevor er – es fiel ihm nicht leicht – 70-jährig seinen Schreibtisch im Verlag räumte. Wie immer achtete er auf jedes Komma. Wie es seine Art war, fragte er mich beim Durcharbeiten des Manuskripts hin und wieder spitz: »Was meint der Herr Autor mit diesem Satz?« und bemerkte nach einer kurzen Pause: »Das streichen wir wohl!?« Dafür und für die zwei Jahrzehnte lange Zusammenarbeit herzlichen Dank.
Berlin, März 2011
1800–1870: Judenfreunde, Judenfeinde
Halbherzige Emanzipation von oben
Am 6. August 1806 verschwand das Heilige Römische Reich deutscher Nation von der Weltbühne. Es hatte gut tausend Jahre bestanden, schließlich sank es unter dem Druck der Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege fast lautlos dahin. Goethe notierte knapp: »Es hat mir doch eine traurige Empfindung gemacht.« Zwar merkten es die Zeitgenossen nicht sofort, aber sie standen am Beginn einer stürmischen Epoche. Bald wurden Menschen aus ihren lange gewohnten Lebensbahnen geworfen, altes Wissen, Handwerkskünste und Gepflogenheiten verloren an Wert. Hunderte Partikularherrschaften wurden mit einigen Federstrichen aufgelöst und jahrhundertealte Abhängigkeiten beendet. Volksfrömmigkeit und weltliche Kirchenmacht schwanden.
Im Süden und Westen der deutschen Länder schritt die Säkularisation schnell voran. Historiker bezeichneten den Klostersturm hernach als »wohltätige Gewaltsamkeit«, rückten ihn so ins Licht aufgeklärter Reformpolitik. Mit diesem Kunstgriff überblendeten sie unzählige, oft wüst vollzogene Enteignungsakte zugunsten der kleinen Leute, der Universitätsbibliotheken, Gemäldegalerien, Dorfpfarreien und Staatskassen. Selbstverständlich begleiteten Habgier und Korruption die Neuverteilung klösterlicher Besitztümer. In Bayern bauten sich Handwerker und Bauern stattliche Häuser aus den Steinen der Konvente, Klosterkirchen und Nebengebäude. Parallel dazu modernisierten aufgeklärte Adelige und Bürger das Recht. Sie trieben den wirtschaftlichen Wandel voran. 1814/15 bremste der Wiener Kongress den Erneuerungsrausch, befestigte die alten Gewalten ein letztes Mal und verschaffte dem bäuerlichen, handwerklichen und städtisch-patrizischen Konservatismus Raum für zähen Widerstand gegen die von Westen heranbrandende Moderne – bis das vertraute Alte mit der in Deutschland verspätet einsetzenden, dann umso turbulenteren industriellen Revolution unwiderruflich in die Brüche ging.
In den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution ordneten deutsche Ratsherren und Staatsmänner das Verhältnis zwischen Christen und Juden neu. 1796 fielen in Frankfurt am Main die Mauern der Judengasse – dank der französischen Belagerung und gegen eine von den Juden an den Stadtkämmerer zu zahlende Kontribution von fast einer halben Million Taler. In Preußen hatte eine 1787 eingesetzte Kommission zwar die Rechtsstellung der Juden erörtert, doch blieben die Verhandlungen ohne greifbaren Erfolg. Erst unter der Vorherrschaft Napoleons gelang der Durchbruch. Die Städteordnung vom 19. November 1808 hob den Zunftzwang auf und garantierte allen Bürgern die Gewerbefreiheit, unabhängig von Stand, Geburt oder Religion. Die Hardenberg’schen Gesetze vom 2. November 1810 und vom 7. September 1811 befestigten diesen Weg.
Die neuen Gesetze ergossen über die Bürger Preußens »eine Wohltat, die von den Regierenden gewährt, nicht vom Volke selbst stürmisch gefordert« worden war, wie der Historiker Friedrich Meinecke feststellte. Sie setzten Unternehmensgeist, Wettbewerb und Kapitalien in Bewegung. Jedoch erschienen die wirtschaftlichen Konsequenzen den meisten deutschen Christen »als Plage«, und die Reform »ist heftig bekämpft worden von denen, denen sie zugutekommen sollte«.[18] Anders die Juden. Sie nahmen die Gewerbefreiheit als Aufforderung zum wirtschaftlichen Aufbruch. Zwar durften sie nicht Apotheker werden und keine öffentlichen Waagen betreiben – das stabilisierte alte Ressentiments –, doch bedeutete es für den weiteren Verlauf nichts, und schon zu diesem frühen Zeitpunkt entstand eine besondere deutsche Konstellation: Die Fortschrittsfreude der meisten Juden stand gegen die Fortschrittsscheu der meisten Christen, die Freiheitslust der einen gegen die Freiheitsangst der anderen, jüdischer Unternehmergeist gegen christlichen Untertanengeist.
Formuliert und durchgesetzt hatte die für die wirtschaftliche Emanzipation der Juden so wichtige preußische Städteordnung Reichsfreiherr Karl vom und zum Stein. Acht Jahre später, 1816, dachte derselbe vom Stein laut darüber nach, die Juden auszuweisen, um mit ihnen »die Nordküste Afrikas (zu) bevölkern«. Wie passte das in ein und denselben deutschen Reformerkopf? Vom Stein konnte Juden noch nie leiden. Ihre wirtschaftliche Gleichstellung bewirkte er nebenbei, aus Gründen der Systematik und unter den Vorzeichen der französischen Besatzung. Nach der Niederlage Napoleons, nach dem Wiedererstarken der dynastischen Mächte und im warmen Strom des Zeitgeistes folgte er dann den Ideen der nationalen Reinheit und des christlichen, von Gottes Gnaden legitimierten Königtums. In dieser Zeit warnte er häufig vor jenen Gefahren, die von einem »Aggregat von Gesindel, Juden, neuen Reichen, phantastischen Gelehrten« ausgehen und dazu führen würden, die aus der Leibeigenschaft befreiten Bauern in »die Hörigkeit an die Juden und an die Wucherer« fallen zu lassen. Vom Stein sprach von der »Verderblichkeit der jüdischen Horde« und forderte, »alle vernünftigen Leute müssen sich vereinigen«, um diese »zu bekämpfen«. Jüdischen Bankiers unterstellte er 1823 generell, dass »deren List, Beharrlichkeit, nationaler Zusammenhang, Mangel an Ehrgefühl, wenn es auf Befriedigung der Habsucht ankam, in jedem Staat verderblich ist und besonders nachteilig auf die Beamtenwelt wirkt«.[19]
Kurz vor dem Ende des preußischen Reformfrühlings unterzeichnete Friedrich Wilhelm III. am 7. Juli 1812 das von Wilhelm von Humboldt vorbereitete Edikt »betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden«. Staatskanzler Hardenberg hatte es gegen den »zähen Widerstand seines Monarchen« durchgesetzt und gab es den Juden »mit Vergnügen« bekannt. Diesen erschien es »als der vollständigste Freiheitsbrief«, und sie feierten das Gesetz »mit unendlichem Jubel«.[20] Es verhalf den altpreußischen Juden zur Staatsbürgerschaft, zur Wehrwürde und sicherte ihnen die Wirtschaftsfreiheit, einschließlich des Rechts zum Kauf und Besitz von Grundstücken zu. Vom Offiziersstand blieben sie ausgeschlossen, auch begrenzte das Gesetz den Zutritt zu Staats- und Wahlfunktionen. Nach Paragraph 3 mussten sie sich Nachnamen zulegen. Die einen wählten alte jüdische Namen (Levi, Cohn), andere ihre Herkunftsorte zum Nachnamen (Bamberger, Sinzheimer), wieder andere bekamen von Amts wegen Spottnamen zugeteilt, die ihnen der »grausame Volkshumor der Germanen angehängt hatte« (Wolf, Kuh), nicht wenige huldigten dem romantischen, der Natur zugewandten Zeitgeschmack und nannten sich Feilchenfeld, Silberklang, Rosenzweig, Lichtblau oder Blumenthal.[21]
In der dem Wiener Kongress von 1814/15 folgenden Ära der Restauration zog die preußische Regierung die noch bestehenden Restriktionen etwas enger, 1822 versperrte sie jüdischen Staatsbürgern den Lehrerberuf »wegen der bei Ausführung sich zeigenden Misshelligkeiten«.[22] In den unruhigen Jahrzehnten zwischen 1830 und 1849 lockerte Preußen einige Beschränkungen für Juden. Den rechtlichen Abschluss fand die Emanzipation in den deutschen Teilstaaten nach 1860. Die beiden maßgeblichen Sätze des Gesetzes »betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen«, das seit dem 3. Juli 1869 für den Norddeutschen Bund und seit 1871 für ganz Deutschland galt, lauten: »Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Teilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiösen Bekenntnis unabhängig sein.«[23]
Vergleicht man die Judenemanzipation in Deutschland nicht mit der in Frankreich, sondern mit der im damals unmittelbar angrenzenden Russland, das große Teile des heutigen Polen einschloss, dann schritt sie rasch voran. Für die in ihrer Bewegungsfreiheit stark reglementierten, immer wieder Pogromen ausgesetzten Juden des russischen Reichs bot der benachbarte preußische Westen seit 1812 ein fast paradiesisches Maß an Rechtsgarantien und Lebenschancen. Die autokratischen Regierungen der deutschen Teilstaaten traten antijüdischer Gewalt entgegen. Soziale Unruhen und eben auch Judenpogrome verstanden sie als Angriffe auf die herrschende Ordnung – deshalb, nicht aus besonderer Sympathie mit den Angegriffenen, schickten sie Soldaten, um solche Volksbewegungen zu unterdrücken.
Nach bescheidenen Anfängen um 1870 ging die Bereitschaft, Juden in den öffentlichen und in den höheren militärischen Dienst aufzunehmen, von 1880 an wieder zurück. Im Jahr 1900 befanden sich in den meisten staatlichen Verwaltungen keine Juden mehr, wie Paul Nathan feststellte. Nathan gehörte zu den herausragenden jüdischen Verbandspolitikern der späten Kaiserzeit und verstand sich als entschlossener Widerpart zu dem seit 1880 auflodernden Antisemitismus. 1901 musste der preußische Justizminister Karl Heinrich Schönstedt im Abgeordnetenhaus erklären, warum er auf konservativen Druck hin keine jüdischen Notare mehr ernenne. Er rechtfertigte das mit dem Hinweis, die Justizverwaltung sei immerhin die einzige, »in der überhaupt jüdische Assessoren angestellt« würden: »Alle anderen Verwaltungen lehnen es ab, jüdische Herren zu übernehmen.« Im preußischen Heer diente damals nicht ein Berufsoffizier jüdischer Religion, seit 1886 war kein Jude mehr zum Reserveoffizier befördert worden. 1911 suchte der Generalsekretär des Verbands Deutscher Juden, Max Loewenthal, abermals nach jüdischen Offizieren im preußischen Heer. Vergeblich. Einen Hauptmann Dreyfus, der im französischen Generalstab diente und aus antisemitischen Motiven des Verrats bezichtigt, degradiert und verbannt wurde, konnte es in Deutschland nicht geben.[24]
Die verdeckte Benachteiligung hatte sich gegen den Buchstaben des Gesetzes auf dem Verwaltungsweg eingespielt. Die Schriftzeugnisse, die in den verschiedenen Parlamenten und Behörden dazu entstanden, belegen das übliche Verfahren: Die führenden Herren der Wilhelminischen Ära wiesen den Verdacht der Judendiskriminierung öffentlich weit von sich, im Stillen förderten sie die judenfeindliche Verwaltungspraxis allerorten. Hier und da duldeten sie einen Konzessionsjuden – diesen Begriff gab es tatsächlich. Für gewöhnlich verfuhren sie wie die Stadtväter des vorpommerschen Ueckermünde. Als es dort 1904 nicht gelang, eine vakante Lehrerstelle zu besetzen, bemerkte der Chronist: »Auf die Ausschreibung meldete sich kein geeigneter Bewerber, nur ein Jude. Da ein solcher nicht erwünscht war, kam die Stadt in schlimme Verlegenheit.«[25]
Etwas besser erging es dem Gerichtsreferendar Arthur Ruppin 1902. Der Oberlandesgerichtspräsident in Naumburg wies ihn dem Amtsgericht des entlegenen Städtchens Klötze bei Salzwedel zu. Amtsrichter Grunert empfing ihn aufs Liebenswürdigste, leutselig nahm er den jungen Kollegen sofort zum Frühschoppen der örtlichen Honoratioren mit. Am nächsten Morgen schritt er zur Vereidigung. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, fragte Grunert die Personalien ab, der Gerichtsschreiber nahm sie auf. »Ihre Religion?« – »Jude«, antwortete Ruppin. »Es traf den Amtsrichter wie ein Blitz. Darauf war er nicht vorbereitet. Sein Referendar – Jude!«[26]
Und dennoch: Widerwillig als Vollbürger akzeptiert, immerhin vor Gewalt und wirtschaftlicher Zurücksetzung wirksam geschützt, stiegen die deutschen Juden zwischen 1810 und 1870 von benachteiligten Untertanen zu aktiven Staatsbürgern auf. Das versinnbildlichte die vor der formellen rechtlichen Gleichstellung vollendete Neue Synagoge in der Berliner Oranienburger Straße. Ihre vergoldete Kuppel erhob sich neben den Kuppeln des Hohenzollernschlosses und des damals noch bescheidenen protestantischen Doms. In keiner anderen europäischen Metropole bauten die Juden so selbstbewusst. »Die größte und prächtigste ›Kirche‹ der deutschen Hauptstadt ist die Synagoge!«, giftete Heinrich von Treitschke 1870.[27] Von 1859 an hatte Hofarchitekt August Stüler den Bau geleitet; zum Eröffnungszeremoniell am 5. September 1866 gaben sich die Spitzen der Stadt und des Staates die Ehre, allen voran Preußens Ministerpräsident Otto von Bismarck.
Eine erhebende und schöne Feier fast ohne Makel – fast. Seine allerchristlichste Majestät König Wilhelm I. erschien nicht, und das aus einem speziellen Grund. Als Religionsgemeinschaft wurden die preußischen und deutschen Juden bis 1919 nicht anerkannt, nicht, wie beispielsweise in den Niederlanden, den christlichen Kirchen gleichgestellt. Seit 1869/71 garantierte das Gesetz den Juden individuelle Rechtsgleichheit, als in ihrer Religion verbundene Gruppe blieben sie Geduldete.
Gute Deutsche, schlechte Deutsche?
Trotz aller Hemmnisse, die der vollendeten bürgerlichen Gleichstellung entgegenstanden, fand die Idee der Judenemanzipation seit den Tagen Hardenbergs viele engagierte Fürsprecher in Deutschland. Sie beriefen sich auf das Vernunftrecht. So zum Beispiel Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Gegen das »Geschrei« der Judengegner stellte er den Anspruch der Juden, »als rechtliche Personen in der bürgerlichen Gesellschaft zu gelten« in das Zentrum seiner Überlegungen.[28]
Viele Deutsche stritten im 19. Jahrhundert für die Rechte der Juden und traten gegen den Antisemitismus auf. Ihr Einsatz, auch ihre Courage sind heute oftmals vergessen, vom Schatten des späteren Mordens überdeckt. Aus dem öffentlichen Gedächtnis ist getilgt, dass Reichskanzler Bismarck auf dem Berliner Kongress 1878 mit Nachdruck für die gesetzliche Gleichberechtigung der Juden in Rumänien, Bulgarien und Serbien eintrat. Er »ruhte nicht, bis er das Wort eines jeden Einzelnen hatte«, er proklamierte »die Gleichberechtigung der Bekenntnisse in so feierlicher und zwingender Weise, wie es noch nie vorher in der Welt geschehen war«.[29] Noch als das Kaiserreich Anfang 1918 mit Rumänien den Frieden von Bukarest schloss, diktierten seine Unterhändler in die Friedensbedingungen, dass den rumänischen Juden nun endlich gemäß dem Berliner Vertrag von 1878 volle staatsbürgerliche Rechte zu garantieren seien. Als Litauen im Sommer 1918 unter deutscher Herrschaft neu gegründet wurde, erklärte die kaiserliche Regierung unter Hinweis auf die »berechtigten Wünsche der Juden«: In Litauen »muss allen nationalen Minoritäten ihr Recht auf bürgerliche Gleichberechtigung, freie Religionsausübung und Pflege ihrer Eigenart und Überlieferung voll bewahrt werden«. Auf der Pariser Friedenskonferenz, die im Sommer 1919 mit dem Versailler Vertrag endete, lancierte die deutsche Delegation im März die Forderung: »Gleichberechtigung und Gleichstellung der Juden und des Judentums in allen Ländern der Welt.«[30]
Die demonstrativen Interventionen des Kronprinzen Friedrich Wilhelm zugunsten der Juden werden kaum mehr erwähnt. Als Kaiser Friedrich III. starb er im Jahr 1888 einige Monate nach seiner Krönung. Im November 1879 hatte er die »gegenwärtigen antisemitischen Umtriebe« als »Schmach und Schande für Deutschland« bezeichnet.[31] Im Großherzogtum Hessen-Darmstadt ordneten die verantwortlichen Männer im Dezember 1890 an, die Antisemiten sorgfältig zu beobachten und »gegen strafbare Ausschreitungen mit Rücksicht auf die Störung des öffentlichen Friedens sofort und streng einzuschreiten«, ebenso gegen »Beleidigungen der Israeliten als solcher«.[32]
Manche Historiker und Literaturwissenschaftler verteilen das Etikett »antijüdisch« oder »rassenantisemitisch« mit großer Geste – an einige geschichtliche Akteure vorschnell, an andere lieber nicht.[33] Oftmals ziehen sie eine gerade Linie von Johann Gottlieb Fichte hin zu Wilhelm Raabe, Gustav Freytag, Heinrich von Treitschke, Wilhelm Marr und Adolf Stoecker, sie fahren mit der Judenzählung im Ersten Weltkrieg fort und gelangen so auf geradem Weg zu »den nationalsozialistischen Gewalthabern«. Derart vereinfacht reichen für den Stempel »Antisemit« ein paar unfreundliche oder bösartige Sätze über Juden aus. Aber das Herauspräparieren scheinbar zwingender Abfolgen judenfeindlicher Äußerungen und Ereignisse erklärt nichts.
Wenn eine Bemerkung von Johann Gottlieb Fichte immer wieder als Beispiel für einen selbst unter deutschen Philosophen verbreiteten Vernichtungsantisemitismus dient, versperrt das den Erkenntnisgewinn. So einfach liegt der Fall nicht. In seinem 1793 verfassten Text über die Französische Revolution schrieb Fichte gegen verschiedene Formen der Unterdrückung an: gegen wirtschaftliche Ausbeutung, Despotie, Hierarchie und gegen geschlossene Kasten, insbesondere das Militär, den Adel und die (noch ghettoisierten) Juden. Nachdrücklich sprach er diesen die allgemeinen Menschenrechte zu: »Zwinge keinen Juden wider seinen Willen, und leide nicht, dass es geschehe, wo du der nächste bist, der es hindern kann.« Aber Fichte lehnte es damals ab, ihnen die Bürgerrechte, die volle Rechtsgleichheit, zuzuerkennen, es sei denn, sie würden gründlich umerzogen und jeder jüdischen Idee entsagen. Seine Überlegung zur aufklärerischen Gehirnwäsche packte er in ein sehr drastisches, anstößiges Bild: »Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel als das, in einer Nacht ihnen alle Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei.«
Diese Textstelle wird in der einschlägigen Literatur dutzendfach isoliert zitiert, manchmal textwidrig als mörderisch interpretiert. Fast immer wird übergangen, dass Fichte nur wenige Zeilen vor dem vielzitierten Satz kompromisslos für die Menschenrechte der Juden eintrat: »Die Menschenrechte müssen sie haben.« Sehr oft werden auch die beiden einleitenden Sätze zu dem Zitat weggelassen. Sie lauten: »Fern sei von diesen Blättern der Gifthauch der Intoleranz, wie er von meinem Herzen fern ist. Derjenige Jude, der über die festen, man möchte fast sagen, unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe durchdringt, ist ein Held, ein Heiliger.« Fichte betonte den Anspruch der Juden auf Menschenrechte und Nächstenliebe, sah jedoch die Notwendigkeit, die christliche Mehrheit vor diesen zu schützen. Aber nicht mit Mord und Totschlag, sondern entweder durch Umerziehung (»andere Köpfe aufsetzen«) oder durch Exilierung (»Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern, und sie alle dahin zu schicken.«) Fichte hat sich später von seiner rabiaten Formulierung distanziert und das in seinem Tun unter Beweis gestellt.[34]
Nichts spricht dagegen, Wilhelm Marr als Antisemiten zu kennzeichnen. Er führte das Wort Antisemitismus ins Weltvokabular ein. Allerdings sollte nicht verschwiegen werden, dass er politisch aus den vorderen Reihen der 48er-Revolutionäre stammt und mit dieser Biographie keinen Einzelfall unter den deutschen Judenfeinden darstellt. Der Berliner Hof- und Domprediger Stoecker war in der Tat ein Vorkämpfer des Antisemitismus – aber auch des deutschen Sozialversicherungssystems, das bis heute als große Errungenschaft gilt. Wie zu zeigen sein wird, setzten sich Antisemiten für das freie, geheime und gleiche Wahlrecht ein, für den Bau von Gartenstädten und für die Errichtung von Konsumvereinen. Solche Ambivalenzen popularisierten den Antisemitismus. Wer sie heute im Namen eines eingängigen Geschichtsbildes ignoriert, begibt sich der Möglichkeit, die deutsche Vorgeschichte des Holocaust in ihrer Komplexität zu begreifen.
Im Namen solcher Eindeutigkeit wird zum Beispiel der glänzende Erzähler Wilhelm Raabe immer häufiger als Antisemit denunziert. Wer diesen mir nichts, dir nichts zu den Produzenten »antijüdischer Klischees« packt, liegt jedoch falsch. Über Raabes Roman »Der Hungerpastor« (1864) mag so reden, wer die historische Vorlage für Moses Freudenstein ignoriert und übergeht, dass im »Hungerpastor« sämtliche jüdischen Nebenfiguren positiv gezeichnet sind. Die beiden Zentralfiguren des »Hungerpastors« stammen aus benachbarten ärmlichen Verhältnissen, verbringen ihre Kindheit in Freundschaft, machen als Erste ihrer jeweiligen Familien das Abitur, dann trennen sich ihre Wege. Der eine, Hans Unwirrsch, bringt es zum grundehrlichen, miserabel besoldeten Pastor einer winzigen mecklenburgischen Pfarre. Bescheiden wahrt er das gute Alte. Der andere studiert in Paris, promoviert und verleugnet am Ende seine Herkunft: Moses Freudenstein, der Sohn eines jüdischen Trödlers, wird vom politisch Freisinnigen zum opportunistischen, erzreaktionären Konvertiten Dr. Theophil Stein, Geheimer Hofrat – mit aller »Herzlosigkeit« auf dem Weg nach ganz oben. Die Vorlage, die sich der Realist Raabe für diese Romanfigur nahm, war Dr. Joël Jacoby (1807–1863), der sich nach seiner Taufe Franz Karl Jacoby nannte und später zu dem von allen Liberalen gehassten preußischen Oberzensor und »Erzschuft« avancierte.
Mit seiner Erzählung »Holunderblüte« (1863) verneigte sich Raabe demonstrativ vor der mosaischen Lebenswelt. 1875 erschien seine Novelle »Höxter und Corvey«, in der davon erzählt wird, wie die zerstrittenen, im Pogrom jäh geeinten Protestanten und Katholiken von Höxter bald nach dem Dreißigjährigen Krieg die drei, vier jüdischen Familien zusammentreiben und die alte Lea totquälen. Der Erzähler ergreift in jedem Satz Partei für die Verfolgten. Er schildert die christlichen Räuber, den bigotten Pfaffen, die Trunkenbolde und Totschläger als verachtenswertes Gesindel. »Wir sind dem Herrn zu Ehren noch immer da, was sie auch an Marter und Bosheit gegen uns ausgeübt haben« – so zugewandt lässt der angebliche Antisemit Raabe seine Geschichte mit dem Trauergesang jüdischer Frauen ausklingen.[35]
Der seit 1850 ungemein populäre Schriftsteller Gustav Freytag schuf in seinem Roman »Soll und Haben« (1855) mit Veitel Itzig die Figur eines habgierigen Juden. Warum denn nicht in einem unendlich reichhaltigen Werk? Als politisch engagierter Bürger und Liberaler trat er stets für die Emanzipation der Juden ein. Bis zum Tod wirkte er aktiv im Verein zur Abwehr des Antisemitismus, den der Berliner Rechtswissenschaftler Rudolf von Gneist 1890 mitbegründet hatte. Über die deutschtümelnden, angeblich »echten Enkel der alten Germanen« urteilte er 1893 an prominenter Stelle: »Was jetzt mit aufgebauschtem Namen die ›antisemitische Bewegung‹ genannt wird, ist in Wahrheit nur das alte Leiden, die Judenhetze.« Seinem jüdischen Freund Jacob Kaufmann, dem »böhmischen Judenknaben, der aus eigener Machtvollkommenheit ein deutscher Patriot« und Demokrat geworden war, widmete Freytag 1871 einen wunderbaren Nachruf.[36] Des ungeachtet wird Freytag heute immer wieder zu den literarischen Vorläufern des Rassenhasses gerechnet.
Tatsächlich waren Raabe und Freytag Vertreter des Realismus. Sie schufen Hunderte Romanfiguren, darunter auch zwei hartherzige Juden. Sie konnten das Ende der deutsch-jüdischen Geschichte nicht kennen. Eine allgemeine antisemitische Tendenz der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert belegen solche fragwürdigen Beispiele nicht. Tatsächlich bedienten im 19. Jahrhundert vergleichsweise wenige deutsche Schriftsteller von Rang antisemitische Klischees. Demgegenüber wimmelt es bei Charles Dickens oder Honoré de Balzac von wucherischen und durchtriebenen jüdischen Gaunern. René de Chateaubriand präsentierte Hebräer abwechselnd als Christusmörder und unverdient reich gewordene Zeitgenossen. Bei Victor Hugo erscheinen die Pogrome zur Zeit der Kreuzzüge als gerechtfertigte Vergeltung für die Massaker, die der Erzähler den biblischen Vorvätern der Hingeschlachteten zur Last legt. Die Sozialisten Charles Fourier und Pierre Joseph Proudhon diskriminierten Juden als Satane und Ischarioths; Michail Bakunin verachtete sie obsessiv; Dostojewski pflegte einen ausgeprägten Judenhass.[37]
Umgekehrt wäre hervorzuheben: Gerade unter den volkstümlichen Dichtern wie Johann Peter Hebel, Peter Rosegger oder Fritz Reuter fanden die jüdischen Deutschen herausragende Verteidiger. Gerhart Hauptmann gehörte ebenfalls dazu. Er thematisierte den neuen Antisemitismus in seiner 1901 uraufgeführten Tragikomödie »Der rote Hahn«, zeichnete die Christen als »giftige Kröten«, Betrüger und Brandstifter, während die Hauptfigur Dr. Boxer als sympathischer, rechtschaffener »kräftiger Mann von sechsunddreißig Jahren, Arzt, jüdischer Konfession« im Personentableau vorgestellt wird.
Der massive öffentliche Auftritt von Antisemiten im Jahr 1880 rief sofort die Gegenkräfte auf den Plan. Theodor Mommsen warnte vor dem »Bürgerkrieg einer (christlichen) Majorität gegen eine (jüdische) Minorität«. Am 14. November 1880 veröffentlichten 75 einflussreiche Berliner in der Nationalzeitung ihre Stellungnahme gegen die judenfeindlichen Umtriebe, darunter Oberbürgermeister Max von Forckenbeck, der Stadtälteste August Gesenius, Rudolf Virchow, Werner Siemens, Johann Gustav Droysen, Theodor Mommsen, Gustav Robert Kirchhoff, Rudolf von Gneist, die Spitzen der Berliner Kaufmannschaft, Landgerichtsdirektor Carl Robert Lessing, Geheimer Sanitätsrat Friedrich Koerte, Stadtschulrat Eduard Cauer, Professor August Wilhelm von Hofmann (Chemiker und Rektor der Universität), weitere Professoren, Rechtsanwälte, Stadträte, Kommerzienräte und Direktoren. Die Herren sparten nicht an deutlichen Worten: Sie wiesen den »Rassenhass« zurück, der »in tief beschämender Weise« neuerdings »wie eine ansteckende Seuche« auftrete. Im Namen des Gesetzes und der Ehre verlangten sie, »dass alle Deutschen in Rechten und Pflichten gleich sind. Die Durchführung dieser Gleichheit steht nicht allein bei den Tribunalen, sondern bei dem Gewissen jedes einzelnen Bürgers.« Die Unterzeichner warnten vor den neuen Antisemiten und besonders vor dem Anheizen der Leidenschaften des Volkes: »Wenn jetzt von den Führern dieser Bewegung Neid und Missgunst nur abstrakt gepredigt werden, so wird die Masse nicht säumen, aus jenem Gerede die praktischen Konsequenzen zu ziehen.« Schon höre man den Ruf nach gegen die Juden gerichteten Ausnahmegesetzen: »Wie lange wird es währen, bis der Haufen auch diesen zustimmt?«[38]
Von Kopf bis Fuß antisemitisch durchdrungen war die wilhelminische Bürgergesellschaft nicht. Ihre besten Köpfe dankten der Vorsehung, dass sie dem ziemlich spröden »germanischen Metall für seine Ausgestaltung einige Prozent Israel« beigesetzt hatte, wie der Historiker Theodor Mommsen es ausdrückte. Der junge Thomas Mann verteidigte den »unentbehrlichen europäischen Kultur-Stimulus, der Judentum heißt«, den »zumal Deutschland« so »bitter nötig« habe.[39]
Selbstemanzipation kraft Bildung
Die verschleppte Emanzipation der mosaischen Minderheit entsprach den gleichfalls trägen Rechtsfortschritten, die sich die christliche Mehrheit eher ersaß als erkämpfte. Im Gegensatz zu den meisten Christen emanzipierten sich die Juden jedoch selbst, und das im Eiltempo. Sie nutzten die ihnen sukzessive zugestandenen Möglichkeiten zielstrebig. Dafür bot Deutschland mit seinem halbherzigen Reformismus, seiner bis 1870 schwachen Wirtschaftsentwicklung und starken Rechtssicherheit gute Grundlagen.
Anders als in agrarisch-stationären Verhältnissen brauchten die Menschen jetzt Neugier, Einfallsreichtum, Geistesgegenwart, Anpassungsgabe, soziale Intelligenz und vor allem Bildung. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde sichtbar, dass den jüdischen Schülern das Erlernen der fortan zwingend erforderlichen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen leichtfiel. Anders als die meisten ihrer christlichen Altersgenossen wurden die jüdischen Knaben in aller Regel seit jeher alphabetisiert, wenn auch auf Hebräisch und mit religiösen Inhalten. Die Eltern legten ihnen zwar keine silbernen Löffel in die Wiege, wohl aber geistige Güter. Im Talmud heißt es, dass man in einer Stadt, in der es keine Schule gibt, nicht wohnen darf. Folglich konnte Arthur Ruppin 1911 selbst für die in elenden Verhältnissen lebenden osteuropäischen Juden im Unterschied zur christlichen Mehrheit sagen: »Bis in die ärmsten Schichten Osteuropas hinab steht die Notwendigkeit des Lernens und Wissens, wenigstens für die Söhne, so fest, dass es in Galizien Tausende von armen Handwerkern oder Händlern gibt, die ⅟₁₀ bis ⅙ ihres Wochenverdienstes (also bis zu einem Gulden von etwa sechs Gulden) für den Melamed ihrer Söhne (den Lehrer des Hebräischen und einiger Elementarkenntnisse) ausgeben. Sie würden lieber hungern, als dass sie ihre Kinder den Unterricht entbehren ließen.«[40]
Der Bildungswille bezog seine Kraft aus der Religion und der jahrhundertelangen Rechtlosigkeit. Jüdische Jünglinge lernten zu abstrahieren, zu fragen, nachzudenken. Sie schulten den Verstand am Umgang mit Büchern, im gemeinsamen Lesen und Auslegen und im kontroversen Debattieren der heiligen Schriften. So trieben sie geistige Gymnastik, so praktizierten sie ihre Religion und wurden im wörtlichen Sinne mündig. Zudem beherrschten Juden meistens zwei oder drei Sprachen mit ihren unterschiedlichen Grammatiken und Ausdrucksfinessen. Vielfach benutzten sie neben der hebräischen auch die lateinische Schrift. Derart geschulte junge Männer verfügten über eine gediegene, leicht ausbaufähige intellektuelle Basis für den Aufstieg kraft Bildung. Der in Dessau aufgewachsene Moses Mendelssohn konnte 1743, im Alter von 14, selbstverständlich lesen und schreiben. Er sprach Jiddisch, Hebräisch, Aramäisch und Deutsch. Im Herbst desselben Jahres zog er nach Berlin, musste als Jude noch Leibzoll entrichten, und der Wachposten vermerkte: »Heute passierten das Rosenthaler Tor sechs Ochsen, sieben Schweine, ein Jude.« Und warum wollte der schief gewachsene Jüngling unbedingt nach Berlin? »Lernen«, soll er dem Wächter geantwortet haben; fest steht, dass er seinem geliebten Lehrer Rabbi David Fränkel hinterherzog. Später sollte Mendelssohn als Seidenfabrikant wohlhabend, als Philosoph berühmt werden.[41]
Die Repräsentanten der jüdischen Gemeinden erkannten früh, wie wichtig systematischer Unterricht für die nächste Generation sein würde. Sie sorgten dafür, dass die jüdischen Kinder gutes Deutsch lernten und gründeten aufs Praktische gerichtete Schulen: 1778 die Freischule in Berlin, 1791 die Wilhelmschule in Breslau, 1798 die Israelitische Mädchenschule in Hamburg, 1799 die Franz-Schule in Dessau, 1801 die Industrieschule für israelitische Mädchen in Breslau und die Jacobsen-Schule in Seesen, 1804 das Philanthropin in Frankfurt am Main, 1805 die Talmud-Tora-Schule in Hamburg. Diese Initiativen verband ein Ziel: »die Verminderung des Elends und der Verachtung, worunter wir seufzen«.[42]
Wie anders verhielten sich die Geistlichen der christlichen Religion. Sie legten Wert auf das Auswendiglernen von Glaubenssätzen, hielten Diskussionen für Teufelszeug, vor dem sie die »Laien« bewahren müssten, und zeigten allenfalls ausnahmsweise Interesse an der systematischen Schulbildung ihrer Schäfchen. Eine christliche, zumeist bäuerliche Familie, in der nur einige ein wenig lesen und schreiben konnten, bedurfte zweier oder dreier Generationen und länger an elementarer Bildung, bis die ersten den Sprung in akademische Höhen schafften. Dann litten die eben Aufgestiegenen noch für einige Jahrzehnte an Unsicherheiten. Bis ins 20. Jahrhundert hinein warnten christliche Eltern ihre Kinder: »Lesen verdirbt die Augen!«
Im Gegensatz zum jüdischen Schulwesen mangelte es dem staatlichen noch lange an soliden materiellen und intellektuellen Grundlagen. Zwar hatte Friedrich Wilhelm I. 1717 die allgemeine Schulpflicht in Preußen eingeführt, doch blieb dem finanziell vernachlässigten Projekt der Erfolg bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts versagt. Überfüllte Klassen und unfähige Lehrer, die das Schulgeld von den Kindern einzogen, bestimmten das Bild. Ausgemusterte oder invalide Soldaten, Hausmeister, alt gewordene Kutscher und gescheiterte Handwerker ergriffen den »Beruf des Prüglers«, wie man sagte, und regierten mit Stockhieben, Ohrfeigen und Kopfnüssen. Der Unterricht solcher Schulmeister »kam auf dem Lande selten über das Buchstabieren hinaus«.[43]
Auf dem Ersten Allgemeinen Deutschen Lehrertag, abgehalten 1876 in Erfurt, forderte der Vorsitzende Julius Beeger zur umfassenden Anwendung der Prügelstrafe auf. Er nannte das Regulativpädagogik, um »1. Rohheit und Wildheit; 2. Arbeitsscheu und Genusssucht; 3. (der) Unbotmäßigkeit« der heranwachsenden Jugend und deren »Frühreife« Herr zu werden. Ein zeitgenössischer Kritiker kommentierte: »Dass die Prügelpädagogik zahlreiche Anhänger in Deutschland hat, wusste ich längst.« Aber erst in Erfurt hatte er zur Kenntnis nehmen müssen, »dass die Prügelpädagogen nahe daran sind, zur unumschränkten Herrschaft zu gelangen« und damit »das Volk nicht für die Freiheit, sondern für die Knechtschaft« erziehen.[44]
Viele Eltern und die noch höchst einflussreichen Geistlichen beider christlicher Konfessionen lehnten die gründliche Unterrichtung der Kinder ab; die Adeligen fürchteten, ihre Untertanen könnten infolge besserer Bildung aufsässig werden; die Bürgermeister widersetzten sich fortschrittlichen Schulideen »teils aus Armut, teils aus Geiz und rohem Sinn«. Der in Bildungsangelegenheiten nicht besonders große König Friedrich II. hielt es 1779 zwar für schön, wenn Preußen aus dem Ausland tüchtige Schulmeister anwerben könnte, »die nicht so teuer wären«, meinte jedoch einschränkend, auf dem platten Land reiche es aus, wenn die Kinder »ein bisschen lesen und schreiben« lernten – »wissen sie aber viel, so laufen sie in die Städte und wollen Secretairs und so was werden«.
Nachdem Friedrich die Bildung seiner Untertanen dem militärischen Machtstreben geopfert hatte, folgten in Preußen zu Beginn des 19. Jahrhunderts beachtliche schulpolitische Anstrengungen. Die Humboldt’schen Reformen erreichten nur die Universitäten und Gymnasien, der Ausbau der Volksschulen und die systematische Lehrerbildung kamen über Anfänge nicht hinaus und versanken seit 1840 unter dem christlich-romantischen König Friedrich Wilhelm IV. im reaktionären Sumpf. Für das Jahr 1870 bezeichnen folgende Indikatoren den preußisch-christlichen Bildungswillen: Von den 36 000 Volkschullehrerstellen waren 3000 unbesetzt, und 20 000 dieser Schulmeister wurden schlechter dotiert als Gerichtsdiener oder Bahnwärter. Die Klassenfrequenz war doppelt so hoch wie in der Schweiz: Sie betrug pro Lehrer mehr als 80 Schüler.
Erst 1872 setzte der Ausbau des Schulwesens langsam ein. Preußen verdreifachte den finanziellen Aufwand für Volksschulen, Lehrergehälter und Lehrerseminare. Es hatte mehr als 30 Jahre gedauert, bis die bildungspolitischen Hauptforderungen, die die Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 1848 gestellt hatten, langsam Wirklichkeit wurden: »Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht unter der Oberaufsicht des Staates und ist, abgesehen vom Religionsunterricht, der Beaufsichtigung der Geistlichen als solcher überhoben. Für den Unterricht in Volksschulen wird kein Schulgeld bezahlt.«[45]
Schließlich und endlich gab es um 1900 in fast jeder preußischen Kreisstadt ein Gymnasium. Aber greifbare Ergebnisse der spät einsetzenden staatlichen Initiative zum systematischen Ausbau der Schulen ließen noch einige Jahrzehnte auf sich warten. Im Jahr 1886 bezifferte der Reformpädagoge Eduard Sack den Anteil der über zehnjährigen Preußen, die niemals eine Schule von innen gesehen hatten, auf 14 Prozent. Von denen, die am Unterricht teilgenommen hatten, sagte er, dass von diesen »der größere Teil bloß sehr notdürftig lesen und schreiben kann«. Diejenigen, welche die Grundrechenarten und das Lesen und Schreiben im Sinne einfacher Elementarbildung wirklich beherrschten, schätzte er »auf höchstens 20 Prozent, für einige Provinzen schwerlich auf mehr denn fünf Prozent«. (Die Daten beruhten auf amtlichen Quellen, allerdings aus dem Jahr 1876.)[46]
Die Folgen des einerseits sehr verhaltenen christlichen und andererseits energisch vorwärtsdrängenden jüdischen Bildungsstrebens springen in den Schulstatistiken sofort ins Auge. Das erste Heft einer 1905 begonnenen Reihe von Veröffentlichungen des damals in Berlin gegründeten Bureaus für Statistik der Juden trägt den Titel »Der Anteil der Juden am Unterrichtswesen in Preußen«. Koautor der Broschüre war Arthur Ruppin, der in der zweiten, 1911 erschienenen Auflage seines Buches »Die Juden der Gegenwart« noch einige Nachträge lieferte.
Ruppin war 1876 in der Provinz Posen geboren worden, wuchs in Magdeburg auf, studierte in Halle und Berlin Rechtswissenschaft und promovierte. Wie berichtet, verbrachte er sein Referendariat in Klötze, anschließend ließ er sich als Rechtsanwalt in Magdeburg nieder. 1904 gründete er den Verband für Statistik der Juden und erarbeitete statistische Studien zur demographischen und sozialen Lage der Juden. 1908 übernahm er die Leitung des Palästina-Amts in Jaffa. Die Gründung der jüdischen Stadt Tel Aviv geht auf seine Initiative zurück. Mit der neuen Siedlung wurde dort die erste hebräischsprachige höhere Schule der Welt errichtet, das Herzl-Gymnasium. 1926 baute Ruppin die Abteilung Soziologie der im Vorjahr gegründeten Hebräischen Universität Jerusalem auf, dann verhalf er jüdischen Deutschen zur Flucht nach Palästina. Er starb 1943.
Folgt man der von Ruppin zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgewerteten preußischen Schul- und Universitätsstatistik, ergibt sich für die unterschiedlichen Bildungsgeschwindigkeiten von Christen und Juden ein deutliches Bild. Im Jahr 1869 stammten 14,8 Prozent der Berliner Gymnasiasten aus jüdischen Familien, während sich vier Prozent der Einwohner zur mosaischen Religion bekannten. 1886 brachten 46,5 Prozent der jüdischen Schüler in Preußen einen höheren als den Volksschulabschluss nach Hause, bis 1901 stieg der Anteil auf 56,3 Prozent. Im selben Zeitraum kroch das christliche Streben nach höherer Bildung von 6,3 auf 7,3 Prozent. Gemessen an christlichen Schulkindern erreichten die jüdischen rund acht Mal so häufig mittlere und höhere Schulabschlüsse. Nichtjüdische Reformpädagogen wie Friedrich Dittes rühmten die »hervorragende Begabung und das lebhafte Interesse für die intellektuelle Arbeit« der Israeliten und deren »sehr eifriges« Engagement in allen Schulangelegenheiten: »Die Eltern halten ihre Kinder nachdrücklich zum Lernen an und bekümmern sich sorgfältig um deren Fortschritte; ihre Kinder stehen nicht selten an Wissbegierde und zähem Fleiße ihren christlichen Schulgenossen voran.«[47]
Aus den Tabellen sticht auch hervor, wie sehr jüdische Eltern bemüht waren, die Mädchen auf höhere Töchterschulen zu schicken. Gleichfalls an den Bevölkerungsanteilen gemessen besuchten im Jahr 1901 in Berlin 11,5-mal so viele jüdische Mädchen eine weiterführende Schule wie christliche. Erstere benahmen sich in den entsprechenden Altersstufen überdurchschnittlich oft unaufmerksam, »frech und frühreif«, das belegen die mäßigen Noten für »Fleiß« und »Betragen«. Diese Schülerinnen interessierten sich quietschfidel für »gesellschaftliche Zerstreuungen«, bemängelten ihre Lehrer. Aber: Sie lernten und vollbrachten insgesamt vortreffliche Leistungen.
Die Angaben zum so unterschiedlich ausgeprägten Bildungswillen von Christen und Juden referieren den Durchschnitt. In einzelnen Berliner Stadtteilen, in den Provinzen Ostpreußen, Posen, Schlesien und (preußisch) Sachsen lagen die Quoten sehr viel weiter auseinander, ebenso in altsprachlichen Gymnasien und an den Hochschulen. Im Jahr 1910