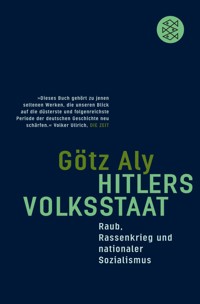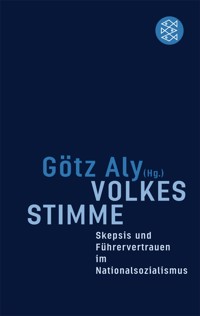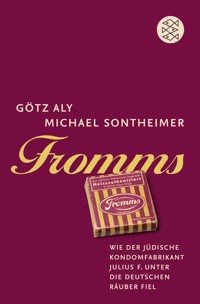9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Götz Aly gehörte 1968 zu den aktiven Kämpfern in Berlin. Als Zeitzeuge und Historiker zeigt er, dass die 68er ihren Vätern näher standen, als es ihnen heute lieb ist. In der "Bewegung" sieht er einen Spätausläufer des Totalitarismus mit einer gewissen Nähe zum Nationalsozialismus. Alys Rückblick ist ein irritierter und deshalb wichtig, weil er weit entfernt ist von Renegatentum und nachträglicher Beschönigung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Götz Aly
Unser Kampf
1968 - ein irritierter Blick zurück
Sachbuch
Fischer e-books
Durchgesehene und erweiterte Ausgabe
Die Achtundsechziger bekämpften den Staat und das Kapital, genannt »Das herrschende System«. Die Rebellen- und Gendarmspiele von 1968 tobten mitten im Luxus des Wirtschaftswunderlands. Die Angegriffenen reagierten konfus, aber weit vernünftiger, als die Legende behauptet. Anders als gängige Veteranenliteratur zum Thema ’68 untersucht Götz Aly, wie die Gegenseite damals dachte.
Er benutzt die Akten des Bundeskanzleramtes, des Innenministeriums, des Verfassungsschutzes und die Nachlässe aus der Emigration zurückgekehrter Professoren wie Richard Löwenthal und Ernst Fraenkel. Er prüft, was Zeitgenossen wie Peter Wapnewski, Josef Ratzinger oder Joachim Fest zu der plötzlichen Unruhe in der Jugend zu sagen hatten. Er zeigt, was die damaligen Maoisten über die Verbrechen Mao Tse-tungs hätten wissen können und wie sie vor der geschichtlichen Last des Vater-landes in die Verherrlichung ferner Guerilleros flohen.
Götz Aly schreibt auch aus eigener Erfahrung. Er hörte zu den Achtundsechzigern und findet heute: »Es ist schwierig, den eigenen Töchtern und Söhnen zu erklären, was einen damals trieb.« Anhand der Quellen analysiert er die »Bewegung« von 1968 als speziell deutschen Spätausläufer des totalitären 20. Jahrhunderts und kommt zu dem Schluss: Die revoltierenden Kinder der Dreiunddreißiger-Generation waren ihren Eltern auf elende Weise ähnlich.
Götz Aly, 1947 in Heidelberg geboren, besuchte im schwäbischen Leonberg und in München die Schule. 1967/68 absolvierte er die Deutsche Journalistenschule (München). Von Dezember 1968 bis Ende 1971 studierte er in Berlin Politische Wissenschaft und Geschichte und beteiligte sich aktiv an der Studentenrevolte. Er gehörte 1971 der Redaktion der Zeitung Hochschulkampf an, 1972–1973 der Roten Hilfe (Westberlin), arbeitete von 1974 bis 1976 im Jugendamt Berlin-Spandau, später zweimal je zwei Jahre bei der taz. Von 1997 bis 2001 war er Chef der Meinungsseite bei der Berliner Zeitung. Dazwischen und danach schrieb er Bücher zum Nationalsozialismus.
Unsere Adressen im Internet: www.fischerverlage.de
www.hochschule.fischerverlage.de
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Das vierzigjährige Jubiläum der 68er-Revolte erforderte eine Streitschrift. Prompt reagierten viele der gealterten Weltverbesserer gereizt. Es reichten ein paar spitze Bemerkungen über längst vergangenen Irrungen und Wirrungen, versehen mit einem nostalgischen Titel, »Unser Kampf« eben, schon gerieten die Antiautoritären von vorgestern aus dem Häuschen. Aufgescheucht riefen sie: Unverschämtheit! Widerwärtig! Das geht zu weit!
In Grüppchen untergehakt rückten die Kampfgefährtinnen und Kampfgefährten zu meinen etwa 40 Lesungen an. Humorfrei und stahlgrau nahmen sie Platz und legten los: »Renegat! Konvertit! Geschäftemacher! Nein, lesen werden wir das Machwerk nicht!« Anwürfe wie »Verräter« und »Denunziant« wurden engagiert von Hocherregten vorgetragen, die gleichzeitig den »ausschließlich aufklärerischen Charakter unserer Bewegung« und ihre eigene Unschuld beteuerten. Wie sollte ich aus dieser reinen Welt der Menschlichkeit und allseitigen Emanzipation irgendjemanden denunzieren oder verraten können?
Meiner Buchvorstellung im wendländischen Hitzacker ging ein Boykottaufruf voraus. Verfasst hatten ihn einige der im Landkreis Lüchow-Dannenberg geballt vertretenen Alt-Alternativen. Sie kämpfen für gerechte Ressourcenverteilung, gegen Atomstrom und belegen gut und gern 150 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Immerhin erschienen etwa 30 der Vorgewarnten. Wut und Empörung hatten sie unter ihren Reetdächern hervorgetrieben. Gegen Ende des Abends trat eine straffe Seniorin an mich heran (»Ich bin die Edelgard«) und blickte vorwurfsvoll. Kommentarlos überreichte sie mir ihr Büchlein »Zusammen mehr erreichen – Kleiner Ratgeber für Bezugsgruppen«. Das Werk beginnt mit einem frischfröhlichen »Hallo allerseits!« und endet auf der Rückseite mit dem Rüstspruch »Die Chemie muss stimmen«. Klingt das nicht nach Volksgemeinschaft? Unmöglich, so etwas gibt es in Edelgards feindesreiner Bezugsgruppenheimat nicht.
Im Verlauf solcher Begegnungen setzten meine Kontrahenten in der Regel vier Abwehrargumente ein: 1. Wer nicht dabei war, kann über diese Zeit nicht urteilen. 2. Wir wollten das Neue. 3. Nicht alles war schlecht. 4. Wir lassen uns unsere Biographie nicht rauben. So ähnlich hatten nach 1945 schon die Eltern der 68er geredet und nach 1989 nicht wenige DDRler. Nach den ersten Zusammenstößen mit meinen bekennenden NichtleserInnen war das Motto für die weiteren Veranstaltungen gefunden: Gegen den Muff von 40 Jahren.
Nicht alle, aber viele der Oldies erwiesen sich in den Diskussionsrunden als selbstgewisse Meister der Erinnerungsflucht und Schönfärberei. Da wurde ernsthaft behauptet, die seit Februar 1968 massenhaft skandierte Parole »USA-SA-SS«, die den Drang der Nazi-Kinder zur Schuldverschiebung so sinnfällig dokumentiert, sei aus Frankreich importiert worden. Wie die Parole auf Französisch geklungen haben soll, bleibt das Geheimnis der Geschichtenerzähler. Von solchen Details abgesehen beschränkten sich die einst aktiven 68er auf zwei Ausreden: 1. In Frankfurt war alles ganz anders als in Westberlin, in Tübingen ohnehin. 2. Ich war ein paar Jahre zu jung (wahlweise zu alt), um die »schlimmsten Auswüchse« mitzumachen. Immerhin gab es solche, nur scheinen sie aus den Gedächtnissen entschwunden.
Vergessen gemacht wird zum Beispiel von den Grünen, dass sich zum Zeitpunkt ihrer Gründung mindestens die Hälfte des Führungspersonals aus revolutionären Sponti-Vereinigungen und doktrinär-marxistischen Gruppen rekrutierte. Stattdessen sind sich dieselben Leute – ob sie nun Antje Vollmer, Joschka Fischer, Jürgen Trittin oder Claudia Roth heißen – einig, dass jene Gruppen nur als bedauerliche Randerscheinung des allgemeinen »Aufbruchs« anzusehen seien. Man muss solche Rätsel nicht lösen; tatsächlich ist der spätere Hang Zehntausender westdeutscher Studenten zum sowjetunionfreundlichen MSB Spartakus, zum Stamokap der Jungsozialisten oder zur soundsovielten trotzkistischen Internationale lebensgeschichtlich nicht günstiger gewesen.
Die linken Buchhandlungen, die mich mit den Büchern zum Nationalsozialismus gerne eingeladen hatten, wollten ihrem Publikum den Autor dieses für manche unaussprechlichen oder »saugefährlichen« (Jutta Ditfurth) Buches nicht zumuten – bis auf eine Ausnahme: die Buchhandlung Roter Stern in Marburg. Viele linke Buchhändler beschimpften die Vertreter des S. Fischer Verlags und warnten ihre Stammkunden und Treuekartenbesitzerinnen vor dem Kauf. Bei diesen kamen seelenvolle Titel wie »Rudi und Ulrike« oder »Mein ’68« besser an, gerne genommen wurde das Zeitzeugenwerk »Vom Duft der Revolte«, die Sehschwachen schenkten einander den Bildband »Wir waren dabei«, versehen mit »ganz lieben Grüßen«. Die Leitung der Universität Göttingen lehnte im Sommersemester 2008 den studentischen Antrag ab, mich zum Thema »1968« einzuladen. Sie versagte die sonst übliche kleine finanzielle Förderung solcher Veranstaltungen, versehen mit dem ausdrücklichen Hinweis, das Buch »Unser Kampf« sei für die akademische Jugend ungeeignet. Sie hat es trotzdem interessiert gelesen.
Etwas einsichtigere 68er arbeiten weniger konfrontativ, sie bevorzugen die leisen Legenden, in erster Linie die Behauptung, sie hätten – bei aller notwendigen Kritik und Selbstkritik im Detail – wesentliche Reformprozesse in Gang gesetzt. Manche vertreten die Meinung, damals wäre die Bundesrepublik Deutschland zum zweiten Mal konstituiert, ihr erst mit der Revolte ein freiheitlicher Geist eingehaucht worden. [1]
Darin spiegelt sich maßlose Selbstüberschätzung. Tatsächlich setzten die wichtigsten Reformen in der Bundesrepublik in den frühen 1960er-Jahren ein. Träger dieser Mühen waren viele der heute 75- bis 85-Jährigen, die mit Remigranten, Antifaschisten und auch mit geläuterten Nazis gemeinsame Sache machten. Das von Fritz Bauer, Hans Bürger-Prinz, Hans Giese und Herbert Jäger herausgegebene Manifest »Sexualität und Verbrechen – Beiträge zur Strafrechtsreform« erschien 1963 und brachte das Thema in den Bundestag. Ralf Dahrendorf redete mit seinem Buch »Gesellschaft und Demokratie in Deutschland« 1965 einer neuen Debattenkultur das Wort. Mit zwei Koitusszenen stellte der Film »Das Schweigen« von Ingmar Bergman den gültigen Sittenkodex massiv in Frage. Die Bundesprüfstelle ließ den Film im Namen der künstlerischen Freiheit 1964 ungekürzt passieren, elf Millionen Deutsche gingen hin. Zum fröhlicheren Liebesleben ermunterte nicht Rainer Langhans, sondern der 1928 geborene Journalist und Filmemacher Oswalt Kolle. Sein Film »Wunder der Liebe« enthielt schlichte Hinweise, wie sich die zumeist mit einer milchigen Deckenlampe beleuchteten, ungeheizten und sehr kärglich eingerichteten Schlafzimmer gemütlicher machen ließen. Den unmittelbar Beteiligten, namentlich den Männern, legte er nahe, wie sich einseitige Glücksminuten zu beidseitigen glücklichen Stunden erweitern ließen und regte an, Dies oder Das experimentell herauszufinden. Angesichts der von 68ern geprägten Männerparole »Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment« darf Oswalt Kolle vorbehaltlos zu den aufgeklärten Humanisten der frühen Bundesrepublik gezählt werden.
Ähnliche Übergänge fanden in der Parteipolitik statt. Den starken Einfluss alter Nazis in der FDP, die sich in den 1950er Jahren noch einen so bezeichneten Gauleiterflügel leistete, überwanden die Nachwuchskräfte der Partei. Zu den damals jugendlichen Helden des Umsturzes zählen Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher oder Liselotte Funke. Parallel dazu bildete sich seit 1961 unter den bundesdeutschen Wahlberechtigten Prozent für Prozent jene Mehrheit heraus, die sich Willy Brandt als Bundeskanzler vorstellen konnte – einen Mann also, den Konservative als »Vaterlandsverräter« schmähten. Diese rasanten Veränderungen in der deutschen Gesellschaft bildeten die Grundlage für 1968. Die Revoltierenden wurden zu Nutznießern, nicht zu Schöpfern des reformerischen Zeitgeistes. Folglich konstatierte der Kultursoziologe Wolfgang Eßbach, der selbst dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund angehört hatte, im Jahr 2006: »Man wird sagen müssen, dass viele der reformerisch Aktiven, die um 1930 geboren wurden und die um 1960 die Bundesrepublik neu zu gestalten begonnen hatten, in der historischen Erinnerung heute von den Achtundsechzigern um ihren Ruhm betrogen worden sind.« Eßbach weist darauf hin, »dass es nicht in erster Linie Altnazis waren, mit denen die Achtundsechziger zu kämpfen hatten«, sondern vor allem »junge, reformfreudige und konfliktfreudige Ordinarien mit neuen Ideen«. [2]
Viele davon werden auf den folgenden Seiten gewürdigt, die Reihe reicht von Wilhelm Weischedel bis Christian Graf von Krockow. Die Galerie lässt sich leicht verlängern. So wandte sich der ursprünglich sympathisierende Philosoph Odo Marquard 1967 von der Neuen Linken ab, weil ihm die Teach-ins »zu viel Ähnlichkeit mit NS-Schulungsabenden« aufwiesen, an denen er als Jugendlicher teilgenommen hatte. Aus anderen Gründen reagierte der Holocaust-Überlebende und -Historiker Joseph Wulf allergisch. Er bemerkte in Berlin rasch, wie sich die neuen linken Weltanschauungskämpfer von der bis dahin einigermaßen selbstverständlichen Solidarität mit Israel verabschiedeten und Partei für palästinensische GuerillaGruppen ergriffen. In seinem Fall stellt sich die bange Frage: Hätte sich dieser Mann, der dem Holocaust entkommen und dann nach Deutschland zurückgekehrt war, 1974 das Leben genommen, wenn wir 68er seine Schriften weiterhin gelesen hätten und nicht 1967 in die realitätsfreie »Faschismus-Theorie« ausgewichen wären? Dieselbe Skepsis gegenüber der neuen linken Bewegung entwickelte Jean Améry. Hannah Arendt hielt einem weltrevolutionär erregten jungen Deutschen Ende 1967 trocken entgegen: »Keine Frage, es geht uns an, wenn in Persien, Vietnam und Brasilien ›unwürdige Zustände‹ herrschen, aber es liegt wahrhaftig nicht an uns. Das, scheint mir, ist eine Art umgekehrter Größenwahnsinn. Probieren Sie einmal, Politik in Persien zu machen, und Sie werden rasch davon geheilt sein. […] Worauf es politisch ankommt, ist limitiert denken lernen.« [3]Mit Ausnahme von Herbert Marcuse reagierten praktisch alle Emigranten, die nach 1933 Deutschland hatten verlassen müssen, ähnlich: Zunächst freuten sie sich über die Unruhe der Jugend, aber schon nach wenigen Monaten erschraken sie vor dem deutschen Furor, der in den 68ern steckte, sich bald wild austobte und den sie nur allzu gut kannten.
Der Basso continuo der jüngeren Nationalgeschichte spielte in der Protestbewegung von 1968 weiter. Er verlieh ihr den unangenehmen Grundton, trotz aller hübschen Varianten in den Spitzentönen. Der Spielfilm »Alma Mater« visualisierte dieses sehr deutsche Problem schon 1969. Er wurde von Rolf Hädrich an der Freien Universität Berlin für den Norddeutschen Rundfunk gedreht. Eindringlich dokumentiert er die Revolte an den originalen Schauplätzen, gelegentlich von realen Störaktionen gegen die Dreharbeiten behindert, die sich, da sie mitgefilmt wurden, bruchlos in das Spielgeschehen fügen. Das Drehbuch hatte Dieter Meichsner geschrieben. Er und Hädrich gehörten zur studentischen Gründergeneration der FU. Den Plot entwickelten sie anhand von Erlebnissen, Gesprächen, Beobachtungen und Eindrücken während des Januar-Streiks 1969, gedreht wurde im Sommersemester. Auf diese Weise entstand ein wirklichkeitsgesättigtes Bild der damaligen Krisen und Aufgeregtheiten. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der liberal gesinnte Remigrant, Geschichtsprofessor Freudenberg, der schließlich an den neuen Universitätsverhältnissen verzweifelt und Deutschland zum zweiten Mal verlässt. In eingespielten O-Tönen treibt der schwäbelnde SDS-Funktionär Tilman Fichter immer wieder zum revolutionären »Zerschlagen«. Die Filmfigur Freudenberg ist wirklichkeitsnah aus den Erzählungen und Empfindungen der damaligen, aus dem Exil zurückgekehrten FU-Professoren Ernst Eduard Hirsch, Richard Löwenthal und Ernst Fraenkel zusammengesetzt. Die beiden Letztgenannten kommen in den folgenden Kapiteln vielfach zu Wort. Ausgerechnet ein Spielfilm ist das vielleicht eindringlichste Dokument zum Lauf der Revolte im Jahr 1969.
Demgegenüber erscheint die heute geschriebene Erinnerungsliteratur schwach. Der Grund dafür liegt im selbstgnädigen Verdrängen, in der Selbstliebe. Nehmen wir das Buch »Rebellion und Wahn« (2008) als Exempel. Es bietet sich an, weil der Verfasser, Peter Schneider, mir unentwegt vorwirft, das Konkurrenzprodukt »Unser Kampf« dokumentiere »Selbsthass«. Was also vermag Selbstliebe? Auf Seite 334 streift Schneider beispielsweise jene Konferenz der Westberliner Großrevolutionäre, die sich im Dezember 1969 mit der künftigen Strategie befasste. Das Treffen ist wichtig, weil es die elenden marxistisch-leninistischen Kadergruppen hervorbrachte und den rebellierenden Studenten die Reste von demokratischem Veränderungswillen austrieb. Schneider gehörte zum engeren Zirkel von etwa 20 Leuten und redete gleich zweimal. Heute fasst er seine damals vorgetragenen Gedanken sehr kurz zusammen: »Wer es mit der Revolution ernst meine«, so habe er sich geäußert, »müsse in die Betriebe gehen und die Arbeiterklasse mobilisieren.« Bei mir als Jüngerem, der ich damals gespannt auf die Ergebnisse wartete, kam Anderes an. Was, das lässt sich heute noch hören. Wegen ihrer überragenden Bedeutung für die Zukunft (der fortschrittlichen Teile) der Menschheit verewigten die Vordenker des künftigen Doktrinarismus ihre Reden auf Tonband.
Demnach formulierte Genosse Peter Schneider die Aufgabe, »die Klassenkämpfe in Deutschland in Bewegung zu bringen«, die »Unterdrücktesten in die Strategie der Kampfbereitesten aufzunehmen« und die »revolutionäre Avantgarde« zu bilden. Das bedeute: »Nur die zentralisierte Organisation nach marxistisch-leninistischem Vorbild wird überhaupt in der Lage sein, so etwas wie Spontaneität hervorzubringen. […] Ein Kader ist nur einer, der sich in den Kämpfen der Massen als Führer qualifiziert, das heißt, es ist viel zu wenig, nur davon zu sprechen, dass die Studenten in den Betrieb gehen, dort sinnliche Erfahrungen sammeln, und dann gehen sie wieder heraus. […] Es ist unbedingt nötig, dass die Studenten Anleitungsfunktionen in den Aktionen, in den betrieblichen Konflikten übernehmen können, und ich bin der Meinung, dass wir in Zukunft niemanden als Kader in einer revolutionären Organisation dulden dürfen, der diese Bedingungen nicht erfüllt. […] Ich sage, dass in der ersten Phase des Aufbaus der Organisation die Organisation von oben nach unten aufgebaut werden muss, und das Prinzip des Zentralismus überwiegt und dass diese Phase in Deutschland sehr lange sein wird, dass diese Phase dazu dient, die Verankerung der zentralistischen marxistisch-leninistischen Organisation in den Massen vorzubereiten.« [4]
Folgt man Schneiders Text von 2008, dann wurde während der Konferenz die Bildung der späteren doktrinären K-Gruppen von »paranoiden«, ihm »nie recht geheueren« Leuten vorangetrieben, einer davon mit einem »Totenkopfschädel« ausgestattet. Schneider nennt sie sämtlich mit Namen. Er selbst wollte nach seinem 38 Jahre später abgegebenen Bericht lediglich den deutschen Arbeitern »zum richtigen Bewusstsein verhelfen«; angeblich fragte er sich damals sofort: »Aber musste ich deswegen gleich Mitglied einer Kaderorganisation werden?« [5]Insgesamt beruht das Buch, wie der Verlag behauptet, auf einem »Schatz«, nämlich Schneiders »Tagebuch«, das er angeblich »als einer von ganz wenigen« führte. Es ist höchste Zeit, ’68 anhand möglichst vielfältiger Quellen zu dokumentieren, anstatt sich auf die Selbstbespiegelung sogenannter Zeitzeugen zu verlassen. Anregungen finden sich in diesem Buch.
Eine Generation nimmt Reißaus
Natürlich meldeten sich brieflich und öffentlich auch ehemalige Mitstreiter zu Wort, die sich deutlich an die peinlichen Momente der wilden Jahre erinnerten. Dazu gehört die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff. Sie machte 1972 in Stuttgart Abitur, geriet als Gymnasiastin ins Milieu des antiautoritären Aufbruchs und berichtet nur ungern darüber: »Meine Erinnerung neigt dazu, die tote Zeit vom Unschönen zu reinigen.« Obschon sie nie zur harten Truppe zählte, lässt sie den »verschobenen Antisemitismus« Revue passieren, »die Rohheit, das Autoritäre im vorgeblich Antiautoritären, die Realitätsverleugnung, den abenteuerlichen Narzissmus«. Im Rückblick steht ihr vor Augen, wie sich ihre Generation »das versammelte deutsche Unglück in einem gigantischen Redestrom von der Seele« wälzte: Wichtig, wichtig, weltumspannend, »schwatzschwatz, meistens ernst, selten witzig«.
Sibylle Lewitscharoff beschreibt, wie »um 1970« revolutionäre Kader aus Frankfurt in die schwäbische Provinz ausschwärmten, um Schüler, gerne auch Schülerinnen für die Revolution zu rekrutieren: »Einer sah aus, als wäre er einem Anarchistenzirkel zu Dostojewskis Zeiten entsprungen und hätte sich seither nicht mehr gewaschen, ein dickliches, schwer bebartetes Männchen mit rollenden Glühaugen. Daneben ein total verlederter Politmann, Briefträger von Beruf, Kopf wie ein abgeschlecktes Ei, die Schreckensassoziation drängte sich auch deshalb auf, weil er vor jedem Satz mit der Zungenspitze prüfend in die Mundwinkel fuhr. Nicht zu vergessen die kalten Kommissare, technoide Büromänner mit Waffenkenntnissen, die in der umliegenden Stuttgarter Provinz mit Entjungferungsauftrag unterwegs waren, um der Bewegung neues Material (ehrlich, es hieß so) zuzuführen. Und dann gab es noch das Arbeiterwunderkind aus Feuerbach. Mit erhobenem Zeigefinger und sanfter Stimme lehrte es wie Jesus im Tempel.« [6]
Ein ganz anderer, wesentlich älterer unter den Ehemaligen, Peter Furth, argumentiert ähnlich. Er lernte einst bei Adorno und gab die Zeitschrift Das Argument mit heraus. Heute gelangt er zu dem Schluss, »dass der Achtundsechziger-Bewegung etwas Totalitäres anhaftete«. Er beklagt die destruktiven Folgen der Revolte, das Anmaßende und den Konformismus im Denken der Linken. Vor allem aber bedauert er, dass er seinen reformerisch gesinnten Schwiegervater, der als Jude und Sozialdemokrat in Buchenwald gesessen hatte, 1968 als »deutschnationalen Bonzen« beschimpfte und nicht merkte, dass er einen der wenigen wirklichen Republikaner vor sich hatte. [7]
Den ehemaligen SDS-Vorsitzenden Reimut Reiche zitiere ich auf Seite 50 mit einem fragwürdigen Textchen zur »Sexuellen Revolution«. Dagegen verdient sein selbstkritischer, von mir zunächst übersehener Rückblick von 1988 unbedingt Beachtung. Er passt gedanklich zu den beiden Schlusskapiteln dieses Buches »Vergangenheitsfurcht und ›Judenknacks‹« und »Dreiunddreißiger und Achtundsechziger«. Vor mehr als 20 Jahren schrieb Reiche über die unbewussten Phänomene jener Jahre und begann mit dem Hinweis, dass das 1967 von Alexander und Margarete Mitscherlich veröffentlichte Buch »Die Unfähigkeit zu trauern« für die revoltierenden jungen Leute von damals »kein Thema« gewesen sei. Aus einem einfachen Grund: Sie schickten sich gerade an, »selbst Teil dieses Themas zu werden«. Reiche analysiert die Banalisierung des Nationalsozialismus zum allgegenwärtigen und angeblich akuten Faschismus als – geschichtlich außengesteuerten – Versuch, das individuell Bedrohliche an der deutschen Vergangenheit zu »entkörpern«. In der Suche nach dem »revolutionären Subjekt« bemerkt er den Wunsch: »Die Volksmassen, und damit die Masse unserer Eltern, seien im Innersten und in Wahrheit ›gut‹, und das nationalsozialistische ›Böse‹ sei ihnen äußerlich.« Anschließend führt er Beispiele zum »gewalttätigen Rigorismus« an und fragt: Warum mussten die 68er alles, was ihnen falsch schien, »zerschlagen«? Warum galten ihnen Trennungsängste von Kindern als Teil eines »falschen Bewusstseins«? Warum ließen sich die Mitglieder der Kommune 1 auf dem berühmten Foto nackt abbilden? Warum ausgerechnet mit erhobenen Händen gegen die Wand gestellt, den Rücken zum Kameraschuss gewandt, daneben ein kleines, nacktes Kind?
Schließlich zitiert Reiche die 1969 vom »Zentralrat der sozialistischen Kinderläden« in Westberlin herausgegebene Schrift, in der die Arbeit von Anna Freud und Sophie Dann über sechs Kinder abgedruckt ist, die im KZ Theresienstadt im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten von ihren Eltern getrennt wurden und überlebten. Die Männer und Frauen vom Zentralrat denunzierten die Autorinnen des Berichts als »bürgerlich-affirmative Wissenschaftler«, betrachteten die Lebensjahre, die jene Kinder im KZ hatten zubringen müssen, als »Versuch einer kollektiven Erziehung«, und fragten: »Ist das kollektive Verhalten der sechs Kinder eine Bereicherung der menschlichen Beziehungen?« Es folgte, man glaubt es kaum, ein glattes Ja.
Während Freud und Dann die schweren Traumata, die psychischen und physischen Entwicklungsstörungen der Kinder penibel beobachteten und dokumentierten, betrachteten die im Zentralrat organisierten jungen Deutschen Theresienstadt als Experimentierfeld:
»Die Gruppe der KZ-Kinder hatte dem Einzelnen geholfen, seine individuellen Fähigkeiten auszubilden und auszuleben. Einschränkungen, die daraus für die ganze Gruppe resultierten, wurden gern hingenommen. […] Autoritätsstrukturen, wie wir sie täglich unter Kindern beobachten können, konnten sich nicht entwickeln. […] Die Kinder standen automatisch füreinander ein, wenn sie sich bedroht oder ungerecht bestraft fühlten. Für die ihnen feindliche Umwelt im Ghetto [Theresienstadt] waren sie besser gerüstet als ihre erwachsenen Mitgefangenen: Sie entwickelten spontan Formen von Solidarität, was bei der Mehrzahl der dort Gefangenen erst – wenn überhaupt – aufgrund schmerzlicher Erfahrungen und unter dem Druck der Verhältnisse möglich war.« [8]
Wer sich die Mühe macht und die Selbstüberwindung aufbringt, solche Texte heute nachzulesen, wird aufhören, sich selbstzufrieden an ’68 zu erinnern.
Leute, die abwegige Texte schreiben, gibt es überall. Das Problem liegt woanders: Dieses Heftchen des Kinderladen-Zentralrats wurde vor der Mensa der Freien Universität und während zig politischer Versammlungen in großen Mengen verkauft. Keiner der Käufer, Neugierigen und oberkritischen Neuerer widersprach dem Inhalt. In dem berühmten, vielfach neu aufgelegten Rowohlt-Bändchen »Kinderläden. Revolution der Erziehung oder Erziehung zur Revolution?« (1971) erhielt der ominöse Zentralrat ein Ehrenplätzchen, und das zitierte Heft wurde in die sehr kurze, sehr merkwürdige Liste der empfohlenen Literatur aufgenommen. Die redaktionelle Verantwortung für die rororo-aktuell-Reihe trug der spätere SPD-Bundestagsabgeordnete Freimut Duve.
Derartige, nicht zufällige Fehlleistungen und Nicht-Reaktionen dokumentieren hinreichend, dass zwischen den deutschen Achtundsechzigern und Hitlers jungen Leuten von 1933, den Dreiunddreißigern, historische und familiengeschichtliche Bande bestanden. Sozialisationswissenschaftlich betrachtet erscheint die Feststellung banal. Die Kontinuitäten mussten bestehen. Die einen waren die Eltern der anderen. Diese 1933 noch recht jungen künftigen Eltern begeisterten sich überdurchschnittlich stark für den Nationalsozialismus. Sie befanden sich in einer für radikale Ideen günstigen Lebensphase, wurden vom NS-Staat besonders umworben, erlebten ihren ersten beruflichen Aufstieg in dieser Zeit und bildeten ihre Freundeskreise. Diejenigen Eltern, die 1933 zwischen 15 und 20 Jahre alt waren, konnten nach 1945 nur schwer auf vornazistische Werte und Maßstäbe zurückgreifen. Sie standen vor dem moralischen Nichts. Zudem waren sie während der letzten beiden Kriegsjahre schwer traumatisiert worden. Es ist nur naheliegend, dass weit überdurchschnittlich viele Kinder dieser Generation – vermittelt über ihre nächsten Angehörigen, Lehrer und Vorbilder – einiges vom alten Gift abbekommen und später in der Revolte ausagieren mussten. Die Revolte dieser Kinder geriet nach einer kurzen freiheitlichen Anfangsphase rasch in den Bann des alten Freund-Feind-Denkens, das im Kalten Krieg – einer unmittelbaren Folge der deutschen Vernichtungsfeldzüge – weitertobte und die Geister der Studentenschaft in den Jahren 1967 bis etwa 1977 maßgeblich beherrschte. Darin liegt kein Vorwurf, keine Schuld – aber auch kein Verdienst der 68er. Es geht um eine historische Tatsache.
Viele meiner Zuhörer reagierten unwillig, sobald ich in meinen Lesungen versuchte, ihnen die kollektivbiographischen Zusammenhänge zu erklären.
»Nein, alles, was Recht ist«, wandte eine 60-jährige Zuhörerin ein, »wir wollten das Gute! Der Nationalsozialismus war das Böse.«
»Wahrscheinlich«, fragte ich zurück, »sind wir uns einig, dass die deutsche Gesellschaft noch Jahrzehnte lang von den Folgen des Nationalsozialismus, des Krieges und der deutschen Verbrechen bestimmt wurde?«
»Ja, natürlich!«
»Aber woher nehmen Sie dann die Kraft, die Sicherheit, dass ausgerechnet Ihr Lebensentwurf davon frei gewesen sein soll?«
Schweigen.
Peter Schneider berichtet in seinem Buch »Rebellion und Wahn«, in welcher Weise sich Rudi Dutschke während der Studentenrevolte zum Nationalsozialismus äußerte. Auf die Frage seines SDS-Genossen Tilman Fichter, ob es nicht an der Zeit sei, statt sich immer nur über die imperialistische Gewalt in Afrika und Vietnam zu erregen, »etwas über den Judenmord zu machen«, erwiderte Dutschke nach einigem Zögern: »Wenn wir das anfangen, verlieren wir unsere ganze Kraft. Eine solche Kampagne ist von unserer Generation nicht zu verkraften, aus dieser Geschichte kommen wir nicht mehr heraus. Man kann nicht gleichzeitig den Judenmord aufarbeiten und die Revolution machen. Wir müssen erst einmal etwas Positives gegen diese Vergangenheit setzen.« [9]
Rudi Dutschke und mit ihm die 68er flüchteten vor der deutschen Geschichte. Wie sich das praktisch auswirkte, beschreibt Reinhard Strecker, der seit Mitte der 1950er Jahre die Aufklärung über die deutschen Verbrechen vorantrieb und 1960 Bundesreferent des SDS für Fragen der NS-Vergangenheit wurde. Im selben Jahr veranstalteten SDS-Mitglieder in der Berliner Kongresshalle eine Ausstellung zur Judenverfolgung. All das endete schlagartig, als Rudi Dutschke, Bernd Rabehl und Christian Semler 1965 starken Einfluss im SDS gewannen. Fortan »galt die konkrete Aufarbeitung der NS-Zeit als belanglos«. Strecker bekam »von diesen Leuten« niemals mehr Geld für seine Projekte: »Den Antiautoritären war überdies am Spektakel gelegen«, resümiert er heute: »Die NS-Zeit war halt nichts, das man eben mal spontan runterziehen konnte, um auf den Putz zu hauen. Jedenfalls gerieten die Opfer, auch die Fürsorgepflicht, jetzt völlig aus dem Blick, und alles trat hinter der Idee einer Gesamtrevolution zurück.« [10]Warum Dutschke oder Rabehl sich nicht mehr für die Nazivergangenheit interessierten, kann offen bleiben. Aber warum wurden ihre Ignoranz und Gleichgültigkeit plötzlich unter den jungen Leuten mehrheitsfähig? Ich erkläre mir das so:
Die Studenten von 1968 hatten in den Jahren zuvor als erste Jugendgeneration mitten in der Pubertäts- und Ablösungsphase unvorbereitet und ohne familiären und gesellschaftlichen Rückhalt in den Abgrund Auschwitz blicken müssen. Die Kräfte, die diese massive Aufklärung vorantrieben, hatten sich in staatlichen Institutionen formiert: in den Parlamenten, Justizverwaltungen und, in unterschiedlicher Stärke, in den Ministerien des Bundes und der Länder. Die großen Verjährungsdebatten im Deutschen Bundestag, die Errichtung der Zentralen Stelle zur Verfolgung der NS-Verbrechen, die fortwährende Auseinandersetzung um Restitutionsfragen – all das wurde nicht entfernt von einer gesellschaftlichen Mehrheit gefordert und durchgesetzt, sondern gegen diese von Verfassungsorganen der zweiten deutschen Republik. Die von der Justiz seit 1958 geführten und von den Medien begleiteten NS-Prozesse hielten für die junge Generation stets dieselbe Lehre bereit: Die Angeklagten waren in aller Regel Männer, die weder vorher und noch nachher kriminell geworden waren, die normalen Berufen nachgingen, aus allen Volksschichten stammten – sie glichen dem Nachbarn, dem Drogisten von gegenüber, dem Hausarzt, dem verehrten Lehrer oder dem Vater auf beängstigende Weise.
Diese Last war zu schwer. Die westdeutsche Jugend (übrigens nicht die der DDR und Österreichs) sah sich mit Verbrechen konfrontiert, die – begangen von der Generation der Väter – »diese Welt, in der wir leben, belasten werden, solange sie besteht«. [11]Vor diesem Hintergrund lässt sich ihre panische Ausweichreaktion erklären, als ungesteuerte Flucht in revolutionäre Fieber- und Albträume. Da die Eltern, die Verwandten und die gesellschaftlichen Kräfte nicht imstande waren – wahrscheinlich noch nicht sein konnten –, sich der schrecklichen Tatsachen zu stellen, erkoren sich die 68er-Studenten und -Schüler den Staat zum Ersatzfeind.
’68 war insgesamt Folge des Zweiten Weltkrieges, des größten Massentraumas seit dem Dreißigjährigen Krieg. Im Westfälischen Frieden von 1648 steht, man solle über das Vergangene nicht sprechen. Das bedeutet für 1945: Die Überlebenden des Krieges mussten, ob sie nun zu den Opfern oder zu den am Ende blutig niedergerungenen Tätern zählten, das Vergangene um des Neuanfangs willen verdrängen. Folglich verordnete sich die körperlich und seelisch schwer verletzte Menschheit eine Art Heilschlaf, der dem künstlichen Koma entsprach, in das Ärzte heutzutage schwer traumatisierte Patienten versetzen. Die politische Form des künstlichen Komas war der Kalte Krieg, er vereiste das Vergangene förmlich. In dem Maße, wie die Zeit verging und die erste Nachkriegsgeneration erwachsen wurde, erwachte die Welt aus ihrem komatösen Zustand. Das verlief unangenehm, mit erheblichen Schmerzen, Verspannungen und Orientierungsschwierigkeiten. Besonders unangenehm aber erwachte das Land, das den Krieg begonnen und – den Alliierten sei Dank – verloren hatte. Denn anders als 1648 standen 1945 die Schuldigen fest: die Deutschen. Deswegen verlief das deutsche ’68 viel härter und langwieriger als das englische, amerikanische oder französische. Die integrativen und traditionalen Kräfte waren in den Ländern, die den Krieg als Verteidigungskrieg geführt und gewonnen hatten, wesentlich stärker als in Deutschland, in dem die Gesellschaft die moralische Basis und alle innere Elastizität verloren hatte. (Ähnliches gilt übrigens für die ’68er-Revolte in den Kriegstreiberländern Japan und Italien.)
Im Jahr 1995 deutete der schon zitierte Odo Marquard die 68er-Revolte als »Reprise« der »Entlastungsmechanismen«, mit der Teile der deutschen Gesellschaft nach 1945 immer wieder vor der Vergangenheit Reißaus nahmen. Der Druck zur Selbstentlastung verstärkte sich seit der Mitte der 1950er-Jahre: zum einen angesichts des Wohlstands, der das Lebensniveau der Opfer der deutschen Rassenkriege rasch überflügelte, zum anderen angesichts der nicht länger zu verschweigenden Einzelheiten des schier grenzenlosen Mordens. Beides ließ »Schuld und Scham unerträglich« werden, besonders für die junge Generation. Sie »floh« 1968 »aus dem Gewissenhaben in das Gewissensein«: »Das schlechte Gewissen, das man selber ›hatte‹, ersparte man sich oder linderte es, indem man schlechtes Gewissen für die anderen ›wurde‹.« Weiter schreibt Marquard unter dem Begriff »nachträglicher Ungehorsam«: »Das vor 1945 unterbliebene Nein sollte durch ein Nein zum nunmehr Vorhandenen (zur Bundesrepublik) nachgeholt werden. Der Nichtwiderstand gegen die Tyrannei sollte durch den Widerstand gegen die Nichttyrannei ausgeglichen werden. Und die versäumte Verweigerung der Diktatur sollte durch die Verweigerung der Nichtdiktatur wettgemacht werden. Diese neue Verweigerung der Bürgerlichkeit konnte nicht wirklich die Demokratisierung fördern, sondern vor allem neue Sympathien für Revolutionsdiktaturen.« [12]
Wie die Fluchtreaktionen aussahen und wie es dazu kam, beschreibe ich auf den folgenden Seiten. Die 68er waren weder an allem Schuld, noch können sie sich besonderer Verdienste rühmen. Sie müssen als Getriebene verstanden werden, in einem gesellschaftlichen Großkonflikt, den sie sich nicht aussuchen und dem sie nicht ausweichen konnten. So lässt sich die Revolte erklären und ohne alle Aufgeregtheit in die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts einordnen.
(Kleinere Fehler, die aufmerksame Leser in der Hardcoverausgabe fanden, sind nun korrigiert.)
Berlin, im Mai 2009
Immer auf der besseren Seite
Revolutionsselig und selbstgewiss
Wer heute zu den 60. oder 65. Geburtstagen der einstigen Protestgenossen von 1968 eingeladen wird, trifft auf eine muntere, von sich selbst überzeugte Gesellschaft. Viele verklären ihre Vergangenheit als heroische Kampfesphase, erheben sich über die Jugend von heute, die angeblich nichts mehr wolle. Aufgekratzt beschreiben die Feiernden ihre revolutionsselige Sturm- und Drangzeit als Geschichte einer besseren Heilsarmee: Sie rechnen sich einer engagierten, stets den Schwachen, der weltweiten Gerechtigkeit und dem Fortschritt verpflichteten »Bewegung« zu, die das Klima der Bundesrepublik insgesamt positiv beeinflusst und die lange beschwiegene nationalsozialistische Vergangenheit thematisiert habe.
Wenige teilen die Einsicht, dass die deutschen Achtundsechziger in hohem Maß von den Pathologien des 20. Jahrhunderts getrieben wurden und ihren Eltern, den Dreiunddreißigern, auf elende Weise ähnelten. Diese wie jene sahen sich als »Bewegung«, die das »System« der Republik von der historischen Bühne fegen wollte. Sie verachteten – im Geiste des Nazi-Juristen Carl Schmitt – den Pluralismus und liebten – im Geiste Ernst Jüngers – den Kampf und die Aktion. [13]Sie verbanden Größenwahn mit kalter Rücksichtslosigkeit. In ihrem intellektuellen, angeblich volksnahen Kollektivismus entwickelten die Achtundsechziger bald den Hang zum Personenkult. Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof, Che Guevara, Ho Chi Minh oder Mao Tse-tung wurden wegen der Entschiedenheit verehrt, mit der sie ihre gesellschaftlichen Utopien vertraten. Anders als ihre Eltern begeisterten sich die Achtundsechziger für ferne Befreiungsbewegungen aller Art, allerdings für solche, die das Adjektiv national im Namen führten. Spreche ich heute einen einstigen Mitstreiter, der es zum hohen Regierungsbeamten gebracht hat, auf unser 1972 so freundliches Urteil über die – von Pol Pot geführte – kambodschanische Revolution an, faucht er zurück: »Aly, das haben wir nie gemacht!«
Nicht jeder Achtundsechziger muss sich an Pol Pot erinnern, gewiss aber an die von Ernst Busch intonierte bolschewistische Genickschuss-Ballade Wladimir Majakowskis, die noch jahrelang auf Hunderten von Demonstrationen und Versammlungen dröhnte: »Still da, ihr Redner! Du hast das Wort! Rede, Genosse Mauser!« In einfacher Prosa: Hört auf zu schwatzen, nehmt die Knarre in die Hand und drückt ab. Die 9-Millimeter-Präzisionspistole der deutschen Mauser-Waffenwerke gehörte zu den Kultgerätschaften der Oktoberrevolutionäre.
Selbstverständlich machte das Revoltieren Spaß, war ungemein romantisch. An Gründen fehlte es wahrlich nicht. Doch die Selbstermächtigung der Achtundsechziger zur gesellschaftlichen Avantgarde, ihr Fortschrittsglaube, ihre individuelle Veränderungswut, ihre Lust an der Tabula rasa und – damit bald verbunden – an der Gewalt erweisen sich bei näherem Hinsehen als sehr deutsche Spätausläufer des Totalitarismus. Daher der Titel dieses Buches: Unser Kampf. Nur so betrachtet kann den Revoltierenden historische Gerechtigkeit und Nachsicht widerfahren.
Die Revolte dauerte von 1967 bis Ende 1969. Danach zerfiel sie rasch in dies und das. Die einen aßen nur noch Müsli, andere wandelten sich zu Berufsrevolutionären, wieder andere suchten in einer Mittwochsgruppe nach dem G-Punkt, entdeckten ihre homosexuelle Bestimmung, errichteten einen Abenteuerspielplatz oder gründeten eine Stadtteilgruppe. Andere entdeckten das Konservative in ihren Herzen: retteten Gründerzeithäuser vor der damals allgegenwärtigen Abrissbirne und versuchten, die Natur vor der Zerstörung zu bewahren – sie wechselten von der Roten Garde zum Regenwald, vom Straßenkampf zum Stuck, vom Bürgerschreck zum Bürgertum. Manche bevorzugten die anarchistischen Ideen des obsessiven Antisemiten Michail Bakunin, andere hängten sich eine Jutetasche um, auf der eine himmelblaue Friedenstaube schwebte. Zwischen Tunix-Kongress, tiefer Sorge um das Waldsterben und Chaostagen konnte jeder nach seiner linksalternativen Fasson selig werden. Der spätere Außenminister Joschka Fischer gehörte zum Beispiel zu den Neigungsgruppen »Revolutionärer Kampf« und »Putztruppe«. Beide wollten »das System« mit Hilfe dezentraler militanter Aktionen aus den Angeln heben.
Zwischen den Farben Lila, Rot, Rosa, Schwarz und Grün eröffneten sich mannigfaltige Möglichkeiten und Mischungen; Gelb stand für »Atomkraft, nein danke!«. Wie berechtigt oder unberechtigt die verschieden gefärbten Zukunftsentwürfe im Einzelnen gewesen sein mochten, verband deren Schöpfer noch lange eines: sie lebten in der hoffärtigen Einbildung, sie gehörten zum besseren Teil der Menschheit. Eine Zeit lang nannte sich die 1967 entstandene Studentenbewegung Außerparlamentarische Opposition (APO), später fasste man die Gruppen unter den Begriffen Neue Linke oder neue soziale Bewegungen zusammen und unterschied sie von der alten, von der DDR repräsentierten Linken. Diese galt als »revisionistisch«, kompromisslerisch und verstaubt. Die anfangs tragende Kraft bildete der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS).
Zwar kann die Studentenrebellion mit Recht als internationales Phänomen beschrieben werden, doch entwickelten sich in den Staaten, die den Zweiten Weltkrieg als Aggressoren begonnen hatten – den einstigen Achsenmächten Deutschland, Italien und Japan – rasch besonders unversöhnliche, gewalttätige und ungewöhnlich dauerhafte Formen des jungakademischen Protests. [14]Im Gegensatz zu England, Frankreich oder den USA verfingen sich die antiautoritären Blumenkinder dieser Staaten rasch im weltanschaulichen Kampfeswahn.
Im Jahr 1965 bedonnerte Ulrike Meinhof, eine der Leitfiguren der im Embryonalstadium befindlichen Neuen Linken, Joachim Fest mit ihren Ideen in einer Weise, die diesen prompt an seinen NS-Führungsoffizier erinnerten: damals, 1944, habe er »das letzte Mal soviel energische Selbstgewissheit über den Lauf und die Bestimmung der Welt vernommen«. Meinhof schnappte kurz nach Luft, dann fiel sie lachend in »aufgeräumte Kampfeslaune« zurück. Abermals legte sie los. Fest unterbrach sie mit dem Einwand, er könne nach den Nazijahren das Bedürfnis nicht begreifen, »das in ihrem kindlichen Himmel-und-Hölle-Spiel zum Ausdruck dränge«. [15]
Zwei Jahre später, in den Tagen, nachdem der Demonstrant Benno Ohnesorg am 2.Juni 1967 von einem Polizisten erschossen worden war, verbrannten Berliner Studenten als Feuerzeichen ihres Aufbegehrens Springer-Zeitungen. Fest, der damals als Fernsehjournalist beim NDR arbeitete, kommentierte: »Fatale Erinnerungen beunruhigen die extremen Gruppen nicht – ihr politisches Bewusstsein wähnt sich im Stande der Unschuld. Sie plädieren für die Beseitigung dessen, was sie (wiederum ganz unschuldig) das ›System‹ nennen.« [16]Es mag die einst aktiv Beteiligten irritieren, doch knüpfte die linksradikale Studentenbewegung von 1968 in mancher Beziehung an die Erbmasse der rechtsradikalen Studentenbewegung der Jahre 1926 bis 1933 an. Deshalb wird eines der folgenden Kapitel von der Kampfzeit des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbunds handeln.
Die Achtundsechzigergeneration der untergegangenen westlichen Teilrepublik war die erste, die es sich leisten konnte, ihre Jugendzeit – definiert als von Arbeit und Verantwortung entlasteter Lebensabschnitt – beträchtlich auszudehnen. Sie hatte die Pille und wusste nichts von Aids. Sie lebte im Überfluss und ahnte noch nicht, dass Deutsche eines Tages als Gastarbeiter in Polen willkommen sein würden. Dank des damals dichten Sozialgeflechts schafften es viele, ihre luxurierende Jugendexistenz bis ins hohe Mannes- und Frauenalter fortzuführen. Die Freundinnen und Freunde der erschlichenen Sozialhilfe, des gelegentlichen Versicherungsbetrugs, die mit 40 Jahren frühpensionierte, vormals kommunistische Lehrerin, die sich bei ehedem vollen Bezügen in eine Landkommune zurückzog – sie alle zählten lange zu den Figuren der linksradikalen Gemeinde, die sich dank ihrer selbstsüchtigen Schläue allgemeiner Achtung erfreuten. Heute schweigen die meisten verschämt. Nach 1989 geriet der Parasitenstolz in Misskredit.
High sein, frei sein, Terror muss dabei sein
Im abgeschotteten Westberlin der Siebziger- und Achtzigerjahre hielten sich die Reste des linksradikalen Milieus noch lange. Wer dort das Kernige liebte, besetzte ein Haus; manche verwandelten es nach mehrjähriger Schamfrist in Eigentumswohnungen. Parallel bot sich an, eine mit Steuergeldern gestützte linke Tageszeitung zu gründen oder staatliche Fördertöpfe auszulöffeln. Von Zeit zu Zeit erschien es passend, auf Arbeitslosenstütze zu wechseln, um dann – Westberlin war frei (von Kontrollen vieler Art) – in Richtung Toskana zu verduften. Die Immobilienpreise fielen, die Zuschüsse aus Westdeutschland stiegen. Der Feind exekutierte Notstandsgesetze und NATO-Doppelbeschlüsse; er stand in Bonn, von dem Szenekarikaturisten Gerhard Seyfried »Bonz« genannt.
Man engagierte sich für den Frieden, das hieß: für den Status quo. Helmut Kohl galt als untote Charaktermaske; Che Guevara und Ulrike – gemeint war die Meinhof – lebten als Maskottchen fort. Die palästinensische Terroristin Leila Khaled guckte – die Kalaschnikow hoch aufgerichtet, den Lauf sanft an die Backe gedrückt – mit ihren schönen schwarzen, leicht gesenkten Augen aufs Kreuzberger Doppelbett, gezimmert vom alternativen Möbelstudio »Holzwurm«. An Häuserwänden stand »High sein, frei sein, Terror muss dabei sein« oder »Mit Gefühl und Härte«. Es entstand eine Art Sentimentalstalinismus. In seine Kurzbiographie schrieb der langsam alternde Revoluzzer: lebt und arbeitet in Berlin. Was immer das bedeuten mochte.
Trotz rückläufiger Produktivität folgten die Löhne und Gehälter im ummauerten Idyll jenen Tarifverträgen, die in Stuttgart ausgehandelt wurden – plus Frontstadtzulage. Der öffentliche Dienst blähte sich auf. Wem sonst nichts einfiel, der konnte in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Freie Universität unterkriechen oder in einem Trägerverein für fortschrittliches Gedanken- und Kulturgut, der mit verächtlich so bezeichneter Staatsknete bewirtschaftet wurde. Zudem benötigte der innere Westberliner Zirkus pro wehrdienstflüchtigen Krawallschwaben mindestens einen Polizisten.
Zwischen Kranzler-Eck und Schlesischem Tor etablierte sich bis in die späten Achtzigerjahre hinein ein juste milieu von Egomanen. [17]Sie führten ihr Leben auf Kosten des gut weggesperrten Teils der europäischen Welt. Das erklärt die seit 1989 virulente Aversion vieler Achtundsechziger gegenüber den Generationsgenossen und den etwas Jüngeren aus der DDR. Sie verkörperten das Gegenbild: sie waren gut ausgebildet, hatten keine Lebenszeit vergeudet, und wenn, dann auf unfreiwillige Art. Gewiss mögen diejenigen, die im Sommer 1989 mit den Füßen gegen die DDR abstimmten, sich in Prag oder Budapest die Ausreise ertrotzten und so den Eisernen Vorhang sprengten, den westlichen Wohlstand im Sinn gehabt haben. Na und? Doch dank einer grandiosen List der Geschichte schenkten sie zuallererst den alternativen WestberlinerInnen die Freiheit. Wie schon 1945 erschienen auch diese Befreier aus dem Osten den Befreiten gänzlich unwillkommen.
Ungerufen zerstörten diese Ostler die mühsam aufgebaute Alternativgemeinschaft. Schließlich hatte die »Bewegung« in den Achtzigerjahren eine Partei hervorgebracht und zuletzt einen rot-grünen Senat in Westberlin gebildet, unter anderem zu dem Zweck, linke Projekte besser mit Steuergeldern zu berieseln. In Bonn sahen sich die Grünen unter Joschka Fischer und Antje Vollmer kurz davor, gemeinsam mit Oskar Lafontaine die Kohl-Regierung abzulösen. Diese DDR-ler vermasselten all das. Schlimm: 1990 flogen die West-Grünen in Folge der Wiedervereinigung aus dem Bundestag.
Die neue Lage bot neue Gelegenheiten, und rasch fand die alte linksradikale Besserwisserei unter umgekehrten Vorzeichen ihr nächstes Feld. Einstige West-Maoisten, autonome Häuserkämpfer oder die Damen und Herren, die im »politischen Zusammenhang ›Siesta‹« gegen die Arbeitsgesellschaft angefaulenzt hatten, brauchten sich nur auf ihre frühere Kritik am »Sowjetrevisionismus« und am Moskauer »Sozialimperialismus« zu besinnen, schon standen sie auf der richtigen Seite. Die Stasijagd konnte beginnen. Da sie selbst die demokratischen Verfahrensregeln erst als Spätbekehrte halbwegs gelernt hatten, machten sie sich mit Konvertiteneifer über die »strukturellen Antidemokraten«, die »miefigen, totalitär verformten« Zonis her. Allein schon das Datschenmilieu dort, wenn man selber in Brandenburg nach einem Häuschen Ausschau hielt! Der Erziehungsstil! Diese unemanzipierte Redeweise!
So stellte sich eine Frau mittleren Alters vor: »Ich heiße Lisa Schmitz und bin Anatom in Jena.« – Anatomin! knackte es im Stammhirn der feminisierten Westlerin. Von Frauenemanzipation hatte die Gute wohl noch nie gehört. Angela Merkel begreift es bis heute nicht. Neulich meinte sie auf die Frage nach der Dauer ihrer Kanzlerschaft: »Da bin ich eher ein kurzfristiger Denker.« Dass die Abiturientinnenquote in den neuen Bundesländern noch immer die mit Abstand höchste in der Republik ist, interessiert in diesem Weltbild nicht. Seit den Sechzigerjahren machten in der DDR ebenso viele Mädchen Abitur wie Jungen – die Westrepublik erreichte die ungefähre Parität 20 Jahre später.
In ihrem Gesprächsbuch vom September 2006 antwortet Antje Vollmer auf die Frage, warum Angela Merkel sich in der CDU habe durchsetzen können: Ihr fehle das »Gen«, das die westdeutschen Politikerinnen immer wieder in die »Frauenfalle« tappen lasse: »Da war die DDR-Sozialisation ausnahmsweise mal von Nutzen.« In derart selbstgerechtem Ton kanzelt sie Merkel weiter ab: »Das zivilgesellschaftliche Modell ist ihr sowieso fremd. Sie war ja auch in diesem Sinne kein Teil der Bürgerrechtsbewegung der DDR.« Letzteres behauptete Merkel nie. Im Gegensatz zur Theologin Vollmer schönt sie ihren Lebenslauf nicht zur Tugendgeraden. Zu dem Einwand, die Bundeskanzlerin sei immerhin aus der Partei Demokratischer Aufbruch zur CDU gekommen, fiel Vollmer ein: »Sie kam eigentlich aus gar nichts, sie war eine hochbegabte Naturwissenschaftlerin aus einem gebildeten, aber isolierten Elternhaus, die sich nicht vorbereitet hat, in die gesellschaftlichen Prozesse einzugreifen.«
Antje Vollmer erlernte solche Künste während der Siebzigerjahre im ideologischen Smog der maoistischen KPD. In ihrer 1978 veröffentlichten, 1984 in verschönerter Form abermals aufgelegten Clara-Zetkin-Biographie heißt es zum Beispiel über die staatstragenden Sozialdemokraten von 1918: »Weder war die Sozialdemokratie als der derzeitige Hauptfeind der Revolution von den breiten Massen klar erkannt, noch waren sie bewaffnet. Vor allem aber fehlte es ihnen an dem starken revolutionären Zentrum, das die Aktionen der Massen anleiten, organisieren und weitertreiben konnte; es fehlte ihnen eine kommunistische Partei.« [18]Vollmer veröffentlichte das Buch unter dem ebenso teutophilen wie agrarrevolutionären Kryptonym Karin Bauer. Wie viele andere distanzierte sie sich von solchen Dogmen nur langsam.
1985 veranstaltete Der Spiegel ein Streitgespräch zwischen ihr und ihrem (damals noch grünen) Fraktionskollegen Otto Schily. Ob sie seinem Antrag »Die Grünen bekennen sich zum Gewaltmonopol des Staates« zustimmen werde, fragte Schily, darauf erwiderte Vollmer: »Mir passt diese Fragerei nicht. Nein, so unterstütze ich ihn nicht.« In Person von Klaus Hartung ergriff die taz damals Partei für Vollmer. [19]Ohne auf den knapp 300 Seiten ihres Gesprächsbuchs nur einen Satz über ihr langjähriges Treiben in einer maoistisch-stalinistischen Frontorganisation zu verlieren, bescheinigt sich Vollmer »natürliche Immunität gegenüber Sektierertum«. Die nachträgliche Neudekoration der eigenen Lebensgeschichte kennzeichnet das Bestreben vieler ihrer Alters- und einstigen Kampfgefährten. Bald wird Antje Vollmers Enkel quietschen: Meine Oma war keine Achtundsechzigerin! [20]
Profit vom Umsturz der Anderen
Die bundesdeutsche Jugend träumte 1968 von grundlegender, radikaler Veränderung. Gemessen an den einst revolutionären Zielen wurde daraus so gut wie nichts. Schließlich legte sich die Neue Linke zu Beginn der Achtzigerjahre einen parlamentarischen Arm in Gestalt der Grünen zu. Das Generationenprojekt fand mit der Regierung Schröder/Fischer 1998 seinen späten Höhepunkt und sieben Jahre später sein bemerkenswert kraftloses Ende.
Gelegentlich fragen Freunde, die in der DDR aufgewachsen sind, woher die unverhüllte Aversion komme, wie sie zum Beispiel Antje Vollmer an den Tag legt. Die Achtundsechziger verachteten die DDR