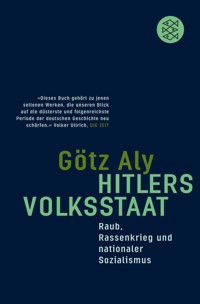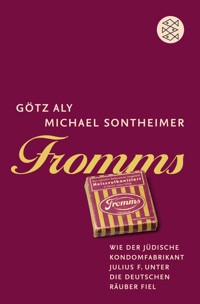19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unnachahmlich treffsicher nimmt der Historiker Götz Aly den keineswegs immer »vorbildlichen« Umgang der Deutschen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit in den Blick: Oft ist von »den Tätern« die Rede, wenn es um die NS-Verbrechen geht, von »der SS« oder »den Nationalsozialisten«. Doch es waren Hunderttausende Deutsche, die aktiv Menschheitsverbrechen ungeheuren Ausmaßes begingen, und viele Millionen, die diese billigten, zumindest aber geschehen ließen. Götz Aly setzte sich in seinen Reden der vergangenen Jahre, von denen die wichtigsten in diesem Band versammelt sind, immer wieder mit den vielfältigen Praktiken auseinander, die Schuld auf möglichst kleine Gruppen und Unpersonen abzuschieben. Doch auch wenn sich mancher dagegen sperrt, so zeigt Götz Aly, es bleibt »Unser Nationalsozialismus«. Seine Maxime lautet: Die Vergangenheit nicht »bewältigen«, sondern vergegenwärtigen. So lässt sich daraus lernen. »Götz Aly (hat) uns vor Augen geführt, dass kein deutscher Staatsbürger sich heute davon freisprechen kann, vom Holocaust möglicherweise profitiert zu haben. Es bleibt die Schuld, die von allen beglichen werden muss.« Patrick Bahners zur Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises 2018 an Götz Aly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Götz Aly
Unser Nationalsozialismus
Reden in der deutschen Gegenwart
Über dieses Buch
Die Vergangenheit nicht »bewältigen«, sondern vergegenwärtigen
Auch wenn sich mancher dagegen sperrt, es bleibt Unser Nationalsozialismus. »Die Täter«, »die SS«, »die Nationalsozialisten«, das waren Hunderttausende Deutsche, die aktiv Menschheitsverbrechen ungeheuren Ausmaßes begingen, und viele Zehnmillionen, die diese billigten, zumindest aber geschehen ließen. Götz Aly setzte sich in seinen Reden der vergangenen Jahre immer wieder mit den vielfältigen Praktiken auseinander, die Schuld auf möglichst kleine Gruppen und Unpersonen abzuschieben. Seine Maxime lautet: Die Vergangenheit nicht »bewältigen«, sondern vergegenwärtigen. So lässt sich daraus lernen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Götz Aly ist Historiker. Für seine Bücher wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Heinrich-Mann- und dem Ludwig-Börne-Preis. 2018 erhielt er für »Europa gegen die Juden 1880–1945« (S. FISCHER) den Geschwister-Scholl-Preis. 2021 erschien sein viel beachtetes Buch »Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491703-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Im Irrgarten deutschen Gedenkens
1 DIE GEGENWART DES UNVERGANGENEN
1945: Die Zwangsbefreiung der Deutschen
Das Böse im Guten, das Gute im Bösen
Massenmorde sichern den Durchhaltewillen
Vergessen und von aller Welt verlassen
Im Osten geehrt, im Westen vergessen
2 ZEITGESCHICHTE, STREITGESCHICHTE
Die wirren Windungen deutschen Erinnerns
Hilberg oder die Angst vor der Wahrheit
Kritik: Gute Bücher, schlechte Bücher
Eine Jüdin überlebt im Berliner Untergrund
Von der eigenen Sinnlosigkeit ergriffen
Trotz allem »im Humanen einig«
Adolf Hitler in Anmerkungen eingesargt
Elmer Luchterhand widerlegt Bruno Bettelheim
Das deutsche Morden in der Sowjetunion
Der immer wieder neue Antisemitismus
3 LEBENSGESCHICHTE, STAATSGESCHICHTE
Eine Lagerwärterin mimt das KZ-Opfer
»Wie nah sind uns manche, die tot sind …«
Onkel Otto: Ein schwules Leben in Berlin
Ein gefährdeter und begeisternder Grenzgänger
Erinnerungen an Dagmar, genannt: die Gräfin
Meinem Lektor Walter Pehle zum 80. Geburtstag
Meinem Freund Hans Mommsen zum 85. Geburtstag
Erinnerung an David, einen Freund und Förderer
Tarnów: Die Bilder der bald Ermordeten …
Seit 45 Jahren glücklich im Archiv
Schriftenverzeichnis Götz Aly (2022)
Abkürzungsverzeichnis
Im Irrgarten deutschen Gedenkens
Die Vorträge, Aufsätze und Predigten, die Gedenk- und Dankesreden dieses Bandes verbindet eines: Die Anlässe und Themen habe ich in keinem Fall selbst bestimmt. Landtagspräsidenten, Organisatoren wissenschaftlicher Tagungen, Preisjurys, ein Pfarrer, ein Rabbiner, die Hinterbliebenen verstorbener Freunde und Zeitungsredakteure baten mich, zu sprechen oder zu schreiben – oft mit knappen zeitlichen Vorgaben. So unterschiedlich meine Auftraggeber ihre thematischen Erwartungen formulierten, so einheitlich war ihr an mich gerichteter Wunsch, den Nationalsozialismus historisch einordnend zu behandeln. Wie selbstverständlich gingen sie davon aus, dass ich Nazitum, Rassismus, Angriffskrieg und Antisemitismus sehr deutlich verurteilen und zu den bis heute wirksamen Folgen sowie den daraus abzuleitenden Konsequenzen sprechen würde.
Das klingt einfacher, als es – jedenfalls für mich – ist. Gewiss, der Nationalsozialismus war abgrundtief böse. Allerdings kommt es meines Erachtens nicht darauf an, Neonazis, Ultranationalisten, ressentimentgetriebene identitäre Großgruppen und halb versteckt oder offen auftretende Judenhasser einfach nur als verwerflich oder ekelhaft zu brandmarken, um am Ende bei der Binsenweisheit zu landen: »Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.« Das trifft zwar zu, aber leider wird dieser Schoß weiterhin fruchtbar bleiben, auch wenn die Erscheinungsformen von Bosheit, Dünkel, Habgier, Massengewalt, Missgunst, Neid und weltanschaulich-veränderungswütiger Besessenheit wechseln.
Zentral bleibt für mich die Frage nach dem Warum. Warum folgten so viele durchaus normale, moralisch gefestigt erscheinende Deutsche 1932 bis 1945 dem politischen Programm des Nationalen Sozialismus? Wie konnte sich aus dem einmal herbeigewählten und konstituierten Hitlerdeutschland mit atemberaubendem Tempo und ungebrochen eine massenmörderische politische Praxis entwickeln? Der israelische Historiker Yehuda Bauer formulierte das hier angesprochene zentrale geschichtliche Problem auf sehr ungemütliche, aber bedenkenswerte Weise. In seiner Rede für die Opfer des Nationalsozialismus, die er 1998 im Deutschen Bundestag hielt, lenkte er am Ende die Blicke seines Publikums in den Abgrund des schwer Verständlichen: »Das Fürchterliche an der Shoah ist eben nicht, dass die Nazis unmenschlich waren; das Fürchterliche ist, dass sie menschlich waren – wie Sie und ich.« (Das Zitat ist zu finden unter Bundestag Gastredner Yehuda Bauer.)
Ebendas, die Nähe, erklärt das weitverbreitete Bedürfnis nach maximaler Distanz. Aber die Mordtaten haben keine Außerirdischen verbrochen, genannt »die SS-Schergen«, »die Nationalsozialisten«, »die Intensivtäter«, »die Rassenideologen«, sondern normale Menschen aus allen Schichten der deutschen Bevölkerung. Was war da los? Wie konnte das geschehen? Daher mein Titel: »Unser Nationalsozialismus«.
In aller Regel erwarten diejenigen, die mich zu Vorträgen einladen, dass ich das Publikum nicht in getragener, feierlich-behäbiger Gedenktonlage langweile, sondern dem vorgegebenen Thema etwas Neues oder Beunruhigendes, auch Aktuelles abgewinne. Das kommt mir entgegen; und die allermeisten heutigen Deutschen möchten aus den Verbrechen ihrer hitlerdeutschen Vorfahren lernen. Aber was? Dass man Männer, Frauen und Kinder nicht in Gaskammern ermorden soll, muss niemand lernen. Dasselbe gilt für alle anderen Schreckenstaten und Massenverbrechen, die Hunderttausende Deutsche seinerzeit begangen haben. Rassismus ist böse und verwerflich. Ohne Frage. Aber warum entsteht immer wieder neuer Großgruppenhass? Welche normalen, in der Gegenwart noch bestens bekannten und weiterhin funktionierenden Mittel setzte die Staatsführung ein, um all diese Schreckenstaten zu ermöglichen? »Bewältigen« oder »aufarbeiten« können wir diese von Deutschen gebilligten oder wenigstens geduldeten, organisierten und vollstreckten Schreckenstaten nicht. Aber wir sollten uns den damit verbundenen Fragen aus verschiedenen Richtungen stellen. Geschichtsschreibung kann kein objektives und allgemeingültiges Bild vergangener Ereignisse nachzeichnen. Es fällt schon jedem einzelnen Menschen schwer, die verschiedenen Gründe für seine eigenen vor 20 oder 30 Jahren getroffenen Entscheidungen zu benennen. Das gilt umso mehr für Entscheidungen, die gesellschaftliches Massenverhalten in Kombination mit Staats- und Kriegsaktionen umfassen. Ihnen liegen komplexe, multifaktorielle und vor allem dynamische Prozesse zugrunde.
Gleich einem Maler oder Fotografen wählt jeder Historiker seine Perspektive aus. Je nachdem, ob man einen Gegenstand aus großer Entfernung, aus der Nähe, von der einen oder anderen Seite, in grellem oder gedämpftem Licht betrachtet, entstehen unterschiedliche Bilder, die für sich genommen alle »richtig« sind. Ein dreidimensionales Objekt kann von der einen Seite schwarz und von der anderen Seite weiß sein, untersucht man es von Nahem, werden Formen, Farbnuancen und Strukturen sichtbar, die von Ferne niemand sieht. Jede dieser Ansichten spiegelt eine Realität – klar, verzerrt oder gebrochen. Das gesamte (geschichtliche) Objekt kann aus einer starren Perspektive niemals erfasst werden. Modische »Narrative«, »Paradigmen« und methodisch einsinnige »akademische Schulen« sind dazu angetan, den Blick aufs Ganze einzuengen und oft genug zu versperren.
Wie im Fall von Fotografen und Malern erfordern Aufträge, die Dritte mit klaren Vorgaben erteilen, Flexibilität und Freude am Wechsel der Blickrichtungen. Genau deshalb finde ich die von außen gestellten Aufgaben anregend, gerade weil sie oftmals meine Pläne und Routinen durchkreuzen. Sie erfordern ungeplante Recherchen und Lektüren, führen zu neuen Fragen und Antworten. Ohne derartige Anstöße, Bitten und Drängeleien (»Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn …«, »Du musst unbedingt …«) hätte ich die Einzelstudien, die dieses Buch versammelt, nicht unternommen. Folglich geht mein Dank an diejenigen, die meinen ziemlich klar strukturierten Alltag zielgerichteter Lektüren und Arbeiten an Buchmanuskripten auf produktive Weise gestört haben.
Bei aller Freude am Perspektivwechsel beharre ich auf der Unterscheidung zwischen wahr und unwahr. Es bleibt grob fahrlässig, wenn sich der Autor einer 2013 erschienenen Biographie über Max Herrmann, den in Theresienstadt ermordeten Begründer der deutschen Theaterwissenschaft, auf Aussagen stützt, die von dessen heimtückischem, antisemitischem und »rein arischem« Schüler Hans Knudsen stammen (S. 72–77). Es muss herausgearbeitet werden, wie und warum das Münchner Institut für Zeitgeschichte und die einschlägigen Verlage es 20 Jahre lang hintertrieben, jedenfalls aber versäumt haben, Raul Hilbergs epochales, 1961 in den USA erschienenes Buch »The Destruction of the European Jews« ins Deutsche zu übersetzen. Dabei geht es nicht allein um bestimmte Institutionen oder Personen, sondern mindestens ebenso sehr um den jeweiligen Zeitgeist beziehungsweise Zeit-Ungeist (S. 94–121).
Letzterer erfreut sich weiterhin zäher und selbstgewisser Lebendigkeit. So hat es die Berliner Akademie der Künste 2020 abgelehnt, eine schon geplante Lesung aus dem langjährigen Briefwechsel zwischen dem Holocaustüberlebenden und Historiker Joseph Wulf und dem Schriftsteller Ernst Jünger zu veranstalten. Gründe wurden nicht genannt. Aber offenbar erschien Jünger den Verantwortlichen der Sektion Literatur als »zu rechts«. Sie ächten diesen gewiss nicht modisch-handlichen Autor, um die nur vermeintlich antifaschistische Fassade ihrer Akademie in einem, wie ich finde, etwas schmierigen Glanz erstrahlen zu lassen. 2020 folgte das »Hamburger Literaturfestival« mit einer ähnlichen Absage dem Berliner Verdikt (S. 139–140). Mit den falschen Selbstgewissheiten derjenigen, die sich für bessere, stets auf der richtigen Seite befindliche Menschen halten, ist aus dem Nationalsozialismus nichts zu lernen.
Zu den Geschichten, die zwingend nach dem simplen Prinzip wahr–unwahr beurteilt werden müssen, gehört die postume Enttarnung der Sozialdemokratin und führenden Gewerkschafterin Imgard Kroymann. Sie behauptete nach 1945, sie habe in KZ-Haft gesessen. Als ehemalige Lagerwärterin wusste sie, wovon sie sprach. Lehrreich erscheint mir an diesem Fall, wie sehr frauengeschichtlich orientierte Historikerinnen und Journalistinnen den Widerstandslügen Kroymanns in den 1980er und 1990er Jahren auf den Leim gegangen sind. Sie bildeten sich ein, in dieser tatkräftigen Frau eine antifaschistische Widerständlerin, eine wagemutige Heldin aus den proletarischen Milieus des Ruhrgebiets entdeckt zu haben. Gläubige Bewunderung verleitete sie dazu, die offensichtlichen Widersprüche in Kroymanns Erzählungen nicht sehen zu wollen.
Das Verdienst an dem Artikel kommt Anne Prior zu. Sie, die Buchhändlerin aus Dinslaken, wurde vor mehreren Jahren auf die Seltsamkeiten in der Biographie des vorgeblichen NS-Opfers Irmgard Kroymann aufmerksam. Sie begann, die Sache zu überprüfen, und fand, vor allem in Leipziger Archiven, Dokumente, mit denen sie die in Deutschland gewiss nicht ganz seltene Selbstverwandlung einer NS-Täterin zum angeblichen NS-Opfer schlüssig belegen konnte.
Ich stieß durch einen Zufall auf diesen Aufsatz. Anfang 2017 bat mich eine Redakteurin der Zeitschrift »Moving the Social« in einem Peer-Review-Verfahren um die Begutachtung der nun in diesem Buch gedruckten Fallstudie. Die Zeitschrift trägt den Untertitel »Journal of Social History and the History of Social Movements« und ist am Institut für Soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum angesiedelt. In meinem Gutachten schrieb ich: »Mich hat die Arbeit stark beeindruckt. Hinzu kommt, dass es Frau Kroymann gelungen ist – was nicht allzu schwer gewesen sein mochte –, die Genderforscherinnen der ersten Generation mit ihren erlogenen Heldinnen- und Widerstandsgeschichten an der Nase herumzuführen. All das spricht in hohem Maße für den Artikel und für das Engagement der Autorin.« Ich empfahl eine Überarbeitung und Straffung des Textes.
Vor dieser Aufgabe scheuten die Kolleginnen von »Moving the Social« zurück und »nahmen von der Publikation Abstand«. Da ich anhand einer Fußnote die Autorenschaft von Anne Prior erriet, rief ich sie zwei Jahre später an, um zu erfahren, ob sie den Aufsatz mittlerweile veröffentlichen konnte. Das war nicht geschehen. Nun steht er, von der Autorin noch einmal durchgearbeitet und von mir redigiert, in diesem Buch. Und ich empfehle Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Beginnen Sie mit Anne Priors exemplarischem Aufsatz »Eine Lagerwärterin mimt das KZ-Opfer«, und schon geraten Sie mittenhinein in das rutschige Geschichtsgelände namens »Unser Nationalsozialismus« (S. 181–204).
Mit Anne Priors ausgezeichneter Studie beginnt der dritte Abschnitt dieses Buches, »Lebensgeschichte, Staatsgeschichte«. Die dann folgenden Texte geben auch Einblicke in meine eigene, nicht gerade glatte wissenschaftliche Biographie: Die Erinnerungen an verstorbene Freunde und Wegbegleiter; die Recherchen zur Ermordung der Juden von Tarnów, die mich immer wieder und stets am Rande beschäftigten, bis sie nach 35 Jahren, aber erst dann, zum Abschluss kommen konnten; schließlich der Vortrag »Seit 40 Jahren glücklich im Archiv«, eine vom Verband deutscher Archivarinnen und Archivare angeregte Selbstauskunft zu meiner Arbeitsweise und zu meiner Freude an Unerwartetem, das sich aus der historiographischen Arbeit immer wieder ergibt.
Auf den letzten Seiten des vorliegenden Bandes sind die Arbeiten verzeichnet, die ich in den vergangenen 43 Jahren zu dem von mir weit gefassten Thema »Unser Nationalsozialismus« lebens- und staatsgeschichtlich geschrieben habe. Der Grund dafür ist einfach: Spätestens in vier Jahren, also an meinem 80. Geburtstag, möchte ich damit aufgehört haben, mich mit KZ-Wärterinnen, neudeutschen Rechthabern oder postfaschistischen Bernd Höckes zu beschäftigen.
Die Forschungen zum Nationalsozialismus verlieren sich mittlerweile in zahllosen, nicht immer wichtigen Details. Folglich verschwindet die zentrale Frage, wie es zu unserem Nationalsozialismus kommen konnte. Sie wenigstens partiell zu beantworten, steht im Mittelpunkt meiner Bücher. Falls Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diese Frage aller Fragen ebenfalls wichtig ist, empfehle ich Ihnen die privat finanzierte, höchst anregende Ausstellung im Story Bunker Berlin. Dort stellt sich Wieland Giebel seit Jahren dem Problem »How could it happen. HITLER. Wie konnte das geschehen«.
Berlin, Dezember 2022
1 DIE GEGENWART DES UNVERGANGENEN
April 1945: Ein Soldat der 12. Panzerdivision der Siebten US-Armee bewacht deutsche Kriegsgefangene des letzten Aufgebots. Sie hatten sich in einem süddeutschen Waldstück ergeben und waren nun – wie die meisten Deutschen – zwangsweise von sich selbst befreit worden. Die originale Bildunterschrift lautet »Negro troops in action«. Foto: Fred Faas/Office of War Information, New York. National Archives, Washington, Nr. 208-AA-32P-2.
1945: Die Zwangsbefreiung der Deutschen
Holocaust-Gedenkrede im Thüringer Landtag, 2019
Was zuvor geschah: Im Sommer 2018 hatte mich der Präsident des Thüringer Landtags, Christian Carius (CDU), eingeladen, am 25. Januar 2019 die Rede zum Holocaust-Gedenktag zu halten. Zur Vorbereitung las ich ein gerade erschienenes, noch wenig beachtetes politisches Bekenntnisbuch. Es stammte vom Vorsitzenden der Thüringer AfD und Führer der AfD-Fraktion im Landtag, Björn Höcke. Nachdem ich die Lektüre abgeschlossen hatte, schien es mir richtig, die neonazistischen und zur Gewalt anstiftenden Passagen des Buches im Gedenkvortrag für die Opfer des Nationalsozialismus nur zu streifen. Deshalb veröffentlichte ich meine Kritik kurz vorher unter der Überschrift »Die AfD, Björn Höcke und die Gewalt« in der Berliner Zeitung vom 15. Januar 2019. Hier der Text:
Bei der Lektüre des 2018 erschienenen Gesprächsbuchs »Nie zweimal in denselben Fluss« mit dem Vorsitzenden der Thüringer AfD, Björn Höcke, stieß ich auf Formulierungen, die unseren Verfassungsschützern und Gesetzgebern zu denken geben sollten. Höcke geht darin der Frage nach, was er und seine Leute denn machen sollen, wenn »neoliberalistische Multikultikräfte«, also die angeblichen Freunde des »Volkstods«, auf absehbare Zeit die Oberhand behalten sollten. Als »strategische Option« empfiehlt Höcke für diesen Fall die Errichtung »gallischer Dörfer« des nationalen Widerstands. Das solle vor allem im Osten Deutschlands geschehen, weil dort »noch großes Potenzial vorhanden« sei, um »das inhumane Projekt einer Migrationsgesellschaft zu stoppen«. Wie es vom gallischen Dorf in den Thüringer Bergen aus weitergehen soll, beschreibt Parteiführer Höcke so: Die »Auffangstellung« kann dann zur »neuen Keimzelle des Volkes werden« – »und eines Tages kann diese Auffangstellung eine Ausfallstellung werden, von der eine Rückeroberung ihren Ausgang nimmt«.
Von seinem Stichwortgeber, einem Sebastian Hennig, befragt, erläutert Höcke, wie er sich die Zukunft nach dem als siegreich gedachten »Ausfall« seiner AfD-Mannen denkt: »In der erhofften Wendephase stünden uns harte Zeiten bevor, denn umso länger der Patient die drängende Operation verweigert, desto härter werden zwangsläufig die erforderlichen Schnitte werden.« An dieser Stelle wirft Hennig ein, »›brandige Glieder können nicht mit Lavendelwasser kuriert werden‹, wusste schon Hegel«, und Höcke fährt fort: »Eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben (…), die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen.«
Was der Vordenker des militanten Rechtsradikalismus darunter versteht, umschreibt er mit folgenden Stichworten: »großangelegtes Remigrationsprojekt«, »wohltemperierte Grausamkeit«, »menschliche Härten und unschöne Szenen werden sich nicht immer vermeiden lassen«, »existenzbedrohende Krisen erfordern außergewöhnliches Handeln«. Auch würden wir bei dieser Gelegenheit »leider ein paar (germanische) Volksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen«. Aber, so Höcke, »mit deutscher Unbedingtheit« sei »die Sache gründlich und grundsätzlich anzupacken«: »Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen.«
So weit die Phantasien zur Machtergreifung, wie sie im geistigen Schoß der AfD ausgebrütet werden. Es handelt sich um einen nur leicht verschlüsselten, meines Erachtens eindeutig verfassungsfeindlichen Aufruf, Waffen zu vergraben und Nächte der langen Messer vorzubereiten.
Zehn Tage später trat der Thüringer Landtag zur Gedenksitzung zusammen. Links von mir saßen einige Überlebende des deutschen KZ- und Rassenterrors, darunter Éva Pusztai-Fahidi aus Budapest, geboren 1925 und frisch verliebt in einen verwitweten fünf Jahre jüngeren Professor für Mathematik. Sie kannte ich gut. Denn ich hatte sie sowohl in Stadtallendorf als auch in Budapest getroffen und 2004 ein Vorwort für die deutsche Ausgabe ihrer Erinnerungen »Anima rerum« geschrieben. Uns gegenüber saß versteinert ins Leere blickend der AfD-Abgeordnete Björn Höcke. Nach einer sehr persönlich gehaltenen Rede des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow war ich an der Reihe:
Wir haben uns versammelt, um an den 27. Januar 1945 zu erinnern – den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Erst in der Nacht zuvor hatten SS-Truppen das letzte der vier aus Erfurt gelieferten Großkrematorien gesprengt; eines war im Oktober 1944 bei einem Aufstand des »Sonderkommandos« zur Leichenverbrennung zerstört, die beiden anderen waren bereits im Dezember zerlegt und Richtung Mauthausen verfrachtet worden. Dort, am Rand der geplanten Alpenfestung, sollte unter dem Codewort »Neu-Auschwitz« ein gleichwertiges Vernichtungslager entstehen. Bis Ende 1944 waren in Auschwitz etwas mehr als eine Million Menschen ermordet worden, die allermeisten, weil sie Juden waren.
Am 27. Januar vor 74 Jahren verharrten noch 7000 von den geflüchteten Wachleuten zurückgelassene, extrem geschwächte Häftlinge im Lager. Nach Gefechten mit Wehrmachtsverbänden erreichten zwei vermummte Soldaten das Tor von Auschwitz-Birkenau am Nachmittag. 213 ihrer Kameraden waren bei den Kämpfen um Auschwitz gefallen. Ihr Maschinengewehr zogen die beiden Soldaten per Schlitten hinter sich her. Ein Freudenschrei erhob sich aus der Menge der Gefangenen: »Die Russen sind da!«
Am 15. April rückten britische Truppen auf das Konzentrationslager Bergen-Belsen vor. Auch dort waren die deutschen Bewacher jäh verschwunden. Wie die ungarische Jüdin Lilly Weiss bezeugte, die als Einzige ihrer großen Familie überlebt hatte, herrschte unter den Häftlingen äußerste Spannung. Man hörte Schüsse und Kanonendonner – bis plötzlich aus einem Lautsprecher diese Sätze erschollen: »Hier sind die Soldaten der Britischen Armee! Ihr seid frei! Ab morgen gibt es Lebensmittel. Die Kranken werden versorgt, die Gesunden kommen in Quarantäne. Sie können nach Hause. Keine Panik! Jeder bleibt an seinem Platz! Bergen-Belsen ist befreit!«
Einige Tage später erreichten sowjetische Truppen den Osten Berlins. Dort, auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee, hielten sich einige Dutzend Juden versteckt, unter ihnen Rabbiner Martin Riesenburger. Er berichtete: »Man schrieb Montag, den 23. April 1945. Als es 15 Uhr war, durchschritt das Tor unseres Friedhofs der erste sowjetische Soldat! Aufrecht und gerade war sein Gang. Ich hatte das Gefühl, dass er mit jedem Schritt bei seinem Kommen zu uns ein Stück des verruchten Hakenkreuzes zertrat. Wir umarmten diesen Boten der Freiheit, wir küssten ihn – und wir weinten!« »Für mich«, so notierte der Philosoph Rudolf Schottlaender, der dank seiner »arischen« Ehefrau in Berlin-Heiligensee überlebt hatte, »war eben Befreiung, was ringsum nur Niederlage und Schrecken bedeutete.«
Sowjetische Soldaten mussten die mit Abstand schwersten Opfer auf sich nehmen. Sofern sie den Krieg lebend überstanden hatten, kehrten sie in eine zerstörte, ausgeplünderte und ausgeblutete Heimat zurück; mehr als zwei Millionen von ihnen wurden in deutscher Gefangenschaft vorsätzlich ermordet, zumeist mit dem Mittel des Hungers. Zu den Gefallenen oder von Deutschen als Gefangene ermordeten sowjetischen Soldaten zählen auch 200000 der insgesamt 500000 jüdischen Rotarmisten.
Mit harter militärischer Gewalt mussten im Mai 1945 viele Zehnmillionen Deutsche gezwungen werden, ihr Werk des Hasses, der Zerstörung und Selbstzerstörung zu beenden. Sie hatten Hitler gewählt, bejubelt oder geduldet und für ihn gekämpft. Insgesamt mobilisierte die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg mehr als 18 Millionen deutsche Männer – fast alle, die laufen konnten –, um zerstörend, raubend und mordend über Europa herzufallen: vom Nordkap bis zum Kaukasus, von Marseille bis Leningrad. Weit überwiegend fühlten sich die Landser als Herrenmenschen, zumal im Osten Europas. Angetrieben hatten sie nazistische Überzeugung, vaterländisches Pflichtgefühl, nationaler Dünkel, Abenteuerlust oder Gleichgültigkeit – die Verrohung erzeugte die Art der Kriegsführung, verstärkt von der begleitenden Propaganda vom »Untermenschen«.
Mir bleibt rätselhaft, wie der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland zu folgender Forderung fand: Auch »wir haben das Recht, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen«. Ich verspüre kein solches Bedürfnis.
Warum das so ist, erkläre ich Ihnen am Beispiel des Feldwebels Werner Viehweg. Er wurde 1912 geboren und wuchs in einem sozialdemokratischen Elternhaus auf. Sein Vater verlor 1933 sofort seine Stellung als Bezirksoberschulrat im sächsischen Löbau; 1945 wurde er als Ministerialrat in Dresden reaktiviert. Doch dokumentiert das Kriegstagebuch, das Werner Viehweg 1941/42 in Polen und Russland führte, wie regimekonform er und auch seine beiden Brüder waren – trotz sozialistischer Erziehung.
Auf dem Marsch Richtung Ukraine notierte Viehweg: »Auffallend die vielen Juden in Polen. Ich lernte sie in ihrem Dreck so richtig kennen, als ich unverhofft ins Judenviertel kam. Überall saßen die ekelhaften Gestalten vor ihren vor Dreck starrenden Läden und mauschelten jiddisch.« Aus der Ukraine berichtete er: »In der Nähe hatte vor einigen Stunden ein Überfall versprengter Russen auf einen Trupp Flaksoldaten stattgefunden; sechs Mann waren dabei ermordet worden. Bei der Gegenaktion schnappte man an die 100 Russen, die größtenteils erschossen wurden. Nur einige hatten eine Gnadenfrist erhalten, um verhört zu werden.« Am 13. August 1941 notierte er: »Dann bummelte ich durch die trostlose Stadt, als dauerndes Schießen verriet, dass eine Erschießung im Gange war. Ich kam gerade hin, als die letzten beiden Raten drankamen. Jedes Mal wurden sechs Mann an die Grube geführt. Ein Ukrainer gab ihnen Anweisungen ›Kopf hoch! Mehr links! Mehr rechts!‹ – dann kommandierte ein SS-Mann und die Schüsse knallten. Lautlos sackten die Leute zusammen und fielen in die Grube. Wer sich noch regte, bekam einige Schüsse mit der MP. Die Leichen lagen wie Heringe in dem Loch. Ein ekelhafter Blutgeruch drang von dort heraus.«
Neben der beifällig-passiven Teilnahme an weiteren Massenmorden notierte unser sächsischer Infanterist, wie er das Abbrennen halber Dörfer bewerkstelligte, wie »das Organisationskommando« Schweine und Hühner einfing sowie Honig, Getreide und Gemüse requirierte oder wie man sich in einer kühlen Oktobernacht in der Nähe von Kiew behalf: »Schnell wurden die Schulbänke zerkloppt und in den Ofen gesteckt, so hatten wir es herrlich warm.« An anderer Stelle redete er zu sich selbst: »Nur gut, dass ich mir gestern ein paar wundervolle Stiefel von einem Gefangenen besorgt hatte.« Möchte jemand in diesem Plenarsaal auf diesen ansonsten durchschnittlichen, gewiss gut und menschenfreundlich erzogenen Soldaten der Deutschen Wehrmacht stolz sein?
Werner Viehweg fand am 8. Februar 1942 den sogenannten Heldentod. Wir sollten auch seiner gedenken, allerdings mit Schaudern vor den menschlichen Abgründen, aber auch mit dem selbstkritischen und demütigen Wissen, wie schnell Menschen verrohen und das nur scheinbar feste Korsett bürgerlicher Kultiviertheit abschütteln können. Auch Werner Viehweg war einer von uns. Kein Fremdkörper. Er gehört zu Deutschland, zur deutschen Geschichte. Vergessen wir ihn nicht, indem wir uns bequem mit den Opfern des nationalsozialistischen Volksstaats identifizieren und uns einbilden, wir Heutigen stünden auf der moralisch sicheren Seite.
Indirekt verweist das Tagebuch auf die üblichen Beschönigungen familiärer Nazivergangenheiten, die so lauten: »Unser Großvater Erich wurde 1933 als SPD-Schulrat entlassen: Wir waren Opfer, durch und durch antifaschistisch!« Aber Vater Erich Viehweg entschied sich früh und in der DDR gegen ein solches Märchen, bewahrte das Tagebuch in der Familie – zur mahnenden Erinnerung. Das ehrt ihn. So konnte später eine Abschrift entstehen.
Die meisten Deutschen schwiegen jedoch 1945, vernichteten Dokumente und flüchteten ins Vergessen. Zunächst bezeichneten sie die Niederlage vom 8. Mai 1945 als Zusammenbruch, dann faselten sie von der Stunde null, später war die Rede vom Neuanfang – Begriffe, mit denen sie versuchten, die begangenen Verbrechen geschichtlich zu amputieren. Ohne Erfolg. Auch wenn wir Heutigen es selten aussprechen, begreifen wir den Mai 1945 doch weit überwiegend als den Beginn der menschlichen, kulturellen und politischen Wiedergeburt unseres Landes. Nicht auszudenken, wenn die Deutschen – also »wir« – diesen Krieg gewonnen hätten. Welche Denkmäler wären errichtet worden? Wer alles hätte Verdienstkreuze, Ehrenbürgerschaften, Straßennamen und Preise bekommen? »Wenn es so weitergegangen wäre«, überlegte ein polnischer Autor 1973, »wer weiß, wie viele Tagebücher und Erinnerungen bis heute in Deutschland erschienen wären, vielleicht mit Titeln wie ›Ich war in der politischen Abteilung des KL Auschwitz‹ oder ›Ich vernichtete 600000 Feinde des Dritten Reiches‹ oder ›Buchenwald-Majdanek-Mauthausen. Kampfetappen eines treuen SS-Mannes‹.« Apropos »treuer SS-Mann«:
In der Gegenwart werden gelegentlich kaum mehr verhandlungsfähige Fünfundneunzigjährige wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht gestellt, weil sie in einem KZ-Lager als Wachleute oder auf der Schreibstube tätig waren. Wären solche Prozesse nach den heute angewandten strafrechtlichen Kriterien zwischen 1950 und 1970 in den drei Nachfolgestaaten des Großdeutschen Reiches – DDR, BRD und Österreich – geführt worden, dann hätten mindestens 300000 deutsche und österreichische Männer und einige Zehntausend Frauen wegen solcher Taten zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden müssen. Das hätten die Gesellschaften und Millionen betroffene Familienmitglieder nicht ertragen. Oft geht uns der auf Distanz bedachte Begriff »SS-Scherge« allzu leicht über die Lippen. Denn 1945 stammten Tausende KZ-Wachmänner aus der Wehrmacht; nach schweren Kämpfen wurden sie dort nicht selten zur Erholung eingesetzt. Frauen wurden in der zweiten Kriegshälfte für gewöhnlich über die Arbeitsämter als KZ-Aufseherinnen rekrutiert. Eine Mitgliedschaft in der NSDAP oder besondere weltanschauliche Schulung in der SS waren dafür nicht erforderlich.
In Thüringen dauerte der Nationalsozialismus bekanntlich nicht zwölf, sondern rund 15 Jahre. Mit einer Unterbrechung stellte die NSDAP hier seit dem 23. Januar 1930 den ersten nationalsozialistischen Minister, den späteren Reichsinnenminister Wilhelm Frick, und Ende August 1932 wurde Gauleiter Fritz Sauckel nach einem glänzenden Wahlerfolg der NSDAP zum Chef der Landesregierung gewählt. Die frühen Siege der NSDAP gingen mit sprachlicher Verrohung einher. So beschimpfte Fritz Sauckel, Abgeordneter und Thüringer Gauleiter der NSDAP, 1931 seine Konkurrenten der bürgerlichen Parteien als »Verräter«, »Betrüger«, »trottelhafte Greise«, »Leisetreter« oder »bürgerliche Schlappschwänze«. Nachdem die erste Regierung mit der NSDAP gescheitert war, rief Sauckel im April 1931 zur Jagd auf die Demokraten: »Wir kommen wieder, und über Ihre Parteileichname spaziert das deutsche Volk!«
Als Volksbildungsminister des Landes Thüringen gab Frick 1930 den folgenden Erlass heraus: »Seit Jahren machen sich fast auf allen kulturellen Gebieten in steigendem Maße fremdrassige Einflüsse geltend, die die sittlichen Kräfte des deutschen Volkstums zu unterwühlen geeignet sind. Einen breiten Raum nehmen dabei die Erzeugnisse ein, die – wie Jazzband- und Schlagzeug-Musik, Negertänze, Negergesänge, Negerstücke – eine Verherrlichung des Negertums darstellen und dem deutschen Kulturempfinden ins Gesicht schlagen.« Laut Begründung sollte »die Verseuchung deutschen Volkstums durch fremdrassige Unkultur« »mit aller Schärfe« gestoppt werden. Unter der Überschrift »Wider die Negerkultur – für deutsches Volkstum« steht dieser Text im Amtsblatt des Thüringischen Ministeriums für Volksbildung vom 22. April 1930.
Dem damals in Weimar formulierten Verständnis von deutscher Leitkultur entspricht heute die in äußerlich gepflegtem Ton vorgetragene Bemerkung des AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland: Die Leute fänden Jérôme Boateng zwar »als Fußballspieler gut« – »aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben«. Dazu passend behaupten rechtsradikale Ideologen wie Björn Höcke, »die brutale Verdrängung der Deutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet« sei »heute Teil der Demographiestrategie der Bundesregierung«. Wo Adolf Hitler agitierte, »der schwerste Kampf« müsse »nicht mehr gegen die feindlichen Völker, sondern gegen das internationale Kapital ausgefochten werden« – gemeint war das angeblich »jüdische« – geht es bei Höcke um »die Strukturen des globalen Geldmachtkomplexes«; aus dem »nationalen Sozialismus« und der »Volksgemeinschaft« wird bei ihm »solidarischer Patriotismus«.
In seiner bekannten »Vogelschiss«-Rede setzte Gauland der volksgestützten national-sozialen Verbrechensherrschaft »über tausend Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte« entgegen. Damit meinte er auch Martin Luther, sprich die protestantische Reformation. Aber 1932/33 wählte jeder zweite Protestant Hitler, jedoch nur jeder vierte Katholik. Bei den Kirchenwahlen vom 23. Juni 1933 errangen die sogenannten Deutschen Christen, also die nazifreundliche Fraktion der evangelischen Kirchen, in Thüringen 88 Prozent der abgegebenen Stimmen, und das bei ungewöhnlich hoher Wahlbeteiligung. Am 12. November 1933 ließ der gewählte Vorstand der Thüringer Landeskirche diesen Text von den Kanzeln verlesen: »Schuldige Dankespflicht gegen Gott und Adolf Hitler treibt uns, uns feierlich und einmütig hinter diesen Mann zu stellen, der unserem Volke und der Welt gesandt ist, die Macht der Finsternis zu überwinden! Wir rufen darum unsere Gemeinden auf, gleichen Sinnes mit uns sich als ein einig’ Volk von Brüdern hinter den Führer zu stellen.«
11 – in Worten: elf – evangelische Landeskirchen gründeten 1938 das »Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben« in Eisenach, ausgerechnet am Fuß der Wartburg, der Zuflucht Martin Luthers. Der Direktor dieses evangelischen Verbrecherinstituts war der später in der DDR noch aktive und anerkannte Jenenser Theologieprofessor Walter Grundmann. Er forderte 1942 unter dem Titel »Das religiöse Gesicht des Judentums«: »Der Jude muss als feindlicher und schädlicher Fremder betrachtet werden und von jeder Einflussnahme ausgeschaltet werden. In diesem notwendigen Prozess fällt der deutschen Geisteswissenschaft die Aufgabe zu, das geistige und religiöse Gesicht des Judentums scharf zu erkennen.«
Auf die Frage, was das Besondere an unserer Kultur sei, erwiderte Gauland: »Es gibt Bach und Goethe und Händel, es gibt Thomas Mann.« Aber ähnlich dem Protestantismus wurden 1933 alle diese Namen von Leuten verraten, die sich für Träger der deutschen Kultur hielten, und es vor 1933 und oft auch nach 1945 tatsächlich waren – hochgebildete Männer und Frauen, die zu Helfern und Exekutoren der Barbarei und zu Propagandisten des Verbrechens wurden. Hannah Arendt sprach vom Bündnis zwischen Mob und Elite.
Der von Gauland genannte Johann Sebastian Bach, der in Eisenach, Ohrdruf, Weimar, Mühlhausen und Arnstadt als Kantor gewirkt hatte, war bald nach seinem Tod von der deutschen Kulturwelt vergessen worden. Wiederentdeckt hat ihn und seine Werke Felix Mendelssohn Bartholdy. Aber dessen als »jüdisch« gebrandmarkte Werke verschwanden 1933 binnen Tagen von den Programmzetteln, hingegen wurde Bach, der französischen und italienischen Einflüssen zugeneigt war, zum Inbegriff »deutscher Stammesart« umgebogen. So steht es in jenem Aufruf, mit dem führende protestantische Kantoren im Frühjahr verhindern wollten, dass »unserem Volk eine nichtbodenständige, kosmopolitische Kirchenmusik dargeboten wird«. Zu den Initiatoren gehörte Günther Ramin, Thomaskantor in Leipzig von 1940 bis zu seinem Tod 1956. Bruno Walter, der bessere Kapellmeister, der seit 1929 das Leipziger Gewandhausorchester dirigiert hatte, musste die Stadt 1933 seiner »fremden Rasse« wegen verlassen. Der Naziprofiteur Ramin wurde in der DDR wie in der Bundesrepublik mit Sonderbriefmarken geehrt.
Auch der weltoffene, strikt antinationalistische Johann Wolfgang von Goethe wurde von der noblen Goethe-Gesellschaft in das System des Bösen gezwungen. Die Erweiterung des Goethemuseums am Weimarer Frauenplan stammt aus dem Jahr 1935. Im Vestibül prangten bis 1945 eine bronzene Hitlerbüste und diese Ehrentafel: »Erweiterungsbau geschaffen durch die hochherzige Unterstützung des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler im dritten Jahr seiner Regierung 1935.« Als Direktor des Goethe-Nationalmuseums amtierte von 1918 bis zum Tode 1949 der Germanist Professor Hans Wahl. 1928 hatte er den antisemitischen Kampfbund für deutsche Kultur mitbegründet. Wie Heinrich Lilienfein, der von 1920 bis zu seinem Tode 1952 Generalsekretär der Deutschen Schillerstiftung in Weimar gewesen war, ruht Hans Wahl in einem Ehrengrab in nächster Nähe zu Goethe und Friedrich Schiller. Auch Lilienfein, einer meiner Großonkel, hatte 1933 das von 88 deutschen Schriftstellern unterzeichnete, an Hitler gerichtete »Gelöbnis treuester Gefolgschaft« abgelegt. Wenn deutsche Hochkultur, die sich im mitteldeutschen Raum zweifellos besonders stark entwickelt hatte, derart missbraucht werden konnte, dann bleibt Skepsis geboten.
Nun zu Alexander Gaulands letztgenanntem Zeugen: Thomas Mann. Er weigerte sich bis zu seinem Tode mit guten Gründen, die 1944 erworbene US-amerikanische Staatsbürgerschaft abzulegen und wieder deutscher Staatsbürger zu werden. Zu Leuten, die fremdenfeindliche Tiraden schwangen und dafür trommelten, dass Deutschland ausschließlich sogenannten Blutsdeutschen gehören solle, bemerkte er 1937: Aus »einem völkergesellschaftlichen Minderwertigkeitsgefühl« erwuchs ostentative Überheblichkeit. »Dünkelmütiger Provinzialismus« machte »die Atmosphäre verdorben und stockig« und das Wort »international« zum Schimpfwort. 1945 resümierte er: »Der deutsche Freiheitsbegriff war immer nach außen gerichtet; er meinte das Recht, deutsch zu sein, nur deutsch und nichts anderes.« Er beinhaltete nicht die Freiheit der Menschen, sondern die »für das deutsche Vaterland«. Er war – und ist – Ausdruck von »völkischem Egoismus« und »militantem Knechtssinn«.
Völkischer Egoismus ebnete den Weg in den Abgrund namens Hitlerdeutschland. Denn parallel zum Angriff auf die Juden definierte die nationalsozialistische Regierung ihr Staatsvolk als Einheit gleichartiger Volksgenossen und -genossinnen. Weil sie für diese angeblich homogene Menschengruppe mehr innere Gleichheit versprach, gewann sie die gesellschaftliche Mehrheit. Das gelang umso leichter, als die Deutschen seit 1929 in immer größerer Zahl die Werte der modernen liberalen Gesellschaft ablehnten und volkskollektivistischen Utopien den Vorzug gaben. Auf dieser gesellschaftlichen Grundlage wurden Buchenwald, Treblinka, Auschwitz und Bergen-Belsen möglich.
Am 19. Februar 1945 schworen die so vielen Nationen angehörenden Überlebenden von Buchenwald, für eine »Welt des Friedens und der Freiheit« einzutreten. In diesem Sinne danken wir den Millionen ausländischen Soldaten, unter ihnen – gerade hier in Thüringen – den vielen Soldaten afroamerikanischer Herkunft: Sie befreiten die Gefangenen der Konzentrations- und Vernichtungslager, die todgeweihten Zwangsarbeiter, die Insassen der Heil- und Pflegeanstalten – und nicht zuletzt befreiten sie die Deutschen von sich selbst.
Was danach geschah: Anders als alle anderen Abgeordneten erhoben sich die der AfD am Ende der Rede nicht – sitzend angeführt von Björn Höcke. Nach der Gedenkveranstaltung meldete sich Stefan Möller, Co-Vorsitzender der Thüringer AfD, schriftlich mit diesen Sätzen: Aus Alys Rede habe »Hass und Verachtung« gesprochen – und »wir«, die AfD, »schämen uns dafür (…) und entschuldigen uns hierfür bei den anwesenden Überlebenden der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft«. Als am Nachmittag im ehemaligen KZ Buchenwald auf dem Ettersberg der Ermordeten gedacht wurde, hatte die Leitung der Gedenkstätte für Funktionäre der AfD ein Hausverbot erlassen, das von einigen Polizisten durchgesetzt wurde.
Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus, München 1955 (und seither vielfach neu aufgelegt).
Éva Fahidi: Anima rerum. Meine Münchmühle in Allendorf und meine wahren Geschichten, Stadtallendorf 2004; 2011 neu aufgelegt unter dem Titel »Seele der Dinge«.
Walter Grundmann, Karl Friedrich Euler: Das religiöse Gesicht des Judentums. Entstehung und Art (Veröffentlichung des Instituts zur Erforschung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben, Eisenach), Leipzig 1942.
Lilly (Weiss) Kertész: Von den Flammen verzehrt. Erinnerung einer ungarischen Jüdin, Bremen 1999.
Thomas Mann: Sieben Manifeste zur jüdischen Frage, hg. v. Walter A. Berendsohn, Darmstadt 1966.
Fred K. Prieberg: Musik im NS-Staat, Frankfurt am Main 1982.
Martin Riesenburger: Das Licht verlöschte nicht. Ein Zeugnis aus der Nacht des Faschismus, Berlin 1960.
Rudolf Schottlaender: Trotz allem ein Deutscher. Mein Lebensweg seit Jahrhundertbeginn, Freiburg i.Br. 1986; in erw. Form unter dem Titel »Deutschsein fünfmal anders. Erinnerungen eines Unangepassten« (Berlin 2017), hg. und eingel. von Irene Selle (geb. Schottlaender) und Moritz Reininghaus.
Das Böse im Guten, das Gute im Bösen
Predigt zum 139. Psalm in Darmstadt, 2018
Liebe Gemeinde, wir feiern heute den vierten Sonntag der Fastenzeit, den dritten vor Ostern – deshalb heißt er imperativisch Laetare: Freue dich! Freue dich darauf, dass Jesus Christus die Menschheit mit seinem Kreuzestod vom Bösen erlöst. Zwar wird diese Hoffnung unerfüllt bleiben, solange Menschen und Völker auf Erden leben, aber immerhin fordert die flehentliche Bitte im Vaterunser »… erlöse uns von dem Bösen« uns Irdische dazu auf, darüber nachzudenken, was denn das Böse in unserem Leben ist, wie es im Diesseits und in uns selbst gezügelt werden kann.
Martin Schneider, der langjährige Pfarrer Ihrer Gemeinde, der bald in den Ruhestand wechseln wird, hat uns, den Gästen auf der Kanzel ihrer Stadtkirche, aufgegeben, zum 139. Psalm des Alten Testaments zu predigen. Mir teilte er den Schluss zu – die ziemlich herben, ja blutrünstigen Verse 19 bis 22, gefolgt von den helleren, gottergebenen Versen 23 und 24. Die sechs Verse vibrieren zwischen Hass und Gewalt, Demut und Selbstzweifel (»… ob bei mir Weg der Trübung ist«).
In der von Martin Buber und Franz Rosenzweig 1929 aus dem Althebräischen verdeutschten Fassung lauten sie: (19) O dass du, Gott, umbrächtest den Frevler: »Ihr Blutmänner, weichet von mir!«, (20) sie, die dich zu Ränken besprechen, es hinheben auf das Wahnhafte, deine Gegner! (21) Hasse ich deine Hasser nicht, DU, widerts mich der dir Aufständischen nicht? (22) Ich hasse sie mit der Allheit meines Hasses, mir zu Feinden sind sie geworden. (23) Erforsche, Gottherr, mich, kenne mein Herz, prüfe mich, kenne meine Sorgen, (24) sieh, ob bei mir Weg der Trübung ist, und leite mich auf dem Wege der Weltzeit!«
Der Psalm ist etwa 3000 Jahre alt und wird in der ersten Zeile König David zugeschrieben. Doch stammt er wie alle anderen so bezeichneten Psalter Davids nicht von diesem, sondern wurde zu einem Zeitpunkt verfasst, als der Eroberer Jerusalems und Staatsgründer Israels bereits tot und zur legendären, geschichtlich wirkungsmächtigen Figur geworden war, die auch in der Erinnerung ambivalent blieb.
Die Samuel-Bücher zeigen ihn als Kämpfer, Frauenhelden und gelegentlich auch mörderischen Intriganten, sie zeigen ihn als listigen Sieger über den Riesen Goliath und als kühl kalkulierenden Kriegsherrn, der die Philister vernichtet, Aufstände im Inneren gnadenlos niederwirft und mit kriegerischen Mitteln die Einigung der Stämme Israels erzwingt. Die Bibel führt David als Erfolgsmann vor, dem nicht selten der Zweck die Mittel heiligt. So körperlich und sittlich makellos wie ihn Michelangelo vor 500 Jahren formte und wie er noch heute auf der Piazza della Signoria in Florenz steht, war der alttestamentarische Nationalheld gewiss nicht. Auch ihn trieben Ehrgeiz und Niedertracht, sexuelle Gier, Liebe, Misstrauen und Verachtung, Großmut und Bosheit, taktisches Geschick und Prunksucht. Mittels militärischer und politischer Siege erzeugte er, wie es im Kommentar des Jüdischen Lexikons von 1927 heißt, »Furcht, Bewunderung und Liebe«; und weiter: »Während er den toten und unschädlichen Gegnern Liebe erwies, schüchterte er die gefährlichen Lebenden ein.«
Glaubt man den letzten Zeilen unseres 139. Psalms, die dem schon zitierten Hassausbruch folgen, dann zeichnete David eines aus: Er kannte seine Schwächen. Zumindest vor Gott fand er zu selbstkritischer Demut, zu Ergebenheit, Reue, Hingabe und Umkehr. Ich wiederhole die schon verlesenen drei Schlusssätze, nun jedoch, und zwar zum Vergleich, in den Worten, die Martin Luther fand: »Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich und erfahre, wie ich’s meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.«
Der theologisch wichtigste Unterschied zwischen den Übersetzungen von Buber-Rosenzweig und Luther steht am Ende: »Leite mich auf ewigem Wege«, übersetzt Luther, jedoch verdeutschen Buber und Rosenzweig »und leite mich auf dem Wege der Weltzeit«. Was hat es mit dem Begriff Weltzeit, hebräisch olam, auf sich? Er unterscheidet sich zum einen von der individuell gefassten Menschenzeit, verstanden als die Lebensdauer einer Person, und zum anderen von der Gotteszeit – einer Zeitspanne ohne Anfang und Ende, die in christlicher Tradition als Ewigkeit verstanden wird.
Die christlichen Übertragungen, die allesamt olam in »ewigen Weg«, »ewigen Bestand« oder »Weg der Ewigkeit« umdeuten, erscheinen mir falsch. Denn olam – Weltzeit – hebt gerade nicht auf die den Irdischen verschlossene Ewigkeit ab, sondern auf den intergenerationellen Zusammenhang – die überschaubare Zeit zwischen unseren Urgroßeltern und Urenkeln. Das sind viele Jahrzehnte vor und nach unserem eigenen Leben. Daraus ergibt sich Verantwortung im Diesseits. Der Mensch soll über die zeitlichen Grenzen seines Lebens hinaus denken und mit der Schöpfung so umgehen, dass sie von seinen Nachfahren weiterhin als »schön« empfunden wird, wie es in althebräischen Texten heißt. Der aufs praktische Verhalten gerichtete Begriff Weltzeit gebietet jedem Einzelnen, den ihm möglichen Beitrag zu einer für Mitmenschen, Natur und Kindeskinder verträglichen Lebensweise gewissenhaft zu prüfen und entsprechend zu leben.
So weit das demütige, an die Lebenden adressierte Ende unseres Psalms. In den vier Versen davor grollen »die Allheit des Hasses« und der Wunsch, »O dass du, Gott, umbrächtest den Frevler«. Das Verfluchen, Hassen und Todestrachten geschieht nicht im Namen des Bösen, sondern im Namen des Guten – und genau darüber müssen wir sprechen. Die angeblichen Frevler sollen des Todes sein, werden, um Luthers Version zu zitieren, als hinterhältig und tückisch beschrieben, als gefährliche, völlig grundlos erzürnte Aggressoren, als Feinde der gerechten Sache, blutdurstig und verabscheuenswürdig. Der derart verengten Charakteristik der anderen, der Gegner, der Fremden, folgt autosuggestive Propaganda, die König David so in den Mund gelegt wird: »Ich hasse sie mit ganzem Ernst; sie sind mir zu Feinden geworden.« Die hier dargelegte Moral funktioniert recht simpel: Der Fremde wird zum Frevler erklärt; weil er Frevler ist, wird er gehasst; weil man ihn hasst, ist er der Feind. Das angeblich Gute legitimiert das Böse.
Nehmen wir ein kleines Beispiel, das sich seit einigen Monaten unweit von hier abspielt – die Hitler-Glocke in der evangelischen Kirche von Herxheim am Berge, versehen mit einem Hakenkreuz und der Inschrift »Alles für’s Vaterland – Adolf Hitler«. Die Glocke hängt in der mehr als tausend Jahre alten Jakobskirche und wurde im Sommer 1934 geweiht. Jenseits des heftig geführten Streits, ob sie hängen bleiben soll oder nicht, steht doch wohl eines fest: Der evangelische Pfarrer, der Gemeindekirchenrat und wahrscheinlich auch die meisten evangelischen Christen von Herxheim waren 1934 mit dieser Glocke einverstanden, sie läutete sie in eine – tatsächlich – neue und – vermeintlich – bessere Epoche. Niemand hatte sie zu diesem Akt des Einverständnisses mit der Regierung Hitler gezwungen. Sie handelten aus freien Stücken.
Das Volk, die geistlichen und weltlichen Führer glaubten, etwas wirklich Gutes zu tun. Sie waren sich einig und zweifelten nicht. Die aktuelle Diskussion verharrt jedoch in entgegengesetzten Überzeugungen. Die einen rufen: Skandal! Wir wollen kein Kreuz mit Haken! Weg damit! Die anderen sagen: Egal, die unschöne Inschrift und Symbolik haben mehr als 70 Jahre niemanden gestört, belassen wir es dabei. Ein weiteres – von mir geteiltes – Argument lautet: Bewahren wir die Hitler-Glocke als Zeichen der Schande! Machen wir sie zur Glocke des Anstoßes! Tilgen wir die Spuren des Bösen nicht! Betrachten wir sie als Mahnung, als Geläut, das uns daran erinnert, dass keiner von uns auf der sicheren Seite steht.