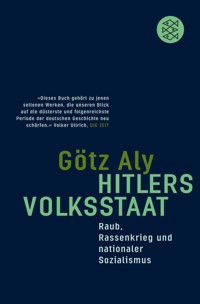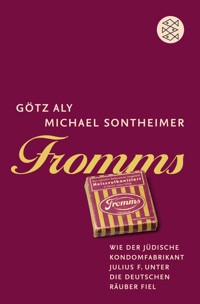9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
***Ein Politbarometer der Deutschen während des Nationalsozialismus*** Über die politischen Stimmungslagen der Deutschen in den Jahren 1939 bis 1945 wurde und wird viel spekuliert, denn es gab damals keine Meinungsumfragen, auf die man zurückgreifen könnte. In diesem Buch unternehmen die Autorinnen und Autoren unter der Federführung des Historikers Götz Aly eine Historische Demoskopie, empirisch abgesichert durch ausgewählte Indikatoren. So wird ermittelt, wie oft Eltern ihren Neugeborenen die Namen Adolf, Horst und Hermann gaben, wie viele Deutsche aus der Kirche austraten oder welche Formeln Angehörige in Nachrufen auf gefallene Soldaten benutzten: Schrieben Sie "Gefallen für Führer, Volk und Vaterland" oder verzichteten Sie auf die Erwähnung des Führers? Auch das Sparverhalten wird analysiert, um herauszufinden, wie die Deutschen ihre Zukunftsaussichten beurteilten. So ergibt sich erstmals ein fundiertes Bild von den politischen Einstellungen der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs, ihrer Zustimmung zur NS-Ideologie, ihrer möglichen Skepsis und ihrer Ängste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Herausgegeben von Götz Aly
Volkes Stimme
Skepsis und Führervertrauen im Nationalsozialismus
Über dieses Buch
Ein Politbarometer der Deutschen während des Nationalsozialismus
Über die politischen Stimmungslagen der Deutschen in den Jahren 1939 bis 1945 wurde und wird viel spekuliert, denn es gab damals keine Meinungsumfragen, auf die man zurückgreifen könnte. In diesem Buch unternehmen die Autorinnen und Autoren unter der Federführung des Historikers Götz Aly eine Historische Demoskopie, empirisch abgesichert durch ausgewählte Indikatoren.
So wird ermittelt, wie oft Eltern ihren Neugeborenen die Namen Adolf, Horst und Hermann gaben, wie viele Deutsche aus der Kirche austraten oder welche Formeln Angehörige in Nachrufen auf gefallene Soldaten benutzten: Schrieben Sie „Gefallen für Führer, Volk und Vaterland“ oder verzichteten Sie auf die Erwähnung des Führers? Auch das Sparverhalten wird analysiert, um herauszufinden, wie die Deutschen ihre Zukunftsaussichten beurteilten.
So ergibt sich erstmals ein fundiertes Bild von den politischen Einstellungen der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs, ihrer Zustimmung zur NS-Ideologie, ihrer möglichen Skepsis und ihrer Ängste.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2006
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403261-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Götz Aly
Historische Demoskopie
Oliver Lorenz
Die Adolf-Kurve 1932–1945
Nationale Namensmoden
Ein Spezialfall, der Name des Führers
Horst, ein Liebling der Bewegung
Hermann, urig und volksnah
Euphorie, Ernüchterung, Ende
Sven Granzow, Bettina Müller-Sidibé, Andrea Simml
Gottvertrauen und Führerglaube
Verspätete Säkularisierung
Zwischen Religion und Politik
Kirchenaustritte 1937–1941
Irdische Selbstgewissheit
Zweifel und Kriegsangst
Philipp Kratz
Sparen für das kleine Glück
Geld, ein heikler Indikator
Spargroschen für den Krieg
Drei Sparformen im Stimmungstest
Minimales Vertrauen in den Staat
Holger Schlüter
Terrorinstanz Volksgerichtshof
Druck und Gegendruck
Wandel der Verfolgungspraxis
Todesurteile gegen Deutsche
Oliver Schmitt, Sandra Westenberger
Der feine Unterschied im Heldentod
Gefallen für Führer oder Vaterland
Kriterien unserer Untersuchung
Die NS-Quote im steilen Fall
Albert Müller
Gesamtstatistik – ein Experiment
Methodische Einschränkungen
Zunahme, Abnahme, Konstanz 1932–1944
Vierteljahresanalyse 1937–1944
Götz Aly
Ideologie, Skepsis und Angst
Das Ende des Führer-Mythos
Mehr Fleisch und Kraft durch Furcht
Dokument
Görings Erntedankrede von 1942
Editorische Vorbemerkung
Die Rede, nach der Tonaufzeichnung
Anhang
Verzeichnis der Diagramme
Die Adolf-Kurve 1932–1945
Gottvertrauen und Führerglaube
Sparen für das kleine Glück
Terrorinstanz Volksgerichtshof
Der feine Unterschied im Heldentod
Gesamtstatistik – ein Experiment
Statistische Daten
Tabelle 1: Namen Adolf, Horst, Hermann (in Prozent)
Tabelle 2: Sparen
Tabelle 3: Todesanzeigen für »Führer, Volk und Vaterland« (in Prozent)
Tabelle 4: Kirchenaustritte, Altreich in ausgewählten Regionen
Tabelle 5: Gerichtsurteile am Volksgerichtshof
Tabelle 6: Summe der Indikatorenwerte und »Stimmungs«-Variable, 1932–1944, Jahresdaten
Tabelle 7: Summe der Indikatorenwerte und »Stimmungs«-Variable, 1937–1944, Quartalsdaten
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Autorinnen und Autoren
Zur Erinnerung an unseren Mitautor Sven Granzow (1977–2006)
Götz Aly
Historische Demoskopie
Heute untersuchen demoskopische Institute, was die Leute denken. Tagtäglich können systematisch und repräsentativ Befragte mit Ja oder Nein antworten, auf einer Skala Noten verteilen oder einfach sagen: »Weiß nicht«, »bin unentschieden«. Das Politbarometer, die Sonntagsfrage, der Geschäftsklimaindex sind vertraute Größen der Gegenwart. Die NS-Führer nutzten die sozialwissenschaftlich gestützte Demoskopie noch nicht. Dennoch interessierten sie sich stark für die (Volks-)Stimmung; sie buhlten um die Mehrheit der Deutschen. Deshalb schickten sie Spitzel aus, ließen Behördenchefs regelmäßig über die örtliche oder regionale Volkslaune berichten und versuchten mit allerlei populistischen Maßnahmen, die innenpolitische Betriebstemperatur warm zu halten.[1]
Zum Volk im Sinne des Nationalsozialismus zählten nicht allein die ideologisch Willigen, sondern alle rassisch und politisch für gut oder wenigstens für unauffällig befundenen Arier. Das waren 95 Prozent der deutschen Staatsbürger. Was Hitler als Stimmung bezeichnete, nennen wir heute öffentliche Meinung. Dahinter verbirgt sich mehr als eine wechselnde Sprachmode. Anders als der Begriff Stimmung setzt öffentliche Meinung den republikanischen Verfassungsstaat voraus: allgemeine und parlamentarische Diskussionen, die gesellschaftlich gewollte und institutionell organisierte Differenz, die Gewaltenteilung, den freien Journalismus, das ständige Hin und Her um die gemeinsamen Angelegenheiten. All das fehlte im Dritten Reich, war zugunsten eines möglichst homogenen Denkens und Handelns (»Gleichschaltung«) abgeschafft worden. Die Diktatur atomisierte die Gesellschaft. Das führte zu einer für totalitäre Regime typischen Entpolitisierung im Zeichen der Politik.
Wirksamer als mit den Mitteln des Terrors erreichte der Hitler-Staat seine Ziele mit der Zerstörung der öffentlichen Räume, in denen normalerweise die unterschiedlichen Interessen formuliert und Kompromisse gesucht werden. Für dieses Werk gesellschaftlicher (Selbst-)Zersetzung bildeten außenpolitische Konflikte, militärische Aggression, gesteigert zum totalen Krieg, einen idealen Nährboden. So wurden die Deutschen bald auf die Sphäre des Privaten, auf die persönlichen Ängste und Freuden zurückgeworfen. Parolen wie »Psst! Feind hört mit!« bewirkten ein Übriges.
Das Wort Stimmung gehört zum Vokabular des Totalitarismus. Der Begriff »öffentliche Meinung« erscheint aus den genannten Gründen unangemessen; von einer irgendwo formulierten volonté génerale kann in der NS-Zeit keine Rede sein. Eher müsste von unöffentlicher Meinung gesprochen werden, von Prozessen kollektiver Verständigung, die sich osmotisch in den subkutanen Schichten der Gesellschaft vollzogen. Ihnen haftete etwas Beschränktes, Verdruckstes an. Sie waren Ausdruck des individuellen, mit der Gesamtheit der Deutschen nur eingeschränkt rückgekoppelten Überzeugungswandels. Am ehesten scheint mir der Begriff »politische Befindlichkeit« brauchbar zu sein.
Soweit die beiden anderen Begriffe dennoch verwendet werden, geschieht das unter den formulierten Vorbehalten. Ganz kann darauf nicht verzichtet werden, zum einen mit Rücksicht auf die sprachliche Vielfalt, zum anderen aus faktischen Gründen. Der NS-Führung gelang es niemals, die gesamte deutsche Gesellschaft zu durchdringen. Mit einer gewissen Notwendigkeit blieben die über Jahrhunderte gewachsenen Kirchen auch in dieser Diktatur einigermaßen intakte Orte, an denen sich zu einzelnen Fragen öffentliche Meinung bildete und im Übrigen wesentlich stärker hätte bilden können.
Die Geistlichkeit verkannte ihre Chance. In der übergroßen Mehrheit blieb sie unfähig, den Trumpf gegen die Herrschaft des Bösen auszuspielen, über den bald hauptsächlich sie verfügte: nämlich einfach öffentlich zu machen, was gesellschaftlich beschwiegen und individuell verdrängt werden sollte. Darin, und nicht im nazifreundlichen Verhalten einzelner Repräsentanten liegt das Hauptversagen der beiden Kirchen: Sie verzichteten darauf, die Macht konsequent zu nutzen, die ihnen objektiv zugewachsen war, weil die Gottesdienste, Andachten, Tauf-, Trauungs- und Begräbnisfeiern die letzen Orte gesellschaftlicher Öffentlichkeit bildeten.
Früh offenbarte der in vielen Einzelfragen regimekritische Michael Kardinal von Faulhaber, Oberhirte des Erzbistums München und Freising, seinen elenden Mangel an politischer Geistesgegenwart in einem Brief. Er dokumentiert exemplarisch das wahrlich himmelschreiende Unverständnis der totalitären Gefahr. Das Schreiben, mit dem Faulhaber einem wegen der Judenhetze zutiefst besorgten Katholiken antwortete, zeichnete früh die schiefe Bahn vor, auf der die zivilen Kräfte der deutschen Gesellschaft ins Rutschen gerieten und schließlich den Holocaust begünstigten. »Dieses Vorgehen gegen die Juden«, so schrieb Faulhaber im April 1933, »ist derart unchristlich, dass jeder Christ, nicht bloß jeder Priester, dagegen auftreten müsste. Für die kirchlichen Oberbehörden bestehen weit wichtigere Gegenwartsfragen; denn Schule, der Weiterbestand der katholischen Vereine, Sterilisierung sind für das Christentum in unserer Heimat noch wichtiger, zumal man annehmen darf und zum Teil schon erlebte, dass die Juden sich selber helfen können, dass wir also keinen Grund haben, der Regierung einen Grund zu geben, um die Judenhetze in eine Jesuitenhetze umzubiegen. Ich bekomme von verschiedenen Seiten die Anfrage, warum die Kirche nichts gegen die Judenverfolgung tue. Ich bin darüber befremdet; denn bei einer Hetze gegen Katholiken oder gegen den Bischof hat kein Mensch gefragt, was man gegen diese Hetze tun könne. Das ist und bleibt das Geheimnis der Passion.«[2]
Faulhaber konnte im April 1933 nicht wissen, in welcher Weise sich das »derart unchristliche« Treiben der Staatsführung noch steigern ließ. Das gilt selbst für einen Mann wie Dietrich Bonhoeffer, der sich damals lediglich für die Rechte der Judenchristen innerhalb der evangelischen Landeskirchen einsetzte, nicht jedoch für die Juden in ihrer Gesamtheit.[3] Bonhoeffer blieb übrigens bei dieser Haltung, wie man in der neunzehnbändigen Edition seiner Werke und Briefe nachlesen kann. Der ihm später so gerne zugeschriebene Satz »Wer nicht für die Juden schreit, darf auch nicht gregorianisch singen!«, ist nirgendwo schriftlich überliefert.[4] Aus einem falschen Attentismus, aus dem Selbstverständnis des eingebildeten Unpolitischen verstießen Faulhaber wie Bonhoeffer gegen das weltlich und gegen das göttlich Gebotene.
In den folgenden Untersuchungen wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß die Deutschen zwischen 1933 und 1945 der Nazi-Ideologie folgten, sich kriegsbegeistert und hitlertreu zeigten, sich skeptisch, eingeschüchtert oder gleichgültig verhielten, widerständig oder nur müde. Das festzustellen ist nicht einfach, wie jeder überprüfen kann, wenn er sich die simple Frage stellt: Wie fühlte ich mich, wie dachte ich in diesem Monat vor so und so vielen Jahren? Die Antwort darauf bewirkt zumindest ein Zögern, wenn nicht Ratlosigkeit. Aber wie soll man dann einigermaßen zuverlässig feststellen, in welchen Stimmungslagen sich ein ganzes Volk noch dazu unter den Bedingungen des Krieges und vor mehr als 60 Jahren befand?
In den bislang gängigen zeitgeschichtlichen Arbeiten wird nach einem fragwürdigen Rezept verfahren: Man nehme die Berichte des Sicherheitsdienstes (»Meldungen aus dem Reich«), vermenge sie sorgsam mit Mutmaßungen über die Volksstimmung, die sich etwa in Goebbels’ Tagebüchern und in amtlichen Quellen finden, und füge der so gewonnenen Masse nach Belieben Ingredienzen aus Feldpostbriefen und privaten Tagebüchern hinzu – und schon scheint klar, wie sich die deutsche Gesellschaft zur Zeit des Dritten Reiches gefühlt haben wird.[5]
Die mit solchen Techniken gewonnenen Ergebnisse erweisen sich als methodisch unbefriedigend. »Beweisen« kann man damit fast alles und folglich nichts. Auf dieser Basis lässt sich beispielsweise der Streit um die Rolle Hitlers nicht klären, dessen diskursive Pole die Begriffe »charismatischer Führer« (Wehler) und »schwacher Diktator« (H. Mommsen) markieren. Das Problem liegt in der nicht zu objektivierenden Auswahl von Zitaten und deren Gewichtung. Diejenigen, die so arbeiten, wissen das genau: »Jede Untersuchung eines Korpus von Feldpostbriefen wird«, so schreibt Sven Oliver Müller, »durch die Probleme der Quantifizierbarkeit und Repräsentativität bestimmt. Die Frage, inwieweit aus den Einzelfunden auf Disposition und Verhalten der Gesamtgruppe zu schließen ist, wird keine repräsentative Antwort erfahren können.« Trotz solcher gravierenden methodischen Einschränkungen arbeitet Müller dann eben doch genau mit diesem Material und behauptet, er könne damit »unter dem Gesichtspunkt möglichst hoher Plausibilität« seine Argumente »untermauern«.[6] Er kann es nicht.
Anhand unserer Studie lässt sich das geschilderte, methodisch schwach fundierte Vorgehen zumindest in Zweifel ziehen. Das erscheint notwendig, weil auf solche Weise in den vergangenen zehn Jahren unter dem Begriff »Konsensdiktatur« das Bild vom massenhaften, mehr oder weniger begeisterten Mitläufertum entstanden ist. Parallel dazu wird die Zahl der Deutschen, die sich gegenüber der nationalsozialistischen Ideologie als immun oder wenigstens skeptisch erwiesen hat, mittlerweile als relativ klein veranschlagt. Das führte zum Beispiel zu der gerne verbreiteten Behauptung, der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 hätte – selbst bei Gelingen des Stauffenberg-Attentats – angesichts einer angeblich anhaltenden massenhaften Hitler-Treue keine Erfolgschance gehabt.[7] Auch wird immer wieder gesagt, Hitler habe sich 1940, nach dem schnellen Sieg über Frankreich, im Zenit seiner Popularität befunden. Schließlich beharren nicht wenige einflussreiche Historiker auf der Meinung, er habe den Mord an den europäischen Juden im Sommer 1941 »auf dem Höhepunkt der Siegesgewissheit« ins Werk gesetzt, getragen von einer geradezu euphorischen Stimmung der Deutschen während des raschen Vormarsches in der Sowjetunion.[8]
Daran schließt sich die übergeordnete Frage unserer Arbeit an: Wie führungskonform und ideologisiert verhielt sich die deutsche Gesellschaft in den Jahren 1941/42, als die Vernichtungslager geplant und gebaut wurden? Wir neigen nicht dazu, unsere Daten überzubewerten. Doch beeinflusste die innenpolitische Stimmungslage auch diese Entscheidung. Wenn man bedenkt, dass Hitler im Spätsommer 1941 die antikirchliche Politik ebenso bremste wie die Euthanasiemorde, weil sie »die Gemüter« in »einer kritischen Periode des Krieges außerordentlich unzweckmäßig« erhitzen würden,[9] dann kommt es darauf an, möglichst präzise den Rahmen zu formulieren, in dem die Beschlüsse zur öffentlich weithin sichtbaren Deportation der deutschen und europäischen Juden getroffen wurden. Am Ende werden wir einige alte Antworten verwerfen, andere relativieren und – so wir schon keine neuen Erklärungen geben können – wenigstens neue Fragen stellen.
Wie schon gesagt, liegen aus der fraglichen Zeit keine Meinungsumfragen vor. Deshalb versuchen wir, mit Hilfe einiger Indikatoren historische Demoskopie zu betreiben. Dazu benutzen wir uns geeignet erscheinende, einigermaßen leicht greifbare Datenreihen, die wir als numerisch erstarrte Ausflüsse der damaligen politischen Stimmungslagen ansehen.
Als Indikatoren können sich gesellschaftliche Randphänomene durchaus eignen: Zum Beispiel lässt sich anhand der stets marginalen, aber doch schwankenden Häufigkeit von Morden auf die Gewaltbereitschaft oder Friedfertigkeit ganzer Gesellschaften schließen. Aus Gründen der Kontrolle ist es notwendig, verschiedene Indikatoren zu kombinieren. Wir betrachten unsere Ergebnisse nicht als endgültig, sondern als ersten Schritt. Deshalb veröffentlichen wir die Zahlen, die unseren einzelnen Diagrammen zugrunde liegen, auf den Seiten 200 bis 211. Teilweise lassen sich die von uns gewonnenen Resultate mit denen schon vorhandener Studien in Beziehung setzen. Grosso modo bestätigen sie deren Aussagen. Um das Schwanken der politischen Stimmung besser messen zu können, haben wir die Daten – soweit möglich – in Vierteljahresschritten erhoben und die folgenden fünf Indikatoren benutzt:
1. Nationalsozialistische Vornamen. Betrachtet man beispielsweise eine nationalistisch eingestellte, aber nicht dauerhaft regimetreue kinderreiche Pfarrersfamilie aus dem Fränkischen, dann zeigt sich: Die Namengebung für sechs von acht Kindern folgte der Familientradition, während der 1933 geborene Sohn Martin den Zweitnamen Adolf und der 1942 geborene Nachzügler den Namen Hartmut erhielt. Im Anschluss an die Untersuchung, die Brechenmacher und Wolffsohn 1994 für München durchführten, ermittelten wir in Zusammenarbeit mit dem Bürgeramt Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt a.M. die Häufigkeit der damals stark politisierten Vor- und Zweitnamen Adolf, Horst und Hermann für die Geburtsjahrgänge 1932 bis 1945.
2. Kirchenaustritte. Während sich die Spitze der NSDAP aus taktischen Gründen zurückhielt, wurde in den regionalen Gliederungen der Partei und in der SS insgesamt für den Austritt aus den christlichen Kirchen aktiv geworben. Zweifellos galt es in nazistisch aktiven Kreisen als schick, sich »gottgläubig« – gemeint war: gottlos – zu nennen. Die indikatorische Bedeutung der Kirchenaustritte begründet sich mit der Annahme, dass selbst relativ loyale Parteigänger der NSDAP den individuellen Kirchenaustritt – und damit den Bruch mit gesellschaftlich noch weithin akzeptierten Mächten – vom vermuteten Erfolg oder Misserfolg der NS-Herrschaft abhängig machten.
3. Sparverhalten. Die unterschiedlichen Formen von Geldanlagen – wie Neuabschlüsse von Spar- und Bausparverträgen – setzen ein gewisses Maß an Zukunftsvertrauen voraus. Selbstverständlich unterlag die Sparquote im Krieg eigenen Gesetzen. Sie musste massiv zunehmen, weil die Möglichkeiten des Konsums schwanden, zugleich aber die familiären Geldeinkommen erheblich wuchsen. Doch trotz solcher Verzerrungen lassen sich unseres Erachtens auch mit Hilfe dieses nicht ganz einfachen Indikators Einsichten gewinnen. Anders als im Fall der Vornamenvergabe, der Kirchenaustritte und der sogleich noch zu erläuternden Gefallenenanzeigen spielte sich das Sparen nicht in der ideologischen Sphäre ab, sondern folgte handfesten materiellen Erwägungen.
4. Staatliche Gewalt gegen Deutsche. Nach dem Ende der NS-Herrschaft behaupteten viele Deutsche, sie hätten stets mit einem Bein im KZ gestanden. Daraus folgte die exkulpatorische Klage: »Was sollten wir denn machen?« Im Unterschied dazu veranschlagt die neuere Forschung die Angst des Durchschnittsdeutschen vor dem Zugriff des Repressionsapparats als ziemlich gering. Um diese Frage genauer zu fassen, nehmen wir die Todesurteile, die der Volksgerichtshof gegen (altreichs-)deutsche Staatsbürger fällte, als Indikator für den nach innen gerichteten NS-Terror. Er repräsentiert den Aufwand an Gewalt, den das Regime betrieb, um die innenpolitische Stabilität zu wahren. Da den Todesurteilen hohe generalpräventive Bedeutung zukam, kann die Kurve umgekehrt als Indikator für konstantes, steigendes oder fallendes Führungsvertrauen gelesen werden.
5. Gefallenenanzeigen. Wir unterscheiden zwei Hauptgruppen: erstens jene Angehörigen, die ihre im Krieg gefallenen Soldaten mit der Formel »… gefallen für Führer, Volk und Vaterland« öffentlich verabschiedeten (einschließlich zeitüblicher Verstärkungen, etwa »in stolzer Trauer«); zweitens solche Angehörigen, die den Soldatentod des Sohnes oder Gatten nur mit den Worten »… gefallen für Volk und Vaterland« bekanntgaben und den »Führer« nicht nannten (einschließlich aller weiteren Abschwächungen bis hin zum Verzicht auf jegliche patriotische Emphase). Zu diesem Zweck werteten wir die Todesanzeigen für Gefallene in der Frankfurter Zeitung und im Frankfurter Volksblatt zwischen September 1939 und August 1944 aus. Die Ergebnisse führen zu deutlichen Übereinstimmungen mit kleineren Stichproben, die Ian Kershaw vor gut zwei Jahrzehnten für drei bayerische Zeitungen erhob.
Aus den genannten Indikatoren bilden wir mit den gebotenen methodischen Vorbehalten die untenstehende Gesamtkurve, die als vorläufiger und gewiss ausbaufähiger Versuch verstanden werden kann, die wechselnden Stimmungslagen in der Zeit des Nationalsozialismus historisch zu rekonstruieren. Wie das geschieht, wird im Kapitel »Gesamtstatistik – ein Experiment« erläutert. Im Anschluss daran werden die auch für uns überraschenden Ergebnisse interpretiert.
Stimmungsverlauf in Quartalen 1937–1944
Im letzten Abschnitt des Buches dokumentieren wir die Erntedankrede, die Hermann Göring in einer besonders kritischen Phase der NS-Herrschaft, am 4. Oktober 1942, gehalten hat. Sie erlaubt einen guten Einblick in die Techniken, mit denen die nationalsozialistischen Stimmungspolitiker ihre Herrschaft innenpolitisch absicherten: Wie sie dafür Mittel des Antisemitismus, der Slawenverachtung, des Führer-Charismas, des Terrors, der kleinen sozialpolitischen Sofortzusagen und der großen Zukunftsversprechen einsetzten.
Das vorliegende Buch entstand während eines zweisemestrigen Forschungsseminars, das ich in den Jahren 2005/06 als Gastprofessor für interdisziplinäre Holocaustforschung am Fritz Bauer Institut der Universität Frankfurt a.M. angeboten habe. Ungewöhnlich war der frische Schwung, mit dem die Studentinnen und Studenten ans Werk gingen. Sie bewältigten die empirische Arbeit, verhandelten mit Archivaren und Amtsleitern, diskutierten einzelne Arbeitshypothesen, Forschungsstände, sie verwarfen untaugliche Indikatoren, fragwürdig forcierende Interpretationen und verwirrende oder falsche graphische Darstellungsweisen.
Diesen noch studierenden Autorinnen und Autoren gilt mein Dank und Respekt. Nicht alle hielten die ganze Zeit durch, schließlich begünstigt der anonyme Normalbetrieb deutscher Universitäten ein solches Vorhaben nicht. Doch haben auch sie zum Gelingen des Unternehmens wesentlich beigetragen; ihre Namen sind in den entsprechenden Kapiteln vermerkt.
Einer unserer Mitautoren, Sven Granzow, nahm sich zu Ostern 2006 das Leben. Die Gründe blieben seiner Familie und auch uns verborgen. Wir verdanken ihm die historische Einleitung des Kapitels »Führerglaube und Gottvertrauen«; er wandte sich heftig gegen die vorschnelle Interpretation des Kurvenverlaufs und wies mit Nachdruck auf die typischen saisonalen Schwankungen hin, die das Kirchenaustrittsverhalten der Deutschen kennzeichnen. Seinen Beitrag zu den schicht- und altersspezifischen Unterschieden anhand aussagekräftiger Unterlagen des Erzbischöflichen Diözesanarchivs in Köln konnte er nicht abschließen. Wir widmen unser Buch Sven Granzow.
Die Rechtschreibung, auch die der historischen Zitate, folgt dem derzeit gültigen Regelwerk. Auf Anführungszeichen, die Distanz zur Begriffswelt des nationalsozialistischen Deutschland demonstrieren soll, verzichten wir. Dazu gehören Wörter wie Altreich (gemeint ist das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937), Arier, Führer, Herrenmensch, Anschluss (Österreichs) oder Wehrkraftzersetzung. Der Kontext unserer Studie macht deutlich, dass wir keines der Unwörter affirmativ gebrauchen.
Die Rostocker Sozialhistorikerin Silke Rossow las und kommentierte unsere Texte und Diagramme kritisch, ebenso Albert Müller in Wien. Er unternahm das Experiment, unsere verschiedenen Indikatoren zu einer Gesamtkurve zu integrieren. Das Kapitel »Terrorinstanz Volksgerichtshof« verfasste Holger Schlüter. Er stützt sich darin auf die empirischen Urmaterialien seiner vor bald 15 Jahren in Zusammenarbeit mit Klaus Marxen abgeschlossenen Dissertation zum Thema »Die Urteilspraxis des Nationalsozialistischen Volksgerichtshofs«. Trotz seiner hohen beruflichen Lasten als Staatsanwalt hat er sich bereitgefunden, die seinerzeit unter anderen Fragestellungen publizierten Daten für unsere Zwecke neu zu differenzieren und zu kommentieren.
Das Bürgeramt Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt a.M. unterstützte unsere Namensrecherche auf zuvorkommende Weise. Wir danken insbesondere dem Leiter des Amtes, Rudolf Schulmeyer, und der zuständigen Referentin, Waltraud Schröpfer. Shamali Sen engagierte sich als wissenschaftliche Hilfskraft auch für dieses Projekt. Nachdem die Materialien beieinander waren, mussten die unterschiedlichen Texte und Tabellen zu Kapiteln eines in sich geschlossenen Buches geformt werden. In diesem Moment schickte uns der Zufall die Lehrstuhlpraktikantin Katharina Steinberg. Sie überraschte uns mit ihrem ausgeprägten Sinn für Organisation, Genauigkeit und Sprache.
Vor allem anderen bot die Gastprofessur am Fritz Bauer Institut den materiellen und geistigen Rahmen für dieses Buch. Mein freundschaftlicher Dank geht an den bis zum Herbst 2005 tätigen Institutsdirektor Micha Brumlik.
Frankfurt am Main, im Mai 2006
Fußnoten
[1]
Einblicke in die dafür angewandten Herrschaftstechniken geben Recker, Nationalsozialistische Sozialpolitik, und Aly, Volksstaat; die Art der Berichterstattung beschreibt Steinert, Hitlers Krieg.
[2]
Akten Kardinal Faulhabers, S. 705.
[3]
Dietrich Bonhoeffer, Die Kirche vor der Judenfrage, in: Der Vormarsch 3(1933), H. 6 (Juni), S. 171–176; abgedruckt in: Bonhoeffer, Werke, Bd. 12, S. 349–358.
[4]
Mitteilung von Wolfgang Huber, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und Mitherausgeber der Werke Bonhoeffers, während einer Podiumsdiskussion am 6.2.2006 in Berlin aus Anlass des 100. Geburtstages von Dietrich Bonhoeffer.
[5]
Dafür exemplarisch: Steinert, Hitlers Krieg; Stöber, Erfolgverführte Nation.
[6]
Müller, Nationalsozialismus in der deutschen Kriegsgesellschaft, S. 72.
[7]
Wehler, Loyal bis in den Untergang.
[8]
Browning, Entfesselung, S. 449–475.
[9]
Goebbels, Tagebücher, Teil II, Bd. 1, S. 239 (15.8.1941).
Oliver Lorenz
Die Adolf-Kurve 1932–1945
Nationale Namensmoden
Vornamen folgen Moden, in denen sich auch der gesellschaftliche Wandel widerspiegelt. Daher bietet es sich an, die Häufigkeit der in den zwölf Hitler-Jahren stark politisierten Vornamen Adolf, Horst und Hermann zu untersuchen. Auch wenn in vielen Einzelfällen traditionelle Motive – wie etwa die Namen von Taufpaten oder Großvätern – mitgespielt haben mögen, so erscheint uns die Vergabe dieser Vornamen doch als ein aussagekräftiger Indikator für den Stimmungswechsel der Jahre 1933 bis 1945. Hoffnungen, politische und militärische Zuversicht, Skepsis und schließlich Angst schlugen sich in den Entscheidungen der Eltern nieder. So individuell sie getroffen wurden, stehen sie in ihrer Gesamtheit für einen klaren Trend.
Mit dem Aufstieg der deutschen Nationalidee zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstärkte sich die Vorliebe für betont deutsche Namen.[10] Zunächst drückte sich das in der großzügigen Vergabe von Herrschernamen im Kaiserreich aus: Ludwig, Wilhelm oder Friedrich häuften sich auffällig; die Otto-Mode darf als Referenz an das politische Werk Bismarcks verstanden werden. Daneben produzierte die Deutschtümelei auch Stilblüten wie Blücherine oder Gneisenauette.[11] Interessant ist die Intention: Sollte in der vornationalen Zeit der Name dem Kind eine unmittelbare, in der Regel christliche Orientierung geben, so wurden nun die Vornamen, zumal männliche, gerne als Huldigung an Personen oder als Reminiszenz an die Größen der sogenannten Nationalgeschichte vergeben.[12] Das folgende Diagramm zeigt die Zunahme deutscher Vornamen im Verlauf von 170 Jahren. Ihren Scheitelpunkt erreichte die Entwicklung in der Zeit des Nationalsozialismus. Unabhängig vom politischen System lösten sich junge Eltern in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zunehmend von familiären Regeln der Namenvergabe. Anders ausgedrückt: Sie verhielten sich freier, machten sich mehr Gedanken, mit welchem Namen und welchen damit verbundenen Hoffnungen sie ihr Kind individuell ausstatten wollten; die Zahl der vergebenen Namen vermehrte sich rasch. Indem sich die Namenvergabe von überkommenen binnenfamiliären Gepflogenheiten löste, wurde sie zugleich politischer und einem schnelleren Wandel unterworfen.[13]
Diagramm 1: Anteil deutscher Vornamen an den insgesamt in Gerolstein zwischen 1810 und 1980 vergebenen Namen im Abstand von jeweils 30, für den letzten Wert von 20 Jahren[14]
Selbstverständlich waren die als deutsch geltenden Namen bereits vorher bekannt, doch wurden sie mit neuem Pathos befrachtet. Die Frage, was einen deutschen Namen denn letztlich ausmachte, kann nicht befriedigend beantwortet werden. Schließlich definierten nationalsozialistische Namenshüter selbst ursprünglich religiöse Namen wie Maria, Peter, Paul und andere als »deutsch«.[15] Die Spitze der germanophilen Namenvergabe wurde schon zu Beginn des Nationalsozialismus erreicht. Obwohl während der NS-Zeit bis dahin wenig gebräuchliche nordische Namen modisch wurden wie zum Beispiel Hartmut, Volker, Dietmar oder Arnhild, Heidrun, Elke und Almut, flachte die Kurve deutscher Namen bald ab. Umgekehrt nahmen christliche und biblische Namen schon während des Zweiten Weltkrieges wieder zu.[16]
Diagramm 2: Anteile der biblischen Namen, gemessen an sämtlichen Vornamen der Geburtsjahrgänge 1931–1945 in München[17]
Nach dem Ergebnis unserer Studie lassen sich männliche Vornamen für die Jahre 1933 bis 1945 besser als politischer Indikator verwenden als weibliche. Unsere Versuche, seinerzeit durchaus modische und als besonders germanisch angesehene Namen wie Karin und Uta als Indikatoren zu nutzen, zeigten, dass die Namenvergabe für neugeborene Mädchen den politischen Überzeugungen der Eltern weniger deutlich folgte. Deshalb verzichten wir auf die Analyse weiblicher Vornamen.
Ein besonderes Augenmerk muss auf die Vergabe von Beinamen gelegt werden. Diese wurde im Nationalsozialismus stark gefördert;[18] mehrgliedrige Namen verstand man als Aufgreifen einer altgermanischen Tradition. Vor allem eröffnete sich im Zweitnamen die Möglichkeit zur Demonstration von Systemtreue unter Vorbehalt. Die Zeiten können sich ändern, das wussten die in dieser unruhigen Epoche lebenden Menschen durchaus. Da schien es praktisch, Sympathie mit dem NS-Staat im Beinamen zu platzieren, diesen bei Bedarf in den Rufnamen zu verwandeln – oder zu verschweigen. Für die Analyse unserer Daten gilt es ferner zu bedenken, von wem die Namen vergeben wurden. Eltern waren damals in ihrer übergroßen Mehrheit zwischen 18 und 35 Jahren alt; sie bildeten den Teil der Bevölkerung, dem die Familienpolitik des NS-Staats sofort einen Nutzen brachte und der sich auch im Krieg besonderer Fürsorge erfreute.[19] Aussagen zur politischen Stimmung während der NS-Herrschaft können mit Hilfe des Vornamenindikators also nur für einen bestimmten, allerdings besonders umworbenen und im Sinne des Nationalsozialismus auch politisch besonders aktiven Teil der Deutschen getroffen werden.
Unserer Erhebung liegt Datenmaterial des Amtes für Statistik und Wahlen der Stadt Frankfurt am Main zugrunde. Es umfasst alle zum Zeitpunkt der Erhebung am 30. Juli 2005 in Frankfurt gemeldeten Personen mit den Vornamen Adolf, Hermann und Horst, die den Geburtsjahrgängen 1932 bis 1945 angehören.
Gemessen an der Zahl der damals im Reichsgebiet insgesamt geborenen Knaben ist die Datenbasis relativ schmal, doch kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlen repräsentativ sind. Zum Zeitpunkt der Erhebung lebten 43000 Männer der Jahrgänge 1932–1945 in Frankfurt a.M. Davon hießen ca. 1800 Horst, Hermann oder Adolf mit Vornamen und 1400 mit Beinamen.
Frankfurt ist und war eine Stadt mit hoher Migrationsrate. Laut Auskunft des Amtes für Statistik und Wahlen lebten zum Zeitpunkt der Erhebung rund 50 Prozent der Einwohner seit mehr als 15 Jahren in der Stadt. Entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Personen der definierten Menge aus dem gesamten ehemaligen Reichsgebiet in Frankfurt zu finden.[20] Zur Untermauerung zogen wir die Studie von Jürgen Gerhards »Die Moderne und ihre Vornamen«[21] sowie die Untersuchung »Die Deutschen und ihre Vornamen« von Michael Wolffsohn und Thomas Brechenmacher[22] heran. Gerhards erfasst Daten, die mit Hilfe des Gerolsteiner Geburtenregisters erhoben wurden[23]