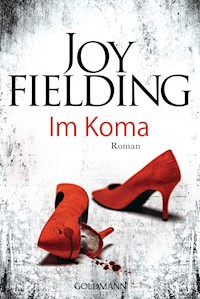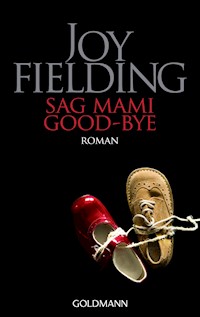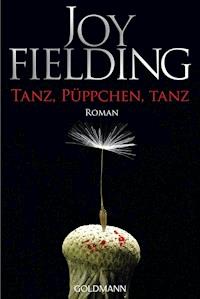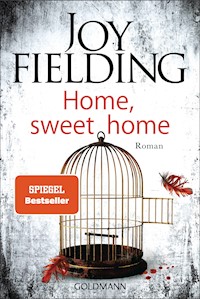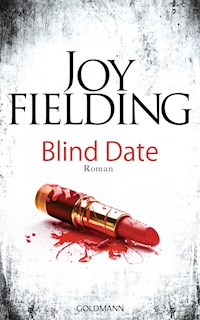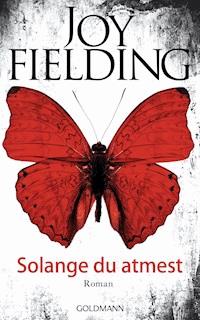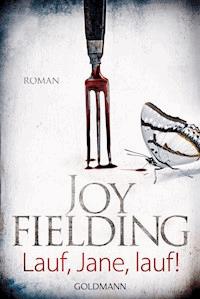10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wahrheit oder Lüge? – Wenn Neugier in ein tödliches Labyrinth führt ...
Als Linda Davidson ihre Freundin Carol in der Klinik besucht, herrscht auf der Station helle Aufregung: Ein Patient ist am Morgen völlig unerwartet gestorben. War es ein natürlicher Tod? In großer Sorge um ihre Freundin versucht Linda herauszufinden, was passiert ist. Dabei stößt sie auf Jenny Cooper, eine ältere Mitpatientin, die unumwunden zugibt, eine Mörderin zu sein. Will Jenny die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Oder verbirgt sich hinter ihren Worten ein schockierendes Geständnis? Linda geht auf Spurensuche und ahnt nicht, dass sie damit in ein gefährliches Netz aus Lügen, Intrigen und Geheimnissen gerät, das auch ihrem Leben eine verhängnisvolle Wende gibt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Linda Davidson führt im sonnigen Florida ein ruhiges und erfülltes Leben. Mit ihrer Freundin Carol verbindet sie seit Jahrzehnten eine tiefe Freundschaft. Doch auf einmal wird Carol vergesslich und bringt immer mehr durcheinander. Wenig später steht die schreckliche Diagnose fest: Demenz. Carol zieht in ein Pflegeheim, wo Linda sie fast täglich besucht. Bei einem der Besuche trifft sie auf die quirlige Jenny Cooper, eine ältere Mitpatientin, deren Zimmer nur wenige Schritte von Carols entfernt liegt. Was als harmlose Bekanntschaft beginnt, nimmt eine schockierende Wendung, als Jenny Cooper Linda eines Tages ins Ohr raunt: »Ich bringe Menschen um.« Linda tut Jennys Äußerung als verwirrtes Gerede ab, doch als plötzlich ein Patient der Station unter mysteriösen Umständen stirbt, wird sie hellhörig. Ist es möglich, dass Jenny die Wahrheit sagt? Ein packendes Katz-und-Maus-Spiel nimmt seinen Lauf, das Lindas einst so beschauliches Leben schon bald aus den Fugen geraten lässt.
Zur Autorin
Joy Fielding gehört zu den großen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller »Lauf, Jane, lauf« waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding hat zwei Töchter und lebt mit ihrem Mann in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida.
Joy Fielding
Die Besucherin
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristian Lutze
Die amerikanische Originalausgabe erscheint 2025 unter dem Titel »Jenny Cooper Has A Secret« bei Ballantine Books, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2024
Copyright © der Originalausgabe 2025 by Joy Fielding Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ulla Mothes
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Magdalena Russocka/Trevillion Images, James Williams/GettyImages und FinePic®, München
KN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32749-1V002
www.goldmann-verlag.de
Für WarrenShannon und EricAnnie und CourtneyHayden und SkylarRemy und Foxy
KAPITEL EINS
»Psst …«
Das Wort prallt von hinten auf meine Ohrmuschel wie ein gut gezielter Kieselstein. Ich drehe mich um und sehe nichts außer dem lang hingestreckten Flur. Es ist niemand da.
Ich zucke mit den Schultern und gehe weiter.
»Psst …«
Im Ernst? Ich bleibe stehen und lasse meinen Blick schweifen. Kauert jemand hinter den violettfarbenen Plüschsofas in dem nahe gelegenen Aufenthaltsbereich? Und wenn, sind wir nicht zu alt für solche Spielchen? »Hallo?«, sage ich eher fragend als grüßend und wende mich erst zu der leeren Besucherlounge rechts von mir und dann zu dem verlassenen Etagentresen links, bis ich mich schließlich einmal im Kreis gedreht habe. Ich will gerade aufgeben, als ich sie entdecke.
Kein Wunder, dass ich sie übersehen habe. Sie ist winzig, ihre Haut hat fast denselben Farbton wie die Betonsäule, an der diese schmächtige Person lehnt, und ihr ungekämmtes Haar passt perfekt zu ihrer gespenstischen Blässe. Noch einen Tick weniger Substanz, und sie wäre unsichtbar, denke ich und lache, während ich überlege, ob die jüngere Generation mich genauso sieht. Oder nicht sieht. Schließlich bin auch ich kein junger Hüpfer mehr. Sechsundsiebzig, seit einem Monat. Weit jenseits des Alters, in dem Frauen für den Großteil der Außenwelt unsichtbar werden.
Und diese Frau ist schätzungsweise mindestens zehn Jahre älter als ich. Aber das könnte auch Wunschdenken sein, wie ich zugeben muss.
»Reden Sie mit mir?«, frage ich und höre einen Widerhall von Robert De Niros berühmtem Monolog aus Taxi Driver, während ich ein paar zaghafte Schritte auf die Frau zugehe. Wie lange ist es her, dass der Film herausgekommen ist? Zwanzig Jahre? Dreißig? Länger?
Ich bleibe stehen und merke überrascht, dass ich nervös bin, wobei ich keine Ahnung habe, weswegen. Was sollte diese schmächtige alte Frau mir antun? Sie wiegt kaum mehr als vierzig Kilo, ich locker sechzig. Na schön, fast fünfundsechzig, als ich das letzte Mal gewogen wurde, obwohl ich damit bei meiner Größe von eins fünfundsiebzig immer noch als schlank gelte. Okay, ein Meter dreiundsiebzig. Seit ich das letzte Mal gemessen wurde, habe ich zwei Zentimeter verloren. Pfunde dazugewonnen, Zentimeter verloren. Ich werde kleiner und breiter. »Nichts, worüber man sich Gedanken machen muss«, hat mein Arzt mir versichert. »Ich bin unbesorgt.«
Und warum sollte er das nicht sein? Mit kaum fünfzig ist er noch Jahre von seinem Verfallsdatum entfernt. Ich hingegen umkreise meins vorsichtig. Ja, alle sagen, ich sehe jung aus für mein Alter; ich treibe Sport, regelmäßige Gesichtsbehandlungen und hin und wieder ein chemisches Peeling. Ich trage mein Haar in einem modischen Bob mit ein paar Strähnchen, die das sich unaufhaltsam ausbreitende Grau in Schach halten, ich kleide mich modisch und trage Designer-Klamotten. Aber der Körper weiß Bescheid.
Der Körper weiß definitiv Bescheid.
Gibt es etwas, das dem Ego mehr zusetzt, als alt zu werden?
»Besser als die Alternative«, hat meine beste Freundin Carol immer gesagt.
»Wenn wir schon alt werden und sterben müssen«, entgegnete ich nur halb im Scherz, »könnten wir dann nicht wenigstens attraktiver werden?«
Und sie hat pflichtschuldig gelacht.
Jetzt lacht sie nicht mehr.
Welchen Grund gibt es also, nervös zu sein, frage ich mich. Ich stehe mitten im Flur im vierten Stock einer gehobenen Demenzpflegeeinrichtung mit Meerblick, die sich – hochtrabend und zynisch – Legacy Place nennt, Ort des Vermächtnisses. Draußen scheint die Sonne wie hier in Jupiter, Florida, mit monotoner Regelmäßigkeit. In dem gesamten sechsstöckigen strahlend weißen Gebäude sind überall Schwestern und Pfleger zu finden. Ein einfacher Ruf, und sie würden den Flur hinuntereilen. Ganz zu schweigen davon, dass selbst ein halbherziger Schubser die alte Schrulle quer durch den Raum segeln lassen würde. Trotzdem bleibe ich ein paar Schritte entfernt von ihr stehen. »Kann ich Ihnen helfen?«, frage ich und hasse die Unsicherheit in meiner Stimme.
»Ich habe ein Geheimnis«, erklärt sie mir. Ihre Stimme ist überraschend kräftig, kein bisschen unsicher.
Ich sage nichts.
»Möchten Sie es hören?«
»Möchten Sie es mir erzählen?«
»Ich weiß nicht«, sagt sie. »Wer sind Sie?«
»Ich bin Linda. Linda Davidson«, füge ich hinzu, als ihr Schweigen deutlich macht, dass sie mehr erwartet.
Ihr Mund zuckt von links nach rechts, als würde sie diese Information buchstäblich verdauen. »Linda ist ein hübscher Name«, sagt sie schließlich. »Man hört ihn nicht mehr so häufig.«
Ich nicke. Sie hat recht. Namen wie Linda sind, so wie die Gertrudes und Ethels vor ihnen, in den letzten Jahren praktisch aus dem Lexikon verschwunden und haben dem aktuellen Schwung von Britneys, Skylars und Briannes Raum gemacht.
»Ich bin Jenny«, sagt sie. »Jenny Cooper.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Jenny.«
»Wirklich?«
Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, also sage ich gar nichts.
»Wer sind Sie?«, fragt sie noch einmal.
»Ich bin Linda.«
»Linda ist ein hübscher Name«, sagt sie wie zum ersten Mal. »Man hört ihn nicht mehr so häufig.«
»Nein, tatsächlich nicht«, stimme ich ihr zu.
»Ich bin Jenny. Jenny Cooper.«
Ich spare mir die Mühe, zu wiederholen, dass es mich freut, sie kennenzulernen, in der Hoffnung, eine dritte Runde dieser Unterhaltung zu überspringen. Stattdessen schenke ich ihr ein, wie ich hoffe, gütiges Lächeln. »Ich sollte los …«
»Wohin?«
»Wohin?«
»Wohin gehen Sie?«
Es scheint mir sinnlos, ihr zu erklären, dass sie das nichts angeht. »Ich besuche eine Freundin. Carol. Carol Kreiger«, fahre ich fort, um ihrer Frage zuvorzukommen. »Sie wohnt in Zimmer 403. Den Flur hinunter.« Ich weise in die vermutete Richtung von Carols Zimmer. Dies ist erst mein zweiter Besuch, seit Carol vor ein paar Wochen hier eingezogen ist, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Zimmer 403 könnte auch in der anderen Richtung den Flur entlang liegen.
Manche Dinge sind zu schmerzhaft, um sich daran zu erinnern.
»Ein hübsches Kleid, das Sie da tragen«, bemerkt Jenny zu meinem kanariengelben Trägerkleid.
»Danke.«
»Normalerweise mag ich Gelb nicht besonders. Wo haben Sie es gekauft?«
»Saks.«
»Sex?«, will sie wissen, und ihre wässrig blauen Augen flackern beunruhigt auf.
»Bei Saks«, korrigiere ich rasch.
»Das ist sehr unanständig.«
»Entschuldigen Sie«, murmele ich, mittlerweile erpicht darauf, hier wegzukommen. Selbst Carols hoffnungslos leeres Starren wird besser sein als das hier. »Ich sollte wirklich gehen …«
»Wollen Sie mein Geheimnis nicht hören?«
»Vielleicht erzählen Sie es mir ein anderes Mal.«
»Ich bringe Menschen um«, sagt sie.
»Was?«
Hinter mir höre ich Schritte und drehe mich erleichtert um.
»Ist alles in Ordnung hier?«, fragt eine Krankenschwester.
Jenny wendet sich abrupt ab und huscht überraschend geschwind davon.
»Entschuldigen Sie. Hat sie Sie belästigt?«
»Nein«, antworte ich. »Sie ist bloß … sie ist bloß … Sie ist offensichtlich nicht ganz bei sich«, bringe ich stammelnd hervor.
»Leider ja. Demenz ist schrecklich.« Die Schwester lächelt, eine ebenso unerwartete wie beunruhigende Geste. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Zimmer 403?«
»Dort entlang.«
Sie weist den Flur hinunter. Ich nicke und setze mich in Bewegung.
»Psst …«, meine ich zu hören, als ich mich Carols Zimmer nähere. Ich fahre herum. Aber diesmal ist wirklich keiner da.
KAPITEL ZWEI
Ich klopfe.
Niemand antwortet.
»Carol?« Langsam schiebe ich die schwere Eichentür auf und gelange unmittelbar in einen Sitzbereich mit einem kleinen lachsfarbenen Sofa, zwei bequemen Sesseln, einem Mini-Kühlschrank und einem runden Couchtisch, auf dem mehrere Promi-Zeitschriften liegen, wie sie Carol früher immer gern gelesen hat. Lorne muss sie mitgebracht haben. Er ist seit acht Jahren mit Carol verheiratet. Es ist für beide die dritte Ehe. Ein Gefährte für die späten Jahre.
Der arme Lorne, denke ich.
Carol steht vor dem großen Fenster, das fast eine gesamte Wand ihres Zimmers einnimmt, und starrt auf den Ozean. Sie trägt einen pinken gesteppten Morgenmantel über einem gestreiften Schlafanzug. Hinter ihr steht ein mit einem Überwurf bedecktes Bett. An den Wänden hängen pastellfarbene Gemälde von Blumengärten in verschiedenen Stadien der Blüte.
»Carol, hi«, sage ich und schließe die Tür hinter mir.
Das Lächeln, mit dem sie sich zur Begrüßung zu mir umdreht, ist breit, ehrlich und von geradezu kindlicher Offenheit. »Hi«, sagt sie.
Sie ist immer eine schöne Frau gewesen. Knapp fünf Zentimeter kleiner als ich, mit hohen Wangenknochen, stechenden grünen Augen und welligem braunem Haar, das früher lang und dunkel war, jetzt jedoch kurz geschnitten und an den Wurzeln sichtlich ergraut ist. Die Carol, die ich kannte, wäre entsetzt gewesen. Sie war immer so pingelig, was ihr Aussehen betraf.
Aber dies ist nicht mehr die Carol, die ich kannte.
»Ist es Zeit fürs Mittagessen?«, fragt sie.
»Nein«, sage ich. Offensichtlich hält sie mich für eine der Schwestern. »Du hast schon zu Mittag gegessen.«
Sichtlich enttäuscht zieht sie die Mundwinkel ihrer einst vollen Lippen herunter.
»Ich bin’s, Linda. Deine Freundin.« Deine beste Freundin seit Ewigkeiten.
»Natürlich. Ich weiß.«
Wirklich?, frage ich mich. Wobei die bessere Frage wäre: Wer bist du? »Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut. Und dir?«
»Auch gut.«
»Das ist gut.«
Gut. Uns geht es allen gut, denke ich. Wirklich?
Ich überlege angestrengt, was ich als Nächstes sagen könnte.
So war es früher nicht, und so sollte es definitiv nicht sein. Carol und ich waren seit der vierten Klasse unzertrennlich. Sie war damals neu in Florida, neu in unserer Schule und meiner Klasse zugeteilt worden. Früher hat sie mich immer gern daran erinnert, dass die ersten Worte, die ich je zu ihr gesagt habe, lauteten: »Verschwinde von meinem Platz!«
Früher haben wir darüber gelacht.
Wir haben über viele Dinge gelacht.
»Komm, setz dich«, sage ich, nehme auf dem Sofa Platz und klopfe auf das Polster neben mir. Sie gehorcht prompt und wendet sich mir direkt zu, sodass ihre Knie den Stoff meines Trägerkleids streifen.
»Das ist ein hübsches Kleid«, bemerkt sie. »So eine schöne Farbe.«
»Normalerweise mag ich Gelb nicht besonders«, höre ich Jenny Cooper sagen.
Ich schüttele den Kopf, um ihn frei zu bekommen.
»Ich habe ein Geheimnis«, fährt Jenny hartnäckig fort.
»Was hast du so gemacht?«, frage ich meine Freundin.
»Ich bringe Menschen um.«
»Ach, weißt du«, antwortet Carol. »Dies und das.«
Unser Leben, der Reichtum all unserer Erfahrungen, reduziert auf drei vage Worte: dies und das. Wie kann das sein?
Ich suche nach einer Antwort in ihren einst strahlenden Augen und erkenne nichts. Ich bin für sie ebenso sehr eine Fremde wie sie für mich. Wie kann das sein?
Wir waren an allen wichtigen Wegmarken füreinander da: Highschool-Bälle und College-Abschlüsse, verlorene Unschuld und gefundene Identität, wunderbare erste Liebe und leidvoll gebrochene Herzen. Ich war deine Trauzeugin und du meine. Du hast in meinen Armen geweint, als dein erster Mann dich wegen einer anderen Frau verlassen hat; ich habe in deinen geweint, als mein Mann nach fünfundvierzig Jahren Ehe dem Krebs erlag.
Es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich ihn verloren habe, und beinahe genauso lange, seit ich nach und nach auch Carol verliere.
Es ging langsam los. Der Verlust eines alltäglichen Wortes, dann eines weiteren. Ein vergessener Name, ein verlegter Schlüssel. Passiert uns allen, haben wir uns gegenseitig mitfühlend versichert und das Ganze weggelacht. Dann eine versäumte Mittagessenverabredung, ein entfallener Anruf. Du hast dich auf dem Weg zu mir verfahren, obwohl du die Strecke genauso gut kanntest wie den Weg zu dir nach Hause. Eines Nachmittags fandest du dich auf der Interstate 95 wieder, ohne einen Schimmer, wohin du unterwegs warst. Es passierte ein zweites und drittes Mal. »Nebel im Hirn«, hast du gesagt und die wachsende Besorgnis weggewischt. Irgendwann hast du aufgehört, Auto zu fahren, vorgeblich weil es überall zu voll sei und zu viele schlechte Fahrer auf der Straße unterwegs seien. Ich habe erleichtert geseufzt, doch die Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Du würdest dich wieder erholen, habe ich mir eingeredet. Du würdest mich nicht allein lassen.
Und dann jener schreckliche Abend im Kravis Center, wo wir eine Tourneetheater-Aufführung von Hamilton ansehen wollten und du auf einmal angefangen hast, zu schreien – du wüsstest nicht, wo du bist, du würdest die Leute, mit denen du zusammen warst, nicht erkennen, du wüsstest nicht, wüsstest nicht …
Früher haben wir über die ständig zunehmenden Kränkungen des Älterwerdens gelacht, die schlaffer werdende Haut, die Rückenschmerzen und die zu häufigen Toilettengänge.
»Besser als die Alternative«, hast du immer gesagt.
Was würdest du jetzt sagen, überlege ich.
Ich vermute, du würdest einen schnellen Tod dieser allmählichen Auflösung all dessen, was dich einmal ausgemacht hat, vorziehen, diesem langsamen Abstieg in eine gnadenlose schwarze Leere.
Vielleicht wäre dem sogar der Wahnsinn vorzuziehen, denke ich und sehe Jenny Cooper vor mir.
»Eben ist etwas wirklich Seltsames passiert«, erzähle ich Carol. »Ich habe so eine Frau getroffen …«
»Ja?«
»Jenny Cooper. Kennst du sie? Ich glaube, sie wohnt ein Stück den Flur hinunter.«
»Ja«, sagt Carol noch einmal.
»Kennst du sie?«
»Ja. Natürlich.«
»Groß gewachsen, stämmig, hellrotes Haar«, beschreibe ich Jennys Aussehen bewusst falsch. Ein Test. Ich warte und hoffe, dass Carol mich korrigiert.
»Wunderschönes rotes Haar, ja«, sagt sie stattdessen.
Ich seufze vernehmlich. »Sie hat mir erzählt, dass sie Menschen umbringt.«
»Tatsächlich?«
Mir schießen Tränen in die Augen. »Sie sagt, es ist ein Geheimnis.«
»Natürlich.«
»Die Schwester sagt, sie leidet unter Demenz.«
»Demenz. Ja«, sagt Carol.
»Ja.« Ich nehme ein People-Magazin von dem Couchtisch, und die nächsten zwanzig Minuten plaudern wir über das Leben der Reichen und Berühmten – das heißt, ich plaudere, und sie stimmt mir zu –, bis Carol aufspringt. »So ein schöner Tag«, sagt sie, geht zum Fenster und lehnt die Stirn an die Scheibe.
»Möchtest du einen Spaziergang machen?«
»Ich glaube nicht. Nein.«
Ich fühle mich schuldig, als ich merke, dass ich eher erleichtert als enttäuscht bin. Früher haben Carol und ich lange Strandspaziergänge geliebt. Dabei haben wir über Gott und die Welt geredet und deren Probleme zusammen mit unseren eigenen gelöst. Es gab nichts, worüber wir nicht sprechen konnten. Jetzt gibt es nichts zu sagen. Nicht einmal Brad Pitt entlockt uns mehr als ein oder zwei Worte.
»So attraktiv«, sage ich.
»So attraktiv«, wiederholt sie.
»Du musst verstehen, dass die Person, die du als Carol kanntest, nicht mehr existiert«, hat ihr Mann mir nach meinem letzten Besuch zu erklären versucht.
Aber die Vorstellung, dass meine lebenslange Freundin mich nicht mehr erkennt, dass sie sich selbst nicht mehr erkennt, dagegen sperrt sich mein Verstand. »Ich weiß, dass du irgendwo dadrinnen bist«, sage ich, als ich zu ihr ans Fenster trete und sie zum Abschied lange umarme.
Komm raus, komm raus, wo immer du bist …
Ich klammere mich an sie, an die Erinnerungen, die wir früher geteilt haben und die jetzt nur noch meine sind. Schließlich windet sie sich aus meiner erdrückenden Umarmung. »Ich komme bald wieder«, erkläre ich ihr.
»Das wäre reizend.«
Sie bleibt am Fenster stehen und starrt auf den Ozean, als ich die Tür öffne. Rasch blicke ich den langen Flur hinunter und erwarte beinahe, dass Jenny Cooper sich auf mich stürzt, an die Wand drängt und mit ihren Geheimnissen behelligt.
Sollte ich der Leiterin dieser Wohnetage erzählen, was sie gesagt hat?, überlege ich, als ich zu den Aufzügen komme. Damit sie denkt, ich bin eine weitere in einer Reihe merkwürdiger alter Damen, beantworte ich meine eigene Frage.
Jenny Cooper ist offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf. Ich glaube nicht wirklich, dass sie jemanden umgebracht hat.
Ich betrete den leeren Fahrstuhl.
Jenny Coopers Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben.
KAPITEL DREI
Ich höre sie streiten, als ich den Wagen in der Einfahrt abstelle und auf die Haustür zugehe. Eine leichte Brise trägt ihre Stimmen aus dem offenen Wohnzimmerfenster meines gepflegten Bungalows durch die schwüle Luft und lässt sie vor meine Füße fallen wie Vogelkot.
Ich mache einen Schritt zurück und frage mich, ob womöglich das offene Fenster die Ursache ihrer Auseinandersetzung ist. Meine Tochter mag frische Luft, ungeachtet der Außentemperaturen, während ihr Mann den Komfort der Klimaanlage vorzieht. Das ist in jüngster Zeit zum Streitpunkt zwischen ihnen geworden, ein weiterer auf der ständig wachsenden Liste.
»Wie soll ich bei der Hitze schlafen?«, habe ich Mick neulich nachts rufen hören. Ich hatte selbst Probleme, einzuschlafen und war in die Küche gegangen, um zu sehen, ob noch etwas von dem Rhabarberkuchen übrig war, den wir zum Nachtisch gegessen hatten. Die Küche ist auf derselben Seite des Hauses wie ihr Schlafzimmer, sodass ich sie selbst bei geschlossener Schlafzimmertür problemlos hören konnte.
»Bitte, stell sie nicht so eiskalt ein«, gab Kleo schließlich bettelnd nach.
Ich schlich auf Zehenspitzen zurück in mein Schlafzimmer auf der anderen Seite des Hauses. Am nächsten Morgen schien alles in Ordnung, obwohl ich an Kleos verquollenen Augen erkannte, dass sie geweint hatte. Ich überlegte, sie zu fragen, ob alles okay war, entschied jedoch, dass ich mich lieber nicht einmischen sollte.
»Bitte schalte nicht den Fernseher ein, wenn ich versuche, mit dir zu reden«, höre ich Kleo jetzt sagen.
»Wir sind fertig mit Reden«, entgegnet Mick, während der Fernseher dröhnend zum Leben erwacht.
Einen Moment lang überlege ich, wieder in den Wagen zu steigen und ziellos durchs Viertel zu fahren, um ihnen ein wenig Zeit zu geben, bis ihre Erregung abgekühlt ist und sie ihre Unstimmigkeiten hoffentlich klären können. Ich könnte zum Supermarkt fahren und etwas zum Abendessen einkaufen. Aber selbst diese einfache Aufgabe ist in letzter Zeit konfliktbelastet, da meine Tochter Fisch vorzieht, während mein Schwiegersohn auf seiner bevorzugten Diät aus rotem Fleisch besteht.
War es schon immer so?, frage ich mich und denke zurück an die Zeit, als sie vor gut einem Jahr bei mir eingezogen sind. Im Sommer zuvor war mein Mann gestorben, und ich war einsam und fühlte mich mehr als nur ein wenig verloren.
»Du solltest nicht allein sein«, hatte meine Tochter beharrt.
»Das Haus ist viel zu groß für dich, um es allein instand zu halten«, hatte ihr Mann beigepflichtet. »Lass uns dir helfen.«
Das war vielleicht das letzte Mal, dass sie sich über irgendwas einig waren.
Ich krame in meiner Handtasche nach meinem Telefon, um anzurufen und meine Ankunft anzukündigen, damit das streitende Paar sich verdammt noch mal zusammenreißen kann – ja, auch alte Damen fluchen –, doch nichts geschieht, als ich die Taste drücke. Der Akku ist leer. Ich habe wieder einmal vergessen, das bescheuerte Ding aufzuladen, so wie ich auch immer vergesse, die Apple-Watch aufzuladen, die sie mir zu Weihnachten geschenkt haben.
Oder vielleicht vergesse ich es auch nicht. In Wahrheit hasse ich alle sogenannten »Smart«-Geräte. Ich mag es nicht, dass mir jemand erklärt, ich soll aufstehen, oder mich mit »Du schaffst das« anfeuert. Und ich brauche ganz bestimmt keine Motivationshilfe von meiner Armbanduhr.
»Scheiße«, murmele ich und lasse das Telefon wieder in den Tiefen meiner zu großen, weichen Lederhandtasche verschwinden, unschlüssig, was ich nun machen soll. Wenn mir nur ein kluger Ratschlag einfallen würde, den ich ihnen geben könnte, ein paar Worte hart erworbener Weisheit, die diese sinnlosen Kabbeleien beenden würden. Denk nach.
Aber ich verliere mich in einem Labyrinth widersprüchlicher Gedanken, weil ich auch nichts Falsches sagen und alles noch schlimmer machen will. Da halte ich lieber die Klappe.
In den fünfundvierzig Jahren, in denen ich mit Bob zusammen war, haben wir uns nur selten gestritten. Sicher, wir haben uns hin und wieder gekabbelt. Aber es gab keine lang gezogenen Scharmützel, keine Nächte, in denen wir uns an entgegengesetzte Seiten des Bettes gedrückt hätten, keine in wütendem Schweigen verbrachten Tage, keine ernsten Konflikte, an die ich mich erinnere. Wenn es drohte, hitzig zu werden, haben wir gewartet, bis der kühle Kopf wieder die Oberhand gewann, und das Problem dann friedlich ausdiskutiert.
Vielleicht lag es daran, dass wir beide den größten Teil unseres Lebens Lehrer an einer Highschool waren, eine Laufbahn, bei der Geduld eher eine Notwendigkeit als eine Tugend ist. Oder vielleicht auch daran, dass ich entschlossen war, unsere beiden Töchter nicht der gleichen verbalen Giftigkeit auszusetzen wie die, mit der ich aufgewachsen war. Weshalb auch immer: Beim ersten Anzeichen von Ärger gab einer von uns beiden entweder nach oder ruderte zurück.
Meistens ich, denke ich jetzt.
»Meinst du, du könntest deinen Arsch aus dem Weg nehmen, damit ich den Bildschirm sehen kann?«, höre ich Mick sagen und schrecke zusammen, weil ich im ersten Moment denke, er redet mit mir.
Nicht dass er je so mit mir sprechen würde. Zu mir war Mick immer nur höflich.
»Ich dachte, du hast gesagt, du hättest noch ganz viel Arbeit zu erledigen«, sagt meine Tochter.
»Und um die kümmere ich mich, wenn ich mich darum kümmere.«
»Lass gut sein«, flüstere ich.
»Das sagst du ständig«, beharrt Kleo, ohne auf meine Warnung zu hören. »Wenn du nicht aufpasst, verlierst du diesen Kunden auch noch.«
»Verdammt, Kleo. Könntest du einfach aufhören!«
»Verdammt«, wiederhole ich, gehe zurück zu meinem Wagen, öffne die Beifahrertür, schlage sie mit aller Kraft wieder zu und hoffe, dass die beiden es gehört haben.
Sofort wird die Haustür geöffnet. »Hi, Mom!«, sagt Kleo, und wie jedes Mal staune ich, wie hübsch sie ist. Mit fast siebenundvierzig sieht sie kaum älter aus als dreißig; sie hat ihr hellbraunes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und trägt keine Spur von Make-up auf ihrer makellosen Haut. Sie hat ein weißes T-Shirt und abgeschnittene Jeans an, die ihre bemerkenswerten Beine betonen. Wie ich es geschafft habe, eine derartige Schönheit zu bekommen, ist mir schleierhaft, auch wenn Kleo sich nie als solche betrachtet hat. »Wie war es mit Carol?«, fragt sie.
»Nicht so toll.«
»Das tut mir leid.«
»Was tut meiner Frau leid?«, fragt Mick, der neben Kleo im Türrahmen auftaucht und locker, beinahe zärtlich den Arm um ihre Schulter legt. Er ist ein attraktiver Mann, gut eins achtzig groß, mit vollem hellbraunem Haar und beeindruckendem Bizeps. Zusammen sind sie ein geradezu blendend schönes Paar.
Wenn sie sich bloß verstehen würden.
»Es war nicht so toll mit Carol«, erklärt Kleo und hebt den Arm, um die Hand ihres Mannes zu tätscheln.
Er küsst sie auf die Stirn. Sie sieht ihn bewundernd an.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, dass die beiden gerade aus dem Bett gestiegen sind.
»Wird ihr Alzheimer schlimmer?«, fragt Mick.
»Schwer zu sagen.«
»Ich glaube, da könnte jemand einen Drink gebrauchen«, sagt er. »Was meinst du, Linda? Es ist fast fünf. Einen kleinen Whiskey? Ein Glas Chardonnay?«
»Einen Tee fände ich schön«, sage ich.
»Tee soll es sein. Kleo? Machst du deiner Mutter eine Tasse Tee?«
Kleo wendet sich lächelnd zur Küche auf der hinteren Seite des Hauses. Als sie hüftschwenkend abzieht, gibt Mick ihr einen verspielten Klaps auf das Hinterteil.
»Komm, erzähl mir davon«, sagt Mick, führt mich in den kleinen Raum, der vom Wohnzimmer in der Mitte des Hauses abgeht, und schaltet rasch den Fernseher aus. Wir setzen uns auf das weiße Sofa, und unsere Knie berühren sich, so wie vorhin Carols und meine.
»Da gibt es nicht viel zu erzählen. Aber etwas Seltsames ist passiert.« Ich berichte ihm von meiner Begegnung mit Jenny Cooper.
»Sie hat dir erzählt, dass sie Leute umbringt?«, wiederholt er.
»Psst«, ermahne ich ihn. »Es ist ein Geheimnis.«
Er lacht. »Wen hat sie denn umgebracht?«
»Das hat sie nicht gesagt.«
»Und du hast nicht gefragt?«
»Ich hatte keine Gelegenheit.«
»Keine Gelegenheit, was zu tun?«, fragt meine Tochter, die hereinkommt und mir einen Becher dampfenden Tee reicht.
Man muss nicht mal mehr Wasser aufsetzen, denke ich. Es kommt kochend heiß aus dem Kran. Ich führe den Becher vorsichtig an die Lippen, als meine Uhr pingt und mir dazu gratuliert, dass ich den zweiten von drei Bewegungsringen geschlossen habe. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet.
Mick wiederholt die Details meiner Begegnung mit Jenny Cooper.
»Sie ist natürlich komplett verrückt«, erinnere ich die beiden.
»Das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem die Wahrheit sagt«, erwidert Mick.
KAPITEL VIER
Als ich am folgenden Montagmorgen im Legacy Place den Aufzug verlasse, lande ich in einem kaum kontrollierten Chaos. Die Flure sind voller Menschen: Schwestern und Pfleger rennen hin und her; Bewohner stehen herum, Furcht in den Augen ihrer ansonsten ausdruckslosen Gesichter.
»Was ist los?«, frage ich eine der Krankenschwestern, die an mir vorbei den Flur hinunterhastet.
Sie beachtet mich gar nicht.
»Was ist los?«, frage ich die Schwester am Etagentresen. Das Namensschild an ihrer weißen Uniform weist sie als Selena aus.
Sie senkt den Kopf und flüstert. »Heute Morgen ist bedauerlicherweise einer unserer Bewohner gestorben.«
»Oh, mein Gott. Carol …?«
»Nein, nein«, beruhigt sie mich. »Mr Oscar aus Zimmer 409.«
»Ich bringe Menschen um«, höre ich Jenny Cooper in mein Ohr flüstern.
Sei nicht albern, denke ich.
»Wie ist er gestorben?«, frage ich argwöhnisch.
»Wie?«, wiederholt Selena, als würde sie die Frage nicht recht verstehen.
»Er wurde doch nicht … ermordet, oder?« Habe ich das gerade wirklich gefragt? Bin ich eine Idiotin?
»Ermordet?« Selena sieht mich entsetzt an. »Er war fast hundert Jahre alt und ist friedlich eingeschlafen. Wenn wir nur alle so viel Glück hätten.« Sie will sich abwenden, hält dann jedoch inne. »Wie um alles in der Welt kommen Sie darauf, dass er ermordet worden ist?«
»Ich bringe Menschen um«, höre ich Jenny wieder sagen.
Ich schiebe ihre groteske Behauptung beiseite. »Ich gucke zu viele True-Crime-Dokus«, sage ich.
Selena schenkt mir ein mattes Lächeln und eilt davon.
In diesem Moment sehe ich sie.
Jenny Cooper hockt auf der Kante eines violettfarbenen Sofas in der Besucherlounge, den Blick auf eine entfernte Wand gerichtet. Aber selbst im Profil wird eines deutlich: Sie lächelt.
Ihr Lächeln jagt mir einen eiskalten Schauer über den Rücken. »Ich gucke auf jeden Fall zu viele True-Crime-Dokus«, murmele ich und gehe rasch zu Carols Zimmer, die Schultern gestrafft, als würde ich mich für ein erneutes »Psst« wappnen. Aber nichts, und ich bin ehrlich gesagt fast ein wenig enttäuscht. Es wäre zumindest eine interessante Anekdote gewesen, die ich Kleo und Mick erzählen könnte, wenn ich nach Hause komme.
Ich seufze. Zum Glück ist die Woche zu Hause relativ friedlich verlaufen. Keine Streitereien, soweit ich es mitbekommen habe, nichts, worüber man übermäßig beunruhigt sein müsste. Aber als Mutter macht man sich immer Sorgen.
»Soll ich ihr sagen, dass sie für den Rest ihres Lebens nie wieder einen sorgenfreien Augenblick haben wird?«, fragte ich meinen Mann, als unsere jüngere Tochter Vanessa zum ersten Mal schwanger war. Vanessa und ihr Mann leben mit ihren drei Kindern in Connecticut. Sie bettelt immer wieder, ich solle dorthin ziehen, damit ich mehr Zeit mit meinen Enkelkindern verbringen kann. Aber was soll ich sagen? Ich bin eine eingefleischte Bewohnerin Floridas. Außerdem lebt Kleo hier, und meine beste Freundin ist … war … hier.
Und vielleicht kommt Carol doch noch einmal zurück, sage ich mir. Wunder geschehen, obwohl jede Hoffnung auf Wunder, die ich vielleicht einmal gehegt habe, zusammen mit meinem Mann gestorben ist.
Ich gehe den Flur hinunter. Die meisten Bewohner sind in ihre Zimmer zurückgekehrt, aber einige stehen noch in den offenen Türen. Im Vorbeigehen fällt mir auf, dass alle Zimmer ähnlich eingerichtet sind.
»Hallo, Ada«, ruft ein alter Mann im Rollstuhl mir zu und winkt mit dürren Fingern.
Es ist zwecklos, ihm zu erklären, dass er sich irrt, also winke ich zurück und gehe weiter, vorbei an einer weiteren offenen Tür.
In dem Zimmer gegenüber von Carols sitzen zwei Frauen auf dem lachsfarbenen Sofa in dem kleinen Sitzbereich. Wahrscheinlich Mutter und Tochter, ihrer offensichtlichen Ähnlichkeit nach zu urteilen, beide dünn, blass und blond. Ihr Alter lässt sich unmöglich schätzen. Ich blicke zu dem schmächtigen weißhaarigen Mann auf dem Sessel neben ihnen. Wahrscheinlich der Vater der älteren Frau.
Die Frau lächelt mich an, als ich vorbeigehe; ihre Tochter runzelt die Stirn. Das arme Ding sieht aus, als wäre es überall lieber als hier. Willkommen im Klub, sage ich stumm.
Der Mann lacht, als hätte ich diesen Gedanken laut ausgesprochen. Seine Tochter lächelt. Ihre Tochter guckt mürrisch. Hinter einer Tür am Ende des Flurs schreit jemand.
Welche ihrer Albträume kehren zu ihnen zurück?
Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass manche Holocaust-Überlebende, die an Alzheimer leiden, glauben, sie wären in einem Lager. Deshalb sind sie gezwungen, das Grauen der Vergangenheit wieder und wieder zu durchleben. Wie kann das gerecht sein?
Ich schüttele den Kopf. Erwarte ich wirklich, dass das Leben gerecht ist? Habe ich in meinen sechsundsiebzig Jahren nichts gelernt?
Die Tür zu Carols Zimmer ist geschlossen wie an den meisten Tagen. Zu viel Lärm regt sie auf.
Früher hat sie Lärm geliebt. Je mehr Chaos, desto besser, hat sie immer gesagt. Wahrscheinlich hat sie deshalb fünf Kinder bekommen. Alles Jungen. Drei aus erster Ehe, zwei aus der zweiten. Einer der Söhne lebt in Miami. Die anderen vier sind rund um den Globus verstreut: einer in London, einer in Spanien, der älteste in Kalifornien, der jüngste in New York. Sie kommen abwechselnd zu Besuch. Manchmal weiß Carol noch, wer sie sind, häufiger hat sie keinen Schimmer. »So ein netter junger Mann«, bemerkte sie kürzlich nach einem Besuch.
Warum also erwarte ich weiterhin, dass sie sich an mich erinnert? Warum lege ich es darauf an, jedes Mal enttäuscht zu werden?
Ich klopfe und will gerade die Tür aufstoßen, als sie von innen geöffnet wird.
Vor mir steht Lorne Kreiger, ein trotz seiner fast achtzig Jahre erstaunlich gut aussehender Mann. Wie kommt es, frage ich mich, dass manche Männer mit dem Alter attraktiver werden? Seine hellbraunen Augen haben nichts von ihrem Funkeln verloren, und die Falten in seinem tief gebräunten Gesicht lassen ihn irgendwie distinguierter, bedeutender wirken als in jüngeren Jahren. »Linda«, sagt er und beugt sich vor, um mich auf die Wange zu küssen. »Schön, dich zu sehen.«
»Auch schön, dich zu sehen«, sage ich und klinge eigenartig förmlich. »Wie geht es ihr heute?«
»Schau selbst.« Er macht einen Schritt zurück und lässt mich eintreten.
Carol steht an ihrem üblichen Platz am Fenster. Falls sie gehört hat, dass ich hereingekommen bin, lässt sie es sich nicht anmerken.
»Carol«, sagt Lorne und schließt die Tür hinter mir. »Carol, Schatz. Sieh mal, wer da ist.«
Carol sieht mich an, lächelt und sagt nichts.
»Es ist Linda, Schatz.«
»Linda«, wiederholt sie, als wäre das Wort ein Fremdkörper auf ihrer Zunge. »Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut. Und dir?«
»Ich fühle mich pudelwohl«, sagt sie, ein Ausdruck, den ich noch nie aus ihrem Mund gehört habe. »Es ist so nett, dass du mich besuchen kommst.«
»Setzen wir uns«, schlägt Lorne vor, und das tun wir, während Carol am Fenster stehen bleibt. »Carol, Schatz? Komm zu uns.« Er klopft auf das Polster neben sich.
Carol nimmt neben ihrem Mann Platz. Sie trägt denselben Morgenmantel über demselben Schlafanzug wie bei meinem letzten Besuch. Sie streicht sich eine imaginäre Strähne hinters Ohr und sieht mich erwartungsvoll an.
»Wie geht es Kleo?«, fragt Lorne. »Und Mick, richtig?«
»Ihnen geht es gut«, sage ich. »Mick hat ein paar Probleme, sein neues Unternehmen zum Laufen zu bringen.«
»Was für ein Unternehmen?«
»Irgendwas mit digitalem Verkauf und Marketing.« Ich schüttele den Kopf. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, was heißt, dass ich keine Ahnung habe, was Mick wirklich macht. Nicht dass er nicht versucht hätte, es mir zu erklären, aber ich neige dazu, mich sofort auszuklinken, sobald ich die Wörter »digital« und »Marketing« höre. Gemeinsam sind sie eine geradezu tödliche Kombination.
»Und Kleo schreibt immer noch an ihrer Doktorarbeit?«
»Sie hofft, sie bis Weihnachten fertig zu haben.«
Ich blicke zu Carol, die scheinbar aufmerksam zuhört. Dringt irgendetwas davon zu ihr durch, frage ich mich, während Lorne und ich knapp eine Stunde lang Smalltalk machen. »Ich sollte gehen«, sage ich schließlich mit einem Blick auf meine Uhr.
»Ich bring dich zum Fahrstuhl«, sagt Lorne und fügt zu seiner Frau gebeugt hinzu: »Ich bin gleich zurück, Schatz.«
Carol lächelt und starrt weiter mit unveränderter Miene auf den Platz, wo wir gesessen haben.
»Vielen Dank, dass du gekommen bist«, sagt er, als wir vor den Aufzügen stehen.
»Ist das dein Freund?«, ruft plötzlich jemand.
Ohne hinzugucken, weiß ich, dass es die Stimme von Jenny Cooper ist.
»Linda hat einen Freund! Linda hat einen Freund!«, krakeelt sie.
»Oh, mein Gott!«
»Kennst du sie?«, fragt Lorne.
»Ich bin ihr letzte Woche begegnet. Nicht zu fassen, dass sie sich an meinen Namen erinnert.«
»Linda hat einen Freund! Linda hat einen Freund!«
»Okay, Jenny«, sagt Selena, erhebt sich von ihrem Platz am Etagentresen und eilt auf Jenny zu. »Das reicht.«
»Ist er dein Liebhaber?«, bohrt Jenny weiter und schmatzt förmlich mit den Lippen. »Wirst du ihn später ficken?«
»Gütiger Gott«, sage ich und wünschte, die Erde würde sich auftun und mich einfach mit Haut und Haaren verschlucken.
»Ficken, ficken, ficken, ficken, ficken«, ruft Jenny mit jeder Wiederholung des Wortes emphatischer.
»Entschuldigen Sie«, sagt Selena und packt Jennys Arm. Die Obszönität hallt zwischen den Wänden wider, während Selena die widerspenstige Frau den Flur entlang zu ihrem Zimmer führt.
Ein letztes nachdrückliches »Ficken«, und sie ist verschwunden.
»Nun, das war … ungewöhnlich«, sagt Lorne lächelnd.
»Das war es wohl.«
»Sie scheint dieses Wort auf jeden Fall zu mögen.«
Es ist ein gutes Wort, denke ich.
Wie aufs Stichwort öffnet sich die Fahrstuhltür, und ich betrete die Kabine. »Ficken«, flüstere ich, als die Tür wieder zugeht. »Ficken, ficken, ficken, ficken, ficken.«
KAPITEL FÜNF
Ich hatte seit drei Jahren keinen Sex mehr.
Das denke ich, als ich eine Woche später auf den Parkplatz vom Legacy Place einbiege. Ehrlich gesagt habe ich seit meinem letzten Besuch an kaum etwas anderes gedacht; das Wort ficken ist unablässig durch meinen Kopf getitscht wie eine dieser silbernen Kugeln in einem Flipperautomaten.
Werden Flipperautomaten noch hergestellt?, frage ich mich. Oder sind sie den Weg von Stereoanlagen und CDs gegangen und von Video-Games oder Spielen ersetzt worden, die man auf dem Handy spielt? Ich steuere meinen großen cremeweißen Mercedes auf den ersten freien Platz, wo ein schrilles Piepen mich warnt, nicht zu dicht an den Zementblock vor den schicken Vorderreifen des Wagens heranzufahren. Den Wagen hat Bob unmittelbar nach seiner Krebsdiagnose gekauft, ausgestattet mit einer beunruhigenden Palette pfeifender und bimmelnder Warntöne. »Da kann ich wenigstens die Fahrt ins Krankenhaus zu meinen Behandlungen genießen«, meinte er.
Wie sich herausstellte, blieb ihm nicht viel Zeit, noch irgendetwas zu genießen.
Ich stelle den Motor ab und lehne mich an die Kopfstütze. In den Falten des Lederpolsters kann ich noch eine Spur von Bob riechen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wahrscheinlich ist es der Grund, warum ich zögere, die verdammte Karre gegen einen anderen Wagen einzutauschen, obwohl der große Mercedes viel zu viel Auto für mich ist. Mit Bobs Kleidung war es das Gleiche. Erst als Kleo und Mick eingezogen sind, habe ich endlich eingewilligt, seine alten Anzüge und Golfshorts zu Goodwill zu bringen. Ganz hinten in einem Kleiderschrank versteckt, bewahre ich immer noch ein paar Hemden von ihm auf, von denen ich gelegentlich eins überstreife, wenn ich nicht einschlafen kann.
Sie sind nicht die Einzige, die Geheimnisse hat, denke ich und sehe vor meinem inneren Auge Jenny Cooper.
Das Wort ficken macht sich erneut in meinem Kopf breit. »Vielen Dank auch, Jenny.« Als ich die Wagentür öffne, drückt mich die für April ungewöhnlich stickige Hitze beinahe zurück auf den Sitz. Irgendwie hatte ich es geschafft, alle Gedanken an Sex in meinen Hinterkopf zu verbannen, wo sie in den vergangenen zwei Jahren auch bequem verborgen geblieben sind wie Bobs Hemden in der hintersten Ecke meines Kleiderschranks. Jennys schockierender Ausbruch hat sie schlagartig wieder wachgerufen.
Sex mit Bob war immer so gut gewesen. Wir hatten entdeckt, dass man das, was man mit der Zeit an Ausdauer verliert, mit Technik wettmachen konnte. Und auch wenn keiner von uns noch Lust oder Geduld für endlose Liebesnächte hatte, hatten wir im Laufe der Jahre gelernt, was funktionierte und wie man es in überraschendem – und überraschend befriedigendem – Tempo erreichte.
Und in den ersten Monaten nach seiner Diagnose änderte sich daran auch nichts. Wir genossen weiterhin ein aktives Sexualleben, und ich konnte mir einreden, dass Bob trotz seiner tödlichen Diagnose nicht wirklich sterben würde.
Bis wir keinen Sex mehr hatten.
Da wusste ich es.
Ich sagte mir, dass ich es nicht vermisste. Ich fand mich mit der Tatsache ab, dass ich keine dieser glücklichen Seniorinnen sein würde, von denen man manchmal liest, die auch mit über neunzig noch ein aktives Sexualleben genossen.
Existierten solche Leute wirklich?, frage ich mich jetzt, als ich auf den Eingang vom Legacy Place zugehe.
Vielleicht, denke ich, als ich die klimatisierte Lobby und einen wartenden Aufzug betrete. Man muss Glück haben, wie bei fast allem im Leben.
Und ich habe mehr Glück gehabt als viele andere Menschen. Mehr als Carol, denke ich, als ich aus dem Fahrstuhl trete und den Flur entlanggehe. Vor ihrer Tür atme ich ein paarmal tief ein und wappne mich gegen das leere Starren, mit dem sie mich begrüßen wird.
Aber als ich die Tür aufstoße, sehe ich nicht Carol.
Ich sehe Jenny Cooper.
Sie steht neben dem Bett und starrt auf Carol hinab, die reglos auf der Bettdecke liegt.
Atmet sie?
»Oh, mein Gott«, stoße ich keuchend hervor und stürze förmlich durchs Zimmer an Carols Bett.
»Vorsicht«, ermahnt Jenny mich und tritt einen Schritt zurück. »Sonst wecken Sie sie auf.«
Ich seufze erleichtert, dass Carol tatsächlich nur schläft. Habe ich wirklich – auch nur für den Bruchteil einer Sekunde – geglaubt, dass Jenny ihr etwas angetan haben könnte? Ich fahre zu ihr herum. »Was machen Sie hier?«
»Ich habe einen Besuch gemacht.«
»Ich denke, Sie sollten jetzt gehen.«
Jenny eilt sofort zur Tür. »Was haben Sie für ein Problem?«
Ich blicke ihr nach, lasse mich auf einen der lachsfarbenen Sessel fallen und konzentriere mich darauf, meine Atmung zu beruhigen. Jennys Überraschungsbesuch hat mich verunsichert. Was hat sie hier gemacht?
»Ich bringe Menschen um«, höre ich sie flüstern.
»Nein, tun Sie nicht!«, sage ich laut.
Nach zehn Minuten wird offensichtlich, dass Carol in nächster Zeit nicht aufwachen wird. Und selbst wenn, würde es keinen großen Unterschied machen, egal, was ich immer wieder hoffe.
Ich warte weitere fünf Minuten, bevor ich an ihr Bett trete. »Auf Wiedersehen, Carol«, flüstere ich, beuge mich vor, um sie auf die Wange zu küssen, und lasse es dann doch. Was, wenn sie aufwacht und mich über sich gebeugt sieht, so wie vorhin Jenny Cooper? Würde sie schreien oder mit Fäusten auf mich losgehen? Lorne hat mir anvertraut, dass sie gelegentlich gewalttätig wird, obwohl ich das nur schwer glauben kann. Carol war immer eine so sanfte Seele. »Ich komme in ein paar Tagen wieder«, sage ich und richte mich auf. »Pass auf dich auf«, füge ich hinzu und denke dabei an Jenny.
Ich gehe zum Etagentresen und erwarte beinahe, dass Jenny auf der Kante eines Sofas in der Besucherlounge hockt und auf mich wartet.
Aber der Besucherbereich ist leer, und ich merke überrascht, dass ich enttäuscht bin.
»Wussten Sie, dass Jenny vorhin im Zimmer meiner Freundin Carol war?«, frage ich Selena.
»Ja«, sagt sie unbekümmert. »Sie besucht oft andere Bewohner. Sie nennt es ›meine Runden machen‹. Eigentlich irgendwie niedlich. Sie hat doch nichts weggenommen, oder?«
»Nein, ich glaube nicht.«
Selena lächelt und wendet ihre Aufmerksamkeit wieder dem Computer zu.
»Meinen Sie, es wäre in Ordnung, wenn ich sie besuche?«
»Sie ist bestimmt begeistert.«
Mit einem Nicken wende ich mich wieder dem langen Flur zu, bleibe dann jedoch noch einmal stehen und drehe mich um. »Entschuldigen Sie, in welchem Zimmer ist sie?«
»Zimmer 415. Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen?«
»Nein«, gebe ich zu.
»Na, viel Spaß«, ruft sie mir nach, als ich den Flur hinuntergehe.
Warum mache ich das, frage ich mich. Warum verbringe ich mehr Zeit als nötig mit jemandem, der offensichtlich nicht ganz richtig im Kopf ist, einer Frau, die mir Obszönitäten an den Kopf wirft und behauptet, sie würde Menschen ermorden? Was fasziniert mich so an ihr? Ist die Welt nicht schon gefährlich genug, ohne dass ich aktiv Ärger suche?
Und dann trifft mich die Erkenntnis: Ich habe nichts anderes zu tun.
Und wenn ich ehrlich bin, will ich nicht nach Hause fahren.
Drei Erwachsene, die unter einem Dach zusammenleben, das ist selbst in besten Zeiten nicht leicht, und dies sind definitiv nicht die besten Zeiten. Kleo und Mick haben sich wieder gestritten, und auch wenn sie sich bemüht haben, ihre Stimmen zu dämpfen, ist es schwer, die Spannung im Haus nicht zu spüren. Sie sickert durch die Wände, schlängelt sich über den Boden, hüllt mich ein wie giftiger Nebel und ruft schmerzhafte Erinnerungen wach.
Vielleicht ist es doch Carol, die Glück gehabt hat, denke ich, bleibe vor Jennys Tür stehen, atme ein paarmal tief durch und klopfe.
»Wer ist da?«, fragt die vertraute Stimme.
»Ich bin’s. Linda Davidson.«
Die Tür wird nur einen Spalt geöffnet, ein altes Gesicht späht heraus. »Linda Davidson«, wiederholt Jenny. »Sie waren eben sehr unhöflich zu mir.«
»Das tut mir leid.«
»Was wollen Sie?«
»Ich dachte, ich könnte Sie ein Weilchen besuchen.«
»Wieso?«
»Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.«
Jenny Cooper öffnet die Tür weiter und starrt mich an, als wäre ich diejenige, die unter Demenz leidet, und nicht sie.
Und vielleicht hat sie recht, denke ich unwillkürlich und wende mich zum Gehen. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe.«
»Na, jetzt sind Sie schon hier. Da können Sie auch reinkommen.«
Tu es nicht, ruft eine leise Stimme in meinem Kopf. Lauf weg, solange du noch kannst.
Aber wie so oft, wenn die Neugier den gesunden Menschenverstand überwältigt, ignoriere ich diese leise Stimme und betrete das Zimmer.
KAPITEL SECHS
Jenny Cooper schließt die Tür hinter mir und weist auf die Cordsamtsessel. »Was sagten Sie noch, wer Sie sind?«, fragt sie.
»Linda Davidson. Wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt.«
Sie nickt, aber ihre leeren blauen Augen verraten, dass sie sich nicht an ein solches Treffen erinnern kann. Sie streicht sich ein paar lange graue Strähnen aus der Stirn, lässt sich behutsam auf einem der Sessel nieder und macht mir ein Zeichen, ebenfalls Platz zu nehmen.
»Sie haben mir erzählt, dass Sie ein Geheimnis haben«, sage ich vorsichtig, während ich mich setze.
In ihren blassblauen Augen blitzt ein Funke auf. »Habe ich Ihnen auch erzählt, was es ist?«
»Sie haben gesagt, dass Sie … dass Sie … Menschen umbringen.«
»Wirklich?«, sie stößt ein entwaffnend mädchenhaftes Kichern aus, nestelt an den Knöpfen ihrer weißen Bluse, wischt mit den Handflächen über den Schoß ihrer grauen Hose und kichert erneut.
Spielt sie mit mir?, überlege ich.
»Sind Sie bei der CIA?«, fragt sie.
»Was?«
»Die CIA. Haben die Sie geschickt, um mich auszuspionieren?«
»Was?«
»Warum sagen Sie andauernd ›was?‹? Sind Sie taub?«
Das war definitiv keine gute Idee. Was in Gottes Namen habe ich mir dabei gedacht? »Ich sollte jetzt gehen«, sage ich und bin schon halb aus meinem Sessel aufgestanden, ehe ihre langen knochigen Finger nach meinem Arm greifen.
»Bleiben Sie«, weist sie mich an.
Ich nehme wieder Platz.
»Wen habe ich umgebracht?«
»Ich weiß nicht. Das haben Sie mir nicht erzählt.«
»Habe ich gesagt, wie viele Menschen ich umgebracht habe?«
»Nein, haben Sie nicht.«
»Hm«, sagt sie. Und dann noch einmal, wie um die Angelegenheit ein für alle Mal abzuschließen: »Hmm.«
Ihre schmalen Lippen zucken hin und her. Ihre blasse, beinahe durchscheinende Haut errötet zart.
»Vier«, sagt sie.
»Was?«
»Vier Leute.«
»Wollen Sie sagen, Sie haben vier Personen umgebracht?«
»Sind Sie beim FBI?«, fragt sie zurück.
»Beim FBI? Nein, natürlich nicht.«
»Bei der Polizei?«
»Ich bin bei niemandem.«
»Nie geheiratet oder verwitwet?«
»Was?«
»Sie haben gesagt, Sie sind bei niemandem. Sind Sie eine alte Jungfer oder eine Witwe?«
Eine Jungfer? Wie lange habe ich dieses Wort nicht mehr gehört?, frage ich mich, kurz abgelenkt. »Ich bin verwitwet.«
»Dann haben Sie wohl so oder so Glück gehabt.«
»Glück?«
»Ehemänner sind nichts weiter als kolossale Nervensägen. Ich weiß das. Ich hatte mehrere.«
»Haben Sie sie umgebracht?«, frage ich, während mir auffällt, dass diese Unterhaltung von Minute zu Minute surrealer wird. Außerdem merke ich, dass ich mich irgendwie amüsiere, und bekomme sofort ein schlechtes Gewissen.
»Was für eine Frage!«, ruft Jenny. »Haben Sie Ihren Mann umgebracht?«
»Was? Nein, natürlich nicht.«
»Und warum denken Sie dann, ich hätte meinen umgebracht?«
»Weil Sie gesagt haben, dass Sie Menschen umbringen und dass Ehemänner beschissene Nervensägen sind.«
»Ich glaube, ich sagte ›kolossale Nervensägen‹.«
»Ja. Entschuldigen Sie.«
»Das Wort ›beschissen‹ mochte ich noch nie. Es ist ziemlich vulgär. Finden Sie nicht auch?«
Mir fehlen offen gestanden die Worte. Also sage ich nichts.
»Vielleicht.«
»Vielleicht … was?«, frage ich vorsichtig. »Vielleicht haben Sie sie umgebracht?«
»Ja, vielleicht habe ich sie umgebracht«, bestätigt sie.
»Sie wissen es nicht genau?«
»Was?«
»Ob Sie sie umgebracht haben oder nicht.«
»Wen soll ich umgebracht haben?«
»Im Ernst?« Sie spielt auf jeden Fall Spielchen mit mir, entscheide ich. »Haben Sie Mr Oscar umgebracht?«, taste ich behutsam weiter.
»Wer ist Mr Oscar?«
»Mr Oscar aus Zimmer 409. Er ist letzte Woche gestorben.«
»Warum sollte ich ihn umbringen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie sind nicht besonders helle, oder?«, fragt Jenny.
Wahrscheinlich nicht, denke ich. »Ich gehe dann jetzt mal lieber.«
»Oh, mein Gott«, ruft sie und springt auf.
»Was ist?«, frage ich, ebenfalls sofort auf den Beinen.
»Da ist Blut.«
»Was?«
»Blut! Blut!« Sie zerrt an ihrer Bluse.
Ich bemerke auf ihrer Bluse einen münzgroßen braunen Fleck unter der linken Brust.
»Das ist kein Blut«, versuche ich sie zu beruhigen. »Es sieht eher aus wie ein Kaffeefleck. Haben Sie heute Morgen Kaffee getrunken?«
»Was haben Sie mir angetan?«, will sie wissen, ohne meine Frage zu beachten, ihre Stimme gefährlich nah an einem Kreischen.
»Ich habe gar nichts getan. Sie müssen sich beruhigen, Jenny. Bitte …«
»Sie haben mich gestochen!«
»Was?! Nein. Natürlich habe ich Sie nicht gestochen …«
»Hilfe! Zu Hilfe, irgendjemand!«
»Jenny, bitte. Niemand hat Sie angerührt. Es ist kein Blut.«
»Sie versuchen, mich umzubringen!«
»Es ist bloß ein Kaffeefleck.«
Sie hört auf zu schreien. »Ein Kaffeefleck?«
»Haben Sie heute Morgen Kaffee getrunken?«, frage ich noch einmal.
Sie knöpft ihre Bluse auf und entblößt das angegraute Unterhemd darunter. Darauf findet sich keine Spur von Blut.
»Sehen Sie? Ihnen ist nichts passiert. Kein Blut.«
»Ein Kaffeefleck«, sagt sie.
Die Tür geht auf, und Selena steckt den Kopf ins Zimmer. »Ist hier drinnen alles in Ordnung? Mir war, als hätte ich Schreie gehört.«
»Alles bestens«, versichere ich ihr, während Jenny an ihrer Bluse herumfummelt und versucht, sie wieder zuzuknöpfen. »Sie war nur kurz verwirrt.«
»Vielleicht sollten Sie ein anderes Mal wiederkommen«, schlägt Selena vor, was ich nur allzu gern aufgreife.
»Selbstverständlich.«
»Warten Sie«, ruft Jenny, als ich zur Tür gehe. »Bitte, Linda Davidson«, sagt sie, und ich bleibe wie angewurzelt stehen, als mein voller Name über ihre Lippen kommt. »Sie kommen doch wieder, oder?«
Ich zögere.
»Bitte. Es tut mir leid, dass ich gesagt habe, Sie wären nicht besonders helle.«
»Ich versuche es.« Was soll ich sonst sagen?
»Das nächste Mal, wenn Sie Ihre Freundin Carol besuchen«, sagt sie mit einer Klarheit, die mir beinahe den Atem raubt. »Dann kommen Sie auch zu mir?«
Ist die Erwähnung von Carol eine Art verschleierte Drohung? »Ich versuche es«, sage ich noch einmal und staune, wie selektiv ihr Erinnerungsvermögen ist.
»Das fände ich schön.«
Ich folge Selena auf den Flur.
»Es gibt so viel, worüber wir reden müssen«, höre ich Jenny sagen, als sich die Tür hinter mir schließt.
KAPITEL SIEBEN
»Du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach, sie noch einmal zu besuchen!« Kleo hat ihre hellbraunen Augen ungläubig aufgerissen. Wir sitzen an dem runden weißen Tisch in meiner Küche, an dem wir gerade unser Abendessen, bestehend aus gedünstetem Lachs und gebratenem Gemüse, beendet haben. Mick genießt seinen wöchentlichen Abend mit »den Jungs«.
Ich weiß nicht genau, warum Mick einmal die Woche ausgehen darf, zumal er Kleo ständig in den Ohren liegt, ihre Ausgaben einzuschränken, aber ehrlich gesagt freue ich mich, ein wenig Zeit allein mit meiner Tochter zu haben.
»Sie hat dich beschuldigt, auf sie eingestochen zu haben, Herrgott noch mal.«
»Ich weiß, aber …«
»Aber was? Nichts aber. Sie erzählt dir, dass sie vier Menschen umgebracht hat, und dann beschuldigt sie dich, du hättest versuchst, sie zu töten?! Du gehst nicht noch mal dorthin.«
»Natürlich gehe ich noch einmal dorthin. Carol ist dort.«
»Okay, Carol kannst du besuchen. Aber du begibst dich nicht noch einmal in die Nähe dieser … dieser … Person …«
»Jenny Cooper.«
»… dieser Jenny Cooper. Sie ist unzurechnungsfähig.«
»Deswegen ist sie dort«, erinnere ich Kleo lächelnd.
»Und deswegen solltest du dich von ihr fernhalten. Was hast du mir erklärt, als ich klein war und einmal einen Mann angestarrt habe, der sich mitten auf der Straße ausgezogen hat? ›Bei Verrückten bleibt man nicht stehen‹, hast du mir erklärt.«
»Sie ist bloß verwirrt«, erwidere ich, wohl wissend, dass Demenz mehr ist als eine schlichte Verwirrung. »Sie bekommt wohl keinen Besuch. Wahrscheinlich ist sie einsam.«
»Tja, nun. Das kommt davon, wenn man all seine Freunde umbringt.«
Ich lache. »Sie hat nicht gesagt, dass sie ihre Freunde umgebracht hat …«
»Nein. Bloß ihre Ehemänner.«
»Also, um ehrlich zu sein, wusste sie es nicht genau …«
Jetzt lachen wir beide. Mein schlechtes Gewissen kehrt zurück. Es ist nicht nett, über das Unglück anderer Menschen zu lachen. Trotzdem, wenn man nicht lachen kann …
»Wie ist sie überhaupt im Legacy Place gelandet?«
»Wie meinst du das?«
»Na ja, es ist keine staatliche, sondern eine private Einrichtung. Diese Apartments sind ziemlich teuer. Irgendjemand muss dafür aufkommen.«
Ich denke an die exklusive Lage mit Meerblick, die medizinische und pflegerische Rund-um-die-Uhr-Betreuung und die drei Mahlzeiten pro Tag, die im Legacy Place angeboten werden. Lorne hat mir anvertraut, dass es ihn ein Vermögen kostet, Carol dort unterzubringen. »Es ist nicht billig«, stimme ich ihr zu.
»Also, wer bezahlt das alles?«
Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung habe.
»Wie dem auch sei«, fährt Kleo fort, »die Frau ist offensichtlich instabil. Und sie ist nicht dein Problem. Du kannst nicht alle retten.«
Ich nicke und beginne, den Tisch abzuräumen.
Im Laufe der Jahre habe ich gesehen, wie mein Vater einem Herzinfarkt erlegen und meine Mutter an einem Schlaganfall gestorben ist. Vor fünf Jahren habe ich meinen älteren Bruder an Prostatakrebs verloren, drei Jahre später meinen Mann an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Jetzt stehe ich hilflos daneben, während meine beste Freundin vor meinen müden Augen verschwindet.
In Wahrheit habe ich nie irgendjemanden retten können.
»Lass mich das machen«, sagt Kleo, nimmt mir das Geschirr aus der Hand und räumt es in die Spülmaschine. »Setz du dich wieder. Du hattest einen anstrengenden Tag.«
Ich gehorche. »Was ist mit dir?«, frage ich. »Ich habe die ganze Zeit geredet. Erzähl mir von deinem Tag.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Ist nicht viel zu erzählen.«
»Wie kommst du mit deiner Doktorarbeit voran?«
Ein weiteres Achselzucken. »Nicht so besonders«, gibt sie zu. »Möchtest du einen Tee?«