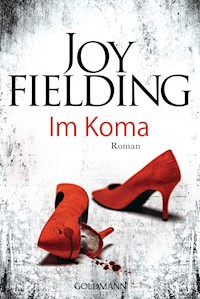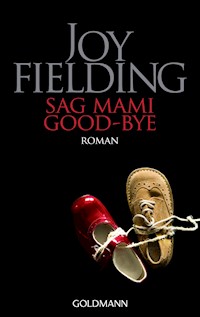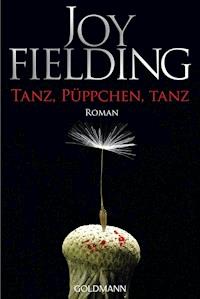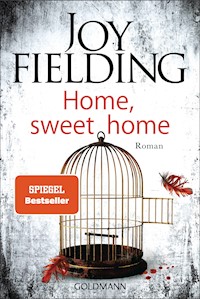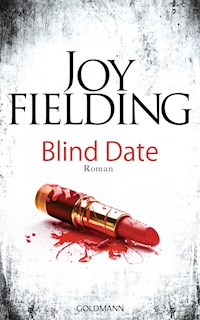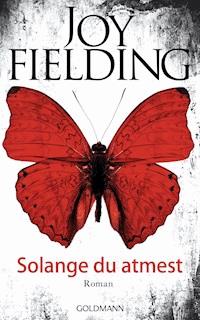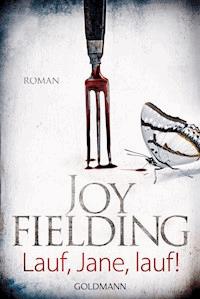9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
Die Hoffnung stirbt nie. Sie tötet ...
Das Leben von Marcy Taggart gerät völlig ins Wanken, als ihre Tochter bei einer Bootsfahrt unter rätselhaften Umständen verschwindet. Auch wenn ihre Leiche nie gefunden wird, gilt Devon als tot. Nur Marcy weigert sich, dies zu glauben, und klammert sich an die Hoffnung, dass Devon noch lebt. Als Marcy alleine nach Irland reist, passiert das Unfassbare: Bei einem Besuch im Pub glaubt sie, ihre Tochter auf der Straße vorbeilaufen zu sehen. Von nun an setzt sie alles daran, Devon zu finden – nicht ahnend, dass sie ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
Marcy Taggart, die in Toronto lebt, hat schwere Zeiten hinter sich. Zwei Jahre zuvor wurde das Kanu ihrer Tochter Devon auf einem See treibend aufgefunden, seither fehlt von der jungen Frau jede Spur. Obwohl die Leiche nie auftauchte, gilt Devon als tot, doch Marcy klammert sich in ihrer anhaltenden Verzweiflung an die irreale Überzeugung, dass ihre Tochter eines Tages zu ihr zurückkehrt. Als ihr Mann Peter sie auch noch wegen einer jüngeren Frau verlässt, hat sie nichts mehr, worauf sie noch vertrauen kann im Leben. Dennoch entschließt sie sich, die zuvor gemeinsam geplante Reise nach Irland alleine anzutreten. Bei einem Ausflug geschieht etwas Unfassbares, denn sie glaubt, durch die Scheibe eines Pubs in Cork die Silhouette ihrer Tochter gesehen zu haben. Marcy mietet sich in einer kleinen Pension ein, besessen von dem Gedanken, Devon endlich zu finden. Eine erste Spur führt in das Haus der wohlhabenden Familie O'Connor, doch während Marcy noch damit beschäftigt ist, widersprüchlichen Hinweisen zu folgen, wird ihr Zimmer völlig verwüstet. Hat sie einen unsichtbaren Feind, der verhindern will, dass sie dem rätselhaften Schicksal ihrer Tochter auf den Grund kommt? Noch kann Marcy nicht ahnen, dass sie in Geschehnisse verwickelt werden wird, die sie fast das Leben kosten ...
Joy Fielding
gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Die Katze • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Flieh wenn du kannst • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
(alle auch als E-Book erhältlich)
Joy Fielding
Herzstoß
Psychothriller
Deutsch von Kristian Lutze
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel»Now You See Her« bei Atria Books, New York.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2011
by Joy Fielding, Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Erstveröffentlichung 2011
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur
Umschlagmotiv: Trevillion Images / Amy Hopp; FinePic, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-06225-5V002
www.goldmann-verlag.de
Für meine beiden hinreißenden Mädchen Shannon und Annie Ich liebe euch mehr,
KAPITEL EINS
»Okay, wenn Sie sich bitte für einen Moment um mich versammeln würden, dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was über das prachtvolle Gebäude vor Ihnen.« Der Führer lächelte die Gruppe von müden und leicht abgekämpft wirkenden Touristen aufmunternd an, die vor der St. Anne’s Shandon Church umherschwirrten. »So ist’s fein«, schmeichelte er in seinem übertriebenen irischen Singsang und schwenkte ungeduldig einen smaragdgrünen Schal über seiner stattlichen Gestalt. »Kommen Sie ein Stückchen näher, junge Dame. Ich beiße nicht.« Sein Lächeln wurde breiter, sodass die untere Reihe seiner fleckigen und krummen Zähne sichtbar wurde.
Gut, dass ihr Mann die Reise nach Irland am Ende doch nicht mitgemacht hatte, dachte Marcy Taggart, als sie ein paar zögerliche Schritte nach vorn machte. Er hätte das schiefe Gebiss des armen Mannes als persönlichen Affront betrachtet. Da geben die Leute haufenweise Geld für Schönheitsoperationen und Designerklamotten aus und vergessen das Wichtigste von allem – ihre Zähne, empörte er sich regelmäßig. Als Kieferorthopäde neigte Peter zu solch harschen Urteilen. Hatte er ihr nicht einmal erklärt, dass ihm als Erstes nicht ihre schlanke Figur oder ihre großen braunen Augen aufgefallen waren, sondern ihre sorgfältig gepflegten, geraden und makellos weißen Zähne? Heute konnte Marcy sich nur wundern, dass sie solche Äußerungen einmal schmeichelhaft, ja, sogar romantisch gefunden hatte.
»Darf ich um Ihre volle Aufmerksamkeit bitten«, sagte der Touristenführer mit einem leicht tadelnden Unterton. Offensichtlich war er an die beiläufige Unhöflichkeit der ihm Anbefohlenen gewöhnt und nahm schon lange keinen Anstoß mehr daran. Obwohl die vierundzwanzig Frauen und Männer vorwiegend mittleren Alters viel Geld für den Tagesausflug nach Cork bezahlt hatten, der mit etwa 120 000 Einwohnern zweitgrößten Stadt der Republik Irland, hatte bestenfalls eine Handvoll von ihnen auch nur einem Wort zugehört, das der Mann seit der Abfahrt in Dublin gesagt hatte.
Marcy hatte es versucht, sie hatte sich wirklich angestrengt. Immer wieder hatte sie sich zur Konzentration ermahnt, als der Führer sie auf der scheinbar endlosen Busfahrt über 168 Meilen verstopfte Autobahnen und enge Landstraßen über die wechselvolle Geschichte Corks belehrt hatte. Der Name ging auf das irische Wort »corcach« zurück, ausgesprochen »kar-kax«, was so viel bedeutete wie »sumpfiger Ort« und sich auf die Lage der Stadt an dem Fluss Lee bezog; sie war im siebten Jahrhundert nach Christus gegründet worden und heute Verwaltungssitz der Grafschaft Cork und die größte Stadt der Provinz Munster. »Die eigentliche Hauptstadt Irlands« nannten die Bewohner Corks ihre Stadt; ihr Beiname »Rebel City« kam daher, dass die Stadtoberen 1491 nach dem Ende der englischen Rosenkriege den Kronprätendenten Perkin Warbeck unterstützt hatten. Heute war Cork der größte Industriestandort im Süden Irlands, wichtigster Zweig war die pharmazeutische Industrie, bekanntestes Produkt ausgerechnet Viagra.
Zumindest glaubte Marcy, dass der Führer das gesagt hatte. Sicher war sie sich nicht. Ihre Fantasie spielte ihr in letzter Zeit unerfreulich häufig Streiche, und mit fünfzig war ihr Gedächtnis auch nicht mehr das, was es einmal war. Aber wovon konnte man das schon behaupten, dachte sie, als sie den Blick verstohlen über die starren Mienen ihrer Mitreisenden schweifen ließ, die ihre besten Zeiten allesamt offensichtlich längst hinter sich hatten.
»Wie Sie sehen, beherrscht der Turm von St. Anne’s hier oben auf der Hügelkuppe den gesamten Nordteil der Stadt«, mühte der Führer sich, die Führer der anderen Reisegruppen zu übertönen, die plötzlich aufgetaucht waren und sich an der Straßenecke um die beste Position drängelten. »St. Anne’s ist das bedeutendste Gebäude von Cork, ihr 1722 erbauter Turm, der an einen riesigen Pfefferstreuer erinnert, gilt weithin als Wahrzeichen der Stadt. Von jedem Punkt in der Altstadt können Sie die Spitze mit der vergoldeten Kugel und die einzigartige Wetterfahne in Fischform sehen. Zwei Seiten des Turmes sind mit rotem Sandstein verklinkert, die beiden anderen mit weißem Kalkstein, Farben, die sich auch in den Trikots der Fußball-Mannschaft und des Hurling-Teams der Stadt wiederfinden.« Er wies auf die große, runde, schwarz-goldene Uhr im untersten Stock der vierstöckigen Turmspitze. »Die große Uhr von Shandon sagt den Bewohnern Corks, wie spät es ist, die Fahne auf der Spitze, wie das Wetter wird.« Im selben Moment ertönte ein Glockenspiel, das die Umstehenden mit offenem Mund staunen ließ. »Das sind unsere berühmten acht Shandon-Glocken«, sagte der Führer stolz. »Wie Ihnen bestimmt schon aufgefallen ist, sind sie den ganzen Tag überall in der Stadt zu hören. Und wenn Sie den Turm besteigen, können Sie sogar selbst darauf spielen, jede Melodie, die Sie wollen, obwohl die meisten Leute sich entweder für ›Danny Boy‹ oder für ›Ave Maria‹ entscheiden.« Er atmete tief ein. »Okay, dreißig Minuten für die Besichtigung der Kirche, danach geht es rüber zum Patrick’s Hill, damit Sie selbst erleben, wie steil die Gassen dort sind. Amerikaner sagen, sie könnten es mit den berüchtigten Straßen von San Francisco aufnehmen.«
»Was ist mit denjenigen, für die der Aufstieg zu beschwerlich ist?«, fragte eine ältere Frau, die weiter hinten stand.
»Für heute hab ich genug von Kirchen«, murmelte der Mann neben ihr. »Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich könnte ein Pint Guinness vertragen.«
»Für diejenigen unter Ihnen, die genug gesehen haben und sich vor der Weiterfahrt lieber ein wenig ausruhen und entspannen wollen, herrscht in der Umgebung kein Mangel an Pubs. Obwohl man die Einheimischen dort eher bei einem Murphy’s oder einem Beamish antreffen wird, zwei Dunkelbiere, die hier in Cork gebraut werden.«
»Klingt gut«, meinte irgendjemand.
»Wir treffen uns in einer Stunde am Busbahnhof Parnell Place«, verkündete der Führer. »Bitte seien Sie pünktlich, sonst bleibt uns am Ende womöglich nicht genug Zeit, auf der Rückfahrt nach Dublin das berühmte Blarney Castle zu besichtigen. Und Sie wollen doch sicher alle den berühmten Blarney Stone küssen, oder?«
Nein, das wollten sie auf keinen Fall, dachte Marcy und erinnerte sich an Peters Ekel bei der Vorstellung, wie eine Fledermaus an den Füßen kopfüber herabgelassen zu werden, um »einen schmutzigen, bakterienverseuchten grauen Stein zu küssen, der mit dem Speichel anderer Leute beschmiert war«, wie er sich so denkwürdig ausgedrückt hatte, als sie ihm die Prospekte zum ersten Mal gezeigt hatte. »Warum sollte jemand, der halbwegs bei Verstand ist, so etwas tun wollen?«, hatte er vorwurfsvoll gefragt.
Marcy hatte gelächelt und geschwiegen. Peter hatte schon vor einiger Zeit aufgehört zu glauben, dass sie halbwegs bei Verstand war.
War das nicht der Grund gewesen, warum sie überhaupt beschlossen hatten, diese Reise zu unternehmen? Hatten nicht alle gesagt, dass es wichtig – ja, entscheidend – für ihr seelisches Wohlbefinden wie auch ihre Ehe war, dass sie und Peter mehr Zeit miteinander verbrachten, Zeit, um das Geschehene als Einheit zu verarbeiten? War das nicht der Ausdruck, den der Psychologe benutzt hatte?
Als ihre Schwester dann die Idee aufgebracht hatte, sie könnten ihren 25. Hochzeitstag doch mit zweiten Flitterwochen begehen, hatte Marcy sich kopfüber in die Planung gestürzt. Irland war Peters Vorschlag gewesen, weil seine Mutter aus Limerick stammte. Jahrelang hatte er davon gesprochen, eine Pilgerfahrt ins Land seiner Vorfahren zu machen. Marcy hatte anfangs für ein exotischeres Ziel wie Tahiti oder Bali plädiert, irgendwo, wo die Durchschnittstemperatur im Juli spürbar über 18 Grad lag, sie Mai Tais am Strand schlürfen und Blumen im Haar tragen konnte; im Gegensatz zu einem Land, in dem Guinness angesagt und es ständig so regnerisch und feucht war, dass sie garantiert aussehen würde, als ob gerade ein Klumpen widerspenstiges Moos auf ihrem Kopf gelandet wäre. Doch im Grunde war es egal, wohin sie fuhren, hatte sie sich gesagt, solange sie es als Einheit taten.
Also hatten sie sich für Peters Vorschlag entschieden.
Aber am Ende hatte Peter sich für eine ganz andere Frau entschieden.
Galt man alleine auch noch als Einheit, fragte Marcy sich jetzt. So sehr sie die oft spektakuläre Natur der irischen Landschaft mit ihren viel gerühmten vierzig Schattierungen von Grün liebte, so sehr hasste sie das graue regnerische Wetter und die alles durchdringende Feuchtigkeit, die wie eine zweite Haut an ihr klebte.
Er könne nicht noch mehr Drama ertragen, hatte Peter gesagt, als er ihr erklärt hatte, dass er sie verlassen wollte. Es ist besser so. Für uns beide. Du wirst bestimmt viel glücklicher sein. Hoffentlich können wir irgendwann Freunde sein. Die feigen Phrasen des Deserteurs.
»Wir haben nach wie vor einen gemeinsamen Sohn«, hatte er gesagt, als ob sie daran erinnert werden müsste.
Ihre Tochter blieb unerwähnt.
Zitternd zog Marcy ihren Trenchcoat enger um ihren Körper und beschloss, sich den Reihen derjenigen anzuschließen, die für eine kurze Pause und ein Bier optiert hatten. Seit der Bus am Morgen um halb neun in Dublin abgefahren war, waren sie unterwegs. Nach einem kurzen Mittagessen in einem typisch irischen Pub gleich nach der Ankunft in Cork hatten sie eine dreistündige Wanderung durch die Stadt gemacht, bei der sie Sehenswürdigkeiten wie das Gefängnis, den Cork Quay Market, das Opernhaus und die St. Fin-Barre’s-Kathedrale besichtigt und die St. Patrick’s Street, die Haupteinkaufsstraße, hinuntergeschlendert waren. Letzte Station waren nun der Besuch der St. Anne’s Shandon Church und der vorgeschlagene steile Aufstieg auf den Patrick’s Hill. Da das Zentrum von Cork auf einer Insel zwischen zwei Armen des Lee lag, war die Stadt von Natur aus in drei große Viertel unterteilt: der Innenstadtkern, genannt »flat of the city«, die North Bank und die South Bank. Den ganzen Nachmittag hatte Marcy eine Brücke nach der anderen überquert. Es wurde Zeit, sich irgendwo hinzusetzen.
Zehn Minuten später hockte sie allein an einem winzigen Zweiertisch in einem weiteren typisch irischen Pub mit Blick auf den Lee. Drinnen war es dunkel, was zu der Stimmung passte, die Marcy mit Macht übermannte. Es war verrückt gewesen, alleine nach Irland zu fahren. Nur eine Verrückte fuhr ohne ihren Mann in die zweiten Flitterwochen, selbst wenn die Reise schon bezahlt war und bei Stornierung nicht zurückerstattet wurde. Ein paar tausend Dollar mehr oder weniger würden sie nicht schmerzen. Peter war mehr als großzügig gewesen. Er wollte offensichtlich so schnell und mit so wenig Aufwand wie möglich von ihr weg. Marcy musste beinahe schmunzeln. Warum sollte er mehr Mühe auf ihre Scheidung verwenden, als er es auf ihre Ehe getan hatte?
»Na, Sie scheinen sich ja zu amüsieren«, sagte eine Stimme irgendwo über ihr.
Marcy blickte auf und sah einen lausbubenhaft attraktiven jungen Mann mit beneidenswert glattem schwarzem Haar, das in seine leuchtend dunkelgrünen Augen fiel. Sie dachte, dass er wahrscheinlich die längsten Wimpern hatte, die sie je gesehen hatte.
»Was darf ich Ihnen bringen?«, sagte der junge Mann mit gezücktem Block und Bleistift.
»Wäre es sehr albern, wenn ich eine Tasse Tee bestelle?«, fragte Marcy zu ihrer eigenen Überraschung. Eigentlich hatte sie vorgehabt, ein Beamish zu trinken, wie es ihr Führer vorgeschlagen hatte. Typisch, dass du wieder so eigensinnig sein musst, hörte sie Peter im Geiste tadeln.
»Überhaupt nicht«, antwortete der Kellner und klang sogar so, als meinte er es ernst.
»Tee klingt wunderbar«, hörte sie jemanden sagen. »Bringen Sie bitte zwei?« Neben ihr schrammten Stuhlbeine über die Bodendielen. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?« Der Mann nahm Platz, bevor Marcy antworten konnte.
Sie erkannte ihn als ein Mitglied ihrer Reisegruppe, obwohl sie sich nicht an seinen Namen erinnerte. Irgendwas Italienisches, dachte sie und sah ihn drei Reihen vor sich vorne im Bus an einem Fensterplatz sitzen. Er hatte sie angelächelt, als sie weiter nach hinten durchgegangen war. Hübsche Zähne, hörte sie Peter in ihr Ohr flüstern.
»Vic Sorvino«, sagte er jetzt und streckte die Hand aus.
»Marcy Taggart«, sagte Marcy, ohne die Hand zu ergreifen. Stattdessen winkte sie knapp und hoffte, dass er sich damit zufriedengab. Warum war er hier? Es gab genug andere Tische, an die er sich hätte setzen können.
»Taggart? Das heißt, Sie sind Irin?«
»Mein Mann.«
Vic ließ den Blick am Tresen entlang und durch den gesamten Pub schweifen. »Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie in Begleitung hier sind«, sagte er, ohne Anstalten zu machen, seinen Stuhl zu räumen.
»Er ist nicht hier.«
»Mag er keine Busreisen?«
»Er mag es nicht, verheiratet zu sein«, hörte Marcy sich sagen. »Jedenfalls nicht mit mir.«
Vic wirkte leicht perplex. »Smalltalk ist nicht gerade Ihre Stärke, was?«
Obwohl sie es nicht wollte, musste Marcy lachen. Sie strich sich einen Wust von Locken aus ihrem schmalen Gesicht.
So viel Haare, dachte sie und hörte die Stimme ihrer Mutter, für so ein winziges Gesicht.
»Entschuldigen Sie«, sagte sie. »Das fällt vermutlich in die Kategorie zu viel Information.«
»Unsinn. Ich gehöre der Denkschule an, die glaubt, dass Informationen immer nützlich sind.«
»Sie sind mein Mann«, sagte Marcy und bereute ihre Worte sofort. Sie wollte ihn auf keinen Fall ermutigen.
Der Kellner kam mit ihren Tees.
»Wahrscheinlich hält er uns für verrückt, weil wir in einem Pub Tee bestellen«, sagte Marcy und beobachtete, wie der attraktive junge Mann auf seinem Weg zurück zur Bar mit mehreren der Frauen flirtete, die sich auf hohen Barhockern um ihn scharten. Er füllte ein halbes Dutzend Krüge mit Bier aus dem Hahn und schob sie mit einer lässigen Handbewegung zu einer Gruppe lauter junger Männer am anderen Ende des Tresens. Seine weiblichen Fans applaudierten voller Bewunderung. Er konnte jede Frau in dem Lokal haben, dachte sie beiläufig. Sie schätzte ihn auf Anfang dreißig und fragte sich, ob ihre Tochter ihn attraktiv gefunden hätte.
»Ehrlich gesagt haben Amerikaner falsche Vorstellungen über irische Pubs«, zog Vic sie mit seinem lockeren Bariton zurück ins Gespräch. »Es sind keine Bars, und man trifft sich hier nicht nur zum Trinken, sondern auch, um Freunde und Nachbarn zu treffen. Und viele Leute trinken Tee oder andere nichtalkoholische Getränke. Das habe ich jedenfalls in meinem Reiseführer gelesen«, fügte er einfältig hinzu und fragte dann, als Marcy weiter stumm blieb: »Woher kommen Sie?«
»Aus Toronto«, antwortete sie pflichtschuldig.
»Toronto ist eine wunderbare Stadt«, sagte er sofort. »Ich war ein paarmal geschäftlich dort.« Er machte eine Pause und erwartete offenbar, dass sie fragte: Wann? Was arbeiten Sie? Als sie das nicht tat, erzählte er es ihr trotzdem. »Das war vor ein paar Jahren. Ich war Fabrikant. Technischer Kleinkram.«
»Sie sind Fabrikant für Schweinkram?«, fragte Marcy und merkte, dass sie nur mit halbem Ohr zugehört hatte.
Vic lachte und verbesserte sie. »Kleinkram. Kleine technische Geräte, deren Namen man sich in der Regel nicht merken kann. Gadgets«, erläuterte er weiter.
Marcy nippte an ihrem Tee und schwieg. Ich bin ein Idiot, dachte sie.
»Ich habe die Firma letztes Jahr verkauft und bin in den Ruhestand gegangen«, berichtete er und fuhr, als das keine weiteren Fragen provozierte, fort: »Ich komme aus Chicago.«
Marcy brachte ein mattes Lächeln zustande. Sie hatte Chicago immer gemocht. Dorthin hätte sie fahren sollen, dachte sie, als das Handy in ihrer Handtasche zu klingeln begann. Chicago hatte eine wundervolle Architektur und interessante Viertel. Und es regnete auch nicht praktisch jeden Tag.
»Ist das Ihr Handy?«, fragte Vic.
»Hmm? Oh. Oh«, sagte sie, fand ihr Telefon ganz unten in ihrer Handtasche und hielt es ans Ohr. »Hallo?«
»Wo zum Teufel steckst du?«, wollte ihre Schwester wütend wissen.
»Judith?«
»Wo bist du gewesen? Ich habe seit einer Woche nichts mehr von dir gehört. Was ist los?«
»Ist alles in Ordnung? Ist Darren irgendwas zugestoßen?«
»Deinem Sohn geht es gut, Marcy«, sagte ihre Schwester, ohne sich die Mühe zu machen, ihre Ungeduld zu kaschieren. »Ich mache mir Sorgen um dich. Warum hast du auf keinen meiner Anrufe reagiert?«
»Ich habe meine Nachrichten nicht abgehört.«
»Warum nicht, verdammt noch mal?«
Weil ich nicht mit dir reden wollte, dachte Marcy, ohne es laut zu sagen. Judith war offensichtlich auch so schon wütend genug. Marcy stellte sich vor, wie ihre zwei Jahre ältere Schwester auf dem Marmorboden ihres neuen Luxusapartments auf und ab lief. Garantiert trug sie ihre Standarduniform bestehend aus einer schwarzen Yoga-Hose und einem passenden Top, weil sie entweder gerade mit dem Training fertig war oder gleich damit beginnen wollte. Judith verbrachte mindestens die Hälfte des Tages mit Sport – gleich morgens früh schwamm sie eine halbe Stunde, gefolgt von ein oder zwei Stunden Spinning und dann eine bis eineinhalb Stunden »Hot Yoga« am Nachmittag. Wenn ihre Zeit es erlaubte und sie in der Stimmung war, streute sie gelegentlich noch eine Pilates-Stunde ein. »Für meine innere Mitte«, wie sie erklärte, obwohl ihr Bauch schon flach und hart war wie Stahl. Wahrscheinlich knabberte sie an einer Karotte, dachte Marcy; die Ernährung ihrer Schwester bestand ausschließlich aus Sushi, rohem Gemüse und hin und wieder einem Löffel Erdnussbutter. Judith war gerade bei Ehemann Nummer fünf. Mit achtzehn hatte sie sich die Eileiter verschließen lassen, nachdem sie schon als junges Mädchen beschlossen hatte, nie eigene Kinder haben zu wollen. »Willst du das Risiko wirklich eingehen?«, hatte sie ihre Schwester gefragt.
»Irgendwas stimmt nicht«, sagte sie jetzt. »Ich komme vorbei.«
»Das geht nicht.« Marcy ließ den Blick zu dem großen Fenster des Pubs schweifen.
»Warum nicht?«
»Weil ich nicht da bin.«
»Wo bist du denn?«
»In Irland«, sagte Marcy nach einer langen Pause.
»Was?«
»Ich bin in Irland«, wiederholte Marcy, obwohl sie genau wusste, dass Judith sie schon beim ersten Mal verstanden hatte. In Erwartung von Judiths Kreischen hielt sie den Hörer ein Stück vom Ohr weg.
»Bitte sag mir, dass das ein Witz ist.«
»Ich mache keine Witze.«
»Bist du mit jemandem zusammen dort?«
»Mir geht es gut, Judith.« Ein Schatten fiel auf das Fenster. Der Schatten blieb stehen und winkte dem Barkeeper, was dieser mit einem verstohlenen Lächeln quittierte.
»Du hast sie doch nicht mehr alle! Ich verlange, dass du auf der Stelle nach Hause kommst.«
»Das geht nicht.« Der Schatten trat in einen Lichtkegel, drehte sich um und verschwand. »O mein Gott«, keuchte Marcy und sprang auf.
»Was ist?«, fragten Vic und Judith gleichzeitig.
»Was ist los?«, fügte ihre Schwester noch hinzu.
»Mein Gott, es ist Devon!«, rief Marcy, sprang auf, stürzte zur Tür und stieß dabei mit der Hüfte gegen einen Tisch.
»Was?«
»Ich habe sie eben gesehen. Sie ist hier.«
»Marcy, beruhige dich. Du redest wirr.«
»Ich bin nicht verrückt.« Marcy stieß die schwere Tür des Pubs auf. Tränen brannten in ihren Augen, als sie die von Touristen verstopfte Straße hinauf- und hinunterblickte. Es hatte leicht angefangen zu nieseln. »Devon!«, rief sie und rannte in östlicher Richtung am Fluss entlang. »Wo bist du? Komm zurück. Bitte, komm zurück.«
»Marcy, bitte«, drängte Judith in Marcys Ohr. »Es ist nicht Devon. Du weißt, dass sie es nicht ist.«
»Ich weiß, was ich gesehen habe.« An der St. Patrick’s Bridge blieb Marcy stehen und überlegte, ob sie den Fluss überqueren sollte. »Ich sag es dir: Sie ist hier. Ich hab sie gesehen.«
»Nein, das hast du nicht«, sagte Judith sanft. »Devon ist tot, Marcy.«
»Das stimmt nicht. Sie ist hier.«
»Deine Tochter ist tot«, wiederholte Judith mit Tränen in der Stimme.
»Fahr zur Hölle!«, rief Marcy. Dann warf sie ihr Handy in den Fluss und überquerte die Brücke.
KAPITEL ZWEI
Nach wenigen Minuten hatte Marcy sich in dem Gewirr von Gassen am Ufer des Lee verirrt. Normalerweise hätte sie die engen Straßen mit den vielen kleinen Geschäften faszinierend gefunden, die Alte Welt, die sich inmitten der belebten modernen Großstadt behauptete, doch der Reiz wich rasch einer wachsenden Frustration.
»Devon!«, rief Marcy und ließ ihren Blick über die schwarzen Schirme gleiten, die überall um sie herum aufgespannt wurden. Zwei Jungen im Teenageralter trödelten vor ihr her, lachten und knufften sich, wie es Jungen überall auf der Welt taten, scheinbar ohne den Regen zu bemerken.
Als er ihre Stimme hörte, drehte einer der Jungen sich um und blickte ziellos in ihre Richtung, bevor er sich wieder seinem Freund zuwandte. Marcy war weder überrascht noch beleidigt. Sie begriff, dass diese Teenager sie einfach nicht mehr auf dem Radar hatten. Öfter, als sie sich erinnern mochte, hatte sie den gleichen vagen Blick in den Gesichtern der Freunde ihres Sohnes gesehen. Für sie existierte sie, wenn überhaupt, als ein Paar nützlicher Hände, das ihnen mittags ein Sandwich machen konnte, oder als menschlicher Anrufbeantworter zur Übermittlung wichtiger Nachrichten an ihren Sohn. Manchmal diente sie auch als Ausrede (»Ich kann heute Abend nicht kommen; meine Mom fühlt sich nicht wohl.«), öfter war sie allerdings Anlass zur Klage (»Ich kann nicht kommen. Meine Mom ist auf dem Kriegspfad.«).
»Mom, Mom, Mom«, wiederholte Marcy flüsternd. Sie strengte sich an, sich an den Klang des Wortes auf Devons Lippen zu erinnern, und sah ihre eigene Mutter vor sich, als jene noch jung und voller Leben war. Sie staunte, dass ein so einfaches Wort mit drei Buchstaben so viel bedeuten, solche Macht ausüben, so beladen sein konnte.
»Devon!«, rief sie wieder, leiser als vorher und dann noch einmal »Devon!« Diesmal brachte sie den Namen kaum über die Lippen. Tränen schossen ihr in die Augen, nasse Locken klebten an ihrer Stirn. Kurz darauf fand sie sich an der belebten Kreuzung der St. Patrick’s Street mit dem Merchant’s Quay wieder.
Vor ihr erhob sich das große Merchant’s Quay Shopping Centre, das Haupteinkaufszentrum der Stadt. Marcy starrte auf die Fassade und dachte, dass sie wahrscheinlich hineingehen sollte, und sei es nur, um dem Regen zu entkommen, doch sie war außerstande, sich vom Fleck zu rühren. War Devon dort? Schlenderte sie durch die verschiedenen Geschäfte, bis der Regenguss aufhörte? Suchte sie bei Marks & Spencer nach sexy Unterwäsche oder bei Laura Ashley nach einer altmodischen Bluse mit Paisley-Muster? Unschlüssig, was sie tun sollte, entschied Marcy draußenzubleiben. Große Einkaufszentren machten sie selbst an guten Tagen nervös.
Und heute war definitiv kein guter Tag.
Stattdessen lief sie weiter die St. Patrick’s Street hinunter, spähte hektisch hierhin und dorthin, versuchte, zwischen den Regentropfen die zarten Züge ihrer Tochter im Gesicht jeder jungen Frau zu erkennen, die an ihr vorbeihastete. Als sie zur Paul’s Lane kam, hörte sie den Führer einer Gruppe nasser und unruhiger Touristen erklären, dass hier bis vor Kurzem wundervolle Antiquitätenläden gewesen seien. Mittlerweile hätten jedoch alle dichtgemacht, weil die Mieten in die Höhe geschossen waren und die jungen Leute sich für nichts interessierten, was älter war als sie selbst. In der heutigen Welt, fügte er unter seinem hellgrünen Regenschirm mit einem missbilligenden Schnalzen hinzu, zähle nur noch das Neue.
Die St. Patrick’s Street beschrieb eine sanfte Kurve wie ein schüchternes Lächeln und endete auf der Grand Parade, einer breiten Durchgangsstraße, in der sich Geschäfte und Büros mit malerischen Häusern aus dem 18. Jahrhundert und Resten der alten Stadtmauer mischten. Marcy ging in südlicher Richtung weiter und ließ ihre Blicke über die leeren Bänke im Bishop Lucey Park schweifen. Sie erreichte die South Mall, das Bankenzentrum von Cork, eine breite Allee mit Häusern im georgianischen Stil, die Banken, Anwaltskanzleien und Versicherungsgesellschaften beherbergten. Hier war Devon bestimmt nicht, dachte Marcy. Mit Institutionen jedweder Art hatte sie immer ihre Probleme gehabt. Mit Geld noch viel mehr.
Schaudernd erinnerte Marcy sich daran, wie sie Devon einmal ausgeschimpft hatte, weil sie vierzig Dollar aus ihrem Portemonnaie genommen hatte. Sie hatte wegen der im Grunde lächerlichen Summe einen Riesenaufstand gemacht, ja, so wie sie sich aufgeführt hatte, hätte man meinen können, Devon hätte die Kronjuwelen gestohlen, Herrgott noch mal.
»Ich hab es mir nur geliehen«, hatte Devon störrisch behauptet. »Ich wollte es zurückzahlen.«
»Darum geht es nicht«, hatte Marcy erwidert. »Das ist es nicht. Es ist eine Frage des Vertrauens.«
»Willst du damit sagen, dass du mir nicht vertraust?«
»Ich will sagen, dass ich es nicht mag, wenn du etwas nimmst, ohne vorher zu fragen.«
»Ich habe es bloß geliehen.«
»Ohne zu fragen.«
»Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass es eine so große Sache ist.«
»Nun, es ist aber eine große Sache.«
»Ich hab mich entschuldigt, oder nicht? Gott, was hast du für ein Problem?«
Was hatte sie für ein Problem, fragte Marcy sich jetzt, die Wimpern so schwer vom Regen – oder waren das Tränen? –, dass sie kaum den Gehsteig vor sich erkennen konnte. Warum hatte sie eine solche Bagatelle zu einem Riesenproblem aufgeblasen? Stahlen nicht alle halbwüchsigen Mädchen hin und wieder Geld aus dem Portemonnaie ihrer Mütter? Und auch wenn Devon damals schon fast einundzwanzig gewesen war, war sie trotzdem noch ein Kind, das zu Hause unter dem Schutz ihrer Mutter lebte.
Der Schutz ihrer Mutter, höhnte Marcy stumm. Hatte Devon sich im Haus ihrer Mutter je beschützt gefühlt?
Und Marcy sich im Haus ihrer Mutter?
Alles, was geschehen ist, war meine Schuld, dachte Marcy, rutschte im selben Moment auf dem nassen Pflaster aus und fiel zu Boden wie ein zusammengeknülltes und weggeworfenes Stück Papier. Sofort sickerte die Nässe von dem Bürgersteig durch ihren Trenchcoat und ihre blaue Hose, doch Marcy machte keine Anstalten aufzustehen. Geschieht mir recht, dachte sie und erinnerte sich an den schrecklichen Nachmittag, als die Polizei vor ihrer Tür gestanden hatte, um ihr zu sagen, dass Devon tot war.
Aber sie war nicht tot.
Sie war hier.
Direkt hier, erkannte Marcy erschrocken und wandte den Kopf hastig zu einer jungen Frau, die aus einem zweistöckigen grauen Backsteingebäude auf der anderen Straßenseite kam. Nicht nur, dass Devon noch lebte, sie war hier in Cork. Sie stand direkt vor ihr.
Marcy rappelte sich auf die Füße, ohne das besorgte Tuscheln diverser Passanten zu hören, die stehen geblieben waren, um ihr aufzuhelfen. Sie rannte quer über die Straße und vergaß dabei, dass Fahrzeuge in Irland, anders als in Kanada, auf der linken Seite fuhren, sodass sie beinahe mit einem Motorroller zusammengestoßen wäre. Der Fahrer rief ihr einen derben Fluch hinterher, der laut auf der Straße widerhallte und die Aufmerksamkeit aller Umstehenden erregte, einschließlich Devon, die den Kopf in Richtung der wütenden Beschimpfung wendete.
Nur dass es nicht Devon war.
Marcy erkannte sofort, dass es nicht dieselbe junge Frau war, der sie gefolgt war. Dieses Mädchen war knapp zehn Zentimeter größer als Devon, die sich immer beklagt hatte, dass sie mit 1,61 Meter zu klein für die aktuelle Mode war. »Warum musste ich auch deine Beine kriegen und nicht Judiths?«, hatte sie Marcy wütend gefragt, als ob die einen Einfluss darauf gehabt hätte.
Marcy hatte Mitgefühl gezeigt. »Ich hab mir auch immer gewünscht, ich hätte die Beine meiner Schwester«, mühte sie sich, die Sache zu entschärfen.
»Marcy!«, hörte sie von Ferne eine leise Stimme rufen. Aber ihr Name klang in ihren eigenen Ohren fremd, ja, beinahe bedeutungslos. »Marcy Taggart«, hörte sie erneut, und der Name dehnte sich aus wie ein Schwamm, nahm Gewicht und Körper an, ohne vertrauter zu werden. Plötzlich war jemand an ihrer Seite und berührte ihren Arm. »Marcy, geht es Ihnen gut?«
Das Gesicht eines Mannes tauchte in ihrem Blickfeld auf. Er war tief gebräunt und hatte dunkles, an den Schläfen graues Haar. Es war ein nettes Gesicht, dachte Marcy, ein Gesicht, das durch ein Paar strahlend blauer Augen vor der Gewöhnlichkeit bewahrt wurde. Warum waren ihr diese Augen nicht schon vorher aufgefallen?
»Ich bin’s, Vic Sorvino«, sagte der Mann und ließ seine Hand über ihrem Arm schweben, als hätte er Angst, dass sie jeden Moment wieder davonstürzen könnte.
»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte Marcy ungeduldig. »Ich bin nicht verrückt.«
»Tut mir leid. Ich wollte nicht andeuten …«
»Ich hab auch nicht plötzlich das Gedächtnis verloren.«
»Tut mir leid«, sagte er noch einmal. »Ich habe mir nur Sorgen um Sie gemacht.«
»Wieso?«
»Nun, so wie Sie losgerannt sind …« Er hielt inne und blickte die Straße auf und ab, als würde er jemanden suchen. »Wie es aussieht, haben Sie sie nicht gefunden.«
»Wovon reden Sie?«
»Das Mädchen, dem Sie nachgelaufen sind. Devon haben Sie sie, glaube ich, genannt.«
»Haben Sie sie gesehen?«, wollte Marcy wissen. »Ist sie zurückgekommen?« Warum war sie nicht darauf gekommen, wieder zu dem Pub zurückzugehen, anstatt ziellos durch enge Gassen zu irren?
»Nein. Ich habe niemanden gesehen«, sagte Vic. »Ich weiß nur, dass Sie neben mir gesessen, an ihrem Tee genippt und telefoniert haben – und dann von einer Sekunde zur nächsten auf die Straße gerannt sind und ›Devon‹ gerufen haben.«
»Das heißt, Sie sind mir gefolgt?«
»Ich habe es versucht. Nach der Brücke habe ich Sie allerdings aus den Augen verloren.«
»Warum?«
»Warum ich Sie verloren habe?«
»Nein, warum sind Sie mir gefolgt?«, fragte Marcy.
»Um ehrlich zu sein, weiß ich es selbst nicht genau. Vermutlich habe ich mir Sorgen gemacht. Sie sahen aus, als hätten Sie ein Gespenst gesehen.«
Marcy starrte ihn an. War es das? War das Mädchen, das sie gesehen hatte, nur eine Erscheinung, ein Produkt ihrer verzweifelten Fantasie, wie es Judith offensichtlich vermutet hatte?
Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass sie Gespenstern nachjagte.
Wie oft hatte sie in den vergangenen zwanzig Monaten Fremde auf der Straße aufgehalten, überzeugt, dass jedes Mädchen, das Devon auch nur flüchtig ähnlich sah, ihre verlorene Tochter war? Und jedes Mal war sie so sicher gewesen, dass die junge Frau, die in der Supermarktschlange wartete, das Mädchen, das ihren Freund an einer Straßenecke umarmte, die Frau, die mit ihren Freunden auf der Terrasse eines Restaurants lachte, ihr Kind war.
Und jedes Mal hatte sie sich geirrt.
War es auch diesmal so? Ergab es irgendeinen Sinn, dass ihre Tochter womöglich hier war?
So weit hergeholt war die Vorstellung nicht, versicherte Marcy sich eilig. Wie oft hatte Devon ihrem Vater gelauscht, wenn der sich über Irland verbreitet hatte? Das schönste Land der Erde, hatte er wiederholt erklärt und versprochen, mit ihr dorthin zu reisen, sobald es sein voller Terminplan erlaubte. Devon hatte ihren Vater vergöttert, insofern wäre es nicht überraschend, wenn sie Irland als Zufluchtsort gewählt hätte.
War das der eigentliche Grund für Marcys Reise? Hatte sie irgendwie gewusst, dass sie Devon hier finden würde?
»Ich habe wohl wirklich ein Gespenst gesehen«, sagte sie, als ihr bewusst wurde, dass Vic auf irgendeine Antwort wartete.
»So was kommt vor.«
Marcy nickte und fragte sich, was er über Gespenster wusste. »Wir sollten zurück zu unserem Bus.«
Er fasste ihren Ellbogen und führte sie behutsam die South Mall zum Parnell Place hinunter. Als sie das verkniffene Gesicht des Führers erblickten, der ungeduldig neben dem wartenden Bus auf und ab lief, war der Regen zu einem leichten Nieseln abgeschwächt. »Es tut mir schrecklich leid, dass wir zu spät kommen«, sagte Marcy, als der Führer sie in den Bus scheuchte.
»Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein«, drängte er und wies den Fahrer an, den Motor zu starten.
Marcy spürte die unverhohlene Feindseligkeit ihrer Mitreisenden, als sie zu ihrem Platz eilte. Der Bus fuhr an, und sie stolperte.
»Vorsicht«, sagte Vic und packte von hinten ihren Mantel, um sie zu halten.
Was machte er immer noch hier, fragte Marcy sich und schüttelte seinen festen Griff ab. Für einen Babysitter war sie zu alt, und an Ritter in glänzender Rüstung glaubte sie schon lange nicht mehr. Glänzende Rüstungen neigten dazu, ziemlich schnell zu rosten, vor allem im strömenden Regen.
»Würden Sie bitte so schnell wie möglich Ihre Plätze einnehmen?«, drängte der Führer, während Marcy auf ihren Sitz hinten im Bus kroch, und Vic sich neben sie setzte. »In ein paar Minuten werden wir durch Blarney kommen, das sich einer der imposantesten Burgen Irlands rühmt«, verkündete er im nächsten Atemzug, »von der heute nur noch der Bergfried steht, ein massiver viereckiger Turm mit einer fünfundzwanzig Meter hohen Brüstung. Unterhalb der Zinnen befindet sich der Blarney Stone, von dem man sagt, dass er jedem, der ihn küsst, die Gabe der Rede beschert. Es versteht sich, dass ich ihn schon viele Male geküsst habe.« Er machte eine Pause für Lacher, die pflichtschuldig ertönten. »Das Blarney Castle besitzt eine malerische Gartenanlage, an den Blarney Lake grenzt ein hübsches kleines Tal. Ich hoffe, Sie werden irgendwann Gelegenheit haben, das Burgverlies zu besichtigen, das direkt in den Fels unter der Burg gehauen wurde, sowie die Hexenhöhle, sofern Sie nicht unter Klaustrophobie leiden. Bedauerlicherweise müssen diese Stationen heute ausfallen.« Ein lautes Stöhnen ging durch den Bus. Der Führer sprach weiter. »Es tut mir sehr leid, aber ich habe Sie vor Verspätungen gewarnt. Sie können sich bei Ihrem Reiseveranstalter beschweren, wenn wir zurück in Dublin sind. Vielleicht wird man Ihnen einen Teil des Fahrpreises zurückerstatten oder anbieten, die Besichtigung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Trotz des großen Menschenandrangs ist Blarney Castle auf jeden Fall einen Besuch wert.« Er sah Marcy grimmig an, als wollte er sie schon im Voraus für die Trinkgelder verantwortlich machen, die ihm ihretwegen entgehen würden. Etliche Köpfe drehten sich ungehalten in ihre Richtung.
»Es tut mir wirklich sehr leid«, flüsterte sie und drehte sich zum Fenster, aus dem ihr eigenes Spiegelbild zurückstarrte. Sie hatte früher einmal als hübsch gegolten, dachte sie und fragte sich, seit wann sie so erschöpft und alt aussah. Die Leute versicherten ihr ständig, dass sie mindestens zehn Jahre jünger aussah, als sie war, und vielleicht hatte das auch irgendwann mal gestimmt. Vorher, dachte Marcy. Bevor sich ihr Leben für immer verändert hatte. Vor jenem furchtbaren Oktobernachmittag, an dem sie beobachtet hatte, wie ein Polizeiwagen vor ihrem geräumigen Bungalow in Hogg’s Hollow gehalten hatte und zwei Beamte langsam auf die Haustür zugekommen waren. Beim Anblick ihrer steifen blauen Uniformen hatte ihr Atem schmerzhaft gestockt.
Sie hatte Uniformen immer gehasst.
»Willst du nicht aufmachen?«, hatte Peter gerufen, als es klingelte. Er saß vor dem Fernseher und guckte irgendein Sportereignis. »Marcy«, rief er noch einmal, als es ein zweites und drittes Mal klingelte. »Wo bist du? Warum machst du nicht auf?«
»Es ist die Polizei«, brachte Marcy krächzend heraus. Ihr fehlte die Kraft, ihre mit einem Mal bleischweren Füße voreinanderzusetzen. Sie war plötzlich wieder fünfzehn Jahre alt und stand neben ihrer Schwester im Zimmer des Schuldirektors.
»Die Polizei?« Peter stapfte in den Flur und riss die Haustür auf. »Meine Herren?«, fragte er, und das Wort blieb unheilschwanger in der Luft hängen, während er die beiden Polizisten hereinbat.
»Sind Sie Dr. Peter Taggart?«
»Ja, der bin ich.«
»Und Sie besitzen ein Ferienhaus im Georgian-Bay-Island-Nationalpark?«, fragte einer der beiden Männer, und Marcy spürte, wie sie am ganzen Leib taub wurde. Sie wandte sich ab, weil sie ihre Gesichter nicht sehen wollte. Wenn sie ihre Gesichter nicht sah, so ihr irrationaler Gedanke, würde sie auch nicht hören müssen, was die Männer sagen wollten.
»Ja, das ist richtig«, bestätigte Peter. »Unsere Tochter ist mit Freundinnen übers Wochenende dorthin gefahren. Warum? Ist irgendwas passiert? Hat sie wieder den Alarm ausgelöst?«
»Ihre Tochter ist Devon Taggart?«
»Ja, das ist richtig. Hat sie irgendwelchen Ärger?«
»Ich fürchte, sie hatte einen Unfall. Vielleicht möchten Sie sich lieber setzen.«
»Vielleicht möchten Sie mir sagen, was passiert ist.«
Aus den Augenwinkeln sah Marcy den Polizisten nicken und zu Boden blicken. »Nachbarn haben beobachtet, wie Ihre Tochter heute Morgen gegen zehn Uhr ein Kanu bestiegen hat. Es herrschte ziemlich raues Wetter, und sie haben gesehen, dass sie keine Schwimmweste trug. Als die Nachbarn bemerkten, dass sie gut drei Stunden später immer noch nicht zurück war, alarmierten sie die Polizei. Das gekenterte Kanu wurde später in der Mitte der Bucht gefunden.«
»Und Devon?«, fragte Peter leise, und seine Haut nahm den Farbton von Pergament an.
»Die Suche dauert an.«
»Das heißt, man hat sie nicht gefunden«, ging Marcy mit Nachdruck dazwischen, auch wenn sie sich weiterhin weigerte, die Polizisten anzusehen.
»Noch nicht.«
»Nun, das ist gut. Das heißt, dass sie wahrscheinlich ans Ufer geschwommen ist.«
»Ich fürchte, das ist äußerst unwahrscheinlich«, erklärte der Beamte so leise, dass man ihn kaum verstehen konnte. »Das Kanu wurde Meilen vom Ufer entfernt gefunden.«
»Es könnte abgetrieben worden sein«, sagte Marcy störrisch.
»Ja«, räumte der Polizist ein. »Ich nehme an, das ist möglich.«
»Devon ist eine sehr gute Schwimmerin.«
»Das Wasser ist extrem kalt«, setzte der zweite Polizist an. »Es ist unwahrscheinlich …«
»Sie sagten, Ihre Tochter sei mit Freunden zu dem Ferienhaus gefahren?«, unterbrach sein Kollege ihn an Peter gewandt.
»Ja«, sagte Peter. »Carrie und Michelle. An ihre Nachnamen erinnere ich mich nicht.« Er sah Marcy hilflos an.
Weil du sie im Grunde gar nicht richtig gekannt hast, dachte Marcy wütend. Wann hast du dir je die Zeit genommen, dir den Nachnamen irgendeiner Freundin deiner Tochter zu merken? Du warst immer so verdammt beschäftigt mit deiner Arbeit oder dem Golfen. Obwohl das Devon offenbar nie bekümmert hatte. »Stafford und Harvey«, erklärte Marcy den Beamten. »Ich bin sicher, sie können Ihnen sagen, wo Devon ist.«
»Die Nachbarn sagen, Ihre Tochter sei allein in dem Haus gewesen.«
»Das kann nicht sein. Sie hat uns erzählt, dass sie mit Carrie und Michelle dorthin fahren wollte. Warum sollte sie lügen?«
Warum hatte sie sonst immer gelogen, fragte Marcy sich jetzt und wischte sich eine einzelne Träne von der Wange.
»Alles in Ordnung?«, fragte Vic sofort, als hätte er jede ihrer Regungen beobachtet.
Marcy antwortete nicht. Sie vergrub sich tiefer in ihrem Sitz, schloss die Augen und stellte sich schlafend.
»Ist Ihnen bekannt, ob Ihre Tochter in jüngster Zeit unter Depressionen gelitten hat?«, hörte sie einen der Polizisten fragen.
»Wollen Sie damit sagen, dass Sie nicht glauben, dass es sich um einen Unfall handelt?«, wich Peter der Frage des Beamten aus. Marcy musste ihre Hand festhalten, um den Polizisten nicht zu ohrfeigen, ihre Finger verschränken, um ihm nicht die Augen auszukratzen. Wie konnte er es wagen, so etwas auch nur zu denken, geschweige denn laut auszusprechen?
»Ich muss Sie das fragen: Halten Sie es für möglich, dass sich Ihre Tochter das Leben genommen hat?«
»Nein, ausgeschlossen«, sagte Marcy vehement und rannte aus dem Zimmer den Flur hinunter, ehe Peter ihr widersprechen konnte. Sie riss die Tür von Devons Zimmer auf und verschlang den Raum mit einem Blick.
Der Brief lehnte an Devons Kopfkissen.
»Auch wenn wir das Blarney Castle nicht besichtigen konnten«, sagte der Reiseführer, »hoffe ich, dass Ihnen unser kleiner Ausflug heute gefallen hat.« Marcy öffnete die Augen und sah, dass sie die Außenbezirke von Dublin erreicht hatten. »Wie Sie bei unserem kurzen Besuch sicher festgestellt haben, braucht man im Grunde mehr als einen Tag, um Cork zu erkunden. Die Bibliothek lohnt auf jeden Fall einen Besuch, ebenso wie das Butter-Museum und die Crawford Art Gallery. Nicht zu vergessen die wunderbare Universität, deren Campus mehr als siebzehntausend Studenten aus aller Welt ein Zuhause bietet.«
Mehr als siebzehntausend Studenten aus aller Welt, wiederholte Marcy stumm und dachte, wie leicht es für ein Mädchen wie Devon wäre, in dieser Menge unterzutauchen. Zu verschwinden.
»Hast du dir je gewünscht, einfach zu verschwinden?«, hatte Devon ihre Mutter gefragt, kurz bevor das gekenterte Kanu in den eisigen Gewässern der Georgsbucht gefunden worden war. »Einfach irgendwo als jemand ganz anderes noch mal neu anzufangen?«
»Bitte rede nicht so, Schätzchen«, hatte Marcy gesagt. »Du hast doch alles.«
Was für eine dumme Antwort, dachte sie jetzt. Gerade sie hätte wissen müssen, dass alles zu haben keine Garantie für irgendwas war.
Man hatte Devons Leiche nie gefunden.
»Das warst du. Ich habe dich gesehen«, flüsterte Marcy tonlos.
»Verzeihung, haben Sie was gesagt?«, fragte Vic.
Marcy schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie laut, aber in ihrem Kopf kreischte eine Stimme: »Du bist nicht tot, oder, Devon? Du bist hier. Ich weiß es. Und egal was es braucht und wie lange es dauert, ich werde dich finden.«
KAPITEL DREI
Ein blinkendes Licht am Telefon zeigte den Eingang neuer Nachrichten an, als Marcy in ihr Hotelzimmer zurückkehrte.