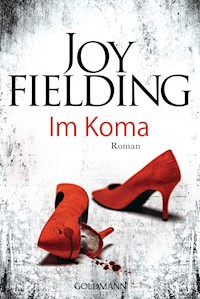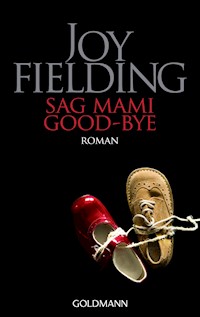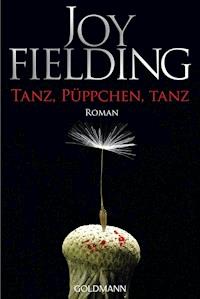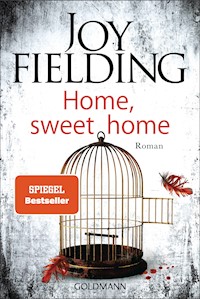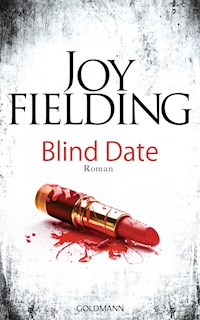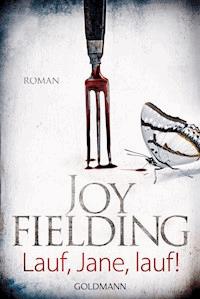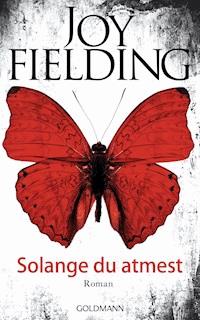
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Psychotherapeutin und mit eigener verkorkster Familiengeschichte glaubt Robin, alle menschlichen Abgründe zu kennen. Doch dann erhält sie eines Tages während einer Sitzung einen Anruf, der sie völlig aus der Fassung bringt. Ihre Schwester Melanie, zu der sie jahrelang keinen Kontakt hatte, teilt ihr mit, dass jemand brutal auf ihren Vater, seine neue Frau Tara und deren zwölfjährige Tochter geschossen hat. Tara erliegt kurz darauf ihren Verletzungen. Obwohl Robin zweifelt, dass es das Richtige ist, sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen, macht sie sich auf den Weg in ihren Heimatort. Ihr ist klar, dass es viele Menschen gibt, die einen Grund hätten, ihren Vater zu hassen – allen voran ihre eigene Familie. Aber was für ein Monster schießt auf eine Zwölfjährige?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Robin Davis ist Psychotherapeutin in Los Angeles, empfindet sich aber nicht als besonders erfolgreich und leidet zudem unter Panikattacken. Die Beziehung zu ihrem Freund steckt in einer Sackgasse, und zu ihrer Familie hat sie kaum Kontakt. Ihre Mutter ist früh verstorben, danach hat ihr Vater Robins ehemals beste Freundin Tara geheiratet. Seither ist ihr Verhältnis zu Tara und ihrem Vater frostig. Auch zu ihrer älteren Schwester Melanie hat sie nur sporadisch Kontakt. Umso mehr beunruhigt es Robin, als sie völlig unerwartet einen verpassten Anruf von Melanie auf ihrem Handy sieht. Die anschließende Therapiesitzung muss sie wegen einer Angstattacke immer wieder unterbrechen. Als sie sich anschließend überwindet, Melanie zurückzurufen, muss sie erfahren, dass es in der Villa ihres Vaters eine Schießerei gegeben hat. Ihr Vater, Tara und deren zwölfjährige Tochter Cassidy wurden dabei schwer verletzt. Obwohl Robin daran zweifelt, dass es das Richtige ist, sich durch einen Besuch ihrer Heimat den Geistern der Vergangenheit zu stellen, macht sie sich spontan auf den Weg nach Red Bluff …
Mehr zu Joy Fielding und ihren Büchern finden Sie am Ende des Buches.
Joy Fielding
Solange du atmest
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kristian Lutze
Die Originalausgabe erscheint voraussichtlich 2018 unter dem Titel »Bleeding Hearts« bei Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Joy Fielding, Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Wilhelm Goldmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Covermotiv: plainpicture/ Spitta+Hellwig; FinePic®, München
Redaktion: Ulla Mothes
AG · Herstellung: SH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19061-3 V005
www.goldmann-verlag.de
Für meine Familie
KAPITEL 1
Das Kribbeln begann in ihrer Magengrube, ein unbestimmtes Nagen, das in ihre Brust wanderte und sich dann nach oben und außen ausdehnte, bis es ihren Hals erreicht hatte. Unsichtbare Finger legten sich um ihre Kehle und drückten fest gegen ihre Luftröhre, sodass die Sauerstoffzufuhr unterbrochen wurde, bis ihr schwindlig wurde. Ich habe einen Herzinfarkt, dachte Robin. Ich kriege keine Luft. Ich sterbe.
Die Frau mittleren Alters, die ihr in der kleinen Praxis gegenübersaß, schien es gar nicht zu bemerken, so sehr war sie mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Irgendwas mit einer dominanten Schwiegermutter, einer schwierigen Tochter und einem Mann, der sie nicht genug unterstützte.
Okay, reiß dich zusammen. Konzentrier dich. Schließlich zahlte die Frau – wie heißt sie noch, verdammt? – keine hundertfünfundsiebzig Dollar pro Stunde, um dafür mit leerem Blick angestarrt zu werden. Sie erwartete, dass Robin zumindest aufmerksam zuhörte. Man ging nicht zu einer Therapeutin, um ihr bei einem Nervenzusammenbruch zuzusehen.
Du hast keinen Nervenzusammenbruch, versuchte Robin, sich zu beruhigen, als sie die vertrauten Symptome erkannte. Es ist auch kein Herzinfarkt. Es ist eine Panikattacke, schlicht und einfach. Und nicht deine erste. Mittlerweile solltest du dich weiß Gott daran gewöhnt haben.
Aber das ist mehr als fünf Jahre her, dachte sie im nächsten Atemzug. Die Panikattacken, die sie früher beinahe täglich überfallen hatten, gehörten der Vergangenheit an. Doch die Vergangenheit lässt einen nie los. Heißt es jedenfalls immer.
Robin musste sich gar nicht fragen, wodurch die plötzliche Attacke hervorgerufen worden war. Sie wusste genau, was – wer – dafür verantwortlich war. Melanie, dachte sie. Als sie aus der Mittagspause in ihre Praxis zurückgekehrt war, hatte sie eine Nachricht ihrer drei Jahre älteren Schwester auf der Mailbox vorgefunden. Robin hatte das Telefon angestarrt und überlegt, ob sie einfach nicht zurückrufen, die Nachricht löschen und so tun sollte, als hätte sie sie nie erhalten, als ihre Klientin gekommen war. Dann musst du eben warten, hatte sie ihre Schwester stumm wissen lassen, ihren Notizblock genommen und war in den größeren Raum gegangen, in dem sie ihre Klienten empfing.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte die Frau sie jetzt, beugte sich in dem blauen Polstersessel vor und musterte Robin argwöhnisch. »Sie sehen irgendwie komisch aus.«
»Könnten Sie mich kurz entschuldigen?« Robin war von ihrem Stuhl aufgesprungen, bevor die Frau etwas erwidern konnte. Sie rannte ins Nebenzimmer und schloss die Tür. »Okay«, flüsterte sie und stützte sich mit beiden Handflächen auf ihren Schreibtisch, sorgfältig darauf bedacht, nicht zu dem blinkenden roten Licht ihres Telefons zu blicken. »Atmen. Einfach ruhig weiteratmen.«
Okay, du hast diagnostiziert, was los ist. Du weißt, wodurch es ausgelöst wurde. Jetzt musst du dich nur noch entspannen und auf deine Atmung konzentrieren. Im Zimmer nebenan wartet eine Klientin. Du hast keine Zeit für diesen Mist. Also reiß dich zusammen. Wie hatte ihre Mutter immer gesagt? Auch das geht vorbei.
Aber nicht alles ging vorbei. Oder wenn, kam es oft von hinten zurück und biss einen in den Arsch. »Okay, tief einatmen«, ermahnte sie sich noch einmal. »Und noch mal.« Nach drei weiteren Zügen ging ihr Atem fast wieder normal. »Okay«, sagte sie. »Okay.«
Aber es war nicht okay, und sie wusste es. Melanie rief aus irgendeinem Grund an, und was immer dieser Grund sein mochte, er war nicht gut. Seit dem Tod ihrer Mutter hatten die Schwestern kaum miteinander gesprochen, und seit Robin Red Bluff nach der überstürzten Wiederheirat ihres Vaters verlassen hatte, gar nicht mehr. Nichts in fast sechs Jahren. Kein Glückwunsch, nachdem Robin in Berkeley einen Master in Psychologie gemacht hatte, keine Aufmunterung, als sie im folgenden Jahr ihre eigene Praxis eröffnet hatte, nicht einmal ein beiläufiges »viel Glück«, als sie und Blake ihre Verlobung bekanntgegeben hatten.
Und so hatte Robin mit Blakes Ermutigung und Unterstützung vor zwei Jahren alle Kommunikationsversuche mit ihrer Schwester eingestellt. Riet sie ihren Klienten nicht immer, sie sollten aufhören, sich die Stirn blutig zu rennen, wenn sie mit einem unbeweglichen Objekt oder unüberwindbaren Konflikt konfrontiert waren? Wurde es nicht Zeit, dass sie ihrem eigenen weisen Rat folgte? Aber es war natürlich immer leichter, Ratschläge zu geben, als sie anzunehmen.
Und nun rief aus heiterem Himmel ihre Schwester an und hinterließ eine kryptische Nachricht auf ihrer Mailbox. Wie ein Krebsgeschwür, von dem man angenommen hatte, es sei herausgeschnitten worden, und das dann umso aggressiver und virulenter zurückkam.
»Ruf mich an«, lautete die Botschaft, die sie auf die Mailbox gesprochen hatte, ohne ihren Namen zu nennen, weil sie es für selbstverständlich hielt, dass Robin die Stimme ihrer Schwester selbst nach all den Jahren erkennen würde.
Und das hatte sie natürlich auch, weil Melanie eine Stimme hatte, die man unweigerlich im Ohr behielt, egal wie viel Zeit vergangen war.
Welche neue Hölle wartete nun wieder, fragte Robin sich und atmete noch ein paarmal tief durch, ohne sich auf weitere Spekulationen einzulassen. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass ihre Fantasie nicht mit der Realität mithalten konnte. Bei Weitem nicht.
Sie überlegte, sich mit Blake zu besprechen, entschied sich jedoch dagegen. Er war beschäftigt und würde auf eine Störung ungehalten reagieren. »Du bist die Therapeutin«, würde er ihr erklären und knapp an ihr vorbeiblicken, als wäre dort jemand Interessanteres aufgetaucht.
Robin verdrängte alle Gedanken an Blake und Melanie, strich ihre schulterlangen, blonden Locken hinter die Ohren und kehrte mit einem aufgesetzten aufmunternden Lächeln in das andere Zimmer zurück. »Tut mir leid«, erklärte sie der wartenden Frau, die ihren ersten Termin hatte und deren Name Robin nach wie vor nicht einfiel. Emma oder Emily. Irgendwas in der Richtung.
»Alles okay?«, fragte die Frau.
»Alles bestens. Mir war nur kurz ein bisschen flau.«
Die Frau kniff die Augen zusammen. »Sie sind doch nicht schwanger, oder? Ich fände es furchtbar, mit der Therapie zu beginnen, und dann hören Sie auf, um Ihr Baby zu bekommen.«
»Nein. Ich bin nicht schwanger.« Um schwanger zu werden, muss man Sex haben, dachte Robin. Und sie und Blake hatten seit einem Monat nicht mehr miteinander geschlafen. »Alles bestens«, sagte sie, während sie verzweifelt versuchte, sich an den Namen der Frau zu erinnern. »Bitte fahren Sie fort. Sie hatten gesagt, dass …«
Was zum Teufel hatte die Frau gesagt?
»Ja, also, ich hatte gesagt, dass mein Mann absolut nicht hilfreich ist, wenn es um seine Mutter geht. Als wäre er wieder zehn Jahre alt und hätte Angst, den Mund aufzumachen. Sie sagt total verletzende Sachen zu mir, und er tut so, als hätte er nichts gehört. Und wenn ich ihn darauf hinweise, sagt er, ich würde übertreiben und solle mir das alles nicht so zu Herzen nehmen. Meine Tochter hat es natürlich auch schon mitgekriegt. Und jetzt ist sie genauso unverschämt. Sie sollten hören, wie sie manchmal mit mir redet.«
Sie glauben, Sie hätten Probleme?, dachte Robin. Sie glauben, Ihre Familie wäre schwierig?
»Ich weiß nicht, warum meine Schwiegermutter mich so hasst.«
Sie braucht keinen Grund, dachte Robin. Wenn sie nur ein bisschen so ist wie meine Schwester, verachtet sie Sie aus Prinzip. Weil Sie existieren.
Das stimmte. Melanie hatte sie von dem Moment an gehasst, an dem sie ihre neugeborene jüngere Schwester zum ersten Mal gesehen hatte, eifersüchtig, weil sie die Aufmerksamkeit der Mutter plötzlich teilen musste. Sie hatte Robin gekniffen, wenn diese friedlich in ihrem Bettchen geschlafen hatte, und nicht aufgehört, bis der Säugling mit winzigen Blutergüssen übersät war; als Robin zwei war, hatte Melanie ihr mit einer Schere die Locken abgeschnitten; als Robin mit sieben völlig arglos Fangen mit ihr gespielt hatte, hatte Melanie sie gegen eine Mauer geschubst und ihr die Nase gebrochen. Ständig kritisierte sie Robins Kleidergeschmack, ihre Interessen und ihre Freundinnen. »Das Mädchen ist ein dummes Flittchen«, war ihr höhnischer Kommentar zu Robins bester Freundin Tara gewesen.
Oh, warte – da hatte sie recht gehabt.
»Ich habe alles getan, um Frieden mit der Frau zu schließen. Ich war mit ihr einkaufen. Ich war mit ihr Mittag essen. Ich habe sie mindestens dreimal pro Woche zu uns nach Hause zum Abendessen eingeladen.«
»Warum?«, fragte Robin.
»Warum?«, wiederholte die Frau.
»Warum machen Sie sich die Mühe, wenn sie so unangenehm ist?«
»Weil mein Mann denkt, dass es sich so gehört.«
»Dann soll er mit ihr einkaufen und Mittag essen gehen. Sie ist seine Mutter.«
»So einfach ist das nicht«, wandte die Frau ein.
»Doch, es ist genau so einfach«, entgegnete Robin. »Sie ist unhöflich und respektlos. Sie sind nicht verpflichtet, sich das anzutun. Hören Sie auf, mit ihr einkaufen und essen zu gehen. Laden Sie sie nicht mehr zum Abendessen ein. Wenn sie fragt, erklären Sie ihr, warum.«
»Und was soll ich meinem Mann sagen?«
»Dass Sie es satthaben, mit so viel Missachtung behandelt zu werden, und es nicht länger hinnehmen wollen.«
»Ich glaube, das kann ich nicht.«
»Was hindert Sie daran?«
»Es ist kompliziert.«
»Eigentlich nicht.«
Sie wollen kompliziert? Ich geb Ihnen kompliziert: Meine Eltern waren vierundzwanzig Jahre verheiratet, in denen mein Vater meine Mutter mit jeder Schlampe betrogen hat, die ihm über den Weg lief, darunter auch meine beste Freundin Tara, die er nur fünf Monate nach dem Tod meiner Mutter geheiratet hat. Und um die Geschichte richtig interessant zu machen, war Tara zu der Zeit noch mit meinem jüngeren Bruder Alec verlobt. Wie kompliziert finden Sie das?
Oh, warten Sie – es gibt noch mehr.
Tara hat eine Tochter aus ihrer ersten gescheiterten Ehe mit Anfang zwanzig. Cassidy müsste jetzt etwa zwölf sein. Süßes Mädchen. Mein Vater vergöttert sie und hat ihr mehr Liebe gezeigt als einem seiner eigenen Kinder. Apropos, hatte ich erwähnt, dass ich seit sechs Jahren nicht mehr mit meiner Schwester gesprochen habe?
»Manche Menschen sind einfach Gift«, sagte Robin laut. »Am besten, man hat so wenig wie möglich mit ihnen zu tun.«
»Selbst wenn es enge Verwandte sind?«
»Gerade wenn es enge Verwandte sind.«
»Wow«, sagte die Frau. »Ich dachte, Therapeuten sollen einem Fragen stellen, damit man die Sachen selbst herausfindet.«
Sollten sie das? Gott, das könnte Jahre dauern. »Ich dachte bloß, ich spar uns beiden ein bisschen Zeit.«
»Sie sind aber tough«, sagte die Frau.
Robin hätte beinahe gelacht. »Tough« wäre wahrscheinlich das letzte Wort, das ihr bei einer Selbstbeschreibung eingefallen wäre. Melanie war die Toughe. Oder vielleicht war »wütend« treffender. Solange Robin sich erinnern konnte, war Melanie wütend gewesen. Auf die Welt im Allgemeinen. Auf Robin im Besonderen. Wobei man fairerweise zugeben musste, dass Melanie es auch nicht immer leicht gehabt hatte. Verdammt, sie hatte es nie leicht gehabt.
Doppelt verdammt, dachte Robin. Wer will schon fair sein?
»Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht?«, fragte die Frau. »Ihr Gesicht …«
»Was ist mit meinem Gesicht?« Habe ich einen Schlaganfall? Bell-Lähmung? Was ist mit meinem Gesicht?
»Nichts. Es sah einen Moment lang ganz zerknittert aus.«
»Zerknittert?« Robin merkte, dass sie brüllte.
»Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beunruhigen …«
»Würden Sie mich noch mal kurz entschuldigen?« Robin stand so ruckartig auf, dass der Stuhl beinahe umgefallen wäre. »Ich bin gleich wieder da.« Sie verließ ihre Praxisräume und lief den mit grauem Teppich ausgelegten Flur entlang bis zur Toilette, drückte die Tür auf und stürzte zum Waschbecken, um ihr Spiegelbild zu betrachten. Eine attraktive dreiunddreißigjährige Frau mit dunkelblauen Augen, angenehm vollen Lippen und einem annähernd herzförmigen Gesicht starrte ihr entgegen. Keine unappetitlichen Warzen oder Makel, keine auffälligen Narben oder Abnormitäten. Alles war an seinem Platz, vielleicht ein wenig schräg wegen ihrer leicht schiefen Nase. Aber nichts, was man als »ganz zerknittert« beschreiben könnte. Ihr Haar müsste nachgefärbt und geschnitten werden, stellte sie fest, als sie an einer widerspenstigen Locke zog. Aber ansonsten sah sie durchaus respektabel, ja, in ihrer rosafarbenen Bluse und dem grauen, gerade geschnittenen Rock sogar professionell aus. Sie könnte ein paar Pfund zulegen, dachte sie und hatte wieder Melanies Stimme im Kopf, die sie daran erinnerte, dass sie trotz ihrer Errungenschaften und ihrem »schicken Uni-Abschluss« noch immer »flach wie ein Pfannkuchen« und »dürr wie ein Stock« war.
Sie spürte das Kribbeln einer weiteren Panikattacke, atmete vorbeugend ein paarmal tief ein und spritzte sich, als das nichts nutzte, eine Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht. »Okay, beruhige dich. Ganz ruhig. Alles ist gut. Außer dass mein Gesicht ganz zerknittert ist«, jammerte Robin ihr Spiegelbild an, als sie ihre geschürzten Lippen und ihre verkniffenen Wangen bemerkte. »Du darfst nicht zulassen, dass Melanie dir so zusetzt.« Sie atmete noch ein paarmal tief durch, durch die Nase ein, durch den Mund aus, die gute Energie einatmen, die schlechte ausatmen. »Nebenan sitzt eine Frau, die geduldig auf deinen Rat wartet«, ermahnte sie sich. »Also geh da jetzt wieder rein und gib ihn ihr.« Wie auch immer sie verdammt noch mal heißt.
Aber als Robin in den Behandlungsraum zurückkam, war die Frau verschwunden. »Hallo?«, sagte Robin, öffnete die Tür zu ihrem Büro und stellte fest, dass der Raum ebenfalls leer war. »Adeline?«, rief sie, als sie in den Flur zurückkehrte, der ebenfalls völlig verlassen war. Klar. Super Zeitpunkt, sich an ihren Namen zu erinnern.
Adeline war offensichtlich geflohen. Abgeschreckt von Robins »tougher« Fassade und ihrem »zerknitterten« Gesicht. Nicht dass Robin es ihr verdenken konnte. Die Sitzung war eine Katastrophe gewesen. Mit welchem Recht glaubte sie, andere Menschen beraten zu können, wenn sie selbst ein komplettes Wrack war?
Robin ließ sich in den blauen Sessel fallen, den Adeline geräumt hatte, und sah sich in dem mit Bedacht dekorierten Raum um. Die Wände waren in einem blassen, aber sonnigen Gelb gestrichen, das eine optimistische Atmosphäre schaffen sollte. An der Wand gegenüber der Tür hing ein Poster mit bunten Blumen, Sinnbild für Wachstum und persönliche Entwicklung. Neben der Tür zu ihrem inneren Heiligtum ein Foto von Herbstlaub, eine subtile Erinnerung daran, dass Veränderung unvermeidlich und positiv war. Den Ehrenplatz hinter dem Stuhl, auf dem sie normalerweise saß, nahm ihr Lieblingsbild ein – eine Collage mit einer Frau mit lockigem Haar und einem besorgten Lächeln in einem Sturm aus abstrakten Regentropfen und glücklichen Gesichtern, über deren Kopf die Worte schwebten: WARUMWERDEICHSOEMOTIONAL? Eine humoristische Note, damit ihre Klienten sich entspannten. Sie hatte das Bild auf einem Garagentrödelmarkt in der Nachbarschaft entdeckt, kurz nachdem sie und Blake zusammengezogen waren. Inzwischen machte er immer öfter »Überstunden«. Wie lange würde es noch dauern, bis er von Auszug sprach?
»Ja, warum werde ich so emotional?«, fragte sie die Frau auf dem Bild.
Die Frau lächelte ihr besorgtes Lächeln und sagte nichts.
Das Telefon in Robins kleinem Büro klingelte.
»Mist«, sagte sie, lauschte, wie es zwei weitere Male klingelte, bevor die Mailbox übernahm. War es Melanie, die sich beschweren wollte, weil Robin nicht prompt zurückgerufen hatte? Robin stand langsam auf. Was soll’s? Sie konnte es genauso gut hinter sich bringen.
In ihrem Büro sah sie als Erstes das blinkende rote Licht des Telefons. Sie ließ sich auf den bequemen burgunderroten Ledersessel hinter ihrem kleinen Eichenschreibtisch fallen. Ursprünglich war es Blakes Schreibtisch in seiner ersten Zeit als Anwalt gewesen; er hatte ihn ihr überlassen, als er zu einer angeseheneren Kanzlei mit einem geräumigeren Büro gewechselt war, das einen Schreibtisch von angemessener Größe erforderte.
Hatten sie ihre Hochzeitspläne deshalb nie in die Tat umgesetzt? Hatte sie nicht die angemessene Größe für einen Mann von seiner wachsenden Statur?
Vielleicht war es auch die hübsche neue Assistentin, die er angestellt hatte, oder die attraktive junge Anwältin im Büro nebenan. Vielleicht war es eine Frau, die er in der Warteschlange bei Starbucks angelächelt hatte, deretwegen er Bedenken bekommen hatte.
Wie lange konnte sie die allzu vertrauten Anzeichen noch ignorieren?
Sie nahm den Hörer ab, lauschte der Ansage, die sie darüber informierte, dass sie eine neue und eine gespeicherte Nachricht hatte. »Um Ihre neue Nachricht anzuhören, drücken Sie bitte 1 – 1.«
Das tat Robin.
»Hi, hier ist Adeline Sullivan«, sagte die Stimme. »Ich rufe an, um mich zu entschuldigen, dass ich einfach so weggelaufen bin. Ich fand, irgendwie passen wir nicht gut zueinander, und um eine Therapeutin zu zitieren, die ich kenne, ›ich dachte, ich spar uns beiden ein bisschen Zeit‹ und gehe einfach. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, Sie können mir die Sitzung in Rechnung stellen. Sie haben mir ein paar Sachen mitgegeben, über die ich nachdenken werde.« Sie hinterließ eine Adresse, an die Robin die Rechnung schicken konnte. Robin löschte die Nachricht sofort. Wenn man doch alles so leicht tilgen könnte. Sie schloss die Augen, und ihre Finger schwebten über dem Telefon.
»Los«, drängte sie. »Du kannst das.« Sie drückte auf die Taste, um sich noch einmal die Nachricht ihrer Schwester anzuhören.
»Erste gespeicherte Nachricht«, verkündete die Stimme vom Band, gefolgt von dem abrupten Befehl ihrer Schwester.
»Ruf mich an«, sagte sie.
Robin musste Melanies Nummer nicht nachgucken. Sie kannte sie auswendig. Sie war ihr ins Hirn gemeißelt. Sie drückte die Tasten, bevor sie es sich anders überlegen konnte.
Am anderen Ende wurde beinahe sofort abgenommen. »Hat ja lang genug gedauert«, sagte ihre Schwester ohne Vorrede.
»Was ist los?«, fragte Robin.
»Ich glaube, du setzt dich lieber«, sagte Melanie.
KAPITEL 2
Am nächsten Morgen wachte Robin in einem fremden Bett in einem unvertrauten Zimmer auf. Das Gespräch mit ihrer Schwester ging ihr wie in Endlosschleife durch den Kopf.
»Es ist wegen Dad«, sagte Melanie mit flacher, nüchterner Stimme.
»Ist er tot?«
»Er liegt im Krankenhaus.«
»Hatte er einen Herzinfarkt?«
»Nein.«
»Jemand hat auf ihn geschossen?«
»Bingo.«
Robin drückte auf die imaginäre Pausetaste, und die Unterhaltung, die die ganze Nacht lang durch ihre Gedanken und Träume gegeistert war, wurde angehalten. Auch das übertriebene Stirnrunzeln, das Robin sich im Gesicht ihrer Schwester vorstellte, fror ein, ein Stirnrunzeln, das Melanie immer davon abgehalten hatte, die Schönheit zu werden, zu der sie laut der Prophezeiung ihrer Mutter heranwachsen sollte.
Robin stand aus dem zu harten französischen Doppelbett auf und schlurfte ins Bad. Warum sahen alle Motelzimmer gleich aus? Gab es irgendeine gewerkschaftliche Vorschrift, dass es uninteressante Quader in Beige- und Brauntönen sein mussten? Nicht dass sie eine Expertin für die Innenausstattung von Motels gewesen wäre, sie hatte im Lauf der Jahre nur in wenigen übernachtet. Sie war direkt aus ihrem beengten Elternhaus in Red Bluff in ein Wohnheimzimmer in Berkeley gezogen, danach wieder zurück zu ihren Eltern, um das Geld zu verdienen, mit dem sie ihre Ausbildung fortsetzen konnte, dann in eine kleine WG in Campusnähe. Eine Zeitlang war sie zwischen Berkeley und Red Bluff gependelt, um bei der Pflege ihrer Mutter zu helfen, und hatte anschließend in einem beengten Studio-Apartment in Los Angeles gewohnt, bis sie mit Blake die geräumigen zwei Zimmer plus großzügigem Koch-Ess-Bereich bezogen hatte, in denen sie jetzt lebten.
Blake, dachte sie und wendete den Namen stumm auf der Zunge, als sie in die Dusche stieg. Was musste er denken? Sie drehte das Wasser an und drückte sich an die Wand der Kabine, als ein eiskalter Sturzbach aus dem Duschkopf strömte.
Blake würde wütend auf sie sein.
Sie hatte ihn seit gestern Nachmittag nicht mehr angerufen. Und da hatte sie auch nicht mit ihm persönlich gesprochen, sondern bloß eine Nachricht bei seiner hübschen neuen Assistentin hinterlassen. Dass sie nach Red Bluff müsse, um sich um einen familiären Notfall zu kümmern, und sich später melden würde. Dann hatte sie sämtliche Termine für den Rest der Woche abgesagt, war nach Hause gefahren, hatte einen kleinen Koffer gepackt, ein Taxi zum Flughafen bestellt und den ersten verfügbaren Flug nach Sacramento genommen, wo sie um sechs Uhr abends gelandet war. Der Bus nach Red Bluff ging erst am nächsten Morgen, die Aussicht, einen Wagen zu mieten und selbst zu fahren, hatte sie eingeschüchtert, und in Wahrheit hatte sie es auch nicht eilig, dort anzukommen. Sie checkte in einem Motel in der Nähe des Busbahnhofs ein, ließ das Abendessen aus, schlang stattdessen drei Schokoriegel aus einem Automaten am Ende des Flurs herunter und widerstand dem Impuls, den Fernseher einzuschalten, für den Fall, dass es Berichte über die Schießerei gab.
Das Maß dessen, was Robin wissen wollte, was sie bewältigen und verarbeiten konnte, war begrenzt.
Sie hatte überlegt, Blake anzurufen, als ihr eingefallen war, dass er etwas von einem Abendessen mit Mandanten gesagt hatte. Also wozu die Mühe? Er war beschäftigt. Er war immer beschäftigt. Zu beschäftigt, um zu telefonieren, offensichtlich. Zu beschäftigt, um ein paar Sekunden zu erübrigen, sie zu fragen, was für ein familiärer Notfall es erforderlich gemacht hatte, dass sie mir nichts, dir nichts zu einem Ort aufgebrochen war, an den nie zurückzukehren sie sich geschworen hatte. Wäre es so schwierig gewesen, eins seiner anscheinend endlosen Meetings zu unterbrechen, um sie anzurufen und wenigstens ein Mindestmaß an Interesse vorzutäuschen?
Also war er vielleicht gar nicht wütend, dass sie noch nicht einmal versucht hatte, ihn zu erreichen. Vielleicht war er erleichtert. Vielleicht hatte sie ihm endlich einen Vorwand geliefert, um ihre Beziehung ein für alle Mal zu beenden.
Nicht, dass er ihr irgendwie helfen könnte, erinnerte sie sich. Sein Fachgebiet war Gesellschaftsrecht, nicht Strafrecht. Und er kannte ihren Vater nicht mal. Oder ihre Schwester. Oder irgendein Mitglied ihrer verkorksten Familie mit Ausnahme ihres Bruders, der in San Francisco lebte. Allerdings hatten sie ihn auch nur zwei Mal getroffen. Sie hatte eine Nachricht auf Alecs Mailbox hinterlassen, doch er hatte ebenfalls nicht zurückgerufen. Sie konnten sie beide mal, hatte Robin beschlossen, ihr Handy ausgeschaltet und war um kurz nach acht ins Bett gegangen.
Sie hätte ihr Handy nicht abschalten sollen, dachte sie jetzt. Was, wenn Blake oder Alec angerufen hatten? Was, wenn Melanie versucht hatte, sie zu erreichen?
»Es ist wegen Dad«, hörte sie ihre Schwester sagen und spulte das Gespräch vor, während der Eisregen aus der Dusche zu einem lauwarmen Tröpfeln abebbte.
»Wer war es?«
»Wir wissen es nicht.«
»Wann?«
»Gestern Abend.«
»Geht es ihm gut?«
»Natürlich geht es ihm nicht gut. Man hat ihm in den Kopf geschossen. Er liegt im Koma.«
»O Gott.«
»Er wurde operiert, aber es sieht nicht gut aus.«
Robin wickelte das winzige Stück Seife in der Seifenschale aus der Verpackung und warf das Papier auf den Boden der Duschwanne, wo es wie ein Stopfen den Abfluss abdeckte, sodass das Wasser bis zu ihren Knöcheln stieg. Die Seife produzierte so gut wie keinen Schaum, egal wie heftig sie rieb. »Na super«, murmelte sie, als ihr das Stück aus der Hand glitt und in dem ansteigenden Wasser verschwand. »Einfach super.« Sie stellte sich direkt unter den Wasserstrahl und spürte, wie ihr feuchtes Haar platt auf die Kopfhaut gedrückt wurde und sich um ihren Kopf schmiegte wie Plastikfolie.
»Man hat ihm in den Kopf geschossen. Er liegt im Koma.«
Sie stieg aus der Dusche auf die zu kleine elfenbeinfarbene Badematte, wickelte sich in ein bereitliegendes, überraschend weiches, beigefarbenes Frotteehandtuch und ging zurück ins Schlafzimmer. Sie blickte auf den Wecker auf dem Nachttisch. Kurz nach sieben, was bedeutete, dass sie noch drei Stunden totschlagen musste, bis ihr Bus fuhr. Dazu noch die gut zwei Stunden, die er für die einhundertfünfundzwanzig öden Meilen über den Highway bis zum Arsch der Welt brauchen würde, besser bekannt als Red Bluff. Das bedeutete noch mindestens fünf Stunden, in denen die Unterhaltung mit ihrer Schwester in ihrem Kopf hin und her witschen konnte wie eine Flipperkugel.
»Das verstehe ich nicht. Wie ist das passiert? Wo ist Tara?«
»Sie wird noch operiert.«
»Operiert? Was soll das heißen? Wurde sie auch angeschossen?«
»Und Cassidy.«
»Was?«
»Du hast mich schon verstanden.«
»Jemand hat auf Cassidy geschossen?«
»Ja.«
»Ich glaube es nicht. Was für ein Monster schießt auf ein zwölfjähriges Mädchen?«
Robin öffnete ihren Koffer und nahm frische Unterwäsche, einen blau-weiß gestreiften Pulli und eine Jeans heraus. Sie zog sich eilig an und überlegte, ob sie den Fernseher einschalten sollte. Vielleicht brachte der lokale Sender einen Bericht über den Überfall. Greg Davis, prominenter Bauunternehmer aus Red Bluff, seine Frau sowie seine Stieftochter wurden in ihrem Haus angeschossen und kämpfen zurzeit im Krankenhaus um ihr Leben, würde ein dynamischer Reporter mit trotzdem ernstem Gesicht verkünden.
Wieder unterbrach Melanie ihre Gedanken. »Wie es aussieht, war es ein bewaffneter Raubüberfall oder so«, sagte sie, und ihre Stimme wurde mit jedem Wort lauter und zittriger. »Offenbar ist gestern irgendwann nach Mitternacht jemand ins Haus eingedrungen und … und …«
»Okay. Okay. Ganz langsam. Tief atmen.«
»Bitte sag mir nicht, was ich machen soll. Du bist nicht hier. Du warst nicht hier.«
Na, das hat ja nicht lange gedauert, dachte Robin, während sich jeder Muskel in ihrem Körper anspannte. Es war derselbe Refrain, den sie seit dem Tod ihrer Mutter hörte. »Erzähl mir einfach, was passiert ist.«
»Das hab ich dir doch gesagt. Sieht aus wie ein bewaffneter Raubüberfall oder so.«
»Was heißt das genau? Weiß die Polizei, wer es war? Gibt es irgendwelche Spuren? Verdächtige?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Hast du mit Alec gesprochen?«
»Ich habe ihn angerufen. Er hat nicht auf meine Nachrichten reagiert.«
»Ich werde versuchen, ihn zu erreichen.«
»Kommst du jetzt nach Hause oder nicht?«
»Ich weiß nicht. Ich muss ein paar Sachen regeln, sehen, welche Flüge gehen und wann der Bus fährt … Es könnte ein bisschen dauern.«
»Gut. Wie auch immer. Es ist deine Entscheidung.«
Robin ließ sich wieder auf das zu harte Bett sinken, stützte den Kopf in die Hände und starrte auf den beige-braunen Teppich. Egal wie oft sie das Gespräch mit ihrer Schwester im Geiste durchging, sie begriff es nicht richtig. Es war wie ein verstörender Traum, der sich aus dem Gedächtnis verflüchtigte, sobald man versuchte, ihn zu verstehen.
Sie saß reglos da, bis sie ihren Magen knurren hörte. Sie hatte seit der Suppe und dem Sandwich zum Lunch am Tag zuvor nichts Vernünftiges mehr gegessen. Wahrscheinlich sollte sie einen Happen frühstücken, bevor ihr Bus fuhr. Man konnte nicht wissen, wann sich wieder die Gelegenheit ergab, etwas zu essen, wenn sie erst in Red Bluff war. Sie schlüpfte mit nackten Füßen in ihre Sneaker, nahm ihre Handtasche, schaltete ihr Handy ein und ging zur Tür. Sie erinnerte sich vage, dass direkt gegenüber dem Hotel ein Diner war.
Das Telefon klingelte, als sie nach der Türklinke griff.
»Blake?«, fragte sie, das Handy am Ohr, ohne vorher auf das Display geguckt zu haben.
»Alec«, erwiderte ihr Bruder. »Was ist los?«
»Hast du schon mit Melanie gesprochen?«
»Ich dachte, ich rede erst mit dir. Was ist los?«
»Mach dich auf was gefasst.«
»Ich bin ganz gefasst.«
Robin atmete tief ein. »Dad ist niedergeschossen worden.«
Es entstand eine kurze Pause, gefolgt von einem nervösen Lachen. »Ist das ein Witz?«
»Nein, es ist kein Witz. Er lebt, aber wahrscheinlich nicht mehr lange.«
»War es Tara?«
»Nein.« Robin unterdrückte ein Lächeln. Das war auch ihr erster Gedanke gewesen. »Sie wurde ebenfalls angeschossen.«
»Tara wurde angeschossen?«
»Und Cassidy.«
»Tara wurde angeschossen?«, wiederholte Alec. »Wie geht es ihr?«
»Ich weiß es nicht. Als ich mit Melanie gesprochen habe, wurde sie noch operiert.«
»Das verstehe ich nicht. Was ist passiert?«
»Melanie sagt, es war offenbar ein bewaffneter Überfall.«
»Wow.« Ein Moment Schweigen. Robin stellte sich vor, wie ihr Bruder sein Kinn massierte, wie immer, wenn er aufgewühlt war. »Das haben sie nun davon, sich das größte verdammte Haus in der Stadt zu bauen.«
»Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Du solltest wohl lieber auch kommen.«
»Nein, keine gute Idee.«
Robin überlegte noch, was sie sagen könnte, um ihren Bruder nach Red Bluff zu locken, als sie merkte, dass er das Gespräch beendet hatte. Sie steckte das Telefon wieder in die Handtasche und entschied, ihn zurückzurufen, wenn sie mehr erfahren und er Zeit zum Nachdenken gehabt hatte.
Sie öffnete die Tür ihres Motelzimmers und trat auf den Parkplatz. Sofort legte die Hitze sich wie eine Decke über ihre Schultern. Mitte April, noch nicht mal acht Uhr, und das Thermometer war bereits über fünfundzwanzig Grad geklettert. In Red Bluff, wo an hundert Tagen im Jahr eine Durchschnittstemperatur von mehr als dreißig Grad herrschte, würde es noch heißer sein. Allein der Gedanke ließ ihre Herzfrequenz steigen.
»Okay, bleib ruhig«, flüsterte sie und überquerte die Straße zu dem Diner im Fünfzigerjahrestil. »Ein Diner ist nicht der passende Ort für eine Panikattacke.« Aber als sie durch die schwere Glastür des Restaurants stolperte, spürte sie bereits das Pulsieren der Angst. Sie setzte sich in eine Nische am Fenster, stieß mit der Hand gegen die Jukebox neben dem laminierten Tisch und schrie kurz auf.
»Alles okay?«, fragte die Kellnerin, die mit einer Kanne heißem Kaffee an den Tisch kam.
»Bestimmt«, brachte Robin hervor und versuchte, eine Stelle auf dem knubbeligen Kunstlederpolster zu finden, an der sie nicht festkleben würde, »wenn ich eine Tasse davon getrunken habe.«
Die Kellnerin goss ihr Kaffee ein. »Möchten Sie die Karte?«
»Nein. Nur den Kaffee.« Robin griff nach der Tasse und ließ ihre Hand wieder in den Schoß sinken, als sie merkte, dass sie zitterte. Sie blickte zu dem Tresen an der Wand. Drei von fünf Hockern waren besetzt von Männern mit schwer aussehendem Werkzeug am Gürtel. Auf einen langen Spiegel hinter dem Tresen war mit schwarzer Farbe eine Liste der Spezialitäten des Hauses geschrieben. Eisbecher. Blaubeerpfannkuchen. Waffeln. Western Omeletts. »Haben Sie Bagels?«
»Sesam, Mohn, Zimt-Rosinen«, ratterte die Kellnerin herunter.
O Gott. »Sesam.«
»Getoastet?«
Mist. »Ja, bitte.«
»Mit Butter?«
Hilfe. »Okay.«
»Ist wirklich alles in Ordnung?«
Robin blickte zu der Frau auf. Sie war um die fünfzig und trug mindestens ebenso viele Pfunde Übergewicht mit sich herum. Sie hatte einen niedlichen bogenförmigen Mund und ein Zwinkern in ihren freundlichen braunen Augen. Lächle einfach und sag ihr, dass es dir gut geht. »Mein Vater wurde niedergeschossen«, erklärte Robin stattdessen. Die Worte waren über ihre Lippen, bevor sie sie zurückhalten konnte.
»Wie furchtbar. Das tut mir leid.«
»Und seine Frau Tara. Sie wurde auch niedergeschossen«, fuhr Robin fort, und ihre Stimme wurde mit jedem Satz schriller. »Sie war früher meine beste Freundin und dazu die Verlobte meines Bruders. Bis sie meinen Vater geheiratet hat.« Sie stieß ein seltsames Kichern aus. Du bist hysterisch, ermahnte sie sich. Hör auf zu reden. Hör sofort auf zu reden. »Und ihre Tochter Cassidy. Sie wurde auch angeschossen. Sie ist erst zwölf.«
Die Kellnerin wirkte perplex. Sie rutschte auf die Bank gegenüber, stellte die Kaffeekanne auf den Tisch und nahm eine von Robins zitternden Händen. »Das ist ja schrecklich, Schätzchen. Ist es hier passiert? Ich hab gar nichts gehört …«
»Nein. In Red Bluff. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Sobald der Bus kommt.« Sie blickte zum Busbahnhof. »Ich lebe in L. A. Es gibt keine Flüge nach Red Bluff mehr, weil kein vernünftiger Mensch dort hinwill. Es gibt einen städtischen Flughafen, aber der wird seit Jahren nicht mehr bedient. Deswegen muss ich den Bus nehmen.«
»Sind Sie allein?«
»Meine Schwester holt mich vom Bus ab.«
»Dann ist ja gut«, sagte die Kellnerin.
»Eigentlich nicht«, erwiderte Robin lächelnd. »Sie hasst mich.« Warum lächle ich? Hör auf zu lächeln!
»Bestimmt nicht …«
»Oh doch, definitiv. Sie denkt, ich hätte es mein Leben lang leicht gehabt. Ich hätte alle Chancen bekommen. Ich bin aufs College gegangen, während sie in Red Bluff bleiben musste. Das stimmt nicht ganz, denn ich hatte zwar ein Teilstipendium, doch den Rest habe ich ganz allein finanziert. Mein Vater meinte, ein Master in Psychologie wäre eine Zeit- und Geldverschwendung, zu der er nicht beitragen wollte, deshalb habe ich so lange gebraucht, um meinen Abschluss zu machen.« Okay, das reicht. Es interessiert sie nicht. Du kannst jetzt aufhören.
Aber die Worte sprudelten weiter aus ihr heraus.
»Deswegen und weil ich hin und her gependelt bin, um meine Mutter zu sehen«, fuhr Robin ohne Pause fort, und die Worte nahmen noch mehr Fahrt auf wie ein führerloser Zug. »Dabei lässt meine Schwester immer geflissentlich aus, dass sie wegen ihrem Sohn in Red Bluff bleiben musste. Sie hat einen Sohn, Landon. Er ist nach einem Schauspieler benannt. Er ist schon tot. Der Schauspieler, nicht Landon. Landon ist autistisch. Ich bin sicher, dafür gibt sie mir auch die Schuld.« Robins Lächeln streckte sich bis zu den Ohren. Sie fing an zu lachen, dann zu weinen, dann lachte und weinte sie gleichzeitig, bis sie nach Luft rang. »O Gott. Ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft.«
Die Kellnerin war sofort auf den Beinen. »Ich ruf einen Krankenwagen.«
Robin streckte die Hand aus und packte die Schürze der Frau. »Nein, ist schon gut. Das ist nur eine Panikattacke. Ist gleich wieder gut. Ehrlich. Ich brauch keinen Krankenwagen.«
»Ich habe Valium in meiner Handtasche. Möchten Sie ein paar?«
»Lieber Gott, ja.«
Eine Minute später war die Kellnerin zurück und hatte zwei kleine Pillen in ihrer Hand.
»Ich glaube, ich mag Sie«, sagte Robin.
Um zehn Uhr stieg Robin in den Greyhound-Bus nach Red Bluff. Alle verbliebenen Schamgefühle über ihren Minizusammenbruch beim Frühstück – Ich bin Therapeutin, Herrgott noch mal. Ich habe einer Kellnerin mein Leben erzählt – waren längst in einem angenehmen Valiumglimmer verschwunden, und sie verschlief fast die ganze zweistündige Fahrt über den Highway 5 nach Norden. »Alles wird gut«, flüsterte sie in ihre Hand, als der Bus sich Red Bluff näherte, das am Fuß der schneebedeckten Cascades etwa in der Mitte zwischen Sacramento und Oregon am Ufer des Sacramento River lag, des größten Flusses in Kalifornien.
»Alles wird gut«, wiederholte sie, als der Bus die von Bäumen gesäumte Main Street hinunter in das großspurig als historischer Downtown District bezeichnete Viertel fuhr. Ihrer Erinnerung nach gab es im Stadtzentrum etwa einhundertfünfzig kleine Läden und Firmen, alle nur wenige Blocks vom Fluss entfernt. Die meisten Einwohner lebten am Stadtrand – ein Fünftel davon unter der Armutsgrenze. Ihr Vater hatte bei der Entwicklung des knapp zweitausend Hektar großen und bis heute weitgehend unbebauten Areals eine wichtige Rolle gespielt.
Dein Vater ist unbesiegbar, sagte Robin sich. Er wird sich von einer kleinen Kugel im Gehirn nicht bremsen lassen. Und Tara ist auch kein Mauerblümchen. Wenn sie etwas ist, dann eine Kämpferin. Das Wort wurde praktisch für sie erfunden. Und die kleine Cassidy wird auch wieder gesund. Sie ist zwölf. Sie wird sich in null Komma nichts berappeln. Du wirst sehen – alle drei kommen durch. Wenn du sie im Krankenhaus besuchst, lachen sie dir ins Gesicht, und dann siehst du zu, dass du schleunigstwieder die Fliege machst.
Robin fühlte sich beinahe friedlich, als der Bus am State Theatre und dem Uhrenturm mit dem goldenen Dach vorbeifuhr – die in lokalen Fremdenführern ebenfalls als »historisch« bezeichnet wurden.
Dann sah sie Melanie am Straßenrand warten.
Robin stieg aus dem Bus, die bunten viktorianischen Fassaden der Main Street verschwammen, als sie ihren kleinen Koffer vom Busfahrer entgegennahm und auf ihre Schwester zuging.
Melanie verschwendete keine Zeit mit Höflichkeiten. »Tara ist tot«, sagte sie.
KAPITEL 3
In Red Bluff leben etwa vierzehntausend Menschen, die meisten sind weiß und Angehörige der unteren Mittelklasse. Das Motto der Stadt lautet A Great Place to Live, obwohl Robin immer gedacht hatte, dass A Great Place to Leave wahrscheinlich der bessere Slogan wäre. Es sei denn, man mochte Rodeos. Das Red Bluff Round-up hatte sich zu einem der größten Rodeos und populärsten Events im Westen entwickelt, jeden April kamen Rancher aus dem ganzen Land, um ihre Bullen in dem Wettbewerb gegeneinander antreten zu lassen. Sie sprach einen stummen Dank, dass sie es knapp verpasst hatte.
Neben dem alljährlichen Rodeo war Red Bluff vielleicht am bekanntesten als der Ort, wo ein geistesgestörtes Ehepaar ein siebzehnjähriges Mädchen entführt und sieben Jahre in einer Kiste unter ihrem Bett gefangen gehalten hatte. Die Entführung hatte im Mai 1977 stattgefunden, und soweit Robin wusste, war seither nicht mehr viel Bemerkenswertes passiert.
»Du siehst beschissen aus«, sagte Melanie, als sie vorn in ihren mit Süßigkeitenverpackungen zugemüllten, zehn Jahre alten Impala stiegen.
Das Gleiche hatte Robin über Melanie gedacht, war jedoch zu höflich gewesen, es laut zu äußern. Ihre Schwester hatte dicke Ringe unter ihren haselnussbraunen Augen, ihr unnatürlich dunkles Haar hing schlaff auf ihre runden Schultern – die Haare Opfer jahrelanger minderwertiger Farbkuren, die Schultern die Folge ihrer schlechten Haltung. »Ich hab nicht viel geschlafen. Wie geht es Dad?«
»Atmet noch.«
»Wann ist Tara gestorben?«
»Vor etwa einer Stunde.«
»Das ist so furchtbar.«
Melanie senkte das Kinn und sah Robin mit unverhohlener Skepsis von der Seite an, während sie den Gang einlegte und anfuhr. »Du warst ja wohl kaum ihr größter Fan.«
»Ich habe ihr nie den Tod gewünscht.«
»Nicht? Dann war das vermutlich Alec. Hast du ihn erreicht?«
Robin nickte und blickte auf die wenigen Bäume, die auf der riesigen Freifläche zwischen dem Zentrum von Red Bluff und dem Krankenhaus am Stadtrand verteilt waren. Seit sie weggegangen war, hatte sich nicht viel verändert. »Ich glaube nicht, dass er uns Gesellschaft leisten wird.«
»Das wundert auch keinen.« Melanie bedachte Robin mit einem kurzen Seitenblick und schaute gleich wieder auf die Straße. »Du glaubst doch nicht …«
»Ich glaube doch was nicht? Dass Alec etwas damit zu tun hatte?« Robin hörte den defensiven Unterton in ihrer Stimme, ein Überbleibsel aus ihrer Kindheit. Es waren immer Robin und ihr Bruder gegen den Rest der Welt gewesen, wobei der Rest der Welt damals vor allem aus Melanie bestand.
»Du hast es ausgesprochen«, sagte Melanie. »Nicht ich.«
»Du hast es gedacht.«
»Erzähl mir nicht, dass dir der Gedanke überhaupt nicht gekommen ist.«
»Alec hat Tara geliebt.« Robin weigerte sich, auch nur die Möglichkeit zuzugeben, dass Melanie recht haben könnte.
»Und unseren Vater gehasst.«
»Nicht genug, um etwas Derartiges zu tun!«
»Bist du dir da wirklich so sicher?«
»Ja.« War sie das? Hatte sie sich nicht zumindest im Hinterkopf genau dasselbe gefragt?
Das St. Elizabeth Community Hospital lag am Sister Mary Columbia Drive, etwa fünf Minuten von der City entfernt. Während der Fahrt blickte Robin wiederholt zu ihrer Schwester und wartete, dass sie sie über ihr Leben, über Blake, ihre Gesundheit oder über irgendwas befragte. »Gibt es sonst irgendwelche neuen Entwicklungen?«
»Was denn zum Beispiel?«
»Ich weiß nicht. Hat Tara vor ihrem Tod noch etwas zur Polizei gesagt?«
»Nein. Sie hat das Bewusstsein nicht wiedererlangt.«
»Und Cassidy?«
»Es steht auf Messers Schneide. Die Kugel ist unter ihrem Herz eingedrungen und im Rücken wieder ausgetreten, sagte der Sheriff. Wie durch ein Wunder hat sie ihre Lunge verfehlt, aber sie hat sehr viel Blut verloren, und ihr Zustand ist nach wie vor kritisch. Die Ärzte sagen, es steht fünfzig zu fünfzig.«
«Ist sie bei Bewusstsein?«
»Sie kommt phasenweise zu sich, sagt aber bisher kein Wort, wenn man versucht, sie anzusprechen.«
»Man weiß also nach wie vor nicht, wer es gewesen sein könnte?«
»Sie sind absolut ahnungslos«, sagte Melanie, jedes einzelne Wort betonend.
»Hat jemand Cassidy gesagt, was mit ihrer Mutter ist?«
»Meines Wissens nicht.« Melanie bog von der Straße auf den überraschend großen Parkplatz des Krankenhauses. »Aber das werden wir wohl gleich erfahren.« Sie fand eine Parklücke zwischen zwei Polizeiwagen, stellte den Motor ab und öffnete die Fahrertür. Ein Schwall heißer Luft schoss auf Robin zu, als hätte ihr jemand eine Granate an den Kopf geworfen. »Kommst du?«
»Warte«, bat Robin und spürte ein unerwünschtes Kribbeln der Angst in der Brust. Offensichtlich ließ die Wirkung des Valiums nach.
»Wozu?«
»Ich dachte bloß … Können wir einfach noch ein paar Minuten hier sitzen bleiben?«
»Wieso?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht könnten wir reden.«
»Über irgendwas Bestimmtes?«
»Eigentlich nicht. Ich hatte bloß gehofft, ich könnte mich erst ein bisschen akklimatisieren.«
»Akklimatisieren«, wiederholte Melanie und dehnte jede Silbe. »Gut. Ich nehme an, Dad kann warten. Es ist schließlich nicht so, als würde er irgendwohin gehen.« Sie sank in ihren Sitz zurück, ließ die Tür jedoch offen. »Okay, dann … rede.«
Robin spürte die Schweißtropfen auf ihrer Stirn und wusste nicht, ob es eine Reaktion auf die Hitze oder auf die Aufforderung ihrer Schwester war. Melanie war mit den Jahren kein bisschen weicher geworden. »Wie geht es dir so?«
»Gut.«
»Arbeitest du noch?«
»Ja.«
»Bei Tillie’s?« Tillie’s war ein Antiquitäten- und Geschenkartikelladen in der Main Street, in dem Melanie in den letzten zwanzig Jahren immer wieder gejobbt hatte.
»Ja, bei Tillie’s.« Sie machte eine Pause. »Aber jetzt muss ich natürlich Urlaub nehmen.«
»Was ist mit Dads Büro?«
»Was soll damit sein?«
»Hat irgendjemand die Leitung übernommen …?«
»Vorübergehend regelt sein kaufmännischer Leiter die Geschäfte.«
Robin wartete ein paar Sekunden, dass Melanie freiwillig mehr sagen würde, doch das tat sie nicht. »Wie geht es Landon?«
Melanie atmete ungeduldig aus. »Gut«, sagte sie und schaffte es, das einsilbige Wort noch kürzer klingen zu lassen.
Robin überlegte, ob sie weitere Fragen zu ihrem Neffen stellen sollte. Ihr war bewusst, dass Landon für Melanie immer ein sensibles Thema gewesen war. Er war das Produkt eines One-Night-Stands mit dem Kapitän der Footballmannschaft ihrer Highschool, als Melanie gerade siebzehn gewesen war. Im Alter von drei Jahren hatte man bei ihm Autismus diagnostiziert. Inzwischen war er achtzehn, und soweit Robin wusste, hatte sein Vater nie einen Cent zu seinem Lebensunterhalt beigetragen, nachdem er kurz nach dem Highschoolabschluss nach Colorado gezogen war und dort als Personal Trainer gearbeitet hatte, bevor er sich in ein mäßig erfolgreiches Fast-Food-Franchise eingekauft hatte. Derweil war Melanie gezwungen gewesen, alle Träume auf eine Karriere als Model aufzugeben und in Red Bluff zu bleiben, um sich um den Jungen zu kümmern.
Obwohl Landons Autismus relativ hochfunktional war, litt der Junge unter extremen Stimmungsschwankungen und war meistens stumm und unkommunikativ, ein Gefangener seines eigenen Bewusstseins. Auch wenn sie jahrelang unter einem Dach gelebt hatten, konnte Robin sich nicht daran erinnern, wann er zum letzten Mal mehr als zwei Worte zu ihr gesagt oder ihr in die Augen geblickt hatte.
Einen autistischen Sohn zu haben hatte Melanies Wut nur noch gesteigert. Auf die Welt im Allgemeinen. Auf Robin im Besonderen.
»Er muss mittlerweile ziemlich groß sein.«
»Ein Meter fünfundachtzig.«
»Wie macht er sich so?«
»Er macht sich großartig. Was sollen die ganzen Fragen nach Landon? Er hatte nichts damit zu tun, was passiert ist.«
»Natürlich nicht. Ich wollte nicht andeuten …«
»Ich sag dir dasselbe, was ich der Polizei auch gesagt habe: Landon war in der Nacht bei mir zu Hause. Die ganze Nacht. Nur weil er autistisch ist, heißt das nicht, dass er auch gewalttätig ist. Er hatte seit Jahren keinen größeren Ausbruch mehr. Zu einer solchen Tat ist er ganz bestimmt nicht fähig. Er würde nie jemandem etwas antun, schon gar nicht seinem Großvater. Oder Cassidy. Er liebt das Mädchen, Herrgott noch mal.«
»Melanie, bitte. Ich war bloß neugierig, wie es ihm geht. Er ist mein Neffe …«
»Ja, nun, ich schätze, daran musst du ihn noch mal erinnern.«
Robin löste ihren Sicherheitsgurt. »Okay. Lass uns reingehen.« Man kann wohl behaupten, ich bin hinreichend akklimatisiert. Sie hievte sich aus dem Wagen und ließ unter der drückenden Hitze, die in beinahe sichtbaren Wellen vom Asphalt aufstieg, die Schultern sacken. Vielleicht lag es auch an dem Kübel Scheiße, den ihre Schwester gerade über ihr abgeladen hatte.
»Dad liegt im Ostflügel«, sagte Melanie und marschierte über den Parkplatz zum Haupteingang des ausladenden einstöckigen weißen Baus.
Sobald sie durch die Tür traten, schlug Robin ein durchdringendes Aroma von Krankheit, Desinfektionsmitteln und Blumen entgegen. Der Geruch von Leid, dachte sie, fühlte sich mit einem Mal wieder sieben Jahre alt, hielt die Hand ihrer Mutter und fasste sich mit der anderen an ihre gebrochene Nase, während sie einem Arzt durch gewundene Flure folgten. Im nächsten Moment war sie zwanzig Jahre älter, stand neben Melanie am Bett ihrer Mutter und betrachtete deren Verfall, ihre Haut war grauer als die Bettwäsche. Sie erinnerte sich, wie sie Melanies Hand greifen wollte, doch ihre Schwester hatte sie weggestoßen. »Nett von dir, dass du es zum großen Finale zurück nach Hause geschafft hast«, hörte sie Melanie sagen. Würde sie jetzt das Gleiche sagen, wenn ihr Vater seinen Verletzungen erlag?
»Sieht immer noch genauso aus«, bemerkte Robin mit einem nur flüchtigen Blick auf das Labyrinth vertrauter Korridore jenseits des Empfangs. Als sie gerade an einem Schild vorbeikamen, das Besucher daran erinnerte, dass die Benutzung von Mobiltelefonen verboten war, klingelte ihr Handy. Hastig zog Robin es aus ihrer Handtasche und hielt es ans Ohr.
»Was zum Teufel ist los?«, wollte Blake wissen, und seine Stimme erfüllte den ganzen Flur. »Ich hab dich gestern Abend bestimmt zehnmal angerufen. Und heute Morgen noch mal«, fuhr er fort, bevor sie etwas sagen konnte. »Ich habe ein Dutzend Nachrichten hinterlassen. Warum hast du dein Handy ausgeschaltet? Warum hast du mich nicht zurückgerufen?«
Robin starrte auf das Telefon und versuchte zu begreifen, was er sagte. »Tut mir leid. Ich hab meine Nachrichten nicht abgehört. Ich hab eine Valium genommen und bin noch immer ein bisschen durcheinander.«
»Du hast eine Valium genommen? Wer hat dir Valium gegeben?«
»Das ist eine lange Geschichte. Können wir später darüber reden?«
»Ich weiß nicht. Können wir?«
»Natürlich.«
»Was ist los, Robin?«
Das Handy fing an zu knacken.
»Mein Vater … Er wurde niedergeschossen.«
Noch mehr Knacken, lauter diesmal.
»Was? Ich habe dich nicht gehört. Die Verbindung bricht zusammen. Hast du etwas von deinem Vater gesagt?«
»Ich hab gesagt, er wurde …«
»Hallo? Hallo, Robin? Bist du noch da?«
Robin folgte ihrer Schwester in einen Flur zum Ostflügel. »Blake? Kannst du mich jetzt hören?«
»Ja, jetzt ist es besser.«
»Wir sollen unsere Handys hier nicht benutzen.«
»Was? Warum nicht?«
»Hier entlang«, wies Melanie sie an und führte Robin vorbei am Schwesterntresen, wo zwei Polizisten mit einem stämmigen glatzköpfigen Mann in einer hellbraunen Uniform sprachen. »Das ist Sheriff Prescott«, sagte sie und nickte ihm zu.
»Was war das mit einem Sheriff?«, fragte Blake.
Robin gab ihm eine kurze Zusammenfassung dessen, was bisher bekannt war. »Wir sind jetzt im Krankenhaus.«
»Da wären wir«, sagte Melanie und blieb vor der geschlossenen Tür von Zimmer 124 stehen.
»Ach du Scheiße. Ist mit dir alles in Ordnung?«, fragte Blake.
»Ich weiß nicht«, antwortete Robin ehrlich.
»Das musst du jetzt ausschalten«, sagte ihre Schwester.
»Hör mal. Es ist gerade wirklich schlecht. Kann ich dich später anrufen?«
»Ich habe den ganzen Tag Meetings. Ich muss dich anrufen.«
»Okay.«
»Gehst du dann auch ran?«
»Ja, mach ich.«
»Und du nimmst kein Valium mehr?«
»Ich habe keins mehr«, sagte Robin jammernd.
Blake lachte. »Gut. Du bist stark. Du brauchst es nicht.«
Ich bin nicht stark, dachte Robin. Ich brauche dich.
»Robin«, sagte Melanie noch einmal. »Kommst du?«
»Ich muss Schluss machen.« Robin beendete das Gespräch, bevor Blake sich verabschieden konnte, und steckte ihr Handy ein.
»Bereit?« Melanie stieß die Tür zum Zimmer ihres Vaters auf und ging hinein.
Robin atmete tief ein und zitternd wieder aus.
»Robin?«, fragte ihre Schwester noch einmal.
Robin setzte widerstrebend einen Fuß vor den anderen, bis sie die Schwelle überschritten hatte, und schloss die Tür.
Ihr Vater lag in einem Privatzimmer mit einem einzelnen schmalen Bett, sein Kopf war dick bandagiert und wurde von zwei Kissen gestützt. Er wurde durch ein Gewirr von Kabeln und Schläuchen am Leben gehalten, ein Monitor registrierte jeden Atemzug und jeden Herzschlag. Erstaunlicherweise schaffte er es immer noch, imposant auszusehen. Oder vielleicht war das auch gar nicht so überraschend. Mit zweiundsechzig war er noch relativ jung und in ausgezeichneter Verfassung. Er trainierte regelmäßig und prahlte häufig damit, keinen einzigen Tag in seinem Leben krank gewesen zu sein. Er hatte sonnengebräunte Haut und muskulöse Arme unter dem kurzärmeligen Krankenhauskittel. »Unglaublich, wie gut er aussieht«, stotterte Robin.
»Er ist schon ein verdammt attraktiver Mistkerl.«
Hurra! Etwas, worüber wir uns einig sind.
Robin trat zum Bett und schaute auf den Mann in der gestärkten weißen Bettwäsche herab. Wer hat dir das angetan?, fragte sie sich im Stillen. Sie fuhr mit den Fingern über die Bettreling und kämpfte gegen das Bedürfnis, ihre Hand auf die ihres Vaters zu legen.
»Weinst du?«, fragte Melanie.
Robin wischte sich Tränen aus den Augen, über die sie ehrlich gesagt genauso erstaunt war wie ihre Schwester. Ihr Vater war ein Schwein. Es gab kein anderes Wort. Oh, warte … es gab einen Haufen anderer Wörter: Wichser, Schurke, Arschloch. Oder wie wär’s mit Dreckskerl, Lump oder Hurensohn? Eigentlich herrschte kein Mangel an Wörtern, mit denen sie ihren Vater beschreiben könnte, und keins davon war schmeichelhaft.
Sie hörte, wie die Tür hinter ihr geöffnet wurde. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass Sheriff Prescott das Zimmer betreten hatte. Er war ein großer Mann, mindestens ein Meter fünfundneunzig mit einem muskulösen, bulligen Oberkörper, über dem die Knöpfe seines Khakihemds spannten. An dessen Brust prangte stolz sein Sheriff-Abzeichen – ein siebenzackiger Stern, der das Bild eines Bullen rahmte, darüber die Worte County of Tehama, darunter das einzelne Wort Sheriff. Sein fester Bauch wölbte sich über den Gürtel seiner zu kurzen Khakihose, deren Beine über abgestoßenen braunen Cowboystiefeln endeten. Er hatte kleine, eng zusammenstehende Augen, große Hände und einen kahlen glänzenden Kopf, wie frisch gewachst. Zwischen seinen Wurstfingern baumelte ein Cowboyhut. Ein Sheriff wie aus dem Bilderbuch eines Casting Directors, dachte Robin unwillkürlich.
»Sheriff Prescott«, begrüßte Melanie ihn.
»Melanie«, erwiderte er.
Beide klangen kein bisschen freundlich.
»Das ist meine Schwester Robin.«
»Sheriff«, sagte Robin.
Sheriff Prescott nickte. »Ich habe überlegt, ob wir uns vielleicht kurz unterhalten könnten. Wenn Sie ein paar Minuten hätten …«
»Selbstverständlich.« Von mir aus Stunden.
»Ich bin im Flur. Lassen Sie sich Zeit. Wann immer Sie so weit sind.«
Robin blickte zurück auf ihren Vater. Geschieht dir verdammt recht, dachte sie und kämpfte gegen eine neue Flut unerwünschter Tränen. »Ich bin jetzt so weit«, sagte sie.
KAPITEL 4
»Wie kommen Sie zurecht?«, fragte der Sheriff, als er Robin zu einem kleinen Wartezimmer am Ende des Flures führte und mit einer Handbewegung einlud, Platz zu nehmen.
»So einigermaßen.« Robin ließ sich auf einen der grünen Plastikstühle vor einem Panoramafenster mit Blick auf die Berge sinken. Prescott zog einen zweiten Stuhl heran, setzte sich so dicht vor sie, dass ihre Knie sich fast berührten, und beugte sich vor, eine Geste, die gleichzeitig vertraut und einschüchternd wirkte.
»Sie sind gerade aus Los Angeles angekommen, soweit ich weiß.«
Robin nickte. »Das ist richtig. Was können Sie zum …«
»Sind Sie gefahren?«, unterbrach er sie.
»Nein. Ich bin gestern nach Sacramento geflogen und habe dann heute Morgen den Bus genommen. Was …«
»Ich fürchte, Red Bluff ist nicht gerade bequem zu erreichen«, unterbrach er sie erneut, offensichtlich entschlossen, die Befragung zu führen. »Soweit ich weiß, sind Sie Therapeutin.«
»Das ist richtig. Was können Sie mir über die Ereignisse sagen?«, fragte sie in einem Atemzug, um ihm keine Gelegenheit zu geben, sie erneut zu unterbrechen.
»Leider noch nicht viel mehr als das, was Ihre Schwester Ihnen vermutlich schon erzählt hat«, antwortete Sheriff Prescott. »Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie mir etwas erzählen könnten.«
»Zum Beispiel?«
»Zum Beispiel, ob Ihnen irgendjemand einfällt, der ein Motiv haben könnte, auf Ihren Vater und Tara zu schießen.«
Es wäre leichter zu überlegen, wer keins hatte, dachte Robin, sagte es jedoch nicht laut. »Ich habe beide seit fünf Jahren nicht mehr gesehen und auch nicht mit ihnen gesprochen«, erklärte sie dem Sheriff. »Ich habe keine Ahnung, wer es getan haben könnte.« Sie stutzte. »Moment mal. Ich dachte, es wäre ein bewaffneter Überfall gewesen.«
»Das ist eine Hypothese, die wir aufgestellt haben«, sagte er. »Aber bis Cassidy uns irgendwas sagen kann, müssen wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen.«
»Wie geht es ihr?«
»Schwer zu sagen. Die Ärzte sind vorsichtig optimistisch, aber sie haben auch gesagt, dass es noch eine Weile dauern könnte, bis sie vollständig über den Berg ist.«
»Sie haben ihr also noch nicht erzählt …«
»Dass ihre Mutter verstorben ist? Nein. Das erscheint im Moment ziemlich sinnlos. Wir wissen nicht, ob und wie viel sie überhaupt mitkriegt. Im Moment versuchen wir, eine möglichst genaue Vorstellung von der Tat zu bekommen, und alles, was Sie uns über Ihren Vater und seine Frau berichten könnten, wäre hilfreich. Soweit ich weiß, waren Sie und Tara Freundinnen.«
Sie wissen eine Menge mehr, als Sie durchblicken lassen, dachte Robin. »Ja, das stimmt.«
»Beste Freundinnen, soweit ich weiß.«
»Seit wir zehn Jahre alt waren.«
»Aber später nicht mehr.«
Robin seufzte. »Es ist schwer, mit jemandem befreundet zu bleiben, der den eigenen Bruder abserviert und dann unseren Vater heiratet, alles kurz nach der Beerdigung der Mutter.«
Ein knappes Lächeln umspielte die Mundwinkel des Sheriffs. »Das kann ich mir vorstellen.«
»Ist das relevant?«
»Seien Sie so gut und beantworten Sie einfach meine Fragen«, sagte der Sheriff. »Wie war Tara?«
Robin dachte über ihre Antwort nach. »Ich bin wahrscheinlich denkbar ungeeignet, Ihnen das zu sagen, da sie offensichtlich nicht der Mensch war, für den ich sie gehalten habe.«
»Und wer war dieser Mensch?«
»Zunächst mal meine Freundin.«
Wieder ein knappes Lächeln. »Was noch?«
Wieder nahm sich Robin einen Moment Zeit, über ihre ehemalige Freundin nachzudenken, doch ihr Geist streikte. Ihr Verstand war eine weiße Leinwand, an der, egal wie viel Farbe sie daraufwarf, nichts kleben blieb. Sie spürte das vertraute Kribbeln in der Brust. »Es tut mir leid, Sheriff. Ich bin müde und mehr als nur ein wenig überwältigt. Ich glaube, ich bin doch noch nicht in der Lage, diese Unterhaltung zu führen.«
Er nickte. »Das verstehe ich. Wir können später reden.« Eine Feststellung, keine Bitte.
»Wenn Sie mir einfach sagen könnten, was passiert ist …«
Sheriff Prescott starrte auf die ausgetretenen Cowboystiefel, die unter seinen zu kurzen Hosenbeinen hervorragten, auf seiner Glatze spiegelte sich das Neonlicht an der Decke. »Der Notruf ist vorgestern Nacht gegen halb eins eingegangen«, begann er und hob den Kopf, bis seine Augen wieder auf Robins Höhe waren. »Es war Cassidy, die schrie, ihre Eltern wären niedergeschossen worden. Dann hörte die Telefonistin in der Zentrale etwas, das klang wie ein Schuss, und danach war die Verbindung unterbrochen. Die Polizei ist so schnell wie möglich zu dem Haus gefahren. Die Beamten fanden die Haustür offen vor, Ihr Vater und Tara lagen von Kugeln durchsiebt auf dem Fußboden des Wohnzimmers, Taras Gesicht war mehr oder weniger weggeschossen.«
O Gott. Taras hübsches Gesicht. Weg. Robin kämpfte gegen den beinahe übermächtigen Drang an, sich zu übergeben, und konzentrierte sich auf die Brauen des Sheriffs, um ihre wachsende Panik in den Griff zu bekommen. Sie waren dunkler und buschiger, als ihr zunächst aufgefallen war, und lagen wie zwei Raupen über seinen Augen. »Und Cassidy?«
»Sie lag oben in ihrem Zimmer auf dem Bett. Bewusstlos. Sie hat schwach geatmet. Ihr Schlafanzug war blutdurchtränkt. Sie hatte das Telefon noch in der Hand.«
Was für ein Monster schießt auf ein zwölfjähriges Mädchen?, fragte Robin sich und dann laut: »Was noch?«
»Das Erdgeschoss war durchwühlt, der Safe im Arbeitszimmer war offen und leer. Sieht so aus, als hätte der oder die Täter nach etwas gesucht. Wir hatten gehofft, dass Sie uns da helfen könnten.« Er strich sich über seinen glatten Schädel. »Und auf dem Boden des begehbaren Kleiderschranks im Schlafzimmer lagen Schubladen und Kleidungsstücke verstreut.«
Das hat gar nichts zu bedeuten, dachte Robin. Tara war nicht gerade ein Ordnungsfreak.
»Es sieht so aus, als hätte jemand Taras Ringe gewaltsam abgezogen. Sie trug keine, und wir haben Blutergüsse an beiden Ringfingern gefunden.«
Robin stellte sich den funkelnden Drei-Karat-Solitärring und den passenden Memoirering vor, die ihr Vater Tara gekauft und die sie ohne Hemmungen herumgezeigt hatte. Genauso wenig wie sie nicht gezögert hatte, die wenigen teuren Schmuckstücke zu tragen, die einmal Robins Mutter gehört hatten und mit denen ihr Vater seine neue Frau überschüttet hatte, sodass nur weniger wertvolle Objekte übrig blieben, um die Robin und Melanie sich streiten konnten. Wobei Robin keine Kraft für weitere Streitereien gehabt und allen von Melanies Forderungen nachgegeben hatte, sodass ihr nur ein schlichter Amethystring geblieben war, den ihre Mutter seit ihrer Kindheit besessen hatte und den Robin nun an einer Kette um den Hals trug. Sie tastete mit den Fingern danach.
»Wir möchten morgen gern mit Ihnen und Ihrer Schwester eine Begehung des Hauses machen, wenn Sie sich dazu imstande fühlen«, sagte Sheriff Prescott, wieder mehr Feststellung als Bitte, »damit Sie gucken können, ob etwas fehlt.«
Robin nickte, obwohl sie nicht wusste, wie sie helfen sollte. Sie hatte das neue Haus ihres Vaters noch nicht einmal gesehen, geschweige denn einen Fuß hineingesetzt. Er hatte es direkt neben ihrem alten Elternhaus gebaut, in dem Melanie und ihr Sohn nach wie vor lebten. »Wissen Sie, wie viele Personen beteiligt waren, wenn es mehr als eine …«
»Das wissen wir nicht«, antwortete er, bevor sie die Frage zu Ende formulieren konnte. »Es hat nicht geregnet, das passiert um diese Jahreszeit nie, sodass es keine verräterischen Spuren im Schlamm oder irgendwas in der Richtung gibt. Es ist nicht wie im Fernsehen. Wir nehmen nach wie vor im ganzen Haus Fingerabdrücke. Aber es ist unwahrscheinlich, dass wir etwas Brauchbares finden. Das Haus ist funkelnagelneu. Offenbar gingen die Handwerker immer noch ein und aus. Außerdem hatten Ihr Vater und Tara ein paar Tage vorher eine große Einweihungsparty gegeben.« Er schüttelte den Kopf, und seine kleinen Augen verengten sich zu winzigen Schlitzen, während die Brauen sich zu einer geraden Linie vereinigten. »Und nicht zu vergessen fand gerade das jährliche Rodeo statt, zu dem viele Fremde in der Stadt waren.«
»Sie sagen also, dass es im Grunde jeder gewesen sein könnte.«
»Bis auf die Tatsache, dass es keine Spuren für ein gewaltsames Eindringen gibt.«
»Das heißt?«
»Das heißt, entweder war die Haustür nicht abgeschlossen oder Ihr Vater oder Tara haben sie geöffnet.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Haustür nicht abschließen würden.«
»Können Sie sich vorstellen, dass sie sie nach Mitternacht für einen Fremden öffnen würden?«
Robin spürte unsichtbare Finger, die gegen ihre Luftröhre drückten, sodass sie trocken husten musste.
»Nun«, sagte der Sheriff, ohne ihr Unbehagen zu bemerken, »wenn Ihnen jemand einfällt, der ein Motiv gehabt haben könnte …«
»Mein Vater hat seinen Reichtum nicht gerade versteckt, Sheriff. Nach allem, was Sie mir bisher erzählt haben, war das Motiv ziemlich offensichtlich ein Raubüberfall, unabhängig davon, ob mein Vater die Angreifer kannte. Und wenn Handwerker im Haus ein und aus gingen, scheint es nur logisch, dass einer von ihnen …«
»Wenn das Leben immer logisch wäre«, unterbrach der Sheriff sie erneut, diesmal mit einem wehmütigen Kopfschütteln. »Ich fürchte, wir müssen uns gedulden, bis Cassidy uns irgendwas erzählen kann.«
»Kann ich sie sehen?«
»Natürlich.« Sheriff Prescott stand auf.
Auch Robin erhob sich und taumelte in ihrer wachsenden Panik in die Arme des Sheriffs.
»Hossa, Vorsicht, junge Dame. Alles in Ordnung?«
»Nur weiche Knie. Tut mir leid.«