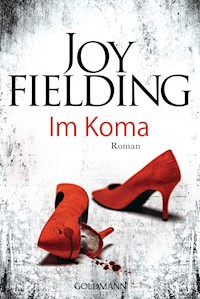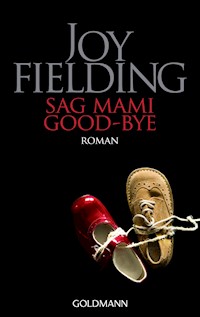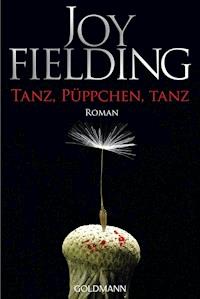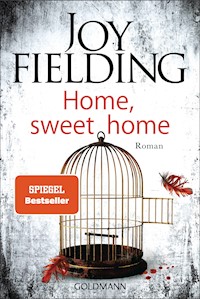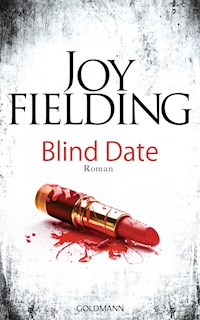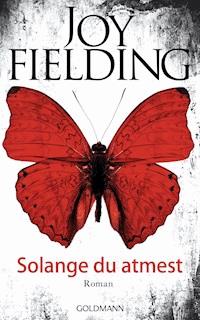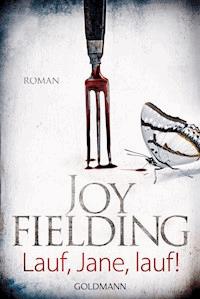Das Buch
Jess Koster ist Staatsanwältin in Chicago. Sie ist jung, engagiert und in der Lage, sich in einer harten Männerwelt zu behaupten. Die aufreibende Scheidung von ihrem Mann hat sie genauso überstanden wie das spurlose und ungeklärte Verschwinden ihrer Mutter. Doch sind ihre tiefen Wunden wirklich verheilt? Seit einigen Tagen fühlt sie sich von kalten Augen verfolgt. Ist es nur Einbildung, oder hat sich der brutale Vergewaltiger Rick Ferguson an ihre Fersen geheftet? Gerade versucht sie, ihm den Prozess zu machen, doch sie weiß, dass die Beweise auf wackligen Füßen stehen. Außerdem zögert sein letztes Opfer, vor Gericht auszusagen, weil Ferguson gedroht hat, die Frau umzubringen. Und dann ist sie eines Tages verschwunden. Sicher, es gibt noch mehr Männer in Jess Kosters Leben. Doch niemandem kann sie sich anvertrauen: weder ihrem Macho-Schwager, der seine Machtallüren an ihrer Schwester auslässt, und auch nicht ihrem Ex-Mann mit seiner irritierenden Angewohnheit, plötzlich und unerwartet zu erscheinen. Aber dann taucht ein neuer Mann in ihrem Leben auf, und obwohl Jess geschworen hat, sich nie mehr zu verlieben, spürt sie, wie sie mit magischer Kraft zu einem Fremden hingezogen wird – einem Fremden mit einem dunklen Geheimnis …
Joy Fielding
gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Die Katze • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Flieh wenn du kannst • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
(alle auch als E-Book erhältlich)
Joy Fielding
SCHAU DICHNICHT UM
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Mechthild Sandberg-Ciletti
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Copyright
1
Er wartete auf sie, als sie zur Arbeit kam. So schien es Jess jedenfalls, die ihn sofort sah. Er stand reglos an der Ecke California Avenue und 25. Straße. Sie spürte, daß er sie beobachtete, als sie aus der Parkgarage kam und über die Straße zum Administration Building lief. Seine dunklen Augen waren kälter als der Oktoberwind, der in seinem strähnigen hellen Haar spielte, seine bloßen Hände waren über den Taschen seiner abgetragenen braunen Lederjacke zu Fäusten geballt. Kannte sie ihn?
Seine Haltung veränderte sich leicht, als Jess näherkam, und sie sah, daß sein voller Mund zu einem halben Lächeln verzogen war, bei dessen Anblick es sie kalt überlief; als wüßte er etwas, das sie nicht wußte. Es war ein Lächeln ganz ohne Wärme, das Lächeln eines Mannes, dem es als Kind Spaß gemacht hatte, Schmetterlingen die Flügel auszureißen, dachte sie schaudernd und ignorierte das kaum wahrnehmbare Kopfnicken, mit dem er sie grüßte, als ihre Blicke sich trafen. Ein Lächeln voller Geheimnisse, begriff sie. Sie wandte sich hastig ab und hatte plötzlich Angst, als sie die Treppe hinauflief.
Sie spürte, wie der Mann hinter ihr sich in Bewegung setzte, wußte, ohne sich umzusehen, daß er hinter ihr die Treppe hinaufging. Als sie oben ihre Schulter gegen die schwere Drehtür aus Glas drückte, sah sie, daß der Fremde auf der obersten Stufe stehengeblieben war. Sein Gesicht spiegelte sich in den rotierenden Glasflächen, erschien, verschwand und erschien von neuem, und das wissende Lächeln wich nicht von seinen Lippen.
Ich bin der Tod, hauchte das Lächeln. Ich bin gekommen, dich zu holen.
Jess hörte sich nach Luft schnappen und merkte am Füßescharren hinter sich, daß sie die Aufmerksamkeit eines der Wächter auf sich gezogen hatte. Mit einem Ruck drehte sie sich herum und sah dem Mann entgegen, der sich ihr vorsichtig näherte und dabei zum Holster seiner Dienstwaffe griff.
»Stimmt was nicht?« fragte er.
»Ich weiß nicht«, antwortete Jess. »Da draußen ist ein Mann, der -« Der was? fragte sie sich stumm, während sie dem Wächter in die müden blauen Augen sah. Der ins Warme möchte, weil es draußen so kalt ist? Der ein Grinsen hat, daß man Gänsehaut bekommt? War das in Cook County neuerdings ein Verbrechen? Der Wächter sah an ihr vorbei zur Tür, und sie folgte mit den Augen langsam seinem Blick. Dort war niemand.
»Ich seh anscheinend Gespenster«, sagte Jess entschuldigend und fragte sich, ob das zutreffe, war froh, daß der junge Mann, wer immer er sein mochte, fort war.
»So was kann schon mal vorkommen«, sagte der Wächter und ließ sich Jess’ Ausweis zeigen, obwohl er wußte, wer sie war. Dann winkte er sie durch den Metalldetektor, wie er das seit vier Jahren jeden Morgen gewohnheitsmäßig tat.
Jess mochte feste Gewohnheiten. Sie stand jeden Morgen Punkt Viertel vor sieben auf und zog nach einer hastigen Morgentoilette die Sachen an, die sie am Abend zuvor sorgfältig zurechtgelegt hatte. Zum Frühstück schlang sie ein gefrorenes Stück Kuchen direkt aus der Tiefkühltruhe hinunter und saß eine Stunde später vor ihrem aufgeschlagenen Terminkalender und ihren Akten am Schreibtisch. Wenn sie gerade an einem Fall arbeitete, gab es immer etwas mit ihren Mitarbeitern zu besprechen, Strategien mußten entworfen, Fragen formuliert, Antworten abgestimmt werden. (Eine gute Staatsanwältin stellte niemals eine Frage, auf die sie die Antwort nicht schon wußte.) Wenn sie sich auf einen bevorstehenden Prozeß vorbereitete, galt es, Informationen zu sammeln, Spuren nachzugehen, Zeugen zu vernehmen, mit Polizeibeamten zu sprechen, Konferenzen abzuhalten, Pläne zu koordinieren. Alles mußte klappen wie am Schnürchen. Jess Koster liebte Überraschungen im Gerichtssaal so wenig wie außerhalb.
Hatte sie sich von dem vor ihr liegenden Tag ein vollständiges Bild gemacht, so pflegte sie bei einer Tasse schwarzen Kaffee und einem Krapfen eine kleine Pause einzulegen, um die Morgenzeitung zu lesen. Mit den Todesanzeigen fing sie an. Immer las sie zuerst die Todesanzeigen. Ashcroft, Pauline, im Alter von siebenundsechzig Jahren ganz plötzlich verstorben; Barrett, Ronald, neunundsiebzig Jahre alt, nach längerer Krankheit friedlich entschlafen; Black, Matthew, geliebter Ehemann und Vater... statt Kränzen Spenden an die Herzforschung von Amerika. Jess wußte selbst nicht mehr, wann sie angefangen hatte, die Todesanzeigen zur Routinelektüre zu machen, und sie wußte auch nicht, warum. Es war eine ziemlich ausgefallene Gewohnheit für jemanden, der knapp dreißig Jahre alt war, selbst für eine Anwältin bei der Staatsanwaltschaft von Cook County in Chicago. »Na, jemand gefunden, den Sie kennen?« hatte einer ihrer Kollegen einmal gefragt. Jess hatte den Kopf geschüttelt. Es war nie jemand darunter, den sie kannte.
Suchte sie nach ihrer Mutter, wie ihr geschiedener Mann einmal unterstellt hatte? Oder erwartete sie vielleicht, ihren eigenen Namen zu sehen?
Der Fremde mit dem strähnigen blonden Haar und dem bösen Lächeln drängte sich rücksichtslos in ihre Gedanken. Ich bin der Tod, sprach er höhnisch, und seine Stimme brach sich an den nackten Bürowänden. Ich bin gekommen, dich zu holen.
Jess senkte die Zeitung und ließ ihren Blick langsam durch das Zimmer wandern. Drei Schreibtische aus mehr oder weniger zerkratztem Walnußholz standen willkürlich verteilt vor mattweißen Wänden. Bilder waren keine da, weder Landschaften noch Porträts, nichts außer einem alten Poster von Bye Bye Birdie, das mit mittlerweile vergilbtem Tesafilm festgeklebt an der Wand gegenüber ihrem Schreibtisch hing. Die durch und durch zweckmäßigen Metallregale waren mit juristischen Fachbüchern vollgestopft. Die ganze Einrichtung wirkte so, als könnte sie jederzeit zusammengepackt und abtransportiert werden. Und so war es auch. Es kam häufig genug vor. Die Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft wurden turnusmäßig von Abteilung zu Abteilung versetzt. Es war nicht empfehlenswert, sich irgendwo zu heimisch zu fühlen.
Jess teilte sich das Büro mit Neil Strayhorn und Barbara Cohen, die ihr als Vertreter beziehungsweise Vertreterin beigeordnet waren. Jess war als Leiterin ihrer Gruppe für alle größeren Entscheidungen über Arbeits- und Vorgehensweise der Gruppe zuständig. In Cook County gab es siebenhundertfünfzig Staatsanwälte, über zweihundert waren allein in diesem Gebäude untergebracht; zu jeder Abteilung gehörten achtzehn Staatsanwälte, drei pro Zimmer, und alle waren sie Abteilungsleitern unterstellt. Spätestens um halb neun pflegte es in dem Labyrinth von Büros im zwölften und dreizehnten Stockwerk des Administration Building so lebhaft und laut zuzugehen wie auf dem Wrigley Field, so schien es Jess jedenfalls meistens, die diese kurzen Augenblicke des Friedens und der Ruhe vor der Ankunft der anderen im allgemeinen sehr genoß.
Heute allerdings war das anders. Der junge Mann hatte sie verstört, sie aus ihrem gewohnten Rhythmus geworfen. Was war es nur an ihm, das ihr so vertraut erschien, fragte sie sich. In Wahrheit hatte sie sein Gesicht ja gar nicht richtig gesehen, hatte über dieses schaurige Lächeln hinaus kaum etwas wahrgenommen, wäre niemals fähig gewesen, ihn einem Polizeizeichner zu beschreiben, hätte ihn bei einer Gegenüberstellung niemals erkannt. Er hatte sie ja nicht einmal angesprochen. Weshalb ging er ihr nicht aus dem Kopf?
Sie wandte sich wieder den Todesanzeigen zu. Bederman, Marvin, 74, nach langer Krankheit in Frieden heimgegangen; Edwards, Sarah, im einundneunzigsten Lebensjahr verschieden...
»Du bist aber früh da!« sagte jemand von der Tür her.
»Ich bin immer früh da«, antwortete Jess, ohne aufzusehen. Die Mühe konnte sie sich sparen. Hätte nicht der aufdringliche Duft des Aramis Eau de Colognes Greg Oliver verraten, so hätte es auf jeden Fall der selbstbewußte, schwadronierende Ton seiner Stimme getan. Im Amt hieß es allgemein, Greg Olivers hohe Erfolgsquote im Gerichtssaal werde nur von seinen Rekorden im Schlafzimmer übertroffen. Aus eben diesem Grund achtete Jess stets darauf, daß ihre Gespräche mit dem vierzigjährigen Staatsanwalt von nebenan streng sachlich und unpersönlich blieben. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit einem Anwalt stand für sie fest, daß eine neue Beziehung zu einem Kollegen nicht in Frage kam.
»Kann ich was für dich tun, Greg?«
Greg Oliver durchmaß den Raum zwischen der Tür und ihrem Schreibtisch mit drei schnellen Schritten. »Zeig mal, was du da liest.« Er beugte sich vor, um ihr über die Schulter zu sehen. »Die Todesanzeigen? Du lieber Himmel, was die Leute nicht alles tun, um ihren Namen in die Zeitung zu kriegen.«
Jess mußte wider Willen lachen. »Greg, ich hab einen Haufen zu tun...«
»Das sehe ich.«
»Nein, wirklich«, behauptete Jess mit einem raschen Blick in sein auf konventionelle Weise gutaussehendes Gesicht, das die flüssige Schokolade seiner Augen bemerkenswert machte. »Ich muß um halb zehn im Gerichtssaal sein.«
Er sah auf seine Uhr. Eine Rolex. Aus Gold. Sie hatte läuten hören, daß er vor kurzem Geld geheiratet hatte. »Da hast du noch massenhaft Zeit.«
»Die Zeit brauch ich, um Ordnung in meine Gedanken zu bringen.«
»Oh, ich wette, die sind schon längst in Ordnung«, entgegnete er und richtete sich auf, aber nur, um sich seitlich an ihren Schreibtisch zu lehnen und ganz offen sein Spiegelbild im Glas des Fensters hinter ihr zu prüfen, während er mit der Hand flüchtig über einen Stapel säuberlich geordneter Papiere strich. »Ich bin überzeugt, daß es in deinem Kopf genauso ordentlich zugeht wie auf deinem Schreibtisch.«
Er lachte, und dabei verzog sich der eine Winkel seines Mundes leicht nach unten. Jess fiel sofort wieder der Fremde mit dem unangenehmen Lächeln ein.
»Schau dich doch an«, sagte Greg, der ihre Reaktion falsch verstand. »Du bist total nervös und angespannt, nur weil ich versehentlich ein paar von deinen Papieren verschoben habe.« Er rückte sie demonstrativ wieder zurecht und wischte dann ein imaginäres Stäubchen von ihrer Schreibtischplatte. »Du magst es gar nicht, wenn jemand deine Sachen anrührt, nicht?«
Mit den Fingern strich er in kleinen Kreisen wie liebkosend über das Holz der Schreibtischplatte. Die Bewegung hatte eine beinahe hypnotische Wirkung. Ein Schlangenbeschwörer, dachte Jess, und fragte sich flüchtig, ob er der Beschwörer war oder die Schlange.
Sie lächelte, höchst verwundert über die seltsamen Gedanken, die ihr an diesem Morgen durch den Kopf gingen, und stand auf. Zielstrebig ging sie zu den Bücherregalen, obwohl sie in Wirklichkeit dort gar nichts zu tun hatte.
»Ich glaube, du gehst jetzt besser, damit ich hier noch etwas geschafft bekomme. Ich muß heute morgen mein Schlußplädoyer im Fall Erica Barnowski halten und -«
»Erica Barnowski?« Er mußte einen Moment überlegen. »Ach so, ja. Das Mädchen, das behauptet, es sei vergewaltigt worden...«
»Die Frau, die vergewaltigt wurde«, korrigierte Jess.
Sein Lachen füllte den Raum zwischen ihnen. »Du lieber Himmel, Jess, die hat doch nicht mal einen Schlüpfer angehabt! Glaubst du etwa, daß irgendein Gericht im ganzen Land einen Mann wegen Vergewaltigung verurteilen wird, weil er es mit einer Frau getrieben hat, die er in einer Kneipe aufgegabelt hatte und die nicht mal einen Schlüpfer anhatte?« Greg Oliver verdrehte kurz die Augen zur Decke, ehe er Jess wieder ansah. »Ich weiß nicht, aber die Tatsache, daß die Dame ohne Schlüpfer in ein bekanntes Aufreißerlokal ging, riecht mir doch stark nach stillschweigendem Einverständnis.«
»Ach, und ein Messer an der Kehle gehört dann wohl deiner Meinung nach zum Vorspiel?« Jess schüttelte den Kopf, eher bekümmert als angewidert. Greg Oliver war bekannt für seine zutreffenden Prognosen. Wenn es ihr nicht einmal gelang, ihren Kollegen davon zu überzeugen, daß der Angeklagte schuldig war, wie konnte sie da hoffen, die Geschworenen zu überzeugen?
»Es zeichnet sich gar nichts ab unter diesem kurzen Rock«, sagte Greg Oliver. »Verraten Sie mir mal, ob Sie ein Höschen tragen, Frau Anwältin?«
Jess strich sich unwillkürlich mit beiden Händen über den grauen Wollrock, der oberhalb ihrer Knie endete. »Hör auf mit dem Quatsch, Greg«, sagte sie nur.
Greg Olivers Augen blitzten mutwillig. »Was würde es denn brauchen, in dieses Höschen reinzukommen?«
»Da muß ich dich leider enttäuschen, Greg«, sagte Jess ruhig. »In diesem Höschen ist nur für ein Arschloch Platz.«
Die flüssige Schokolade von Greg Olivers Augen gefror einen Moment zu braunem Eis, dann jedoch schmolz sie sofort wieder, als sein Lachen erneut das Zimmer erfüllte. »Das liebe ich so an dir, Jess. Du bist so verdammt frech. Du nimmst es mit jedem auf.« Er ging zur Tür. »Eines muß ich dir lassen – wenn jemand diesen Fall gewinnen kann, dann du.«
»Danke«, sagte Jess zu der sich schließenden Tür. Sie ging zum Fenster und blickte geistesabwesend zur Straße hinunter. Riesige Plakatwände schrien zu ihr hinauf. Abogado, verkündeten sie. »Rechtsanwalt« auf Spanisch, gefolgt von einem Namen. Auf jedem Schild ein anderer Name. Rund um die Uhr geöffnet.
Es gab in diesem Viertel sonst keine Hochhäuser. Das Administration Building mit seinen vierzehn Stockwerken überragte alles, häßlich und hochmütig. Das anschließende Gerichtsgebäude war bloß sieben Stockwerke hoch. Dahinter stand das Gefängnis von Cook County, wo des Mordes und anderer Verbrechen Angeklagte, die entweder die Kaution nicht aufbringen konnten oder denen Sicherheitsleistung nicht zugestanden worden war, eingesperrt blieben, bis ihnen der Prozeß gemacht wurde. Ein finsterer, unheilvoller Ort, dachte Jess oft, für finstere, unheilvolle Menschen.
Ich bin der Tod, flüsterte es von den Straßen herauf. Ich bin gekommen, dich zu holen.
Sie schüttelte energisch den Kopf und sah zum Himmel hinauf, aber selbst der war stumpf und grau, von Schneewolken schwer. Schnee im Oktober, dachte Jess. Sie konnte sich nicht erinnern, wann es das letzte Mal vor Allerheiligen geschneit hatte. Trotz der Wettervorhersage hatte sie ihre Stiefel nicht angezogen. Sie waren nicht mehr wasserdicht und hatten rund um die Kappen häßliche Salzringe, wie die Jahresringe eines Baums. Vielleicht würde sie später kurz in die Stadt gehen und sich ein paar neue kaufen.
Das Telefon läutete. Gerade mal acht Uhr, und schon ging es los. Sie hob den Hörer ab, ehe es ein zweites Mal läuten konnte.
»Jess Koster«, sagte sie.
»Jess Koster, Maureen Peppler hier.« In der Stimme schwang mädchenhaftes Gelächter. »Störe ich dich?«
»Du störst nie«, versicherte Jess ihrer älteren Schwester und sah dabei Maureens vergnügtes Lächeln und ihre warmen grünen Augen vor sich. »Ich bin froh, daß du angerufen hast.«
Jess hatte Maureen immer mit den zart gezeichneten Ballettänzerinnen Edgar Degas’ verglichen, weich und verschwommen in den Konturen. Selbst ihre Stimme war weich. Die Leute sagten oft, die Schwestern sähen einander ähnlich. Das stimmte in gewisser Hinsicht, beide hatten sie das gleiche ovale Gesicht, beide waren sie groß und schlank, doch nichts an Jess war verschwommen. Ihr braunes schulterlanges Haar war dunkler als das Maureens, ihre Augen hatten einen tieferen, eindringlicheren Grünton, ihr zierlicher Körper war weniger gerundet, kantiger. Es war, als hätte der Künstler zweimal die gleiche Skizze angefertigt, die eine dann in Pastell ausgeführt, die andere in Öl.
»Was gibt’s?« fragte Jess. »Wie geht’s Tyler und den Zwillingen?«
»Den Zwillingen geht’s prächtig. Tyler ist immer noch nicht begeistert. Er fragt dauernd, wann wir sie endlich zurückschicken. Du hast dich nicht nach Barry erkundigt.«
Jess kniff einen Moment die Lippen zusammen. Maureens Mann, Barry, war ein erfolgreicher Wirtschaftsprüfer, und für seinen brandneuen Jaguar hatte er sich Nummernschilder mit der Aufschrift EARND IT pressen lassen. Mußte sie wirklich noch mehr von ihm wissen? »Wie geht es ihm?« fragte sie trotzdem.
»Gut. Das Geschäft läuft phantastisch trotz der Wirtschaftskrise. Oder vielleicht deswegen. Na, egal, er ist jedenfalls sehr zufrieden. Ich wollte dich für morgen abend zu uns zum Essen einladen. Bitte sag jetzt nicht, du bist schon verabredet.«
Jess hätte beinahe gelacht. Wann hatte sie das letzte Mal eine Verabredung gehabt? Wann war sie das letzte Mal ausgegangen, ohne daß berufliche Gründe dahintergesteckt hätten? Wie war sie auf den Gedanken gekommen, nur Ärzte seien vierundzwanzig Stunden am Tag im Dienst?
»Nein, ich bin nicht verabredet«, antwortete sie.
»Gut, dann kommst du also. Ich seh dich dieser Tage viel zu selten. Ich glaube, ich hab dich öfter zu Gesicht bekommen, als ich noch gearbeitet habe.«
»Dann fang doch wieder an zu arbeiten.«
»Nie im Leben. Also, morgen um sechs. Dad kommt auch.«
Jess lächelte. »Schön, wir sehen uns morgen.« Kurz bevor sie den Hörer auflegte, hörte sie aus der Ferne noch Babygeschrei. Sie stellte sich vor, wie Maureen vom Telefon ins Kinderzimmer lief, sich über die Bettchen ihrer sechs Monate alten Zwillinge beugte, die Kleinen wickelte und fütterte und dabei darauf achtete, daß auch der Dreijährige, der ihr nicht von der Seite wich, die Aufmerksamkeit bekam, die er sich so dringend wünschte. Welten entfernt von den heiligen Hallen der Harvard Business School, an der sie ihren Magister in BWL gemacht hatte. Jess zuckte die Achseln. Jeder von uns muß seine Entscheidung treffen, dachte sie. Maureen hatte ihre offensichtlich getroffen.
Sie setzte sich wieder an ihren Schreibtisch und versuchte, sich auf das bevorstehende Stück Arbeit zu konzentrieren. Sie hoffte inständig, sie könnte Greg Oliver beweisen, daß er sich geirrt hatte. Sie wußte allerdings, daß es nahezu unmöglich war, in diesem Fall eine Verurteilung zu erreichen. Sie und ihr Kollege würden schon sehr überzeugend sein müssen.
Bei einem Prozeß vor dem Geschworenengericht arbeiteten die Staatsanwälte immer paarweise. Ihr Vertreter, Neil Strayhorn, würde zunächst ein erstes Schlußplädoyer halten, in dessen Rahmen er den Geschworenen noch einmal die nackten, häßlichen Tatsachen des Falls ins Gedächtnis rufen würde. Dem würden die abschließenden Bemerkungen des Verteidigers folgen, und danach würde Jess selbst das replizierende Schlußplädoyer halten, das reichlich Gelegenheit zu kreativer moralischer Entrüstung bot.
»Jeden Tag werden in den Vereinigten Staaten 1871 Frauen vergewaltigt«, begann sie laut, um in der Geborgenheit ihres Büros ihren Vortrag noch einmal zu üben. »Das heißt, daß etwa alle 46 Sekunden eine erwachsene Frau vergewaltigt wird, was sich im Laufe eines Jahres zu 683000 Vergewaltigungen summiert.« Sie holte tief Atem und wendete die Sätze in ihrem Kopf wie Salatblätter in einer großen Schüssel. Sie wendete sie immer noch hin und her, als zwanzig Minuten später Barbara Cohen kam.
»Wie läuft’s?« Barbara Cohen, mit knallrotem Haar, das ihr in krausen Locken fast bis zur Rückenmitte herabfiel, war beinahe einen Kopf größer als Jess und sah mit ihren langen, dünnen Beinen aus, als ginge sie auf Stelzen. Jess mochte noch so schlecht gelaunt sein, sie brauchte Barbara, ihre zweite Mitarbeiterin, nur anzusehen, und schon mußte sie lächeln, ob sie wollte oder nicht.
»Ich bemühe mich, die Ohren steifzuhalten.« Jess sah auf ihre Uhr, eine schlichte Timex mit einem schwarzen Lederband. »Hör mal, Barbara, ich möchte gern, daß du und Neil diese Drogensache, den Fall Alvarez, übernehmt, wenn es zum Prozeß kommt.«
Barbara Cohens Gesicht zeigte eine Mischung aus freudiger Erregung und Unsicherheit. »Ich dachte, das wolltest du selbst machen.«
»Ich kann nicht. Mir schlägt die Arbeit über dem Kopf zusammen. Außerdem schafft ihr beide das bestimmt. Ich bin ja hier, wenn ihr Hilfe brauchen solltet.«
Barbara Cohen bemühte sich ohne Erfolg, das Lächeln zurückzuhalten, das sich auf ihrem Gesicht ausbreitete und alle professionelle Nüchternheit verdrängte.
»Soll ich dir einen Kaffee holen?« fragte sie.
»Wenn ich noch mehr Kaffee trinke, muß ich nachher im Gerichtssaal alle fünf Minuten raus. Glaubst du, daß mir das bei den Geschworenen viel Sympathie einbringen würde?«
»Wohl kaum.« Barbara lachte.
Neil Strayhorn traf ein paar Minuten später mit der frohen Botschaft ein, daß er das Gefühl habe, er brüte eine Erkältung aus. Er setzte sich unverzüglich an seinen Schreibtisch. Jess konnte sehen, wie sich seine Lippen bewegten, während er lautlos den Text seiner Schlußbemerkung hersagte.
In den sie umgebenden Büros der Staatsanwaltschaft von Cook County wurde es langsam lebendig. Jess registrierte automatisch jede neue Ankunft, während in den Nachbarräumen Stühle gerückt, Schubladen geöffnet und geschlossen, Computer eingeschaltet wurden, während Faxgeräte zu summen begannen und Telefone läuteten. Ohne sich dessen bewußt zu sein, vermerkte sie das Eintreffen jeder der vier Sekretärinnen, die den achtzehn Anwälten dieser Abteilung zur Verfügung standen, erkannte, ohne sich zu bemühen, den schweren Schritt Tom Olinskys, ihres Abteilungsleiters, als er zu seinem Büro am Ende des langen Korridors ging.
»Jeden Tag werden in den Vereinigten Staaten 1871 Frauen vergewaltigt«, begann sie von neuem, in dem Bemühen, ihre Konzentration wiederzufinden.
Eine der Sekretärinnen, eine Schwarze, die ebensogut zwanzig wie vierzig hätte sein können, schaute zur Tür herein. Ihre langen tropfenförmigen roten Ohrringe fielen ihr fast bis auf die Schultern.
»Connie DeVuono ist hier«, sagte sie und trat einen Schritt zurück, als befürchte sie, Jess würde den nächstbesten Gegenstand nach ihr werfen.
»Was soll das heißen, sie ist hier?«
»Das heißt, sie steht draußen vor der Tür. Sie ist anscheinend einfach am Empfang vorbeimarschiert. Sie behauptet, sie müßte unbedingt mit Ihnen reden.«
Jess warf einen Blick auf ihren Terminkalender. »Wir sind erst für vier Uhr verabredet. Haben Sie ihr gesagt, daß ich in ein paar Minuten bei Gericht sein muß?«
»Ja. Sie läßt sich nicht abwimmeln. Sie ist sehr erregt.«
»Das ist nicht weiter verwunderlich«, sagte Jess bei dem Gedanken an die junge Witwe, die auf brutalste Weise von einem Mann geschlagen und vergewaltigt worden war, der ihr danach gedroht hatte, sie zu töten, falls sie gegen ihn aussagen sollte. Der Termin für die Verhandlung des Falls war noch zehn Tage entfernt. »Führen Sie sie doch bitte ins Besprechungszimmer, Sally. Ich komme sofort.«
»Soll ich mit ihr reden?« erbot sich Barbara.
»Nein, nein, ich mach das schon.«
»Was meinst du, kann das Ärger bedeuten?« fragte Neil Strayhorn, als Jess in den Korridor hinausging.
»Was sonst?«
Das Besprechungszimmer war ein kleiner, fensterloser Raum, in dem der lange braune Walnußtisch und die acht Stühle um ihn herum gerade Platz hatten. Die Wände hatten den gleichen mattweißen Anstrich wie die in den übrigen Räumen, der beigefarbene Teppich war alt und abgetreten.
Connie DeVuono stand gleich an der Tür. Sie schien geschrumpft zu sein, seit Jess sie das letzte Mal gesehen hatte, ihr schwarzer Mantel fiel weit und formlos um ihren Körper. Ihr Gesicht war so weiß, daß es einen grünlichen Schimmer zu haben schien, und die Haut unter ihren Augen war schlaff und runzlig, trauriges Indiz dafür, daß sie vermutlich seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen hatte. Allein die dunklen Augen sprühten in einem Feuer zorniger Energie und ließen von der früheren Schönheit dieser Frau ahnen.
»Bitte entschuldigen Sie die Störung«, begann sie.
»Es ist einfach so, daß wir im Moment nicht viel Zeit haben«, sagte Jess gedämpft, aus Sorge, der Frau, die unter starker Spannung zu stehen schien, könnten beim ersten lauteren Wort die Nerven durchgehen. »Ich muß in einer halben Stunde bei Gericht sein.« Jess schob ihr einen der Stühle hin. Die Frau brauchte keine weitere Aufforderung. Als versagten ihr ihre Beine plötzlich den Dienst, ließ sie sich auf den Stuhl hinunterfallen. »Geht es Ihnen nicht gut? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Oder ein Glas Wasser? Kommen Sie, geben Sie mir Ihren Mantel.«
Connie DeVuono winkte bei jedem der Vorschläge mit zitternden Händen ab. Jess bemerkte, daß ihre Fingernägel bis zum Fleisch hinunter abgeknabbert waren, die Nagelhaut an allen Fingern blutig gerissen war. »Ich kann nicht aussagen«, sagte sie. Ihre Stimme war so leise, daß sie kaum zu hören war, und sie wandte sich ab, als sie sprach.
Dennoch wirkten die Worte wie ein Schlag. »Was?« fragte Jess, obwohl sie genau verstanden hatte.
»Ich habe gesagt, ich kann nicht aussagen.«
Jess setzte sich auf einen der anderen Stühle und rückte so nahe an Connie DeVuono heran, daß ihre Knie sich berührten. Sie nahm die Hände der Frau, die eiskalt waren, und umschloß sie mit den ihren.
»Connie«, begann sie langsam, während sie versuchte, die kalten Hände zu wärmen, »unsere ganze Beweisführung steht und fällt mit Ihnen. Wenn Sie nicht aussagen, kommt der Mann, der Sie überfallen hat, ungeschoren davon.«
»Ich weiß. Es tut mir wirklich leid.«
»Es tut Ihnen leid?«
»Ich kann nicht aussagen. Ich kann nicht. Ich kann nicht.« Sie begann zu weinen.
Jess zog hastig ein Papiertuch aus der Tasche ihrer grauen Jacke und hielt es Connie hin, doch die ignorierte es. Ihr Weinen wurde lauter. Jess dachte an ihre Schwester, wie mühelos es ihr zu gelingen schien, ihre weinenden Säuglinge zu beruhigen und zu trösten. Jess besaß keine solchen Talente. Sie konnte nur hilflos dabeisitzen, ohne etwas zu tun.
»Ich weiß, daß ich Sie im Stich lasse«, sagte Connie DeVuono schluchzend. »Ich weiß, daß das für alle eine kalte Dusche ist...«
»Machen Sie sich unseretwegen keine Sorgen«, sagte Jess. »Sorgen Sie sich um sich selbst. Denken Sie daran, was dieses Ungeheuer Ihnen angetan hat.«
Connie DeVuono hob den Kopf und sah Jess mit zornigem Blick an. »Glauben Sie, das könnte ich je vergessen?«
»Dann müssen Sie dafür sorgen, daß er so etwas nie wieder tun kann.«
»Aber ich kann nicht aussagen! Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht.«
»Okay, okay, beruhigen Sie sich. Es ist ja gut. Weinen Sie sich erst mal aus.«
Jess lehnte sich an die harte Stuhllehne und versuchte sich in Connie hineinzuversetzen. Seit dem letzten Mal, als sie miteinander gesprochen hatten, war offensichtlich etwas geschehen. Bei jeder ihrer früheren Zusammenkünfte hatte sich Connie trotz aller Angst fest entschlossen gezeigt auszusagen. Sie war die Tochter italienischer Einwanderer und im unerschütterlichen Glauben ihrer Eltern an das amerikanische Rechtssystem aufgewachsen. Jess war von diesem festen Glauben sehr beeindruckt gewesen. Sie hielt es durchaus für möglich, daß er stärker war als ihr eigener, der nach vier Jahren bei der Staatsanwaltschaft doch etwas gelitten hatte.
»Ist etwas passiert?« fragte sie und beobachtete Connie scharf.
Connie hob den Kopf und straffte die Schultern. »Ich muß an meinen Sohn denken«, sagte sie mit Nachdruck. »Er ist erst acht. Sein Vater ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Wenn mir jetzt auch noch etwas passiert, hat er keinen Menschen mehr.«
»Aber Ihnen wird nichts passieren.«
»Meine Mutter ist zu alt, um sich um ihn zu kümmern. Außerdem spricht sie sehr schlecht Englisch. Was soll denn aus Steffan werden, wenn ich sterbe? Wer soll sich um ihn kümmern? Sie vielleicht?«
Jess verstand, daß die Frage rhetorisch gemeint war, antwortete aber dennoch. »Mit Männern hab ich’s leider nicht besonders«, sagte sie leise, in der Hoffnung, Connie zum Lächeln zu bringen. Die bemühte sich, wie sie sah, aber ohne Erfolg. »Aber, Connie, wenn wir Rick Ferguson erst hinter Schloß und Riegel haben, kann Ihnen gar nichts mehr passieren.«
Connie DeVuono zitterte. »Es war schlimm genug für Steffan, daß er seinen Vater so früh verlieren mußte. Gibt es etwas Schlimmeres, als dann auch noch die Mutter zu verlieren?«
Jess spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. Sie schüttelte den Kopf. Nein, es gab nichts Schlimmeres.
»Connie«, begann sie und war selbst überrascht, als sie das Zittern in ihrer Stimme wahrnahm. »Glauben Sie mir, ich verstehe Sie. Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Aber wie kommen Sie auf den Gedanken, Sie seien sicher, wenn Sie nicht aussagen? Rick Ferguson ist schon einmal in Ihre Wohnung eingebrochen. Er hat Sie so brutal zusammengeschlagen, daß Sie einen ganzen Monat lang kaum die Augen öffnen konnten. Er wußte nicht, daß Ihr Sohn nicht zu Hause war. Das war ihm völlig gleichgültig. Wieso glauben Sie, daß er es nicht wieder versuchen wird? Besonders wenn er weiß, daß er nichts zu fürchten hat, weil Sie zu große Angst haben, um ihm das Handwerk zu legen. Wieso glauben Sie, daß er nicht das nächste Mal auch Ihren Sohn mißhandeln wird?«
»Das wird er nicht tun, wenn ich nicht aussage.«
»Aber das wissen Sie doch gar nicht.«
»Ich weiß nur, daß er gesagt hat, er würde mich umbringen, ehe ich aussagen könnte.«
»Aber damit hat er Ihnen doch schon vor Monaten gedroht, und das hat Sie nicht von Ihrem Entschluß abbringen können.« Einen Moment war es still. »Was ist passiert, Connie? Wovor haben Sie Angst? Hat er irgendwie mit Ihnen Kontakt aufgenommen? Wenn das der Fall ist, können wir seine Freilassung auf Kaution aufheben lassen -«
»Sie können gar nichts tun.«
»Wir können eine ganze Menge tun.«
Connie DeVuono griff in ihre große schwarze Ledertasche und entnahm ihr eine kleine weiße Schachtel.
»Was ist das?«
Ohne ein Wort zu sagen reichte Connie Jess die Schachtel. Jess öffnete sie und zog vorsichtig die Schichten von Seidenpapier weg, unter denen sie etwas Kleines, Hartes spürte.
»Das Kästchen stand vor meiner Tür, als ich sie heute morgen aufmachte«, sagte Connie, während sie zusah, wie Jess das letzte Papier wegzog.
Jess drehte sich der Magen um. Der Schildkröte, die leblos und nackt in ihren Händen lag, fehlten der Kopf und zwei Beine.
»Sie hat Steffan gehört«, sagte Connie tonlos. »Als wir vor ein paar Tagen abends nach Hause kamen, war sie nicht in ihrem Glas. Wir konnten nicht begreifen, wie sie da herausgekommen sein sollte. Wir haben sie überall gesucht.«
Jess begriff augenblicklich Connies Entsetzen. Vor drei Monaten war Rick Ferguson in ihre Wohnung eingebrochen, hatte sie geschlagen und vergewaltigt und ihr dann mit dem Tod gedroht. Jetzt wollte er ihr offenbar zeigen, daß es ihm ein leichtes sein würde, seine Drohungen wahrzumachen. Wiederum hatte er sich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft, so mühelos, als hätte man ihm den Schlüssel gegeben. Er hatte das Haustier ihres Kindes getötet und verstümmelt. Niemand hatte ihn beobachtet. Niemand hatte ihn daran gehindert.
Jess hüllte die tote Schildkröte wieder in ihren Kokon aus Seidenpapier und legte sie zurück in ihren kleinen Sarg.
»Ich hab zwar wenig Hoffnung, daß uns das etwas bringen wird, aber ich möchte das doch mal im Labor untersuchen lassen.« Sie ging zur Tür und winkte Sally. »Würden Sie mir das bitte ins Labor bringen lassen.«
Sally nahm das Kästchen so vorsichtig entgegen, als hätte sie es mit einer Giftschlange zu tun.
Plötzlich sprang Connie auf. »Sie wissen doch so gut wie ich, daß Sie es nicht schaffen werden, da eine Verbindung zu Rick Ferguson herzustellen. Man kann ihm nichts nachweisen. Man kann ihm nie etwas nachweisen. Er kann sich alles erlauben.«
»Nur wenn Sie es zulassen.« Jess kehrte zu Connie zurück.
»Was hab ich denn für eine Wahl?«
»Sie haben eine Wahl«, entgegnete Jess, die wußte, daß ihr nur wenige Minuten blieben, um Connie umzustimmen. »Sie können sich weigern auszusagen und auf diese Weise dafür sorgen, daß Rick Ferguson ungestraft davonkommt und für das, was er Ihnen angetan hat, was er Ihnen noch immer antut, niemals zur Rechenschaft gezogen werden wird.« Sie machte eine Pause, um ihre Worte wirken zu lassen. »Oder Sie können vor Gericht gehen und dafür sorgen, daß dieser Mensch bekommt, was er verdient, und für lange Zeit ins Zuchthaus wandert, wo er niemandem mehr etwas antun kann.« Sie sah den Schimmer der Unschlüssigkeit in Connies Augen und wartete einen Augenblick. »Machen Sie sich nichts vor, Connie. Wenn Sie nicht gegen Rick Ferguson aussagen, helfen Sie niemandem, am wenigsten sich selbst. Sie geben ihm nur die Erlaubnis, es wieder zu tun.«
Die Worte hingen zwischen ihnen im Raum wie Wäsche, die jemand vergessen hatte von der Leine zu nehmen. Jess wartete mit angehaltenem Atem. Sie sah, daß sie Connie schwankend gemacht hatte, und wollte jetzt auf keinen Fall etwas sagen oder tun, was sie womöglich veranlassen würde, einen Rückzieher zu machen. Doch sie hatte schon die nächste Ansprache auf der Zunge. Es gibt die bequeme Tour, begann sie, oder es gibt die harte Tour. Die bequeme Tour ist, wenn Sie sich bereit erklären auszusagen wie vereinbart. Die harte Tour ist, wenn ich Sie zur Aussage zwingen muß. Ich erwirke einen Haftbefehl gegen Sie, zwinge Sie, vor Gericht zu erscheinen und als Zeugin auszusagen. Wenn Sie sich dann immer noch weigern, eine Aussage zu machen, wird der Richter Ihnen Mißachtung des Gerichts vorwerfen und Sie in Beugehaft nehmen. Wäre das nicht wirklich bitter – statt des Mannes, der Sie überfallen hat, Sie selbst hinter Gittern?
Jess wartete. Sie war entschlossen, diese Worte zu gebrauchen, wenn es sein mußte, aber im stillen betete sie darum, sie könnten ungesagt bleiben.
»Kommen Sie, Connie«, sagte sie schließlich, einen letzten Versuch machend. »Sie sind doch eine Kämpfernatur. Nach dem Tod Ihres Mannes haben Sie nicht klein beigegeben; im Gegenteil, Sie sind auf die Abendschule gegangen und haben sich eine Stellung gesucht, um für Ihren Sohn sorgen zu können. Sie sind eine Kämpfernatur, Connie. Lassen Sie sich das nicht von Rick Ferguson rauben. Schlagen Sie zurück!«
Connie sagte nichts, doch ihre Haltung wurde ein wenig aufrechter, ihre Schultern strafften sich. Schließlich nickte sie.
Jess drückte ihr die Hände. »Sie sagen aus?«
Connies Stimme war nur ein Flüstern. »Ja. Mit Gottes Hilfe.«
»Uns ist jede Hilfe willkommen.« Jess warf einen raschen Blick auf ihre Uhr und stand auf. »Kommen Sie, ich bringe Sie hinaus.«
Neil und Barbara waren bereits gegangen, um pünktlich zur Verhandlung zu kommen. Jess führte Connie durch den Korridor, an der Wand mit der langen Reihe voll abgeschnittener Krawatten vorbei, von denen jede den ersten Sieg eines Staatsanwalts vor einem Geschworenengericht symbolisierte. Die Gänge waren mit Blick auf Halloween schon mit großen orangefarbenen Papierkürbissen und Papphexen, die auf ihren Besen die Wände entlangritten, dekoriert. Wie in einem Kindergarten, dachte Jess, nahm nickend Greg Olivers gute Wünsche entgegen und ging weiter durch die Empfangshalle zu den Aufzügen draußen vor der Glastür. Durch das große Fenster am hinteren Ende der Vorhalle konnte man die ganze West- und Nordwestseite der Stadt sehen. An einem schönen Tag konnte man sogar ganz leicht den O’Hare-Flughafen ausmachen.
Die Frauen sprachen nichts, während der Aufzug sie nach unten trug. Alles Wichtige war bereits gesagt. Im Erdgeschoß verließen sie den Aufzug und bogen um die Ecke, auf dem Weg zu der verglasten Passage, die das Administration Building mit dem anschließenden Gerichtsgebäude verband.
»Wo haben Sie geparkt?« fragte Jess, die Connie noch hinausbringen wollte.
»Ich bin mit dem Bus gekommen«, begann Connie DeVuono. Sie brach plötzlich ab und drückte die Hand auf den Mund. »O Gott!«
»Was denn? Was ist los?« Jess folgte mit den Augen dem entsetzten Blick der Frau.
Der Mann stand am gegenüberliegenden Ende des Korridors, lässig an die kalte Glaswand gelehnt. Die Haltung seines schlaksigen mageren Körpers hatte etwas Bedrohliches. Sein Gesicht war teilweise von den langen ungekämmten Strähnen dunkelblonden Haars verdeckt, die auf den Kragen seiner braunen Lederjacke herabfielen. Als er sich langsam herumdrehte, um sie zu grüßen, sah Jess, wie sein Mund sich zu dem gleichen beklemmenden Lächeln verzog, mit dem er an diesem Morgen auf sie gewartet hatte.
Ich bin der Tod, sagte es.
Jess fröstelte unwillkürlich und versuchte dann so zu tun, als käme es von dem kalten Windstoß, der durch die Drehtür ins Foyer fegte.
Rick Ferguson.
»Ich möchte, daß Sie ein Taxi nehmen, Connie«, sagte sie auf dem Weg zur California Avenue hinaus, wo gerade eines vorgefahren war und jemanden absetzte. Sie drückte Connie zehn Dollar in die Hand. »Ich kümmere mich schon um Rick Ferguson.«
Connie sagte nichts. Es war, als hätte sie ihre ganze Energie bei dem Gespräch mit Jess verbraucht und hätte jetzt keine Kraft mehr zu widersprechen. Die Zehn-Dollar-Note in der zur Faust geballten Hand, ließ sie sich von Jess in das Taxi schieben und warf keinen Blick zurück, als der Wagen anfuhr. Jess blieb noch einen Moment auf dem Bürgersteig stehen und versuchte innerlich zur Ruhe zu kommen, dann machte sie kehrt und ging durch die Drehtür wieder ins Gebäude.
Er hatte sich nicht von der Stelle gerührt.
Durch den langen Flur ging Jess auf ihn zu. Die Absätze ihrer schwarzen Pumps klapperten auf dem harten Granitboden. Mit jedem Schritt, den sie machte, bekam sie seine Gesichtszüge schärfer in den Blick. Die vage Drohung, die von ihm ausging – ein junger Weißer Anfang Zwanzig, vielleicht einen Meter fünfundsiebzig groß, fünfundsiebzig Kilo schwer, blondes Haar, braune Augen -, wurde konkreter, persönlicher – leicht nach vorn gebeugte Schultern, ungepflegtes langes Haar, stechende Augen unter schweren Lidern, eine mehrmals gebrochene Nase, die niemals richtig behandelt worden war, und immer dasselbe schreckliche Lächeln.
»Ich verbiete Ihnen, sich Mrs. DeVuono zu nähern«, sagte Jess mit scharfer Stimme, als sie ihn erreichte, und fuhr zu sprechen fort, ehe er sie unterbrechen konnte. »Wenn Sie sich noch einmal in ihrer Nähe blicken lassen, und sei es nur rein zufällig, wenn Sie versuchen sollten, mit ihr zu sprechen oder auf andere Weise mit ihr Verbindung aufzunehmen, wenn Sie es noch einmal wagen sollten, ihr so ein grausiges kleines Geschenk vor die Tür zu legen, lasse ich Ihre Haftverschonung aufheben. Dann finden Sie Ihren Arsch im Knast wieder. Haben Sie mich verstanden?«
»Wissen Sie eigentlich«, sagte er sehr lässig und ohne Eile, so als befände er sich mitten in einem ganz anderen Gespräch, »daß es keine gute Idee ist, mir auf die Zehen zu treten.«
Jess hätte beinahe gelacht. »Was soll das heißen?«
Rick Ferguson verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen, zuckte die Achseln, machte ein gelangweiltes Gesicht. Er sah sich um, kratzte sich bedächtig an der Nase. »Na ja, Leute, die mir in die Quere kommen, neigen dazu... zu verschwinden.«
2
Jeden Tag werden in den Vereinigten Staaten 1871 Frauen vergewaltigt«, begann Jess. Ihr Blick glitt langsam über die sechs Männer und sechs Frauen hin, die in zwei Reihen in der Geschworenenbank im Gerichtssaal 706 des State Court House in der California Avenue saßen. »Das heißt, daß etwa alle 46 Sekunden eine erwachsene Frau vergewaltigt wird, was sich im Laufe eines Jahres zu 683000 Vergewaltigungen summiert.« Sie machte eine kurze Pause, um die ungeheuerliche Zahl wirken zu lassen. »Manche Frauen werden auf der Straße überfallen; andere in der eigenen Wohnung. Manchen wird von dem viel zitierten Wildfremden in einer dunklen Gasse Gewalt angetan, weit häufiger jedoch werden Frauen von Menschen vergewaltigt, die sie kennen: von einem wütenden abgewiesenen Verehrer, einem Freund, dem sie vertraut haben, einem Bekannten. Vielleicht, wie Erica Barnowski«, sagte sie, mit dem Kopf auf die Klägerin deutend, »von einem Mann, den sie in einer Bar kennengelernt haben. Es trifft Frauen jeden Alters und jeder Hautfarbe, jeder Konfession und jeder Bildungsstufe. Das einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist ihr Geschlecht. Es geht also um Sexualität, sollte man meinen, aber so ist es nicht. Bei der Vergewaltigung geht es nicht um Sexualität. Vergewaltigung ist ein Gewaltverbrechen. Da geht es nicht um Leidenschaft, nicht einmal um Lust. Es geht um Macht. Es geht um Herrschaft und Unterdrükkung. Um Erniedrigung. Um das Zufügen von Schmerz. Die Vergewaltigung ist ein Akt der Wut, ein Akt des Hasses. Mit Sexualität hat sie nichts zu tun. Die Sexualität benutzt sie nur als Waffe.«
Jess sah sich in dem ehrwürdigen alten Gerichtssaal um, ließ ihren Blick zur hohen Decke und den hohen Fenstern schweifen, über die dunkle Holztäfelung an den Wänden, die schwarze Marmorumrandung der großen Flügeltüren. Rechts vom Richter verbot über einer Tür ein Schild alle Besucher im Gerichtssaal und Zellentrakt. Linker Hand verkündete ein zweites Schild: »Ruhe! Rauchen, Essen, das Mitbringen von Kindern verboten!«
Der Zuschauerraum mit den acht Sitzreihen, deren Holz von Graffiti zerkratzt war, hatte einen alten schwarz-weißen Fliesenboden. Genau wie im Film, dachte Jess, froh und dankbar, daß sie seit achtzehn Monaten der Kammer von Richter Harris zugeteilt war und nicht einer der anderen Kammern, zu denen die kleineren, neueren Säle in den unteren Stockwerken gehörten.
»Die Verteidigung möchte Sie etwas anderes glauben machen«, fuhr Jess fort und nahm ganz bewußt mit jedem einzelnen Geschworenen Blickkontakt auf, ehe sie ihre Aufmerksamkeit langsam auf den Angeklagten richtete. Douglas Phillips, weißer Mittelstand, ein Durchschnittstyp, recht ehrbar aussehend in seinem dunkelblauen Anzug mit der gedeckten Paisley-Krawatte, verzog beleidigt den Mund, ehe er den Blick zu Boden senkte. »Die Verteidigung möchte Sie glauben machen, daß das, was sich zwischen Douglas Phillips und Erica Barnowski abspielte, ein Geschlechtsakt war, der mit dem Einverständnis der Klägerin vollzogen wurde. Die Verteidigung hat Ihnen berichtet, daß Douglas Phillips Erica Barnowski am Abend des dreizehnten Mai 1992 in der Singles-Bar Red Rooster kennenlernte und sie zu mehreren Drinks einlud. Wir haben mehrere Zeugen gehört, die aussagten, die beiden zusammen gesehen zu haben, trinkend und lachend, wie sie sagten, und die unter Eid bezeugt haben, daß Erica Barnowski aus freien Stücken und ganz ohne Zwang die Bar gemeinsam mit Douglas Phillips verließ. Erica Barnowski selbst hat das bei ihrer Vernehmung zugegeben.
Aber die Verteidigung möchte Sie nun weiter glauben machen, daß das, was sich zwischen den beiden zutrug, nachdem sie die Bar verlassen hatten, ein Akt überwältigender Leidenschaft zwischen zwei erwachsenen Menschen war. Douglas Phillips behauptet, die Blutergüsse an Armen und Beinen der Klägerin seien die bedauerlichen Nebenwirkungen des Geschlechtsverkehrs in einem kleinen Auto europäischer Herkunft. Die nachfolgende Hysterie des Opfers, die von mehreren Leuten auf dem Parkplatz wahrgenommen und später von Dr. Robert Ives im Grant Hospital beobachtet wurde, tut er schlicht als Tobsuchtsanfall einer Frau ab, der es nicht paßte, nach Gebrauch weggeworfen zu werden wie – in seinen einfühlsamen Worten – ›ein benutztes Kleenex‹.«
Jess konzentrierte jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit auf Erica Barnowski, die neben Neil Strayhorn am Tisch der Staatsanwaltschaft saß, der Geschworenenbank direkt gegenüber. Erica Barnowski war siebenundzwanzig Jahre alt, sie war sehr blaß und sehr blond und saß völlig unbewegt in dem braunen Ledersessel mit der hohen Lehne. Nur ihre Unterlippe bewegte sich, sie hatte während des ganzen Prozesses unaufhörlich gezittert, so daß ihre Zeugenaussage bisweilen beinahe unverständlich gewesen war. Dennoch hatte die Frau kaum etwas Weiches an sich. Das Haar war zu gelb, die Augen waren zu klein, die Bluse zu blau, zu billig. Sie hatte nichts Mitleiderregendes an sich, nichts, das war Jess klar, was den Geschworenen automatisch ans Herz gegangen wäre.
»Die Schnitte an der Kehle der Klägerin zu erklären, bereitete ihm etwas mehr Mühe«, fuhr Jess fort. »Er habe sie nicht verletzen wollen, behauptet er jetzt. Es sei ja nur ein kleines Messer gewesen, gerade einmal zehn Zentimeter lang. Und er habe es ja nur zum Spaß herausgezogen. Er habe den Eindruck gehabt, daß es sie errege, hat er Ihnen erzählt. Er glaubte, ihr gefiele das. Woher hätte er wissen sollen, daß es ihr nicht gefiel? Woher hätte er wissen sollen, daß sie nicht das gleiche wollte wie er? Woher hätte er wissen sollen, was sie wollte? War sie nicht schließlich in die Kneipe gekommen, weil sie einen Mann suchte? Hatte sie sich nicht von ihm einladen lassen? Hatte sie nicht über seine Witze gelacht und sich von ihm küssen lassen? Und vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, sie hatte keinen Schlüpfer an!«
Jess holte einmal tief Atem und richtete ihren Blick wieder auf die Geschworenen, die ihr jetzt mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörten.
»Die Verteidigung hat die Tatsache, daß Erica Barnowski keine Unterwäsche trug, als sie an jenem Abend in das Red Rooster ging, ungeheuer hochgespielt. Eine eindeutige Aufforderung, möchte sie Sie glauben machen. Stillschweigendes Einverständnis. Einer Frau, die ohne Höschen in eine Aufreißerkneipe geht, geschieht nur recht, wenn ihr das Schlimmste widerfährt. Erica Barnowski wollte etwas erleben, behauptet die Verteidigung, und der Wunsch ist ihr erfüllt worden. Na schön, kann sein, daß das Erlebnis ein bißchen krasser war, als sie es sich vorgestellt hatte, aber hey, das hätte sie doch besser wissen müssen.
Gut, vielleicht hätte sie es tatsächlich besser wissen müssen. Vielleicht war es wirklich nicht sehr klug von Erica Barnowski, in eine Kneipe wie das Red Rooster zu gehen und ihren Schlüpfer zu Hause zu lassen. Aber glauben Sie doch bitte ja nicht, daß mangelnde Klugheit des einen einem anderen das Recht gibt, seine Menschenwürde mit Füßen zu treten. Glauben Sie ja nicht, daß Douglas Phillips die Signale mißverstanden hat. Lassen Sie sich nicht einreden, daß dieser Mann, der von Berufs wegen Computer repariert, der keinerlei Schwierigkeiten hat, komplizierte Softwareterminologie zu dechiffrieren, unfähig ist, zwischen einem einfachen Ja und Nein zu unterscheiden. Was an einem Nein ist für einen erwachsenen Mann so schwer zu verstehen? Nein heißt schlicht und einfach Nein!
Und Erica Barnowski hat an jenem Abend laut und deutlich Nein gesagt, meine Damen und Herren. Sie hat Nein nicht nur gesagt, sondern sie hat Nein geschrien. Sie hat es so laut und so oft geschrien, daß Douglas Phillips ihr ein Messer an die Kehle halten mußte, um sie zum Schweigen zu bringen.«
Jess merkte plötzlich, daß sie ihre Worte insbesondere an eine Geschworene richtete, die in der zweiten Reihe saß, eine Frau Ende Fünfzig mit kastanienbraunem Haar und kräftigen, dennoch seltsam zarten Zügen. Es war etwas am Gesicht dieser Frau, das sie faszinierte. Sie war schon zu Beginn des Prozesses auf sie aufmerksam geworden und hatte sich bereits früher gelegentlich dabei ertappt, daß sie das Wort beinahe ausschließlich an sie richtete. Vielleicht lag es an der Intelligenz, die sich in den weichen grauen Augen spiegelte. Vielleicht lag es an der Art, wie sie den Kopf leicht zur Seite zu neigen pflegte, wenn sie sich bemühte, einen schwierigen Punkt zu erfassen. Vielleicht lag es auch einfach an der Tatsache, daß sie besser gekleidet war als die meisten anderen Geschworenen, von denen mehrere Bluejeans anhatten und billige, schlecht sitzende Pullover. Oder vielleicht lag es daran, daß Jess das Gefühl hatte, zu dieser Frau durchzudringen, und hoffte, über sie auch die anderen zu erreichen.
»Es liegt mir fern zu behaupten, ich würde mich auskennen, was Männer angeht«, fuhr Jess fort und hörte das Lachen ihrer inneren Stimme, »aber es fällt mir ausgesprochen schwer zu glauben, daß ein Mann, der einer Frau ein Messer an die Halsschlagader halten muß, ehrlich davon überzeugt ist, sie wolle mit ihm schlafen.« Jess machte eine Pause und sprach ihre nächsten Worte mit sorgfältiger Betonung. »Ich behaupte hingegen, daß selbst in unserem angeblich so aufgeklärten Zeitalter die doppelte Moral blüht und gedeiht, jedenfalls hier, in Cook County. Der beste Beweis dafür ist das Bemühen der Verteidigung, Ihnen einzureden, daß Erica Barnowskis Versäumnis, an jenem Abend Unterwäsche zu tragen, weit verwerflicher sei als die Tatsache, daß Douglas Phillips ihr ein Messer an die Kehle hielt.«
Wieder ließ Jess ihren Blick langsam von einem Geschworenen zum anderen wandern. »Douglas Phillips«, fuhr sie dann fort, »behauptet, er habe geglaubt, Erica Barnowski sei einverstanden und wolle den Geschlechtsverkehr genau wie er. Aber ist es nicht Zeit, daß wir aufhören, die Vergewaltigung aus der Perspektive des Täters zu sehen? Ist es nicht Zeit, daß wir aufhören zu akzeptieren, was Männer glauben, und endlich anfangen, auf das zu hören, was Frauen sagen? Einvernehmen ist keine einseitige Sache, meine Damen und Herren. Einvernehmen erfordert beiderseitige Zustimmung. Das, was am Abend des dreizehnten Mai zwischen Erica Barnowski und Douglas Phillips geschah, geschah entschieden nicht in beiderseitigem Einvernehmen.
Erica Barnowski mag einer Fehleinschätzung der Lage schuldig sein«, sagte Jess abschließend. »Douglas Phillips ist der Vergewaltigung schuldig.«
Sie kehrte an ihren Platz zurück und tätschelte Erica Barnowski flüchtig die überraschend warmen Hände. Die junge Frau dankte ihr mit einem kurzen Lächeln.
»Gut gemacht«, flüsterte Neil Strayhorn.
Vom Verteidigungstisch kam kein solches Lob; dort saßen Douglas Phillips und seine Anwältin, Rosemary Michaud, kerzengerade, den Blick starr geradeaus gerichtet.
Rosemary Michaud war fünf Jahre älter als Jess, hätte aber ihrem Aussehen nach gut um das Doppelte älter sein können. Sie trug das dunkelbraune Haar in einem strengen Knoten, und wenn sie geschminkt war, dann so dezent, daß es nicht zu bemerken war. Jess fühlte sich jedesmal, wenn sie sie sah, an das Stereotyp der alten Jungfer erinnert, obwohl diese alte Jungfer dreimal verheiratet gewesen war und derzeit, so wurde gemunkelt, eine Affäre mit einem hohen Polizeibeamten hatte. Aber wie im Leben, so zählte im Gerichtssaal weniger das, was war, als das, was wahrgenommen wurde. Image war alles, wie in der Werbung behauptet wurde. Und Rosemary Michaud, in ihrem konservativen blauen Kostüm, mit dem ungeschminkten Gesicht und der schlichten Frisur, vermittelte genau das Bild einer Frau, die einen Mann, den sie einer so niedrigen Tat wie einer Vergewaltigung für schuldig hielt, niemals verteidigen würde. Es war von Douglas Phillips ein kluger Schachzug gewesen, ihr seine Verteidigung anzuvertrauen.
Rosemary Michauds Motive, Douglas Phillips’ Mandat zu übernehmen, waren schwerer zu ergründen, wobei Jess natürlich völlig klar war, daß es nicht Aufgabe des Anwalts war, Schuld oder Unschuld festzustellen. Dafür gab es die Geschworenen. Wie oft hatte sie das Argument gehört, hatte sie selbst das Argument vorgebracht, daß die Justiz einpacken könnte, wenn Anwälte begännen, sich als Richter und Geschworene aufzuspielen. Es war schließlich von der Unschuldsvermutung auszugehen; jeder hatte ein Recht auf bestmögliche Verteidigung.
Richter Earl Harris räusperte sich zum Zeichen, daß er sich anschickte, die Geschworenen zu belehren. Er war ein gutaussehender Mann Ende Sechzig, ein Schwarzer mit bronzebrauner Haut und krausem grauen Haar. Die Güte seines Gesichts, der weiche Glanz seiner dunklen Augen betonten die Ernsthaftigkeit seines Engagements für Recht und Gerechtigkeit.
»Meine Damen und Herren Geschworenen«, begann er und schaffte es irgendwie, selbst diese Worte frisch und lebendig klingen zu lassen, »ich möchte Ihnen für die Aufmerksamkeit und den Respekt danken, die Sie diesem Gericht in den vergangenen Tagen gezeigt haben. Fälle wie dieser sind niemals einfach zu behandeln. Die Emotionen schlagen da hohe Wellen. Aber Ihre Pflicht als Geschworene ist es, Ihre Emotionen auszuklammern und sich einzig auf die Fakten zu konzentrieren.«
Jess konzentrierte sich weniger auf die Worte des Richters als auf die Reaktion der Geschworenen auf sie. Alle saßen sie vorgebeugt auf ihren braunen Lederstühlen und hörten aufmerksam zu.
Welcher Auffassung würden sie sich anschließen, fragte sie sich, wohl wissend, wie schwierig es war, die Reaktionen der Geschworenen zu deuten, ihre Entscheidungen vorauszusagen. Als sie vor vier Jahren bei der Staatsanwaltschaft angefangen hatte, hatte sie kaum glauben können, daß sie sich in ihren Beurteilungen so oft und so gründlich irren konnte.
Die Geschworene mit den intelligenten Augen hustete hinter vorgehaltener Hand. Jess wußte, daß in Vergewaltigungsprozessen die Frauen unter den Geschworenen oft schwerer zu überzeugen waren als die Männer. Dahinter steckte wahrscheinlich ein Verleugnungsmechanismus. Wenn die Frauen sich einreden konnten, daß das Opfer das, was geschehen war, selbst verschuldet hatte, konnten sie sich beruhigt sagen, daß ihnen selbst niemals etwas Ähnliches widerfahren würde. Sie würden schließlich niemals so leichtsinnig sein, nach Einbruch der Dunkelheit allein durch den Park zu gehen, sich von einem flüchtigen Bekannten im Auto mitnehmen zu lassen, sich in einer Bar von einem Fremden ansprechen zu lassen, ohne Schlüpfer herumzulaufen. Nein, dazu waren sie zu klug. Sich der Gefahren allzusehr bewußt. Sie würden niemals vergewaltigt werden. Sie würden sich ganz einfach niemals in eine so riskante Situation begeben.
Die Geschworene wurde auf Jess’ forschend auf sie gerichteten Blick aufmerksam und wandte sich verlegen ab. Sie straffte ihre Schultern und stand kurz von ihrem Sitz auf, ehe sie es sich wieder bequem machte und ihren Blick auf den Richter konzentrierte. Im Profil wirkte die Frau imposanter, ihre Nase wirkte schärfer, die einzelnen Gesichtszüge stärker ausgeprägt. Sie hatte etwas Vertrautes, das Jess vorher nicht aufgefallen war; die Art, wie sie sich hin und wieder mit einem Finger leicht auf die Lippen klopfte; die Wölbung ihres Nackens, wenn sie sich bei gewissen Schlüsselsätzen vorbeugte, die schräge Fläche ihrer Stirn; die schmalen Augenbrauen. Jess wurde sich plötzlich bewußt, daß die Frau sie an jemanden erinnerte, und sofort versuchte sie, die Gedanken auszublenden, die sich formen wollten, versuchte, das Bild zu verbannen, das sich entfalten wollte. Nein, kommt nicht in Frage, dachte Jess, während ihr Blick gehetzt durch den Gerichtssaal flog und sie in Armen und Beinen das gefürchtete Kribbeln spürte. Sie kämpfte gegen den Impuls zu fliehen.
Beruhige dich doch, fuhr sie sich im stillen ungeduldig an, als sie fühlte, wie es ihr den Atem abschnürte, ihre Hände klamm wurden, ihre Unterarme feucht. Warum gerade jetzt? fragte sie sich, während sie gegen die wachsende Panik kämpfte und versuchte, sich zur Ruhe zu zwingen. Warum geschah ihr das gerade jetzt?
Sie zwang sich, wieder die Geschworene anzusehen, die vorgebeugt in ihrem Sessel saß. Als spürte sie Jess’ neuerliches Interesse und sei fest entschlossen, sich davon nicht einschüchtern zu lassen, drehte die Frau sich halb herum und sah ihr direkt in die Augen.
Jess wich dem Blick der Frau nicht aus, sondern erwiderte ihn, bis die Frau wegsah. Dann schloß sie voller Erleichterung die Augen. Was hatte sie da nur gesehen? Sie spürte, wie die Muskeln in ihrem Rücken sich entspannten. Wodurch konnte eine solche Assoziation ausgelöst worden sein? Die Frau besaß keinerlei Ähnlichkeit mit irgend jemand, den sie kannte oder je gekannt hatte. Ganz gewiß nicht mit der Frau, die sie flüchtig in ihr zu sehen gemeint hatte. Jess fand sich töricht und schämte sich ein wenig.
Nein, da war nicht einmal die entfernteste Ähnlichkeit mit ihrer Mutter.
Jess senkte den Kopf, so daß ihr Kinn beinahe im Kragen ihrer Bluse verschwand. Acht Jahre waren vergangen, seit ihre Mutter verschwunden war. Acht Jahre, seit ihre Mutter aus dem Haus gegangen war, um einen Arzttermin einzuhalten, und nie wieder gesehen worden war. Acht Jahre, seit die Polizei die Suche nach ihr mit der Begründung aufgegeben hatte, sie sei vermutlich das Opfer eines Verbrechens geworden.
In den ersten Tagen, Monaten, selbst Jahren nach dem Verschwinden ihrer Mutter hatte Jess oft geglaubt, ihr Gesicht irgendwo in einer Menge gesehen zu haben. Es geschah immerzu: Sie war im Supermarkt und sah plötzlich ihre Mutter, die einen überquellenden Einkaufswagen den Nachbargang hinunterschob; sie war bei einem Baseballspiel und hörte plötzlich die Stimme ihrer Mutter, die, drüben auf der anderen Seite des Wrigley Field sitzend, die Chicago Cubs anfeuerte. Ihre Mutter war die Frau hinter der Zeitung hinten im Bus; die Frau vorn im Taxi, das in der entgegengesetzten Richtung fuhr, die Frau, die mit ihrem Hund unten am Seeufer um die Wette joggte.
Im Laufe der Jahre waren diese Erscheinungen seltener geworden. Aber lange Zeit hatte Jess unter Alpträumen und Angstanfällen gelitten, die sie ganz plötzlich, wie aus heiterem Himmel zu packen pflegten, so bösartig und gewaltsam, daß sie sie allen Gefühls in ihren Gliedern, aller Kraft in ihren Muskeln beraubten. Im allgemeinen begannen sie mit einem leichten Kribbeln in Armen und Beinen und entwickelten sich dann zu einer richtiggehenden Lähmung, die von Wellen von Übelkeit begleitet wurde. Und wenn sie vorüber waren – manchmal nach Minuten, manchmal erst nach Stunden -, war sie völlig erschöpft, ausgelaugt, ein in Schweiß gebadetes Häufchen Elend.
Ganz langsam und unter Mühen, wie jemand, der nach einem Schlaganfall das Laufen wieder lernt, hatte Jess ihr inneres Gleichgewicht, ihr Selbstvertrauen, ihre Selbstachtung wiedergewonnen. Sie erwartete nicht mehr, daß ihre Mutter plötzlich zur Tür hereinkommen würde; fuhr nicht mehr jedesmal zusammen, wenn das Telefon läutete, weil sie erwartete, die Stimme am anderen Ende würde die ihrer Mutter sein. Die Alpträume hatten aufgehört. Sie hatte keine Panikattacken mehr. Jess hatte sich geschworen, sich nie wieder in solchem Maß auszuliefern.
Und nun hatte das vertraute, gefürchtete Kribbeln von neuem ihre Glieder befallen.
Warum gerade jetzt? Warum gerade heute?
Sie wußte, warum.
Rick Ferguson.
Jess beobachtete, wie er die Tür zu ihrem Gedächtnis aufstieß; sein grausames Lächeln umfing sie wie eine Schlinge um ihren Hals. »Es ist keine gute Idee, mir auf die Zehen zu treten«, hörte sie ihn sagen; seine Stimme klang belegt, seine Hände ballten sich zu Fäusten. »Leute, die mir in die Quere kommen, neigen dazu... zu verschwinden.«
Verschwinden.
Wie ihre Mutter.
Jess versuchte, sich zu sammeln, ihre ganze Aufmerksamkeit auf das zu richten, was Richter Harris sagte. Aber Rick Ferguson schob sich immer wieder zwischen sie und den Richter, und seine braunen Augen reizten sie mit höhnischem Blick, ihn doch nur herauszufordern.
Was ist das nur zwischen mir und Männern mit braunen Augen? fragte sich Jess, die plötzlich eine Collage aus braunäugigen Männergesichtern vor sich sah: Rick Ferguson, Greg Oliver, ihr Vater, ihr geschiedener Mann.
Das Bild ihres geschiedenen Mannes drängte die anderen Gesichter rasch in den Hintergrund. Wie typisch für Don, dachte sie, selbst wenn er nicht da war, so dominant zu sein, daß niemand neben ihm Platz hatte. Er war, elf Jahre älter als sie, ihr Mentor, ihr Geliebter, ihr Förderer und ihr Freund gewesen. Er wird dir keinen Raum zur Entfaltung lassen, hatte ihre Mutter gewarnt, als Jess damit herausgerückt war, daß sie beabsichtigte, diesen ungeheuer von sich überzeugten Mann zu heiraten, der im ersten Jahr ihres Studiums ihr Dozent gewesen war. Sieh dich doch erst mal um, hatte ihre Mutter gebeten. Es eilt doch nicht. Aber je mehr Einwände ihre Mutter vorgebracht hatte, desto mehr Entschlossenheit hatte Jess, die rebellische Tochter, an den Tag gelegt, bis am Ende die Opposition gegen ihre Mutter zum stärksten Band zwischen ihr und Don geworden war. Sie heirateten sehr bald nach dem Verschwinden von Jess’ Mutter.
Von Anfang an hatte Don in ihrer Ehe das Sagen. In den vier Jahren ihres Zusammenlebens bestimmte er alle ihre Unternehmungen; er suchte die Wohnung aus, in der sie lebten, die Möbel, mit denen sie sich einrichteten, er bestimmte, mit wem sie verkehrten, was sie unternahmen, ja, selbst was sie aß, wie sie sich kleidete.
Vielleicht war es ihre Schuld gewesen. Vielleicht hatte sie in den Jahren unmittelbar nach dem Verschwinden ihrer Mutter genau das gewollt und gebraucht: jemanden, der ihr alle Entscheidungen abnahm, sie umsorgte und verwöhnte. Vielleicht hatte sie die Möglichkeit gebraucht, selbst in einem anderen zu verschwinden.
Anfangs hatte Jess nichts dagegen gehabt, daß Don ihr Leben in die Hand nahm. Er wußte, was für sie am besten war. Er meinte es gut. Er war immer für sie da, trocknete ihre Tränen, half ihr über die schrecklichen Panikanfälle hinweg. Wie hätte sie ohne ihn überleben können?
Aber dann hatte sie in zunehmendem Maß, vielleicht sogar ohne bewußte Absicht, versucht, sich selbst zu behaupten; sie fing an, sich mit ihm zu streiten, trug plötzlich Farben, von denen sie wußte, daß er sie nicht mochte, stopfte sich, kurz bevor er sie in sein Lieblingsrestaurant führte, mit Süßigkeiten und Chips voll, weigerte sich, seine Freunde zu treffen, bewarb sich um einen Posten bei der Staatsanwaltschaft, anstatt zu Don in die Kanzlei zu gehen, zog schließlich aus der gemeinsamen Wohnung aus.