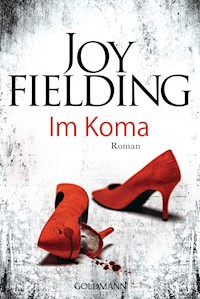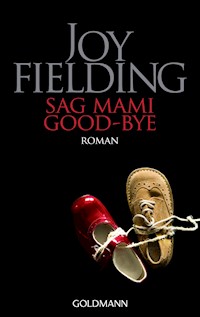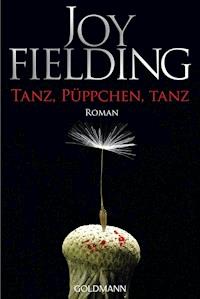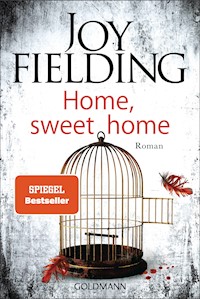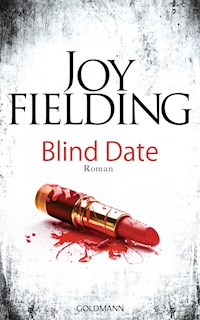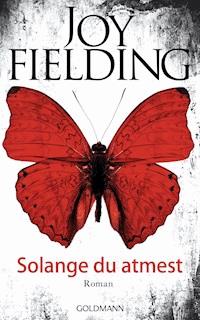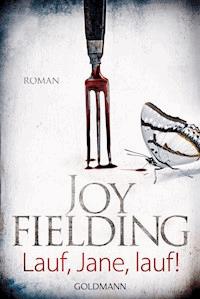2,99 €
2,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
Eigentlich ist Gail Winton zu beneiden: Sie führt eine glückliche Ehe mit einem unkomplizierten Mann, hat zwei reizende Töchter und ein sorgenfreies Leben. Doch dann bricht ihre Welt über Nacht zusammen. Ihre sechsjährige Tochter Cindy wird vergewaltigt und ermordet. Als die Polizei keine Spur des Täters findet, nimmt Gail die Sache selbst in die Hand. Und in ihrer maßlosen Trauer wird die Suche nach dem Mann, der ihre Tochter getötet und ihre Familie zerstört hat, zu Gails Obsession ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2010
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Das Buch
Gail Walton führt ein perfektes Leben: Verheiratet mit dem geradlinigen, unkomplizierten Jack, Mutter zweier reizender Töchter und weit und breit keine dunklen Wolken am Horizont. Doch dann bricht ein Albtraum über ihre Welt herein. Ihre sechsjährige Cindy wird vergewaltigt und ermordet. Gail gibt der Polizei 60 Tage Zeit, den Mörder zu fassen. Als diese Frist vorbei ist und es immer noch keine Spur gibt, macht sie sich selbst auf die Suche. Sie will keine Rache, sagt sie, nur Gerechtigkeit. In ihrer maßlosen Trauer weist Gail alle Menschen, die sich um sie bemühen, zurück: ihre Freunde, ihre Tochter Jennifer, ihren Mann. Die Suche nach Cindys Mörder ist für sie zur Obsession und zu ihrem einzigen Lebensinhalt geworden …
Joy Fielding
gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Die Katze • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Flieh wenn du kannst • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
Joy Fielding
LEBENSLANGIST NICHT GENUG
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Christa Seibicke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1984 unter dem Titel
»Life Penalty«
bei Doubleday, New York
Ausgabe Mai 1996
Copyright © der Originalausgabe 1984 by Joy Fielding, Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1996
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Deutsche Übersetzung aus dem Amerikanischen
von Christa Seibicke
CN · Herstellung: sc
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur
Umschlagmotiv: Wojciech Zwolinski / Trevillion Images; FinePic®, München
ISBN 978-3-641-05414-4
V004
www.goldmann-verlag.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Copyright
Meinem geliebten Vater Leo Tepperman zum Gedenken
1
Der Alptraum begann genau siebzehn Minuten nach vier an einem ungewöhnlich warmen und sonnigen 30. April. Bis zu diesem Augenblick hatte Gail Walton sich für eine glückliche Frau gehalten, und wenn einer der Reporter, die nach jenem Tag das Haus am Tarlton Drive umlagerten, sie damals gebeten hätte, ihre Selbsteinschätzung zu begründen, wäre ihr die Antwort nicht schwergefallen.
Sie hätte die Hände ausgestreckt, mit denen sie später ihr Gesicht gegen die neugierigen Kameras und das unbarmherzig grelle Blitzlichtgewitter abschirmte, und hätte die Gründe für ihr Glück stolz an den langen, schmalen Fingern aufgezählt. Da war zuerst einmal Jack, ein geradliniger, umkomplizierter Mann, der keine Flausen im Kopf hatte. Jack war vielleicht ein bißchen ungeschliffen, aber er war ehrlich, treu und liebte seine Frau auch nach acht Ehejahren noch voller Hingabe. Die nächsten beiden Finger zählten für ihre Töchter Jennifer und Cindy. Die Mädchen waren einander nicht ähnlich, aber sie hatten schließlich auch sehr verschiedene Väter. Das brachte Gail zum vierten Grund ihres Glücks, zu ihrem Exmann Mark Gallagher... Nicht viele Frauen hatten ein so entspanntes, ungezwungenes Verhältnis zu ihrem früheren Ehepartner wie sie. Es war nicht immer so gewesen, aber in letzter Zeit hatten sie beide die erfreuliche Erkenntnis gewonnen, daß die fünf Jahre ihres Zusammenlebens doch nicht sinnlos vergeudet waren.
Gail ging auf die vierzig zu, wirkte aber – nicht zuletzt dank ihrer sprühenden Vitalität – gut zehn Jahre jünger. Sie erfreute sich bester Gesundheit. Ihre Familie bewohnte ein hübsches Haus in einer netten Stadt. Livingston, New Jersey, bot zwar nicht so viel Abwechslung wie New York, dafür aber lebte man hier sicherer und ruhiger, vor allem mit Kindern. Außerdem war New York selbst bei schlechtesten Verkehrsverhältnissen weniger als eine Autostunde entfernt, und dank Jacks beträchtlicher Einkünfte – er war Tierarzt – konnte sie sich den Ausflug in die Metropole leisten, sooft sie Lust dazu verspürte. Jacks guter Verdienst enthob sie auch der Notwendigkeit, selbst einer festen Arbeit nachzugehen. Sie hatte das Berufsleben in den Jahren nach der Trennung und Scheidung von Mark bis zum Überdruß kennengelernt. Damals mußte sie ihre kleine Tochter bei ihrer Mutter lassen, während sie als Bankangestellte den Unterhalt für sich und das Kind verdiente. Jetzt konnte sie es sich leisten, in aller Ruhe mit ihren Freundinnen zu Mittag zu essen. Wenn die anderen an ihren Arbeitsplatz zurückeilten, blieb Gail mit einem Kaffee zurück und sann über die Mischung aus Neid und Verwirrung nach, mit der die Freundinnen sich von ihr verabschiedet hatten. Man beneidete sie, weil sie keine unbefriedigende Arbeit zu verrichten brauchte. Gleichzeitig irritierte es die Frauen, daß Gail nicht zu wissen schien, wie wichtig ein Beruf unabhängig von den drei großen K für die Selbstverwirklichung jeder Frau ist. Was machte sie bloß den ganzen Tag zu Hause, wo es nichts zu tun gab, als ein sechsjähriges Kind zu betreuen?
Gail hatte es aufgegeben, den berufstätigen Freundinnen ihre Wahl plausibel zu machen. Sie genoß es ganz einfach, Hausfrau und Mutter zu sein; es machte ihr Spaß, ihre beiden Töchter zu versorgen, wenn sie von der Schule heimkamen, und sie war der festen Überzeugung, daß die sechzehnjährige sie genauso nötig brauchte wie die sechsjährige. Sie konnte sich gut daran erinnern, wie gern sie selbst als Heranwachsende ihre Mutter um sich gehabt hatte. Außerdem war sie gar nicht so untätig. Gail, die von Jugend auf eine begabte Klavierspielerin gewesen war, hatte vor einiger Zeit begonnen, Kindern aus der Nachbarschaft Musikunterricht zu erteilen. Inzwischen hatte sie fünf Schüler, einen für jeden Schultag. Die Kinder – im Alter von acht bis zwölf Jahren – kamen nachmittags um vier für eine halbe Stunde zu ihr ins Haus. Um diese Zeit war Jennifer mit ihren Hausaufgaben beschäftigt, und Cindy hockte vor dem Fernseher; sie war ganz wild auf »Sesamstraße«.
Glück hatte Gail auch mit ihren Eltern. Beide waren gesund und wohlauf. Sie hatten sich nach der Pensionierung des Vaters eine Eigentumswohnung in Florida gekauft, gleich am Meer. Vor vier Jahren waren sie nach Palm Beach gezogen, und seitdem hatten Gail, Jack und die Mädchen sie mindestens einmal jährlich besucht. Ihre Eltern kamen einmal im Jahr nach Livingston, um die Kinder zu betreuen, während Gail und Jack sich ein paar Tage ungestörten Urlaub gönnten. Laura und Mike, enge Freunde der Waltons, beide berufstätig und kinderlos aus Überzeugung, mokierten sich oft über den ewig gleichen Trott, in den Gail und Jack verfallen seien: Florida mit den Kindern im Winter, Cape Cod allein im Sommer. Laura war Sozialarbeiterin, Mike Rechtsanwalt. Die beiden zog es ständig in exotische Länder. Letztes Jahr waren sie in Indien, im Jahr davor in China gewesen. Gail lockte weder Indien noch China. Diese Länder waren zu weit entfernt von allem, was ihr Geborgenheit einflößte: ihr Heim, ihre Familie, die Stadt, in der sie aufgewachsen war. Vielleicht bin ich in einen gewissen Trott verfallen, dachte Gail. Aber ich hab’ ihn mir wenigstens selbst ausgesucht. Inmitten von Trubel und Aufregung hatte sie sich nie wohl gefühlt. Das war einer der Gründe für das Scheitern ihrer ersten und für den Erfolg ihrer zweiten Ehe. Mark war unberechenbar gewesen, Jack dagegen plante jeden Schritt im voraus. Mark setzte sich ins Auto – er fuhr einen ausländischen Sportwagen von leuchtender Farbe mit Metallic-Effekt – und sauste ab ins Blaue. Er wußte nicht, wo er hinwollte, und er benutzte keine Straßenkarte. Wenn er sich verfuhr – und das passierte ihm ständig -, kurvte er lieber stundenlang in der Gegend herum, als jemanden nach dem Weg zu fragen. Es schien ihm gleichgültig zu sein, ob er sein Ziel erreichte oder nicht.
Jack Walton hingegen plante jeden seiner Schritte im voraus. Seine Zeit war genau eingeteilt, bis auf die Minute. Jeder erledigte Punkt auf seinem Terminkalender wurde ordentlich durchgestrichen. Wenn Jack irgendwohin mußte, sei es in einen anderen Ort oder auch nur in einen anderen Stadtteil, dann nahm er am Abend zuvor die Straßenkarte zur Hand und suchte sich die beste Route heraus. Alle zwei Jahre kaufte er einen neuen Wagen, immer einen weißen und stets ein amerikanisches Modell. Jack kam nie zu spät. Mark hatte Gail schrecklich nervös gemacht. Bei Jack fühlte sie sich geborgen. Das Gefühl der Sicherheit schätzte Gail mehr als alles andere in ihrem Leben. Carol, ihre Schwester, war das genaue Gegenteil. Sie ähnelte Mark, und Gail hatte oft gedacht, ihr erster Mann wäre mit ihrer jüngeren Schwester gewiß glücklicher geworden als mit ihr. Carol hatte Mark zwar angehimmelt, war aber zu rastlos gewesen, um die fünf Jahre auszuharren, die es dauerte, bis Gails Ehe zerbrach. Sie war nach New York gezogen, hatte erst mit einem Maler zusammengelebt, dann mit einem anderen, war später auf Tänzer übergewechselt und schließlich – vermutlich aus schierer Lust an Extremen – bei einem Börsenmakler gelandet. Mit ihm wohnte sie nun schon zwei Jahre zusammen. Mark hatte vor drei Jahren wieder geheiratet. Julie war eine wundervolle Frau, die Mark vergötterte und Jennifer wie ihre eigene Tochter behandelte. Auch dafür war Gail dankbar.
Mein Leben, hätte sie den Zeitungsleuten gesagt, die später eine Erklärung von ihr erbetteln wollten, als sie zu schwach und hinfällig war, um ihnen zu antworten, mein Leben ist genauso, wie ich mir’s erträumt habe.
Ihr Tagesrhythmus änderte sich fast nie. Punkt sieben Uhr fünfzehn an jedem Schultag klingelte der Wecker. Es kostete sie keine Überwindung, das Bett zu verlassen. Sie war von Kind an Frühaufsteherin gewesen und liebte den Morgen ganz besonders. Sie duschte, zog sich rasch an und ging hinunter, um das Frühstück zu machen. Jack und die Kinder ließ sie noch ein Weilchen schlafen. Gail genoß diese ersten Minuten des Tages für sich allein. Während sie den Tisch deckte und Kaffee kochte, ließ sie ihre Gedanken treiben. Ohne an etwas Bestimmtes denken zu müssen, entspannte sie sich und schöpfte Kraft für die kommende Stunde, in der sie sich abhetzen mußte, um die Mädchen für die Schule fertigzumachen.
Vor allem Jennifer machte ihr Mühe. Wie die meisten Teenager drückte sie sich abends vor dem Zubettgehen und war morgens kaum wachzukriegen, gleichgültig, wie lange Gail sie schlafen ließ. Wenn sanftes Schütteln und Rufen nichts fruchteten, mußte Gail ihre älteste Tochter buchstäblich aus dem Bett zerren. Erst wenn sie wie eine zerzauste Puppe am Boden lag, öffnete Jennifer widerstrebend die Augen.
Cindy bereitete ihrer Mutter wesentlich weniger Schwierigkeiten. Seit sie ein Baby war, hatte sie sich in jeder Beziehung leichter lenken lassen als Jennifer. Gail brauchte ihr nur sanft über die Stirn zu streichen, und schon schlug das Kind die großen blauen Augen auf. Cindy reckte sich, und ihre warmen Ärmchen umfingen zärtlich den Nacken der Mutter. Dann galt es, etwas zum Anziehen auszusuchen. Aber was Gail auch vorschlug, sie stieß regelmäßig auf Protest. Denn so unproblematisch Cindy ansonsten war, sobald es um ihre Kleidung ging, hatte sie einen unbeugsamen Dickkopf. An vielen Tagen hoffte Gail insgeheim, Cindys Lehrerin möge erraten, daß die Kleine sich ihre Sachen selbst aussuchte und daß ihre Mutter weder farbenblind noch eine überspannte Exzentrikerin sei. Heute bestand Cindy, obwohl es recht warm war, darauf, ein purpurrotes Samtkleid anzuziehen, das sie von den Großeltern geschenkt bekommen hatte und das ihr inzwischen mindestens eine Nummer zu klein war. Als Gail ihr erklärte, sie habe das Kleid in letzter Zeit doch nicht mehr tragen wollen, eben weil sie herausgewachsen sei, blickte Cindy ihre Mutter unverwandt an, schob die Unterlippe vor und wartete auf Gails unvermeidliche Kapitulation.
Jack stand inzwischen unter der Dusche, und der Kaffee war fertig. Beim Frühstück ging es stets geräuschvoll zu. Jack und die Kinder waren in Eile, und wenn die drei um halb neun das Haus verließen, goß Gail sich noch eine Tasse Kaffee ein und gönnte sich eine Verschnaufpause mit der Morgenzeitung, ehe sie die Küche aufräumte und hinaufging, um die Betten zu machen. Jack setzte die Kinder auf dem Weg zur Arbeit ab. Beide Schulen lagen in der Nachbarschaft, und so kamen die Mädchen zu Fuß heim, Cindy immer in Begleitung einer Klassenkameradin und deren Kindermädchen. Wenn die beiden gegen halb vier nach Hause kamen, wartete Gail schon auf sie. Eine halbe Stunde konnte sie mit den Mädchen besprechen, was sie in der Schule erlebt hatten. Dann begann ihr Klavierunterricht.
Die Zeit, in der ihre Töchter in der Schule waren, verbrachte Gail so wie die meisten Hausfrauen des Mittelstandes. Sie machte Besorgungen, führte Telefonate, kaufte Lebensmittel ein, ging gelegentlich zum Friseur, traf sich mit einer Freundin zum Mittagessen, erledigte auf dem Heimweg noch einiges, bereitete zu Hause das Abendbrot vor und wartete auf die Rückkehr ihrer Familie. Hätte man sie aufgefordert, ihr Leben zu beschreiben, wie es gewesen war, bis sie an jenem sonnigen Aprilnachmittag um genau siebzehn Minuten nach vier in den Tarlton Drive einbog, so hätte Gail Walton sich als typische Vertreterin der amerikanischen Durchschnitts-Hausfrau bezeichnet: mittleren Alters, Angehörige der Mittelschicht und von neutraler Gesinnung. Ihr war durchaus bewußt, daß praktisch all ihre Freunde eine solche Charakterisierung scheuen würden, und doch umfaßte sie alle Elemente eines Lebensstils, in dem Gail sich geborgen fühlte.
Sie empfand keine Sehnsucht nach ewiger Jugend. Ihre Mädchenjahre hatte sie nicht gerade in bester Erinnerung. Da sie schüchtern war und einen flachen Busen hatte, war sie von den umschwärmten Cliquen in ihrer Schule nie akzeptiert worden. Die Jungen, die Gail anhimmelte, behandelten sie wie Luft. Erst seit sie über dreißig war, fühlte Gail sich wirklich wohl in ihrer Haut. Sie war vermutlich die einzige aus ihrem Bekanntenkreis, die sich auf ihren vierzigsten Geburtstag freute. Jedenfalls war ihr bisher die mid-life-crisis erspart geblieben, unter der all ihre Nachbarn zu leiden schienen. Sie war weder von ihrem Schicksal frustriert, noch langweilte sie ihr ruhiges, nicht sonderlich abwechslungsreiches Leben. Gail war belesen, hielt sich über aktuelle Ergebnisse auf dem laufenden und gewann zusehends Vertrauen in ihre Fähigkeit, bei jedem Gespräch mithalten zu können. Sie gehörte keiner Partei an. Weder die Unruhen der sechziger Jahre noch der Vietnamkrieg hatten sie ins Fahrwasser der Radikalen zu ziehen vermocht, was wohl an ihrer Schüchternheit lag und an einer angeborenen Abneigung gegen harte Konfrontation und Ausschreitungen. Den einzig extrem anmutenden Schritt ihres Lebens hatte Gail unternommen, als sie das College im Jahr vor der Abschlußprüfung verließ, um Mark Gallagher zu heiraten. Sie bedauerte es oft, keinen akademischen Grad zu besitzen, allerdings nicht genug, um zurück auf die Universität zu gehen und das Versäumte nachzuholen. Sie gehörte keinem Club und keiner Kirche an. Sie respektierte das Recht eines jeden, nach eigener Fasson selig zu werden, und erwartete von den anderen die gleiche Rücksichtnahme für sich. Ihre Freunde bewunderten ihren inneren Frieden und ihre heitere Gelassenheit. Man sah in ihr die Verkörperung des wohltuenden Normalmaßes, fragte sie um Rat, verließ sich auf ihren gesunden Menschenverstand. Ihren Bekannten vermittelte Gail die beruhigende Gewißheit, die Welt könne durchaus in Ordnung sein, und ein anständiger Mensch erhalte seinen gerechten Lohn auf Erden. Hätte man sie aufgefordert, ihr seelisches Befinden in einem Wort zusammenzufassen, so hätte Gail Walton den Begriff »zufrieden« gewählt. Sie repräsentierte heute all das, was sie immer hatte sein wollen.
Doch um siebzehn Minuten nach vier an einem besonders warmen, sonnigen Aprilnachmittag wurde alles anders.
2
Sie sah die Polizeiautos, als sie um die Ecke bog, und wußte instinktiv sofort, daß sie vor ihrem Haus hielten. Panik ergriff sie. Die Tüten und Päckchen entglitten ihren Händen. Gail stand wie angewurzelt und starrte auf die Wagen. Sie hielt den Atem an, zog den Bauch ein und drückte den Rücken durch. Im nächsten Moment rannte sie aufs Haus zu. Vergessen waren ihre Einkäufe; sie sah nur die Polizeiautos. Ihre Armbanduhr zeigte siebzehn Minuten nach vier. Für sie stand in diesem Augenblick die Zeit still.
Später, viel später, als das Beruhigungsmittel, das man ihr gegeben hatte, zu wirken begann und ihre Gedanken zwischen Traum und Wirklichkeit schwebten, ging ihr wieder und wieder der Verlauf dieses Tages durch den Sinn. Sie überlegte, was hätte anders sein können, und spürte, daß es ihre Schuld war. Sie hatte die Routine durchbrochen.
Morgens, gleich nachdem Jack und die Mädchen gegangen waren, hatte Lesley Jennings Mutter angerufen. Lesley habe sich die halbe Nacht lang übergeben. In der Schule grassiere ein Virus, da habe das Kind sich wohl angesteckt. Leider könne sie heute nicht zur Klavierstunde kommen. Gail hatte die junge Mutter getröstet. Ihr fiel ein, wie sie sich früher aufgeregt hatte, wenn Jennifer einmal krank war, während sie jetzt bei Cindy die Ruhe selbst blieb. Der jungen Frau gab sie den Rat, den die besorgte Mutter gewiß auch schon vom Kinderarzt bekommen hatte: Lesley solle im Bett bleiben, keine feste Nahrung zu sich nehmen, aber möglichst viel trinken. Mrs. Jennings schien dankbar für den Rat und gestand schuldbewußt, daß sie verzweifelt nach einem Babysitter für ihre Kleine suche, weil sie unbedingt ins Büro müsse. Gail verwies sie an die Tochter einer Freundin, die vor kurzem mit der Schule fertig geworden war und sich bestimmt gern ein paar Dollars nebenher verdienen würde. Wieder bedankte Mrs. Jennings sich überschwenglich und wünschte Gail, ihre Kinder mögen von dem Grippevirus verschont bleiben, der anscheinend durch alle Schulen Livingstons geistere. Wahrscheinlich war der viele Regen in letzter Zeit schuld daran. Es sei wirklich typisch für ihre Tochter, sich ausgerechnet jetzt anzustecken, wo das Wetter sich endlich bessere. Kinder sind eben regelrechte Brutstätten für Viren, dachte Gail, als sie auflegte.
Es war ein herrlicher Tag, viel zu schön, um ihn im Haus zu verbringen. Spontan griff sie erneut nach dem Telefonhörer und rief Nancy Carter an, die flatterhafteste unter ihren Freundinnen. Gail bezweifelte, daß je ein ernsthafter Gedanke ihren oberflächlichen Sinn getrübt hatte. Nancy war zweiundvierzig. Ihr Mann hatte sie vor fünf Jahren wegen einer jüngeren Frau verlassen, und seitdem verbrachte Nancy einen Teil des Tages bei ihrer Masseuse und den Rest im Tennisclub. Sie war der geborene Käufertyp und kannte kein größeres Vergnügen, als Geld auszugeben, besonders das ihres Exmannes. Sie befaßte sich mit Astrologie, okkulten Wissenschaften und E. S. P. Nancy behauptete zwar, sie könne in die Zukunft blicken, doch als ihr Mann ihr damals eröffnet hatte, er wolle sie verlassen, um mit seiner Maniküre zusammenzuleben, da war sie als einzige aus ihrem Freundeskreis völlig überrascht gewesen. Ihre Zeitungslektüre beschränkte sich auf die Klatschspalten. Sie wäre wohl kaum in der Lage gewesen, einen der beiden Senatoren zu benennen, die ihren Heimatstaat in Washington vertraten, aber sie kannte die intimsten Details aus Dustin Hoffmans Privatleben und sämtliche Skandale der sensationslüsternen Joan Collins. Gails Freundin Laura klagte häufig über Nancys mangelnden Tiefgang, doch Gail fand ihre Oberflächlichkeit und Ichbezogenheit eher amüsant, und die strahlende Sonne heute lud förmlich ein zu einer unbeschwerten Plauderei beim Schaufensterbummel. Die Mädchen brauchten etwas Leichtes zum Anziehen. Na, und ich auch, dachte Gail. Nancy war auf dem Sprung, als Gail anrief. Sie hatte einen Termin bei ihrem Therapeuten. Die beiden Frauen verabredeten sich zum Lunch im »Nero«.
Es wurde ein vergnügliches Essen. Gail brauchte nicht viel zur Unterhaltung beizutragen. Sie saß nur lächelnd da und hörte Nancy aufmerksam zu. Wenn sie mit etwas, das Nancy behauptete, nicht einverstanden war, so behielt sie es für sich. Nancy interessierte sich sowieso nicht für die Meinung anderer Leute, sondern nur für ihre eigene. Während Nancy Carter wortreich von ihrer Sitzung beim Therapeuten berichtete, dachte Gail, ihre Freundin sei wohl egozentrischer als alle Frauen, die sie kannte. Gleichgültig, wovon die Rede war oder was auf der Welt geschah, Nancy fand stets einen Weg, es auf sich zu beziehen. Als das Gespräch auf Indira Gandhi kam und man die unsichere politische Lage diskutierte, in der sich die indische Regierungschefin befand, sagte Nancy: »Also ich weiß, wie ihr zumute ist. Mir ging’s haargenau so, als ich für das Präsidentenamt in meinem Club kandidierte.« Ihre Ichbezogenheit war ihr größter Charakterfehler, machte in Gails Augen aber auch ein Gütteil ihres Charmes aus. Ihre Freundin Laura hingegen nahm Anstoß daran. Sie verdrehte ständig vor Empörung die Augen, wenn sie zu dritt zusammen waren. Doch Gail hatte gelernt zu akzeptieren, daß man mit Nancy Carter nur über Nancy Carter sprechen konnte.
Gail hörte sich an, daß Nancys Therapeut ihre Depressionen auf Schmerzen an der Wirbelsäule zurückführe (ohne die Freundin mit dem Hinweis zu unterbrechen, daß die meisten Menschen über Vierzig mit einem Rückenleiden zu kämpfen hätten). Mochten die Fehler ihrer Freunde noch so zahlreich sein, Gail wußte, daß man an ihr gegebenenfalls ebenso viele finden könnte. Wie in der Ehe, so kam es letztlich auch in einer Freundschaft darauf an, den Partner mit all seinen Schwächen zu akzeptieren, wenn man die Beziehung nicht gefährden wollte. Wer dazu nicht in der Lage war, der mußte lernen, allein zu leben. Gail war noch nie gern allein gewesen. Am wohlsten fühlte sie sich als Mitglied einer Familie. Nancy hatte sie nach Short Hills, ein exklusives Geschäftsviertel, geschleppt. Sie bummelten von Boutique zu Boutique, angeblich auf der Suche nach Kleidern für Gails Töchter, aber Gail merkte bald, daß Nancy schon nach wenigen Minuten in der Kinder- und Jugendabteilung unruhig wurde und erst dann wieder bei Laune war, wenn sie für sich etwas zum Anprobieren fand. Die Zeit verstrich wie im Flug. Als Gail auf ihre Armbanduhr sah, stellte sie erschrocken fest, daß es schon nach drei war. Da sie unmöglich vor ihren Kindern zu Hause sein konnte, rief sie in Jennifers Schule an und ließ ihr ausrichten, sie solle gleich nach dem Unterricht heimgehen und auf Cindy warten. Erst als Nancy sich verabschiedete, weil sie um halb vier einen Termin beim Friseur hatte, konnte Gail in Ruhe etwas für sich und die Kinder aussuchen. Sie war nicht mit dem Wagen in die Stadt gefahren, und das herrliche Wetter verlockte sie dazu, einen Teil des Heimwegs zu Fuß zurückzulegen. Es war Viertel nach vier durch, als sie in ihre Straße einbog. Normalerweise wäre sie um halb vier zu Hause gewesen. Normalerweise hätte sie die Kinder bei ihrer Rückkehr von der Schule daheim erwartet. Normalerweise wäre sie jetzt schon zur Hälfte mit der Klavierstunde fertig und würde im Geiste das Wochenende der Familie planen. Aber sie war von ihrer Routine abgewichen.
»Was ist hier los?« rief sie und versuchte aufgeregt, den Polizeikordon vor ihrer Haustür zu durchbrechen.
»Tut mir leid, Sie dürfen da nicht rein«, sagte ein Beamter zu ihr.
»Aber das ist mein Haus! Ich wohne hier.«
»Mom!« schrie Jennifer von drinnen.
Die Haustür flog auf, und Jennifer warf sich unter hysterischem Schluchzen in die Arme ihrer Mutter.
Gail überlief es eiskalt, dann wurden ihre Glieder taub. Wo war Cindy?
»Wo ist Cindy?« Ihre eigene Stimme klang fremd in ihren Ohren.
»Mrs. Walton«, ertönte eine Stimme neben ihr, »ich glaube, wir sollten hineingehen.« Sie spürte einen Arm um ihre Schulter und fühlte, wie jemand sie über die Schwelle zog.
»Wo ist Cindy?« wiederholte sie ihre Frage, diesmal etwas lauter.
Der Mann führte sie ins Eßzimmer und schob sie auf das grünrosa gemusterte Sofa. »Wir haben Ihren Gatten verständigt. Er ist schon unterwegs.«
»Wo ist Cindy?« Gails Augen suchten den Blick ihrer älteren Tochter. Ihr Schrei gellte durchs Zimmer: »Wo ist sie?«
»Sie ist nicht heimgekommen.« Jennifer weinte hilflos. »Ich bin von der Schule gleich nach Haus gegangen, so wie du’s gesagt hast. Ich hab’ hier auf sie gewartet, aber sie kam nicht. Da hab’ ich bei Mrs. Hewitt angerufen und gefragt, ob Linda schon daheim sei. Das Kindermädchen war dran. Sie sagte, Linda sei’s in der Schule schlecht geworden, und sie habe sie schon früher abholen müssen. Sie habe versucht, dich anzurufen, aber bei uns habe sich keiner gemeldet.«
»Sie muß sich verlaufen haben«, stieß Gail hervor. Sie verdrängte die Erkenntnis, daß es in ihrem Haus nicht vor Polizisten wimmeln würde, wenn ihre kleine Tochter sich bloß auf dem Heimweg verirrt hätte. »Sie ist sonst nie allein nach Haus gekommen. Ich hätte ihr das nicht erlaubt.«
»Mrs. Walton«, sagte der Mann neben ihr leise, »können Sie uns beschreiben, was Ihre Tochter anhatte, als sie heute morgen zur Schule ging?«
Gails Blick wanderte unruhig durchs Zimmer, während sie fieberhaft überlegte, was Cindy heute früh angezogen hatte. Sie sah nur das dunkelblonde Haar vor sich, das dem Kind über die Stirn und bis in die Augen hing. Sie hatte sich vorgenommen, den Pony zu schneiden, ehe er so lang wurde, daß Cindy nicht mehr richtig sehen konnte. Sie sah die lachenden blauen Augen, die zarte, feingeschwungene Wangenlinie, die anstelle der Pausbacken getreten war, und den kleinen, vollen Mund, in dem die beiden unteren Vorderzähne fehlten. Das purpurrote Samtkleid war mindestens eine Nummer zu klein. »Sie trug ein rotes Samtkleid, vorn mit Smokarbeit verziert und mit’nem weißen Spitzenkrägelchen. Ich hab’ ihr gesagt, es sei zu klein, und außerdem sei’s heute zu warm für Samt, aber wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, ist alles Reden zwecklos. Also hab’ ich nachgegeben und sie das Kleid anziehen lassen.« Sie stockte. Warum hatte sie den Polizisten das alles erzählt? Sie konnte an ihrem Gesichtsausdruck ablesen, daß sie sich nicht dafür interessierten, ob Cindy der Witterung gemäß angezogen war oder nicht. »Sie trug weiße Kniestrümpfe und rote Schuhe«, fuhr Gail fort. »Ihre Sonntagsschuhe. Sie mochte weder Ballerinas noch welche zum Schnüren. Nur Schnallenschuhe. Sie trug auch nie Hosen, sondern immer Kleider und Röcke. Sie war ein sehr weibliches kleines Mädchen.« Gail hielt sich den Mund zu vor Schreck über das, was sie gerade gesagt hatte. Sie war ein sehr weibliches kleines Mädchen. Sie hatte über ihre Tochter in der Vergangenheitsform gesprochen. »O mein Gott!« Sie stöhnte, sank in die Kissen zurück und wünschte, das alles wäre nur ein Traum. »Wo ist mein Kind?« Ihre Stimme war kaum verständlich und schien von weit her zu kommen.
Die Haustür wurde geöffnet, und plötzlich war Jack neben ihr, nahm sie in die Arme und streifte mit den Lippen ihre Wange. »Weiß man schon Genaueres?« fragte er.
»Worüber?«
Der Beamte, der sie hereingeführt hatte, setzte sich jetzt auf einen Stuhl ihr gegenüber. Gail blickte ihm ins Gesicht, und es überraschte sie, wie jung er war. »Vor etwa einer halben Stunde wurde die Leiche eines Kindes gefunden. Und zwar in den Anlagen bei der Riker-Hill-Schule.« Er bemühte sich um einen neutralen Ton. »Ein paar Jungs haben sie auf dem Heimweg nach der Schule entdeckt. Sie nehmen jeden Nachmittag die Abkürzung durch den Park. Heute hörten sie merkwürdige Geräusche aus einem Gebüsch. Dann sahen sie jemanden davonrennen. Sie schauten nach und stießen auf die Leiche des Mädchens.« Er hielt inne, so als erwarte er, Gail würde etwas sagen. Aber sie schwieg, den Blick starr auf den sandfarbenen Webteppich zu ihren Füßen gerichtet. »Grade als wir die Unglücksstelle erreichten, kam Ihre Tochter die Straße runtergelaufen. Sie suchte ihre kleine Schwester. Wir haben sie nach Hause gebracht und Ihren Mann angerufen. Sie konnten wir ja nicht erreichen.« Er stockte wieder. »Wir wissen nicht genau, ob’s Ihre Tochter ist, Mrs. Walton. Wir wollten es Jennifer nicht zumuten, die Leiche zu identifizieren...«
Gail hörte Jennifer schluchzen, streckte die Arme aus, zog das zitternde Mädchen an sich und wiegte sie auf ihrem Schoß wie ein Baby.
»Wo ist das Kind... die Leiche?« korrigierte Jack sich hastig. Gail spürte die Spannung in seiner Stimme und wußte, daß er seine Angst vor ihr und ihrer Tochter zu verbergen suchte.
»Unten auf’m Revier«, antwortete der Beamte. »Wir möchten Sie bitten, mitzukommen, und wenn möglich die Leiche zu identifizieren.«
Gail blickte ihn an und wunderte sich, daß Polizisten tatsächlich Dinge sagten wie »unten auf’m Revier«.
»Aber Sie sind nicht sicher, daß es Cindy ist?« Jacks Worte klangen mehr wie eine Feststellung als eine Frage.
Gail beeilte sich, ihm beizuspringen. »Bloß weil sie verschwunden ist, weil sie sich auf dem Heimweg verlaufen hat, muß doch die Leiche, die Sie gefunden haben, nicht...« Sie brach ab. Das Sprechen schmerzte zu sehr, es war, als stieße ihr jemand ein Messer in die Brust.
»Wie wurde dieses kleine Mädchen umgebracht?« fragte Jack.
Gail versuchte vergeblich, die Antwort nicht zu hören.
»Sieht aus, als habe man sie erwürgt. Möglicherweise wurde sie vorher sexuell mißbraucht.« Der Beamte senkte die Stimme, so als merke er, daß seine Sprache zu klinisch wirkte. »Das können wir natürlich erst mit Bestimmtheit sagen, wenn alle Untersuchungen durchgeführt sind.«
Gail schüttelte den Kopf. »Die armen Eltern!« Sie spürte, wie die Tränen, die in ihren Augen brannten, ihr über die Wangen liefen. »Wie furchtbar für sie, wenn sie erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Was für ein schreckliches Unglück!«
»Mrs. Walton!« Die Stimme kam von weit her. »Mrs. Walton.« Mit jeder Nennung ihres Namens entfernte die Stimme sich weiter, bis sie nicht mehr aus demselben Raum zu kommen schien. Es war, als berühre die Hand auf ihrem Arm jemand anderen. »Mrs. Walton«, sagte die Stimme wieder, aber Gail konnte sie kaum noch hören, weil der plötzlich aufbrandende Lärm in ihrem Kopf sie übertönte. »Erkennen Sie das wieder?« fragte die Stimme. Die Hand zwang sie, etwas anzuschauen, das sie nicht sehen wollte, etwas, wovon sie schon vorhin, als ihr Mann das Zimmer betreten hatte, einen flüchtigen Blick erhascht, das wahrzunehmen ihr Gehirn sich jedoch geweigert hatte.
»O mein Gott«, flüsterte Jack und vergrub das Gesicht in den Händen. Seine Schultern zuckten unter dem Schmerz, den er nicht länger zu verbergen suchte.
Gail spürte, wie Jennifers Kopf sich fester an ihre Brust preßte, während sie selbst wie magisch angezogen wurde von der ausgestreckten Hand des Polizisten, die das schlammbespritzte rote Samtkleid emporhielt. Sie versuchte zu sprechen, aber sobald sie ein Wort formte, schoß wieder dieser brennende Schmerz durch ihren Körper, und es kam ihr vor, als werde das unsichtbare Messer tiefer in ihren Körper gestoßen. Sie blickte an sich hinunter und sah das Messer ihren Leib durchtrennen, wie ein Reißverschluß, der eine Jacke öffnet. Sie beobachtete, wie die Innereien herausquollen, und wartete ungeduldig auf ihr Ende. Aber sie wurde bloß ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kam, erlangte sie das Bewußtsein nur für einen Augenblick. Dann gab der Arzt ihr ein Beruhigungsmittel.
3
Die nächsten Tage wanderten an Gails umnebeltem Geist vorbei wie Szenen aus einem Theaterstück während der ersten Kostümproben, bei denen die Markierungen noch nicht genau stimmen und die Schauspieler den Text noch nicht einwandfrei beherrschen.
Schauplatz der Handlung war ein kleines Zimmer auf der Privatstation des St.-Barnabas-Krankenhauses. Die cremefarbenen Wände waren mit hübschen Drucken geschmückt. Ein großer Blumenstrauß prangte auf dem Fensterbrett. In der Mitte der Bühne stand ein modernes Klinikbett. Die gestärkten weißen Laken und die sorgfältig aufgeschüttelten Kissen setzten zwar einen etwas strengen Akzent, kreierten jedoch genau die richtige Atmosphäre. Mehrere Schauspieler in Arztkitteln und Schwesternuniformen machten viel Aufhebens um die Hauptperson im Bett. Sie wischten ihr den Schweiß von der Stirn, kontrollierten die Temperatur, setzten Spritzen oder gaben ihr Tabletten. Sie landeten immer wieder einen Versprecher, wenn sie ihre Beileids- oder Trosttexte hersagten, konnten manchmal ihre Tränen nicht zurückhalten und mußten sich für eine Weile in die Kulisse zurückziehen, ehe sie von neuem geschäftig über die Bühne eilten.
Ihr galt all diese Aufmerksamkeit. Sie war die zweite Besetzung, die widerstrebend für die Hauptdarstellerin hatte einspringen müssen. Sie war völlig unvorbereitet auf diese Rolle, eingeschüchtert von ihrem neuen Rang und sprachlos, obwohl sie anscheinend den besten Text hatte und alle anderen nur darauf zu warten schienen, daß sie das Stichwort gab.
»Was ist das?« stammelte sie mühsam, als vor ihren Augen plötzlich eine ausgestreckte Handfläche erschien.
»Valium. Nehmen Sie es, das entspannt.«
Gail nahm die Tabletten. Die Schauspielerin in der weißen Schwesterntracht zog anscheinend zufrieden ihre Hand zurück und ging nach links von der Bühne ab. Sie stieß mit einem distinguiert wirkenden Schauspieler im weißen Kittel zusammen, der kam, um Gails Puls zu fühlen.
Gail schloß die Augen. Als sie sie wieder aufschlug, saß Jack neben ihr. Er hatte seine Hand durch die Gitterstäbe vor ihrem Bett geschoben und umklammerte ihre Finger. Sie spürte, wie sehr er sich bemühte, seine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen. Doch die Spannung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Wangen waren aufgedunsen, seine Augen starrten ins Leere. Auf der fahlen, käsigen Haut leuchteten hektische rote Flecke, die aussahen wie verrutschte Schminke. In unregelmäßigen Stößen durchdrang sein Atem die fast unerträgliche Stille. Qualvolle Sekunden lang hörte sie gar nichts, dann folgte eine Anzahl kurzer, schneller Atemstöße rasch aufeinander, so als müsse er sich immer wieder daran erinnern, Luft zu holen. Er räusperte sich mehrmals mechanisch. Als Gail die Augen lange genug offenzuhalten vermochte, um seinem Blick zu begegnen, da starrte er auf etwas, das nur er zu sehen vermochte. Sie wandte sich ab und ließ den Kopf in die Kissen zurücksinken, aus Angst, womöglich seine Vision zu erraten und sie teilen zu müssen.
»Jennifer...?« tastete sie sich vor.
»Ihr geht’s gut. Ihr Vater und Julie kümmern sich um sie.«
»Hast du mit ihr gesprochen?«
»Gestern abend und auch heut früh. Heute morgen fühlte sie sich schon besser. Julie hat bei ihr geschlafen.«
»Das war nett von ihr.« Gails Worte waren ein undeutliches Genuschel. »Julie ist eine nette Frau.« Jack nickte. »Und du, was ist mit dir?«
»Ich hab’ eine von den Tabletten genommen, die der Arzt mir gegeben hatte. Hat leider nicht viel geholfen. Die ganze Nacht hörte ich Cindy nach mir rufen.«
»O Gail...«
»Aber dann muß ich wohl doch für’n paar Minuten eingenickt sein. Jedenfalls war mir auf einmal, als hätte sie um’n Glas Wasser gebeten. Ich hätte drauf schwören können! Du weißt ja, sie hat nachts oft Durst. Ich stand auf, ging ins Bad, drehte den Wasserhahn auf, und als ich nach einem Glas griff, da fiel mir ein...«
»Ich hätte bei dir bleiben sollen«, sagte Gail. »Ich hab’ nichts im Krankenhaus verloren. Du brauchst mich. Jennifer braucht mich. Ich muß hier raus.« Gail versuchte sich aufzurichten. Doch Jack legte ihr seine starken Hände auf die Schultern und drückte sie sanft in die Kissen zurück.
»Du kommst schon früh genug nach Hause. Laß dir noch ᾽nen Tag Zeit. Du mußt erst wieder zu Kräften kommen.«
»Zu Kräften«, wiederholte Gail mechanisch und versuchte, den Sinn der Worte zu erfassen. »Jedesmal, wenn mein Kopf klar wird, steht schon jemand bereit, um mir noch ᾽ne Spritze zu verpassen oder mir’ne Tablette zu geben. Sie reden mir ein, das Zeug würde mir helfen, mich zu entspannen, mich besser zu fühlen. Aber das stimmt nicht. Medikamente ändern gar nichts. Sie zögern das Unvermeidliche bloß hinaus. Sie machen’s den Ärzten und Schwestern leichter, aber nicht mir, auch wenn die Leute sich einbilden, mir zu helfen.« Sie machte eine Pause. Als sie weitersprach, war ihre Stimme nur noch ein Flüstern. »Weißt du, was ich mir die ganze Zeit wünsche?«
»Was denn?«
»Jedesmal, wenn ein Arzt mit ᾽ner neuen Spritze rein kommt, hoffe ich auf einen Fehler im Labor, ein vertauschtes Medikament, eine falsche Dosis. Das kommt vor, weißt du, auch Ärzten unterlaufen Fehler... Bei jeder Spritze hoffe ich, daß es die letzte ist...«
»Gail!«
»Entschuldige.« Gail sah die Angst in den Augen ihres Mannes. »Das hätte ich nicht sagen dürfen. Es war nicht fair dir gegenüber.«
»Ich liebe dich, Gail.«
»Weißt du, was Cindy mich mal gefragt hat? Das ist ungefähr einen Monat her. Sie sagte: ›Mami, wenn wir sterben, können wir’s dann zusammen tun?‹ Aus heiterem Himmel. Einfach so. >Mami, wenn wir sterben, können wir’s dann zusammen tun?< Was hätte ich ihr antworten sollen? Ich hab’ >ja< gesagt. Und dann fragte sie weiter: >Hältst du mich dabei an der Hand?< Und ich hab’ wieder >ja< gesagt. Und sie fragte: >Versprichst du’s mir?<« Gail schwieg eine Weile. »Ich hab’s ihr versprochen. O Gott, Jack!« Ihr Oberkörper wiegte sich hin und her.
Gail hörte in der Ferne Sirenen aufheulen und wiegte sich in ihrem Rhythmus, immer schneller, immer heftiger. Jack trat einen Schritt zurück und machte den weißen Gestalten Platz, die vor ihren Augen verschwammen. Sie merkte auf einmal, daß die Sirenen in ihrem Innern ertönten, und wußte, daß bald wieder eine Nadel aufblitzen würde, um die Menschen um sie herum von diesem furchtbaren Schrei zu erlösen und allen Linderung zu verschaffen, die nicht unmittelbar zu leiden brauchten.
»Sind meine Eltern benachrichtigt worden?« erkundigte sich Gail später bei Jack. Sie wußte nicht, ob es noch derselbe oder bereits ein anderer Tag war.
»Ich hab’ sie angerufen. Sie fliegen heute nachmittag her. Carol ist schon da. Sie wartet zu Hause auf dich. Die Ärzte sind nämlich der Meinung, du solltest im Krankenhaus möglichst wenige Besucher haben, damit du dich nicht überanstrengst.«
»Aber sie ist meine Schwester!«
»Wenn du willst, fahr’ ich sie später her.«
»Von wem sind die Blumen?« Es kostete sie Mühe, ihre Gedanken zu ordnen.
»Die hat Nancy geschickt.«
»Das war nett von ihr.«
»All unsre Freunde haben angerufen und sich erkundigt, wie sie uns helfen können. Laura ist einfach großartig. Sie organisiert alles, sorgt fürs Essen...«
»Was ist mit deiner Mutter?«
»Ich konnte sie bis jetzt noch nicht erreichen. Sie macht’ne Kreuzfahrt in der Karibik. Laura versucht sie aufzuspüren.«
»Ich sollte nach Hause kommen«, wiederholte Gail dumpf. Wie oft hab᾽ ich das in den letzten Tagen schon gesagt? Wie lange bin ich wohl schon hier? überlegte sie. Die vielen Notizblöcke und die gespannten Gesichter fielen ihr ein. »Wo waren die Reporter?«
»Vor unserem Haus, als wir dich ins Krankenhaus brachten. Ein paar lungern immer noch da rum.«
»Was wollen sie denn?«
»Antworten, genau wie wir.«
Gail schloß die Augen.
»Draußen ist jemand von der Polizei«, sagte Jack. »Er möchte mit dir reden. Willst du ihn sehen?«
»Ja.« Gail richtete sich in den Kissen auf und betrachtete den gutaussehenden jungen Mann mit dem hellbraunen Haar, der an ihr Bett trat, ein trauriges Lächeln auf den Lippen.
»Ich bin Lieutenant Cole.« Er zog sich einen Stuhl heran. »Ich war gestern bei Ihnen.«
Was denn, erst gestern? wunderte sich Gail. So viele Träume in der kurzen Zeit? »Haben Sie den Mann gefunden?« fragte sie mit kaum hörbarer Stimme.
»Nein«, antwortete der Kommissar. »Aber die Jungs, die Cindy fanden, konnten uns’ne Beschreibung geben.«
Er sprach sehr behutsam. »Leider ist nicht viel damit anzufangen. Wir haben sogar einen Arzt hinzugezogen, der die Jungen hypnotisierte, aber sie konnten sich lediglich darauf einigen, daß der Kerl aschblondes Haar hatte, schlank und mittelgroß war und einen jugendlichen Eindruck machte.«
»Ist das alles?« fragte Jack.
»Sie haben ihn nur von hinten gesehen. Er trug Bluejeans und eine gelbe Windjacke. Das ist’ne ziemlich vage Beschreibung, die auf mindestens tausend Männer passen könnte, mich eingeschlossen. « Er hielt inne und fuhr dann leise fort: »Oder zum Beispiel auf Ihren Exmann, Mark Gallagher.«
»Mark?« wiederholte Gail ungläubig.
»Darf ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren früheren Mann stellen, Mrs. Walton?«
»Bitte, fragen Sie.« Gail schüttelte die von den Betäubungsmitteln verursachte Lethargie ab. »Aber Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Mark hätte meiner kleinen Tochter nie etwas zuleide getan.«
»Wann wurden Sie von Mr. Gallagher geschieden?«
Gail mußte einen Augenblick nachdenken. »Ach, das ist schon fast dreizehn Jahre her.«
»Macht es Ihnen etwas aus, mir zu sagen, warum Sie sich scheiden ließen?«
»Dafür gab’s viele Gründe. Wir waren sehr jung und sehr verschieden. Mark war noch nicht reif für die Ehe. Er hatte... hatte andere Frauen.« Lieutenant Cole blickte von seinen Notizen auf. »Frauen«, wiederholte Gail. »Keine Kinder. Die Damen, die ihm gefielen, waren in jeder Beziehung erwachsen, das können Sie mir glauben.«
»Wie stand er zu Ihrer neuerlichen Heirat?«
Gail zuckte die Achseln. »Er hat mir Glück gewünscht. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen.«
Jacks Hand umklammerte die ihre.
»Welche Beziehung hat er zu seiner Tochter?«
»Er liebt Jennifer. Er ist ihr ein wundervoller Vater.«
»Wie reagierte er denn darauf, daß Jack seinen Platz einnahm?«
Gail sah ihrem Mann in die Augen. »Ich glaube, anfangs war er ein bißchen beunruhigt. Aber als er merkte, daß Jack keineswegs die Absicht hatte, ihm seine Vaterrolle streitig zu machen, da fand er sich sehr bald mit der neuen Lage ab. Jack und Jennifer kommen prima miteinander aus. Sie lieben sich aufrichtig. Aber Mark ist ihr Vater, und das weiß sie auch.«
»Wie reagierte Mark, als Sie von Ihrem jetzigen Mann ein Kind bekamen?«
Gail versuchte sich zu erinnern. »Ich weiß nicht mehr«, sagte sie schließlich. »Ich glaube nicht, daß es ihn sonderlich berührt hat.«
»War er nicht eifersüchtig?«
»Nicht daß ich wüßte. Warum sollte er auch?«
»Sie haben also nicht den Eindruck, daß er Rachegefühle hegte?«
»Rache? Wofür? Ich versteh’ nicht, worauf Sie hinauswollen.«
»Reg dich nicht auf, Gail«, versuchte Jack sie zu beschwichtigen.
»Was meint er denn nur?« Gail wandte sich an ihren Mann, so als sei der Kommissar gar nicht anwesend.
»Ihr Exmann hat für die Zeit der Ermordung Ihrer Tochter kein Alibi«, sagte Lieutenant Cole sachlich.
»Er braucht doch kein Alibi!« protestierte Gail schwach, während sie versuchte, diese Information zu verarbeiten.
Lieutenant Cole blätterte in seinen Aufzeichnungen. »Er hat zu Protokoll gegeben, daß er zwischen zwei und drei Uhr nachmittags eine Dame in West Orange fotografiert habe. Sein nächster Termin war um vier. Er sollte Zwillinge aufnehmen, nicht weit von Ihrem Haus.« Er machte eine Pause, damit die Fakten sich ihrem Gedächtnis einprägten. »Man braucht keine Stunde von West Orange nach Livingston.«
»Sie verschwenden Ihre Zeit, Lieutenant.« Gail fühlte ihre Augenlider schwer werden.
»Was wissen Sie über Jennifers Freund?«
»Eddie?« Jacks Erstaunen rüttelte sie wieder wach.
»Eddie Fraser«, las Lieutenant Cole laut und deutlich aus seinem Notizbuch vor. »Sechzehn Jahre alt, Obersekundaner, Einserschüler.«
»Eddie und Jennifer gehen in dieselbe Klasse«, ergänzte Jack.
»Seit fast einem Jahr sind die beiden befreundet.«
»Um Gottes willen, so glauben Sie mir doch! Eddie hat’s nicht getan.« Gail wimmerte. Sie spürte, wie die aufsteigende Angst ihr Herz umklammerte. »Sie vergeuden wertvolle Zeit. Eddie ist ein netter Junge, ein gewissenhafter Schüler. Er möchte Arzt oder Rechtsanwalt werden. Er ist unheimlich verknallt in Jennifer. Und er hat unsere Cindy sehr lieb.«
Sie brach unvermittelt ab.
»Haben Sie je etwas Ungehöriges an seinem Verhalten Cindy gegenüber bemerkt?«
»Ungehörig? Was meinen Sie damit?«
»Hat er das Kind je auf eine Weise angesehen, die Ihnen Unbehagen verursachte? Wenn die beiden miteinander spielten oder sich balgten, haben Sie da jemals beobachtet, daß er ihre Beine streichelte? Hat er ihr vielleicht mal einen Klaps auf den Po gegeben und vergessen, die Hand zurückzuziehen? Oder...«
»Aufhören! Hören Sie sofort auf damit! Das ist doch Wahnsinn. Eddie hätte Cindy nie was Böses getan. Er ist ein netter, lieber Junge, immer höflich, immer zuvorkommend und hilfsbereit.« Gail blickte zu Jack auf. »Ist es nicht so?« Jack nickte schweigend.
»Wir haben Eddie gern, und er mag uns auch. Na ja, anfangs waren wir nicht begeistert über eine so enge Freundschaft, einfach weil die Kinder noch so jung sind. Wir dachten, es sei zu früh für Jennifer, sich auf einen bestimmten Jungen zu kaprizieren. Aber als wir Eddie näher kennenlernten, gefiel er uns so gut, daß wir zu der Ansicht gelangten, sie könne es wesentlich schlechter treffen. Und das wird sie vielleicht in den nächsten Jahren auch. Denn man darf nicht vergessen, daß die beiden erst sechzehn sind. Wir wollten ihre... ihre Leidenschaft«, sie stockte, »nicht durch ein Verbot steigern. Aber wir stellten den beiden gewisse Bedingungen. Sie dürfen nicht unter der Woche miteinander ausgehen, und Freitag- und Samstagabend muß Jennifer spätestens um eins zu Hause sein. Eddie hat sich stets an unsere Abmachungen gehalten. Wir hatten nie Ärger mit ihm. Verstehen Sie denn nicht?« Sie wandte sich dem jungen Kommissar zu. »Eddie kann’s nicht gewesen sein. Er liebte Cindy wie seine eigene Schwester. Ich weiß, daß er nur in diesem Sinne an sie gedacht hat.«
»Er hat für die fragliche Zeit kein Alibi«, wiederholte Lieutenant Cole das Argument, das er zuvor gegen Mark Gallagher ins Feld geführt hatte. »Er will nach der Schule direkt nach Hause gegangen sein, um sich auf eine Klassenarbeit vorzubereiten.«
»Wenn er das gesagt hat, dann war’s auch so«, versicherte Gail.
»Leider war zur fraglichen Zeit niemand sonst im Haus, der seine Anwesenheit bezeugen könnte.«
»Das ist doch einfach lächerlich.« Gail schloß die Augen. Sie würde sich keine Fragen mehr anhören, ehe der Kommissar nicht bereit war, ihre Antworten zur Kenntnis zu nehmen. Eddie war kein Kinderschänder. Und ein Mörder erst recht nicht. Genausowenig wie Mark Gallagher. Die Polizei verplemperte ihre Zeit, statt draußen nach dem Täter zu suchen.
»Was tun Sie, um den Mörder zu finden?« Sie wußte instinktiv, daß es der nächste Morgen war, als sie diese Frage stellte. Sie wußte es, obwohl niemand sich vom Fleck gerührt zu haben schien. Die Sonnenstrahlen fielen schräger auf den Blumenstrauß am Fenster, die Schwestern wirkten frischer, tüchtiger, ihre Handlungen schienen präziser. Sie bewegten sich so zuversichtlich, als gäbe es wirklich einen Grund dafür. Man hatte vergessen, ihnen zu sagen, daß kein Grund vorhanden war.
Gail hatte den größten Teil der Nacht dem gesichtslosen Mörder ihrer kleinen Tochter gegenübergestanden. Sie hatte ihn töten wollen, es aber nicht fertiggebracht. Sie hatte die Chance verpaßt, den Tod ihres Kindes zu rächen und so wenigstens einen Teil ihrer Schuld abzutragen. Sie wußte, daß es der nächste Morgen war, weil sie sich noch müder fühlte als am Abend zuvor.
»Was tun Sie, um den Mörder zu finden?« wiederholte sie und überlegte, ob der Kommissar ihre Frage beim ersten Mal nicht gehört oder ob sie vielleicht nur in Gedanken gesprochen hatte.
»Wir tun, was in unsrer Macht steht.« Die Beteuerung des Kommissars klang wie eine eingelernte Floskel. »Jeder verfügbare Mann ist auf den Fall angesetzt. Wir haben alle vorbestraften Sexualverbrecher des Staates überprüft. Ihr Mann hat sich bereits die Fotos angesehen, um festzustellen, ob ihm einer von den Kerlen bekannt vorkommt. Wir möchten auch Sie darum bitten, wenn Sie sich wieder etwas kräftiger fühlen.«
»Ich werd’ mir die Bilder jetzt ansehen.«
Er holte bereitwillig einen Stapel Fotos aus der Tasche. Gail betrachtete sorgfältig jedes Gesicht. Einige waren jung, andere nicht, manche wirkten auf den ersten Blick unsympathisch, andere sahen recht gut aus. Keiner kam ihr bekannt vor. Sie gab Lieutenant Cole die Fotos zurück. »Die sind alle so... normal«, sagte sie schließlich verwundert. Sie hatte erwartet, daß man das Böse an den Zügen eines Menschen ablesen könne.
»Wir führen eine Serie von Tests durch«, sagte Lieutenant Cole.
»Tests? Was denn für Tests?«
»Der Mörder hat eine deutliche Fußspur im Schlamm hinterlassen. Davon machen wir’nen Abdruck. Ferner werden Speichel-, Blut- und Samentests vorgenommen.«
Die letzten Worte trafen sie wie ein Schlag in die Magengrube. Der bittere Geschmack in ihrer Kehle wanderte hinauf zum Mund, sie würgte, und im nächsten Augenblick erbrach sie sich in die Schüssel neben ihrem Bett. Binnen Sekunden war eine Schwester neben ihr und hielt ihr den Kopf. Der Kommissar verschwand.
Als sie ein wenig später flach auf dem Rücken lag, Jack ihre Hand hielt und im Zimmer nichts mehr zu hören war außer ihrem Atem, überlegte sie, wieso sie noch am Leben sei, obwohl alles in ihrem Innern abgestorben schien.
Die Journalisten warteten vor dem Krankenhaus auf sie. Wie harte, flinke Kieselsteine schleuderten sie Gail ihre Fragen entgegen, bedrängten sie mit ihren Körpern und mit ihren Kameras.
»Haben Sie irgendeinen Verdacht?«
»Hat die Polizei Ihnen einen Hinweis darauf gegeben, in welche Richtung ihr Verdacht geht?«
»Gibt’s Indizien oder Spuren?«
Wie im Fernsehen, dachte sie und schwieg.
»Wie stehen Sie zur Todesstrafe?«
Jemand antwortete. Später hörte sie in den Nachrichten erstaunt, daß sie selbst es gewesen war, die den Reportern erklärte, sie sei weder blutrünstig noch rachsüchtig, sondern wünsche lediglich, daß der Mörder gefaßt werde. Sie habe vollstes Vertrauen in die Arbeit der Polizei.
Woher hatte ich bloß die Kraft, das zu sagen, überlegte sie.
Sie saßen im Fond des Polizeiwagens, der sie nach Hause brachte. Jack blickte starr hinaus auf die Straße. Er ließ ihre Hand nicht los. Lieutenant Cole saß vorn neben dem Fahrer.
»Ich möchte Sie warnen«, sagte er über die Schulter. »Vermutlich warten vor Ihrem Haus noch mehr Reporter auf Sie.«
Gail nickte schweigend. In Gedanken memorierte sie den Autopsiebefund.
Während sie mit der Vorstellung kämpfte, wie man ihr schönes Kind im Dienste der Wahrheitsfindung seziert hatte, erklärte ihr die Polizei, daß Cindy Walton am dreißigsten April gegen fünfzehn Uhr dreißig von einem unbekannten Täter sexuell mißbraucht und anschließend mit den Händen erdrosselt worden sei; im wesentlichen die gleiche Information, die ihr der Kommissar gegeben hatte, als er noch gar nichts zu wissen glaubte. Nach zwei Tagen war die Polizei ungeachtet aller gegenteiligen Beteuerungen keinen Schritt weitergekommen, hatte noch keine Chance wahrgenommen, den Mörder zu fassen. Man hatte lediglich die Bestätigung dessen erbracht, was alle Beteiligten von Anfang an wußten. Aber der Körper ihrer kleinen Tochter hatte unter dem Messer des Gerichtsmediziners eine weitere Schmach erlitten, die Spur des Mörders war um zwei Tage älter, und entgegen ihrer Stellungnahme vor der Presse war Gail sich ganz und gar nicht sicher, daß man den Täter fassen würde. Der Umstand, daß die beiden Hauptverdächtigen Menschen waren, von deren Unschuld sie überzeugt war, stärkte nicht gerade ihr Vertrauen in die Fähigkeiten der Polizei. Die werden den Mörder nie finden, ging es ihr durch den Kopf; während sie den Blick auf Lieutenant Coles straffe Schultern gerichtet hielt.
Er ist ein netter Kerl; er meint’s gut; er scheint uns wirklich helfen zu wollen. Aber für ihn ist Cindy eben doch bloß ein Fall. Und das ist sie auch für alle anderen, ein trauriges, ja tragisches Ereignis, gewiß, aber kein ungewöhnliches in der heutigen Zeit. Ihr Tod hat die Leute vielleicht berührt, aber ihr Leben hat er nicht verändert. Die Polizei wird tun, was in ihren Kräften steht, aber wenn man’s genau betrachtet: Was können sie schon tun? Sie wußte aus der Presse, daß die Spur eines Mörders nach ein paar Tagen so gut wie verwischt ist. Gail hatte Grund zu der Annahme, daß die Polizei den Täter nicht mehr fassen würde, wenn es ihr bis jetzt nicht gelungen war, ihn zu stellen.
Der Mörder ihrer Tochter war entkommen und bewegte sich frei auf den Straßen der Stadt. Dieser Gedanke zerriß den Nebelschleier, den das zuletzt verabreichte Beruhigungsmittel über ihr Gehirn gebreitet hatte. Das ist die schlimmste Erniedrigung, dachte sie. Aber ich darf es nicht erlauben, niemals! Und in ihrem Kopf formte sich ein Plan: Wenn die Polizei den Mörder ihrer Tochter nicht finden konnte, dann mußte sie es selbst tun.
Gail war nicht sonderlich überrascht von dieser Erkenntnis. Es schien, als habe ihr Unterbewußtsein von Anfang an eine solche Absicht gehegt. Es war im Grunde ganz einfach: Sie würde den Tod ihrer Tochter rächen und den Mörder seiner gerechten Strafe zuführen. Sie würde nicht länger die hilflose Marionette bleiben, als die sie sich in ihren Alpträumen erschienen war.
Aber zuvor werde ich der Polizei eine Chance geben.
Gail lehnte sich an Jack, ließ ihren Körper ausruhen, um neue Kraft zu schöpfen. Sie blickte aus dem Fenster.
Ich werde ihnen sechzig Tage geben, entschied sie.
4
Ihre Familie empfing sie an der Haustür – mit Gesichtern, die an die düsteren Menschendarstellungen auf den Holzschnitten von Edvard Munch erinnerten, Gesichter, die in unbewältigtem Schmerz erstarrten.
»Mom!« Gail taumelte in die Arme ihrer Mutter. Ihre zitternden Körper preßten sich haltsuchend aneinander.
»Mein Liebling!« Gail hörte ihre Mutter schluchzen, doch dann fühlte sie sich von starken Armen fortgezogen.
»Daddy«, seufzte sie. Ihr Vater, ein stattlicher Mann mit sonnengebräuntem Gesicht, preßte sie fest an seine Brust und vergrub den Kopf an ihrer Schulter. Sie spürte am Gewicht seines Körpers, daß sie ihn genauso stützte wie er sie.
»Wie furchtbar«, murmelte er. »Unsere süße kleine Cindy.«
Gail versuchte vergeblich, den Kopf zu bewegen. Ihr Vater hielt sie mit eisernem Griff umklammert. Auf einmal kam sie sich vor wie in einer Zwangsjacke, mit seitlich festgepreßten Armen und unfähig, sich zu rühren. Als sie versuchte, sich zu befreien, schienen die Arme ihres Vaters sich nur noch fester um sie zu schließen. Sie fühlte sich wie ein hilfloses Tier, das langsam von einer Python getötet wird. Bei jedem verzweifelten Atemzug ihres Opfers wand die Riesenschlange sich fester um ihre Beute. Gail bekam keine Luft mehr. Er würgte sie, erdrosselte sie, preßte das Leben aus ihrem matten Körper. Mein Gott, Cindy, war es so? schrie es in ihrem Herzen. Dann riß sie sich mit Gewalt aus den Armen ihres Vaters. Verwirrt starrte er sie an. Schließlich sagte er eindringlich: »Sie werden ihn schon kriegen. Und wenn wir Glück haben, erschießt einer den Dreckskerl. Jawohl, man sollte das Schwein erschießen.«
»Aber Dave.« Die mahnende Stimme ihrer Mutter.
»Sie werden ihn finden«, wiederholte ihr Vater unbeirrt.
»Aber wenn ich᾽s mir recht überlege, ist erschießen zu gnädig für so einen. Dasselbe gilt für die Gaskammer oder den elektrischen Stuhl. Diese Bestie sollte man langsam töten. Man müßte ihm die Eier abschneiden und ihm die Eingeweide mit bloßen Händen aus dem Leib reißen. Ich wäre dazu imstande. Das weiß ich genau!« Seine Stimme versagte. Kraftlos ließ er sich in einen Sessel fallen.
»Grausamkeit bringt uns unsere Cindy auch nicht zurück.« Gails Mutter nahm ihre Tochter tröstend in die Arme.
»Zumindest könnte dieses Schwein seine Tat nicht wiederholen«, schnaubte Gails Vater. »Und seine Visage wäre für immer von dieser Erde verbannt.«
»Ich bin ganz deiner Meinung, Dad.« Die Stimme kam aus der hinteren Ecke des Zimmers. Gail blickte über die Schulter ihrer Mutter in das Gesicht ihrer jüngeren Schwester Carol. Wie bleich und schmal sie war! Die Geschwister fielen sich in die Arme.
»Gail, o Gail, es ist so furchtbar«, schluchzte Carol.
»Carol, daß du da bist!« Gail spürte, wie ihre Glieder taub wurden. Ihre Beine versagten den Dienst. »Ich muß mich setzen«, sagte sie gerade noch rechtzeitig, ehe sie wegsackte. Arme umfingen sie und führten sie zum Sofa, wo emsige Hände ihr Kissen unterschoben und ihren Kopf gegen die Lehne betteten. Als sie wieder zu sich kam, saß sie zwischen Mutter und Schwester. Im Ohrensessel gegenüber dem Sofa erblickte sie ihren Vater. Er hatte das Gesicht in den Händen vergraben.
Jack stand immer noch am Fenster. Er schien unfähig, sich zu rühren. Er hat niemanden, der ihn trösten könnte, dachte Gail. Sein Vater war tot, und seine Mutter, mit der Gail ein herzliches, wenn auch nicht sonderlich enges Verhältnis verband, mußte erst noch gefunden werden. Jack war ein Einzelkind, und jetzt stand er ganz allein. Er hat niemanden außer mir, schoß es Gail durch den Kopf. Sie rutschte zur Seite und streckte die Hand nach ihm aus. Jack setzte sich bereitwillig zwischen sie und ihre Schwester. Aber dann waren es seine Arme, die sie umfingen und trösteten. Typisch Jack, dachte Gail und lehnte ihren Kopf an seine Brust.
Reglos und schweigend saßen sie da. Es gab ja auch nichts zu sagen. Der Fremde im Gebüsch hatte das letzte Wort gehabt.
Es klopfte zaghaft. Lieutenant Cole, den Gail bisher gar nicht bemerkt hatte, öffnete die Tür. Jennifer kam hereingelaufen, und Gail erhob sich gerade noch rechtzeitig, um das Mädchen aufzufangen, das weinend in ihren Armen zusammenbrach. Gail bedeckte die nassen Wangen ihrer Tochter mit Küssen. Dann merkte sie, daß Jennifer nicht allein gekommen war. Mark und Julie, Gails Exmann und seine Frau, sowie Jennifers Freund Eddie hatten ihre Tochter begleitet. Mark und Eddie, dachte Gail mit einem Blick auf den Kommissar. Seine beiden Hauptverdächtigen.
Mark und Julie traten zu ihr, und Mark nahm sie wie selbstverständlich in die Arme. Ich hatte ganz vergessen, daß er soviel größer ist als Jack, dachte Gail. Doch schon nach wenigen Augenblicken spürte sie die gleiche Atemnot, die sie in den Armen ihres Vaters empfunden hatte. Sie machte sich los und wandte sich Julie zu. In ihrer Umarmung fühlte sie sich wohler.
»Wenn wir irgendwie helfen können«, sagte Julie, »dann bitte, laß es uns wissen. Wenn du möchtest, daß Jennifer noch eine Weile bei uns bleibt...«
»Ich danke euch, aber ich glaube, im Augenblick gehört sie nach Hause. Trotzdem, vielen Dank für alles.«
»Hat die Polizei schon was herausgefunden?« Julie blickte sich nach Lieutenant Cole um.
»Die Polizei glaubt, Mark hätt’s getan.« Gail lachte, und alle blickten sie verstört an. War das Lachen wirklich so laut gewesen, wie es in ihren Ohren widerhallte?
Gail wandte sich Jennifers Freund zu. »Und wenn Mark es nicht war, dann du, Duane – sagt die Polizei.« Warum sehen mich auf einmal alle so komisch an? In Gedanken wiederholte Gail ihre Worte. »Ach, Eddie«, korrigierte sie sich eilig. Sie mußte über ihren Irrtum lachen. Ich hab’ gar nicht gewußt, daß unbewußte Assoziationen so lustig sein können, dachte sie. Lieutenant Cole scheint sich gar nicht wohl zu fühlen in seiner Haut. Ob er den Witz verstanden hat, der in meinem Fehler steckte? Oder ist er noch zu jung, um sich an die Zeit zu erinnern, als der Rock’n’ Roll seinen Siegeszug antrat?
Sie wußte nicht, wer sie zurück zum Sofa führte, ihr die Beine hochlegte und ein Kissen unter den Kopf schob. Jemand breitete eine Decke über sie. Man gab ihr ein Glas Wasser. Sie hörte, wie die Haustür sich öffnete und schloß. Es war jemand gegangen, doch ihre Lider waren so schwer, daß sie die Augen nicht öffnen konnte, um zu sehen, wer noch bei ihr war. Sie ließ sich von der Müdigkeit einhüllen, die während der letzten Tage wie ein drohendes Monster in ihren Muskeln gelauert hatte. Ehe sie in bleiernen Schlaf fiel, sah sie als letztes ihren sonnengebräunten Vater vor sich, wie er zusammengesunken in seinem Sessel hockte und zehn Jahre älter wirkte, als sie ihn vom letzten Sommer her in Erinnerung hatte.
Stimmen drangen an ihr Ohr, und sie schlug die Augen auf.
»Hallo«, flüsterte ihre Freundin Laura. Sie versuchte zu lächeln. »Wie fühlst du dich?«
Gail richtete sich auf, schob die Decke weg und setzte die Füße auf den Boden. »Wie spät ist es?« fragte sie. Draußen war es inzwischen dunkel geworden. Ihre Eltern, ihre Schwester und Jennifer waren nicht mehr im Zimmer. Auch der Kommissar war verschwunden. Sie fragte sich, ob sie wohl nur geträumt habe, daß all diese Leute hier in ihrem Wohnzimmer seien.
»So gegen acht«, sagte Jack. »Lieutenant Cole ist schon vor ’ner Weile gegangen. Die andern hab᾽ ich zum Abendessen in ein Restaurant geschickt.«
»Sind die Blumen von Nancy?« fragte Gail mit einem Blick auf das riesige Bukett aus Rosen und Nelken auf dem Teetisch.
Jack nickte.
»Bist du in Ordnung?« fragte Laura.
Gail atmete tief durch. »Ich weiß nicht recht. Ich fühl’ mich wie erstarrt. Wahrscheinlich kommt das von all den Medikamenten, die sie mir gegeben haben.«
»Und vom Schock«, meinte Laura.
Gail nickte schweigend. Ihr Blick irrte ziellos umher und blieb schließlich auf den Blumen haften. Rote Rosen, rosa Nelken.
»Rosa war Cindys Lieblingsfarbe.«
Laura schaute zu Boden. »Meine auch, als ich noch klein war.«
»Wirklich? Genau wie bei mir.« Ein zaghaftes Lächeln spielte um Gails Mundwinkel. »Wahrscheinlich ist es die Lieblingsfarbe aller kleinen Mädchen.«
Die Unterhaltung stockte; das Lächeln verschwand.
»Ist Nancy hier gewesen?« Gails Gedanken wanderten zurück zu den Blumen.
Jack schüttelte den Kopf.
»Du darfst nicht zuviel von Nancy erwarten«, mahnte Laura sanft.
Gail mußte beinahe lachen. »Ich hab’ nie viel von Nancy erwartet. Nancy ist eben Nancy. Jeder muß auf seine Weise mit dem Schmerz fertig werden.«
Lauras Miene wurde ernst. »Wie wirst du denn damit fertig?«
»Ich weiß nicht.« Gail schüttelte nachdenklich den Kopf, erst langsam und dann immer schneller. Plötzlich zog Laura sie in ihre Arme, legte ihr die Hand auf den Nacken und zwang sie mit sanfter Gewalt, den Kopf stillzuhalten. Gails Stirn lehnte an Lauras weicher Baumwollbluse.
»Laß ihn raus«, flüsterte Laura. »Verschließ deinen Schmerz nicht in dir.«