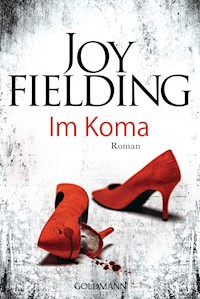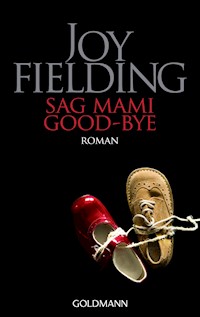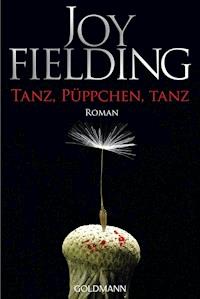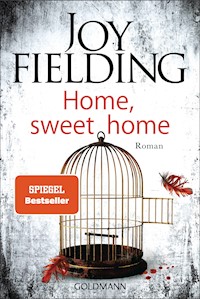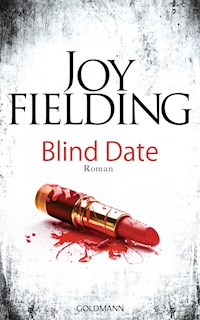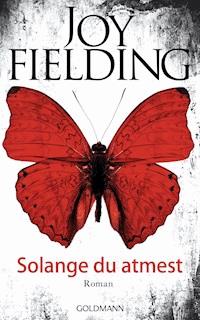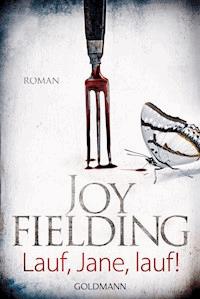
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Albtraum einer Frau beginnt, als sie sich plötzlich blutbefleckt, die Taschen voller Geld und ohne Erinnerungsvermögen auf den Straßen Bostons wiederfindet. Wer ist der Mann, den man ihr als ihren Ehemann vorstellt? Was sind das für Medikamente, die ihr angeblich helfen sollen? Und warum fühlt sie sich als Gefangene im eigenen Haus? Verzweifelt kämpft Jane von nun an um ihr Gedächtnis – es wird ein Kampf auf Leben und Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Für Warren und für Shannon und Annie
2
Sie hätte nicht sagen können, warum sie das Lennox Hotel wählte. Vielleicht weil es eines der ältesten Bostoner Hotels und daher kleiner und irgendwie echter als seine modernen Konkurrenten war oder vielleicht weil schöne Erinnerungen an frühere Aufenthalte noch in ihrem Unterbewußtsein verankert waren; sie wußte es nicht. Es war sogar möglich, daß sie hier schon als Gast eingetragen war, sagte sie sich hoffnungsvoll, als sie zum Empfang ging und, wie zuvor in dem kleinen Laden, um ein Lächeln des Wiedererkennens betete.
Sie mußte warten. Vor ihr war ein Ehepaar mit seinen zwei kleinen Söhnen, flachsköpfigen kleinen Teufeln in Matrosenanzügen, die ihrer Mutter am Rockzipfel hingen und laut klagend dem ganzen Foyer ihr Ungemach mitteilten.
»Ich hab Hunger«, rief der Kleinere, vielleicht vier Jahre alt, und zog seiner Mutter den Rock bis über das Knie in die Höhe, als hätte er die Absicht hineinzubeißen.
»Ich will zu McDonald’s«, assistierte sofort der Bruder, der höchstens ein Jahr älter war.
»McDonald’s, McDonald’s!« Mit diesem Schlachtruf tobten sie um ihre hilflosen Eltern herum, die sich alle Mühe gaben, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung.
»Laßt Mama und Papa erst mal ein Zimmer nehmen, dann suchen wir uns ein schönes Restaurant, hm?« sagte die junge Mutter flehentlich und fixierte ihren Mann mit einem Blick, der ihn drängte, schneller zu machen.
»McDonald’s! McDonald’s!« schallte es augenblicklich.
Aber dann waren die Formalitäten endlich erledigt, die ganze Familie wurde von einem fürsorglichen Pagen zum wartenden Aufzug geführt, und über das Foyer legte sich wieder die Aura eines vornehmen Hotels europäischen Stils.
»Kann ich Ihnen behilflich sein, Madam? – Madam?«
»Oh, entschuldigen Sie«, sagte sie, als sie merkte, daß der junge Mann am Empfang sie meinte. »Ich hätte gern ein Zimmer.«
Er begann schon in seinen Computer zu tippen. »Für wie lange?«
»Ich weiß nicht genau.« Sie räusperte sich einmal, dann noch einmal. »Für wenigstens eine Nacht. Vielleicht zwei.«
»Ein Einzelzimmer?« Er spähte an ihr vorbei, um zu sehen, ob sie allein war, und sie drehte automatisch den Kopf.
»Ja, ein Einzelzimmer. Bitte.« Denk an deine Manieren, sagte sie sich und hätte beinahe gelacht.
»Ich habe ein Zimmer«, sagte der junge Mann, den Blick auf den Bildschirm gerichtet, »zu fünfundachtzig Dollar. Es ist in der achten Etage, Nichtraucher, mit Doppelbett.«
»Wunderbar.«
»Und wie bezahlen Sie?«
»Bar.«
»Bar?« Zum ersten Mal sah der junge Mann sie direkt an. Nie zuvor hatte sie Augen von einem so intensiven Blau gesehen. Glaubte sie jedenfalls. Mit Sicherheit konnte sie es nicht sagen. Gott allein wußte, was sie alles in ihrem Leben gesehen hatte.
»Ist Ihnen Barzahlung nicht recht? Nehmen Sie kein Bargeld?«
»Doch, doch, natürlich. Es kommt nur selten vor, daß jemand bar bezahlt. Die meisten Leute zahlen mit Kreditkarten.«
Sie nickte stumm, dachte, daß sie in ihrem anderen Leben zweifellos auch zu diesen Leuten gehörte, und fragte sich, wie ein Mensch so unglaublich blaue Augen haben konnte.
»Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte der junge Mann irritiert.
»Oh, entschuldigen Sie«, stammelte sie. »Es sind nur ihre Augen. Sie sind so unwahrscheinlich blau.« Dumme Gans, sagte sie sich, der Junge glaubt wahrscheinlich, du willst ihn anmachen.
»Ach, das sind gar nicht meine«, erwiderte er fröhlich und wandte sich wieder seinem Bildschirm zu.
»Wie bitte?« Der Verdacht rührte sich in ihr, daß sie von einem anderen Stern gekommen sei.
»Das sind Kontaktlinsen«, erklärte er unbekümmert. »Zwei Nächte, sagten Sie?«
Es bereitete ihr große Mühe, dem Gespräch zu folgen. Die Panik, die während der Taxifahrt allmählich nachgelassen hatte, kehrte wieder. »Ja, höchstens zwei Nächte. Und dann? Wohin sollte sie gehen, wenn sie dann immer noch nicht wußte, wer sie war? Zur Polizei? Warum war sie nicht gleich dorthin gegangen?
»Bitte füllen Sie mir das noch aus.« Der junge Mann schob ein Blatt Papier über den Tisch. »Name, Adresse und so weiter«, erläuterte er, als er ihre Verwirrung sah. »Ist Ihnen nicht gut?«
Sie holte tief Atem. »Ich bin sehr müde. Ist das denn notwendig?« Sie stieß das Blatt Papier über den Tisch zurück.
Jetzt zeigte er Verwirrung. »Tut mir leid, aber wir brauchen wenigstens Name und Adresse.«
Ihr Blick huschte vom Gesicht des jungen Mannes zur Drehtür und blieb schließlich an der Zeitschrift hängen, die sie immer noch fest in den Händen hielt. »Cindy«, sagte sie allzu laut. Dann noch einmal, leiser, sicherer: »Cindy.«
»Cindy?«
Sie nickte und sah zu, wie er widerstrebend einen Stift nahm und den Namen auf die Karte schrieb.
»Und der Nachname?«
Warum tat er ihr das an? Hatte sie ihm nicht gesagt, sie sei müde? Hatte er nicht begriffen, daß sie bar zahlte? Warum mußte er nach Dingen fragen, die ihn gar nichts angingen? Sie dachte an das junge Paar und seine beiden kleinen Söhne, die nach McDonald’s gebrüllt hatten. Kein Wunder, daß die Jungen quengelig und ungeduldig gewesen waren. Hatte er diesen Leuten auch so zugesetzt?
»McDonald!« sagte sie, ohne zu überlegen. »Cindy McDonald.« Noch einmal holte sie Luft, ehe sie fortfuhr. »Memory Lane 123 – New York.«
Bei dem Wort Memory stockte seine Hand, und sie mußte sich auf die Lippe beißen, um das aufkommende hysterische Gelächter zurückzuhalten. Aber dann war das Formular ausgefüllt, sie brauchte nur noch zu unterschreiben und zu bezahlen. Sie sah, wie ihre Hand den fremden Namen unten auf das Blatt setzte, und war angenehm überrascht von Schwung und Kraft ihrer Unterschrift. Dann griff sie in ihre Manteltasche, zog zwei knisternde Hundert-Dollar-Scheine heraus und bemühte sich, nichts von ihrer Erheiterung über das sichtliche Unbehagen des jungen Mannes merken zu lassen.
»Gepäck?« Sein resignierter Ton verriet, daß er die Antwort schon wußte. Als sie den Kopf schüttelte, zuckte er auch nur die Achseln und reichte ihr zusammen mit dem Wechselgeld ihren Zimmerschlüssel. »Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wenn wir noch irgend etwas für Sie tun können, lassen Sie es uns wissen.«
Sie lächelte. »Worauf Sie sich verlassen können.«
Sobald sie die Zimmertür hinter sich geschlossen hatte, schleuderte sie die Zeitschrift auf das breite Bett, zog den Mantel aus und ließ ihn zu Boden fallen. Der Anblick des Blutes auf ihrem Kleid traf sie mit einer Gewalt, als hätte man ihr eine überreife Tomate ins Gesicht geworfen. »O Gott, nein!« stöhnte sie. »Das ist ja furchtbar!«
Sie riß und zerrte an dem Kleid wie ein Tier, das in einer Schlinge hängt. Im nächsten Moment lag es auf dem Boden, und sie suchte an ihrem Körper nach Verletzungen.
Es waren keine zu sehen.
»O Gott, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten?«
Mit heftiger Bewegung drehte sie sich um, als könnte sie die Antwort irgendwo innerhalb dieser blau-weiß gemusterten Wände finden. Aber die Wände sprachen nur von freundlich geblümter Behaglichkeit, von Blut und Verwundung sagten sie nichts. »Wessen Blut ist das, wenn es nicht meines ist?«
Sie lief zum Kleiderschrank, riß ihn auf und sah ihr angstvolles Gesicht im großen Spiegel an der Innenseite der Tür. »Wer bist du, verdammt noch mal? Und wessen Blut ist das an deinem Kleid?«
Die Frau im Spiegel sagte nichts, äffte sie nur stumm nach, während sie an ihrem Körper nach Spuren von Verletzungen suchte. Auf ihren Armen entdeckte sie zwar ein paar blaue Flecke, aber das war auch alles.
Hastig hob sie die Arme hinter den Rücken und öffnete den Verschluß ihres fleischfarbenen Büstenhalters, warf ihn weg und starrte auf die kleinen Brüste, die da recht stolz aus der Verhüllung sprangen. Flüchtig fragte sie sich, ob sie an diesen Brüsten je ein Kind gestillt hatte. Eigentlich ein ganz hübscher Busen, dachte sie, bewußt bemüht, sich durch Konzentration auf alltägliche Einzelheiten eines alltäglichen Lebens zu beruhigen. Würde solche Konzentration sie schließlich in ihr eigenes alltägliches Leben zurückführen?
Nein. Der eigentlich ganz hübsche Busen sagte ihr nichts. Nicht, ob je ein Säugling an ihm gelegen hatte; nicht, wann er zum ersten Mal die zärtliche Berührung eines Mannes gespürt hatte; nicht einmal, ob er je bewundert worden war. Sie stieß ein kurzes Lachen spöttischer Geringschätzung aus; sie war offensichtlich nahe daran durchzudrehen. Da stand sie in einem Hotelzimmer mitten in Boston, einer Stadt, die sie kannte, ohne zu wissen, wie sie dahingekommen war, hatte die Taschen voller Geld und das Kleid voller Blut und hatte nichts Besseres zu tun, als im Spiegel ihren nackten Busen anzugaffen und sich zu fragen, ob er je bewundert worden war.
Und warum nicht? dachte sie, faßte das Gummiband ihrer Strumpfhose und zog sie zusammen mit dem beigefarbenen Bikinihöschen herunter, um ihren nackten Körper in Augenschein zu nehmen. Was hoffte sie von ihm zu erfahren?
Gute Figur, stellte sie fest, während sie sich von allen Seiten betrachtete. Straff, muskulös, beinahe knabenhaft. Die Waden waren gut entwickelt, die Beine kräftig und wohlgeformt, der Bauch flach, die Taille nicht übermäßig betont. Mehr ein Kinderkörper als ein Frauenkörper, trotz ihres Alters. Ein Körper, der ganz bestimmt nicht auf der Titelseite einer Zeitschrift landen würde, dachte sie mit einem Blick auf das Heft auf dem Bett. Cindy Crawford starrte sie mit einer Mischung aus Mitleid und Nachsicht an. Ja, werd nur grün vor Neid, schien sie zu sagen, und die Frau vor dem Spiegel nickte in Anerkennung der Niederlage.
Sie griff nach dem blauen Kleid zu ihren Füßen und mied dabei sorgfältig das blutgetränkte Vorderteil. Konnte das Kleid ihr etwas verraten? Dem Etikett nach war es Größe 36, reine Baumwolle, ein Modell von Anne Klein. Es hatte einen runden Kragen und große weiße Knöpfe bis zur Taille, einen schlichten, leicht ausgestellten Rock, und war vermutlich so übertrieben teuer gewesen, wie es übertrieben einfach war. Wer immer sie auch war, sie hatte offensichtlich genug Geld, um sich das Beste zu leisten.
»Das Geld!« Sie rannte zu dem achtlos hingeworfenen Mantel und zog mit nur einem flüchtigen Gedanken daran, was für einen lächerlichen Anblick sie bieten mußte, die Scheine aus den tiefen Taschen. Das Reservoir an Hundert-Dollar-Noten schien unerschöpflich zu sein. Wieviel Geld hatte sie bei sich? Woher hatte sie es? »Was tue ich mit dem vielen Geld?« fragte sie laut, während sie die Scheine ordentlich auf dem Bett auszulegen versuchte.
Überrascht stellte sie fest, daß die meisten Scheine sauber gebündelt waren, wie direkt von der Bank. Aber wieso und warum? War es möglich, daß sie tatsächlich eine Bankräuberin war? Das sie bei einem Raubüberfall mitgemacht, das Geld eingesteckt hatte und mit fremdem Blut bespritzt worden war, als irgend etwas schiefgegangen war? War es möglich, daß sie einen Menschen erschossen hatte?
Eine tiefe Angst packte sie. Denn es erschien ihr möglich. Es erschien ihr möglich, daß sie fähig sein könnte, einen Menschen zu töten. »O Gott, o Gott«, stöhnte sie und rollte sich auf dem königsblauen Spannteppich zusammen wie ein kleines Kind. Hatte sie wirklich bei einem Raubüberfall einen unschuldigen Menschen getötet? Und war sie allein gewesen, oder hatte sie einen Komplizen gehabt? War sie vielleicht eine moderne Bonnie, der ihr Clyde abhanden gekommen war?
Sie hörte sich lachen, und das Gelächter trieb sie wieder in die Höhe. Obwohl es ihr durchaus möglich erschien, daß sie jemanden getötet hatte, erschien ihr die Vorstellung, sie könnte an einem Banküberfall teilgenommen haben, schlicht lachhaft. Da hätte sie schon in auswegloser Verzweiflung sein müssen. Und was konnte eine teuer gekleidete Frau Anfang bis Mitte Dreißig in solche Verzweiflung treiben, daß sie sogar zu töten bereit war?
Sie brauchte ihr Gedächtnis nicht, um sich diese Frage zu beantworten. Ein Mann konnte einen zu solcher Verzweiflung treiben. Und was für ein Mann? fragte sie sich, ohne auf diese Frage eine Antwort zu erwarten.
Mit zitternder Hand fuhr sie sich durch das schweißfeuchte Haar. Sie neigte sich wieder über das Bett, auf dem ordentlich im Karree aufgereiht neun Bündel Geldscheine lagen. Sie nahm das erste Bündel, zog die Heftklammer ab, die die Scheine zusammenhielt, und begann zu zählen. Sie zählte sie alle durch und stellte fest, daß jedes Bündel aus zehn Hundert-Dollar-Noten bestand. Neun Bündel zu je zehn Hundert-Dollar-Scheinen, das machte neuntausend Dollar. Zählte man das Geld dazu, das sie für Taxi und Hotel ausgegeben hatte, und die losen Hunderter, so kam man auf etwas über neuntausendsechshundert Dollar. Was hatten fast zehntausend Dollar in ihren Manteltaschen zu suchen?
Sie merkte plötzlich, daß ihr kalt war und sie auf den Armen eine Gänsehaut hatte. Sie stand auf, ging um das Bett herum und hob den Mantel vom Boden auf. Sie sah das getrocknete Blut an seinem Innenfutter, als sie hineinschlüpfte und die Hände in die Taschen steckte. Sie fand noch ein paar Scheine darin und warf sie zu dem Rest des Geldes aufs Bett.
An einem der Scheine haftete ein Zettel. Sie nahm ihn und glättete ihn und war froh, daß sie zum Lesen offensichtlich keine Brille brauchte. Sie erkannte die kraftvollen, flüssigen Züge auf dem Zettel wieder; sie waren von derselben Hand geschrieben, die unten am Empfang das Anmeldeformular unterzeichnet hatte. Sie selbst hatte also die wenigen, allem Anschein nach belanglosen Wörter niedergeschrieben, die sie nun vor sich hatte. Aber wann? Solche Zettel konnten sich wochen-, ja monatelang in vergessenen Manteltaschen herumtreiben. Es war unmöglich festzustellen, wann sie diesen hier geschrieben hatte. ›Pat Rutherford, Z. 31, 12.30‹, stand da, und darunter, ›Milch, Eier‹. Was hatte das zu bedeuten?
Nun, offensichtlich, daß sie Milch und Eier gebraucht hatte – sie war ja zum Einkaufen unterwegs gewesen, als ihr Gedächtnis plötzlich ausgesetzt hatte, aber wie lange war es her, daß sie losgegangen war? – und eine Verabredung mit einer Person namens Pat Rutherford gehabt hatte. Aber wer zum Teufel war Pat Rutherford ?
Sie sprach den Namen mehrmals mit wachsender Frustration vor sich hin. War Pat Rutherford ein Mann oder eine Frau? Vielleicht war sie selbst Pat Rutherford. Aber weshalb hätte sie ihren eigenen Namen und eine Zimmernummer auf einen Zettel schreiben und einstecken sollen? Doch höchstens, wenn sie häufiger an diesen Gedächtnisstörungen litt und die Erfahrung sie gelehrt hatte, immer einen Zettel mit ihrem Namen bei sich zu tragen, damit sie sich jederzeit ihrer Identität vergewissern konnte. Klar, und sich mit sich selbst verabreden konnte! Schluß mit dem Quatsch.
Hatte sie die Verabredung eingehalten? Hatte sie Pat Rutherford zur vereinbarten Zeit aufgesucht, knapp zehntausend Dollar kassiert und den oder die Unglückliche dann getötet? War das Pat Rutherfords Blut auf ihrem Kleid? Hatte sie Pat Rutherford erpreßt ? Oder hatte Pat Rutherford sie erpreßt? War sie völlig übergeschnappt? Woher kamen diese Hirngespinste?
»Pat Rutherford, wer bist du?«
Sie fand in der Nachttischschublade ein Telefonbuch von Boston und blätterte zu R: Raxlen, Rebick, Rossiter, Rumble, seitenweise Russels, Russo, Rutchinski, endlich Rutherford, eine halbe Seite Rutherfords allein im Stadtgebiet. Es gab einen Paul und zwei Peter, aber niemanden namens Pat, allerdings drei unerklärte P.’s. Sie spielte mit dem Gedanken, bei jeder dieser Nummern anzurufen, und verwarf ihn gleich wieder. Was würde sie denn zu Mr./Mrs./Miss P. Rutherford sagen? Guten Tag, Sie kennen mich wahrscheinlich nicht, ich kenne mich ja selbst nicht, aber haben wir uns vielleicht irgendwann in der letzten Zeit mittags um halb eins in Zimmer 31 getroffen? Und habe ich Sie bei dieser Zusammenkunft zufällig schwer verletzt?
Absurd.
Sie packte das Telefonbuch wieder weg. »So, und was mach ich jetzt?« fragte sie laut, den Blick zur Zimmerdecke gerichtet. Sie war todmüde und hungrig. »Geh ich zur Polizei, oder versuche ich, dieser Geschichte selbst auf den Grund zu kommen? Mach ich mich auf den Weg zur nächsten Irrenanstalt, oder nehm ich erst mal ein Bad? Soll ich gleich was unternehmen oder lieber bis morgen warten? Was soll ich tun?« Zerstreut blätterte sie in der großen Speisekarte des Etagenservice. »Im Zweifel erst mal was essen«, hörte sie sich antworten.
Sie hatte keine Ahnung, wo sie diese Weisheit herhatte, aber die Lösung war nicht schlecht. Sie griff zum Telefon, wählte den Etagenservice und bestellte sich ein Steak und einen großen Salat. Sie brauchte nur einen Moment, um die ihr gestellten Fragen zu beantworten: Das Steak halb durch, zur gebackenen Kartoffel saure Sahne, statt Wein lieber Mineralwasser. Vegetarierin war sie offenbar nicht, und sie konnte nur hoffen, daß sie nicht an irgendwelchen seltsamen Lebensmittelallergien litt. Für solche Komplikationen war sie jetzt viel zu hungrig.
Zwanzig Minuten, hatte man ihr gesagt. Zwanzig Minuten, um sich frisch zu machen. Sie hängte ihren Mantel über einen hohen gradlehnigen Stuhl und ging in das weiß gekachelte Bad.
Wie schön wäre es, einfach zu verschwinden, dachte sie, während ihr das Wasser aus der Dusche über das Gesicht strömte. Mein Geist ist sowieso schon weg; dann nehmt doch auch meinen Körper. Was immer ich getan habe, wer immer ich sein mag, vielleicht ist es besser, es nicht zu wissen. Vielleicht bin ich so besser dran. Vielleicht ist das, wovor ich davongelaufen bin, von solcher Art, daß es gut ist, ihm für immer fernzubleiben.
Sicher würde man sie vermissen. Sicher suchte man sie, auch wenn man so wenig wie sie wußte, wo man suchen sollte. Ihre Eltern oder ihr Mann, wenn sie einen hatte; ihr Chef oder jemand, der für sie arbeitete; ihr Lehrer oder ihre Schüler; ihre Freunde oder ihre Feinde; vielleicht sogar die Polizei! Ganz bestimmt suchte man sie. Warum ging sie nicht einfach zur Polizei ? Dann würde sie schon sehen.
Weil sich bis morgen früh alles geklärt haben wird, sagte sie sich und sprang aus der Dusche, als sie es draußen klopfen hörte. Rasch wickelte sie sich in ein Badetuch, zog ihren Mantel darüber und ging zur Tür. Sie wußte, wer es war, fragte aber dennoch, mit heiserer, kaum hörbarer Stimme.
»Der Etagenkellner«, kam die Antwort wie erwartet.
»Einen Augenblick.« Ihre Stimme war jetzt fester, bestimmter.
Gerade als sie die Hand nach der Tür ausstreckte, fiel ihr Blick auf das Geld auf dem Fußende des Betts. Sie erstarrte. Einen Moment lang dachte sie daran, alles einfach so zu lassen, wie es war, dem ahnungslosen Kellner zu öffnen und ihn das bestellte Essen zum Tisch gegenüber vom Bett bringen zu lassen und sich anzusehen, wie er beim Anblick des vielen Geldes reagierte, das da so lässig vor ihm ausgebreitet lag. Würde er so tun, als wäre das Geld gar nicht da oder als wäre es das Normalste von der Welt, in einem Hotelzimmer fast zehntausend Dollar auf dem Bett herumliegen zu lassen? Machten das nicht alle Gäste so?
Es klopfte ein zweites Mal. Wie lange hatte sie hier dumm herumgestanden ? Sie wollte auf ihre Uhr sehen, entsann sich vage, daß sie die Uhr mit dem Kleid abgelegt hatte, und erinnerte sich, daß das Kleid immer noch in einem blutbetränkten Bündel auf dem Boden lag. »Eine Sekunde«, rief sie, hob das Kleid auf und warf es in den Kleiderschrank. Sie legte die Uhr wieder an, zog das Badetuch unter dem Mantel heraus und warf es über die Geldbündel. Im letzten Moment nahm sie sich noch einen der losen Scheine.
Außer Atem, als hätte sie gerade einen Marathonlauf hinter sich, erreichte sie die Tür, zog sie mit Anstrengung auf und ließ den älteren Mann herein. Ihr Blick flog unruhig zwischen ihm und dem Bett hin und her, aber wenn er ihre Nervosität bemerkte oder sich wunderte, daß sie einen Mantel trug, obwohl sie darunter offensichtlich klatschnaß war, verlor er kein Wort darüber, und sein Blick blieb unverwandt auf den Servierwagen gerichtet, den er vor sich herschob.
»Wo hätten Sie es gern?« fragte er in angenehm nichtssagendem Ton.
»Gleich hier.« Sie wies auf den Schreibtisch am Fenster, erstaunt, wie leicht ihr die Worte über die Lippen kamen.
Er stellte das Tablett mit dem Essen auf den Schreibtisch, sie drückte ihm die zerknitterte Hundert-Dollar-Note in die Hand und sagte, es sei gut so. Er zögerte und blickte dann mißbilligend zum Bett.
Ihr wurde so mulmig, daß sie sich am Schreibtisch festhalten mußte, um nicht umzukippen. Hatte er das Geld bemerkt?
»Ich schicke Ihnen jemand, der das Bett aufschlägt«, sagte er.
»Nein!« rief sie so schrill, daß sie beide zusammenzuckten. Sie räusperte sich, hörte sich lachen, etwas davon murmeln, daß sie zu arbeiten habe und ungestört sein wolle. Er nickte, steckte das Geld ein und zog sich ziemlich eilig zurück.
Sie wartete, bis sie ganz sicher war, daß er weg war, ehe sie die Tür noch einmal öffnete und das Schild ›Bitte nicht stören‹ hinaushängte. Dann kehrte sie zum Schreibtisch zurück, hob den silbernen Deckel von der Schale mit ihrem Abendessen und setzte sich. Aber schon nach wenigen Bissen überwältigte sie die Müdigkeit, und sie torkelte schwindlig vor Erschöpfung zum Bett. Ohne sich die Mühe zu machen, das Geld wegzuschieben oder den Mantel auszuziehen, schlug sie den Überwurf zurück und kroch unter die schwere blaue Decke. Morgen früh, dachte sie vor dem Einschlafen noch, wenn ich aufwache, ist bestimmt wieder alles in Ordnung.
Aber als sie am folgenden Morgen um sechs die Augen öffnete, hatte sich nichts geändert. Sie hatte noch immer keine Ahnung, wer sie war.
3
Die erste Stunde war die schlimmste. Bei der Erkenntnis, daß die angeblich belebenden Kräfte des Schlafs nichts dazu getan hatten, ihr Gedächtnis zu beleben, wurde ihr so flau, daß sie nur noch ins Bad taumeln konnte, um das bißchen Essen, das sie am Abend hinuntergewürgt hatte, wieder von sich zu geben. Als das Frühstück kam – frischer Orangensaft, Croissants und Kaffee –, sah sie, daß eine Zeitung mit auf dem Tablett lag. Ihr Blick flog zwischen Zeitung und Fernsehapparat hin und her und verweilte bei keinem.
Wovor hatte sie Angst? Fürchtete sie ernstlich, ihr Bild auf der Titelseite wiederzufinden? Glaubte sie etwa, man habe sie für eine Talkshow zum Thema des Tages erkoren?
Noch immer in der ängstlichen Erwartung, sich ihrem eigenen Konterfei gegenüberzusehen, zwang sie sich, den Fernseher einzuschalten. Aber sie bekam nur eine hübsche Blondine Mitte Zwanzig zu sehen, die die Nachrichten in so frischfröhlichem Ton vortrug, daß ihr gleich wieder übel wurde, und die mit keinem Wort eine hübsche Brünette Anfang bis Mitte Dreißig erwähnte, die verschwunden war; dafür berichtete ein Mann aus Nord Carolina, er hätte Elvis gesehen, als er den Mülleimer ausleerte.
Und auch die Morgenzeitung brachte nichts: keinen Hinweis auf eine aus dem Gefängnis entflohene Strafgefangene, kein Wort von einer geistesgestörten Patientin, die sich davongemacht hatte. Man suchte keine Zeugin in Verbindung mit irgendeinem unerquicklichen Vorfall und wußte nichts von einer Frau zu berichten, die sich im Schock vom Ort eines schweren Unfalls entfernt hatte. Es stand überhaupt nichts in der Zeitung.
Wenn sie gar nicht aus Boston stammte, dachte sie, wenn sie nun aus einem anderen Teil des Landes kam und nur in Boston gestrandet war, dann bestand für die Lokalblätter ja auch kein Grund, über sie zu berichten. Aber das Blut auf ihrem Kleid war noch feucht gewesen, als sie es entdeckt hatte, und das konnte nur bedeuten, daß das, was sich ereignet hatte, was immer es gewesen sein mochte, nicht allzu weit entfernt und vor nicht allzu langer Zeit geschehen sein mußte.
Sie erinnerte sich an den Zettel, den sie in ihrer Tasche gefunden hatte – ›Pat Rutherford, Z. 31, 12.30‹. Stand vielleicht über diese Person etwas in der Zeitung? Sie las das Blatt noch einmal durch und fand nichts. Wenn das Blut auf ihrem Kleid von Pat Rutherford stammte, dann hatte sich Pat Rutherford entweder in aller Stille und Unauffälligkeit wieder erholt oder lag noch immer irgendwo unentdeckt.
Da aus der Zeitung offensichtlich nichts zu erfahren war, konzentrierte sie sich auf den Fernsehapparat, schaltete von einem Programm zum anderen, sprang zwischen Good Morning America und der Today Show hin und her. Sie erfuhr, daß es Fachleute gab, die Wissenswertes über geschlagene Lesben und kleptomane Transvestiten zu berichten wußten, daß es ein wahres Heer junger Mädchen gab, die vor ihrem dreizehnten Geburtstag nicht nur ein, sondern mehrere Kinder geboren hatten, und daß es eine erschreckende Menge von Ehemännern gab, die keine Lust hatten, mit ihren Frauen zu schlafen. Sie erfuhr das alles von Leuten, die endlos darüber redeten und irgendwelchen Moderatoren im Fernsehen ihr Herz ausschütteten.
Sie dachte schon daran, beim Sender anzurufen. Ich habe eine super Idee für eine Show, würde sie sagen: Frauen, die nicht wissen, ob sie geschlagene Lesben oder kleptomane Transvestiten sind, die nicht wissen, wieviele Kinder sie vielleicht bis zu ihrem dreizehnten Lebensjahr zur Welt gebracht haben, die keine Ahnung haben, ob ihre Ehemänner öfter als zweimal im Jahr mit ihnen schlafen. Frauen, die nicht wissen, wer sie sind. Alter Hut, konnte sie die Leute vom Sender sagen hören. Solche Frauen gibt’s doch wie Sand am Meer.
Vielleicht, stimmte sie zu. Aber wieviele von ihnen haben fast zehntausend Dollar in den Manteltaschen und die Kleider voller Blut?
Ja, warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? hörte sie die Moderatoren in erregtem Einklang gurren. Reiche, blutbefleckte Frauen, die nicht wissen, wer sie sind! Mann, das ist eine Idee, die wirklich noch nicht da war.
Den Talkshows folgten Spielsendungen, dann kamen die Seifenopern. Die Bilder schicker und gepflegter Männer und Frauen flimmerten über den Bildschirm, und eine sonore Männerstimme kündete den Auftritt der Jungen und Rastlosen an. Jung und nutzlos, hörte sie den jungen Mann im Tante-Emma-Laden sagen, als sie sich zurücklehnte, um sich die Sendung anzusehen. Wer waren all diese problembeladenen schönen Menschen, und wieso waren sie am hellichten Nachmittag so aufgedonnert ?
Widerstrebend holte sie ihr eigenes Kleid aus dem Schrank und betrachtete das blutdurchtränkte Vorderteil wie ein modernes Kunstwerk, vielleicht von Jackson Pollock. Aber es sagte ihr genausowenig wie ein abstraktes Bild. Heftig knüllte sie das Kleid zusammen und schleuderte es an die Wand. Wie zum Hohn entfaltete es sich im Herabfallen wieder. Sie kehrte zu ihren Platz am Fußende des Bettes zurück und starrte blind vor sich hin, bis die schräg durch das Fenster einfallenden Sonnenstrahlen ihr sagten, daß es Abend war.
Die Nachrichten um halb sieben meldeten neue Probleme, aber immer noch nichts von einer verschwundenen Frau mit Blut auf dem Kleid und viel Geld in den Taschen.
»Wer bin ich?« rief sie, schaltete zornig den Fernsehapparat aus und bestellte sich beim Etagenservice ein Abendessen, wobei sie sich über die Unverwüstlichkeit ihres Appetits wunderte. »Was ist mir passiert? Wo habe ich mein Leben hingepackt?«
Zu Beginn des nächsten Tages wußte sie, daß sie sich auf die Suche machen mußte.
Copley Place ist ein beeindruckender Komplex von Büro- und Geschäftsbauten am Copley Square, dem Herzen der Back Bay. Es gibt dort ein großes Hotel, mehrere gute Restaurants und über hundert Läden und Kaufhäuser, die über zwei Ebenen verteilt sind.
Aber sie war nicht beeindruckt. Sie war verängstigt.
Unter dem Mantel nur die Unterwäsche, die bloßen Füße in die engen Schuhe gezwängt, näherte sie sich dem ultramodernen Kaufhaus am Ende des Einkaufszentrums. In der Hand hielt sie eine Plastiktüte für schmutzige Wäsche aus dem Hotel, die mit sauberen Bündeln von Hundert-Dollar-Scheinen gefüllt war. Unter dem Geld lag ein zweiter Wäschebeutel, der ihr blutverschmiertes Kleid enthielt.
»Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«
Sie sah sich um, entdeckte, daß sie irgendwie in die Abteilung für Damenbekleidung gelangt war, und nickte der vogelähnlichen Frau an ihrer Seite zu. Wenn sie jetzt etwas gebrauchen konnte, dann Hilfe.
»Ich brauche ein paar neue Sachen«, sagte sie in täuschend ruhigem Ton. »Ich habe überhaupt nichts anzuziehen.«
Die Verkäuferin beugte sich interessiert vor. »Sie brauchen eine neue Garderobe?« fragte sie eifrig.
»Nein, ich brauche nur etwas für heute.«
Die Hoffnung auf eine dicke Provision erlosch im hageren Vogelgesicht der Frau. »Möchten Sie sich etwas Elegantes ansehen oder eher etwas Sportliches?« fragte sie zurückhaltend, als wäre sie nicht sicher, ob sie vielleicht zum besten gehalten wurde.
»Sportlich. Hosen vielleicht und einen leichten Pulli.«
»Dann kommen Sie bitte mit.« Die Frau führte sie in einen Teil der Etage mit einer verlockenden Auswahl an Sommersachen. »Welche Größe?«
Sie hielt den Atem an, während sie versuchte, sich an die Größe des blauen Kleids zu erinnern. »Sechsunddreißig?«
»Tatsächlich?« Die Frau musterte ihren Mantel so scharf, als könne sie durch ihn hindurchsehen. »Ich hätte auf vierunddreißig getippt.«