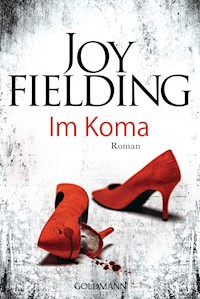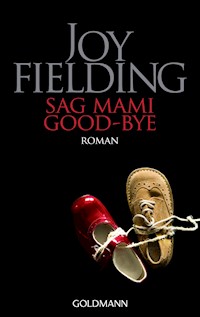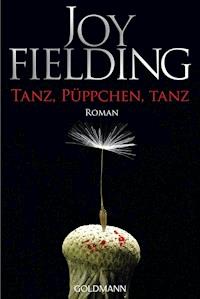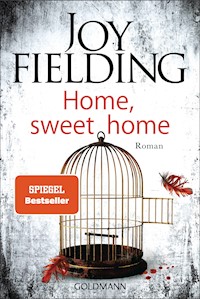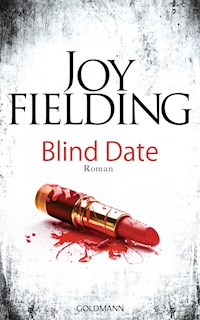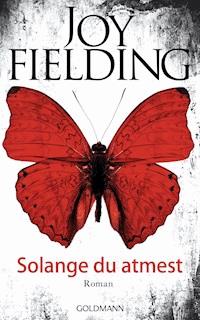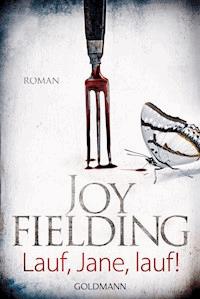Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Danksagung
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Leseprobe: Joy Fielding, Das Herz des Bösen
Newsletter-Anmeldung
Orientierungsmarken
Titelseite
Copyright-Seite
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Hauptteil
Danksagungen
Das Buch
Casey Marshall führt ein sorgenfreies Leben in Philadelphia: Sie stammt aus vermögenden Verhältnissen, ihr Beruf als Innendesignerin macht ihr großen Spaß, und soeben haben sie und ihr geliebter Ehemann Warren beschlossen, ein Baby zu bekommen. Da ereignet sich plötzlich ein unfassbarer Vorfall: Casey ist im Begriff, in einer Tiefgarage in ihren Wagen zu steigen, als in letzter Sekunde aus dem Nichts ein Wagen auftaucht und in vollem Tempo auf sie zusteuert. Als Casey im Krankenhaus das Bewusstsein wieder erlangt, ist sie völlig orientierungslos: Sie ist umgeben von tiefster Dunkelheit, sie kann sich nicht bewegen und nicht sprechen, und sie hat keine Ahnung, was ihr widerfahren ist. Mit zunehmender Panik entnimmt sie den Gesprächen der Ärzte, dass sie mehrere Wochen im Koma lag und ihr weiteres Schicksal ungewiss ist. Doch es kommt noch viel schlimmer, als sie einem Gespräch in ihrem Zimmer entnehmen muss, dass sie nicht einem Unfall zum Opfer fiel – sondern einer gezielten Attacke. Und sehr bald weiß sie: Der Mörder ist in ihrer Nähe und wartet nur darauf, erneut zuzuschlagen. Aber wie soll sie sich verständlich machen in ihrer Lage? Ein verzweifelter Wettlauf gegen den sicheren Tod beginnt …
Joy Fielding
gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Die Katze • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Flieh wenn du kannst • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
(alle auch als E-Book erhältlich)
Joy Fielding
IM KOMA
Roman
Deutsch von Kristian Lutze
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Still Life« bei Atria Books, New York.
Die im Text enthaltenen Zitate stammen aus: George Eliot, Middlemarch: Eine Studie über das Leben in der Provinz. Übersetzt von Rainer Zerbst, Philipp Reclam, Stuttgart, 1985.
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
ISBN : 978-3-641-02789-6 V006
www.goldmann-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
Danksagung
Für all die wahrhaft wundervollen Frauen in meinem Leben
KAPITEL 1
Weniger als eine Stunde bevor der Wagen sie mit einer Geschwindigkeit von achtzig Stundenkilometern erfasste, drei Meter durch die Luft wirbelte, ihr sämtliche Knochen brach und ihren Kopf auf dem Beton aufschlagen ließ, aß Casey Marshall noch mit ihren beiden besten Freundinnen im Southwark, einem beliebten Nobel-Restaurant in South Philadelphia, zu Mittag und ließ ihren Blick immer wieder aus dem eleganten, schmalen Speiseraum in den wunderschönen abgeschlossenen Innenhof schweifen. Sie fragte sich, wie lange das ungewöhnlich warme Märzwetter wohl noch andauern würde, ob ihr vor ihrem nächsten Termin noch Zeit zum Joggen bliebe und ob sie Janine gestehen sollte, was sie wirklich von ihrer neuen Frisur hielt. Sie hatte behauptet, sie gut zu finden, was gelogen war.
Bei dem Gedanken an die ersten warmen Frühlingstage musste Casey unwillkürlich lächeln, und ihr Blick glitt über den Strauß riesiger, rosafarben leuchtender Pfingstrosen auf dem Stillleben von Tony Scherman und wanderte von dort weiter zu dem prachtvollen Mahagonitresen im vorderen Teil des Restaurants.
»Du hasst sie, oder?«, hörte sie Janine fragen.
»Die Pfingstrosen?«, fragte Casey, obwohl sie bezweifelte, dass Janine das Gemälde je zur Kenntnis genommen hatte. Janine brüstete sich regelmäßig damit, ihre Umgebung gar nicht wahrzunehmen, was sie allerdings nicht davon abzuhalten schien, für ihre gemeinsamen Mittagessen immer nur die edelsten und teuersten Restaurants auszusuchen. »Ich finde sie fantastisch.«
»Meine Frisur. Du findest sie schrecklich.«
»Ich finde sie nicht schrecklich.«
»Aber zu streng.«
Casey blickte direkt in Janines beinahe stechende blaue Augen, die einen ganzen Tick dunkler waren als ihre eigenen. »Ein wenig, ja«, räumte sie ein. Die harten Konturen des präzise geschnittenen Bobs erdrückten Janines langes, schmales Gesicht und betonten ihr ohnehin spitzes Kinn, vor allem in Kombination mit der pechschwarzen Tönung.
»Ich hatte die ewig gleiche Frisur einfach satt«, erklärte Janine und sah ihre gemeinsame Freundin Gail Bestätigung heischend an.
Gail, die Casey gegenüber auf Janines Seite des Tisches saß, nickte gefällig. »Nun, ein bisschen Abwechslung kann bekanntlich nicht schaden«, sagte sie fast zeitgleich mit Janine, sodass die Sätze sich überlappten wie in einem Kanon.
»Ich meine, wir sind schließlich nicht mehr auf der Uni«, fuhr Janine fort. »Wir sind über dreißig. Man muss mit der Zeit gehen...«
»Mit der Zeit gehen ist immer gut«, kam das Echo von Gail.
»Es war einfach überfällig, diese Alice-im-Wunderland-Frisur abzulegen.« Janines spitzer Blick blieb an Caseys schulterlangen, naturblonden Haaren hängen.
»Ich mochte deine Haare lang«, wandte Casey ein.
»Ich auch«, stimmte Gail zu und strich sich ein paar fransige braune Locken hinters Ohr. Gail hatte nie Probleme mit ihrer Frisur. Sie sah immer so aus, als hätte sie gerade in eine Steckdose gefasst. »Aber so mag ich es auch«, fügte sie hinzu.
»Nun ja, irgendwann ist es soweit: Zeit für etwas Neues! Sagst du das nicht immer?« Die Frage war mit einem derart süßen Lächeln garniert, dass Casey nur mit Mühe entscheiden konnte, ob sie gekränkt sein sollte oder nicht. Klar war auf jeden Fall, dass sie nicht mehr über Frisuren redeten.
»Es ist vor allem Zeit für einen Kaffee«, verkündete Gail und winkte dem Kellner.
Casey beschloss, Janines Anspielung zu überhören. Welchen Sinn hatte es, alte Wunden aufzureißen? Stattdessen hielt sie dem gut aussehenden, dunkelhaarigen Kellner ihre Porzellantasse hin und sah zu, wie die heiße, dunkelbraune Flüssigkeit aus der Tülle der silbernen Kaffeekanne plätscherte. Casey wusste, dass Janine es nie ganz verwunden hatte, dass sie ihre gemeinsam nach der Uni gegründete juristische Personalagentur verlassen hatte, um etwas ganz Eigenes auf die Beine zu stellen, noch dazu in der völlig fremden Branche der Innendekoration. Aber sie hatte sich eingeredet, dass Janine nach einem Jahr zumindest ihren Frieden damit geschlossen hatte. Kompliziert wurde die Angelegenheit durch die Tatsache, dass Caseys neue Firma von Beginn an floriert hatte, während Ja nines Unternehmen stagnierte, was jeden geärgert hätte. »Es ist wirklich erstaunlich, wie alles, was du anfasst, zu Gold wird«, hatte Janine schon des Öfteren bemerkt, stets begleitet von jenem breiten Lächeln, das über den leicht giftigen Unterton hinwegtäuschte, der Casey nicht entging. Wahrscheinlich war es nur ihr eigenes schlechtes Gewissen, dachte sie jetzt, ohne recht zu wissen, wofür sie sich schuldig fühlen sollte.
Sie trank einen großen Schluck Kaffee und spürte, wie er in der Kehle brannte. Sie und Janine waren seit ihrem zweiten Studienjahr an der Brown University befreundet. Janine hatte gerade von Jura zu englischer Literatur gewechselt, Casey studierte Englisch und Psychologie. Trotz ihrer offensichtlich völlig gegensätzlichen Charaktere – Casey war eher zurückhaltend und nachgiebig, Janine reizbar und extrovertiert – hatten sie sich auf Anhieb verstanden. Vielleicht ein Fall von Gegensätzen, die sich anziehen. Jede meinte wohl, dass die andere etwas hatte, was ihr selbst fehlte. Casey hatte nie lange über die Frage gegrübelt, was sie zusammengebracht und warum ihre Freundschaft auch die zehn Jahre nach dem Examen überdauert hatte, obwohl in der Zeit ziemlich viel passiert war – darunter Caseys Ausstieg aus der gemeinsamen Firma und vor zwei Jahren ihre Hochzeit mit einem Mann, den Janine – garniert mit dem obligaten strahlenden Lächeln – als »natürlich verdammt perfekt« bezeichnet hatte.
Casey mochte Janine ganz einfach. Und genauso erging es ihr mit Gail, ihrer anderen besten Freundin, die in fast jeder Hinsicht viel unkomplizierter war. Casey kannte Gail seit der Grundschule, und obwohl das mehr als zwanzig Jahre zurücklag, war Gail im Grunde dasselbe arglose nette Mädchen geblieben, das sie immer gewesen war. Bei Gail wusste man immer, woran man war. Sie hatte mit ihren zweiunddreißig Jahren schon ziemlich viel durchgemacht, aber immer noch ein Kichern wie ein schüchterner Teenager. Manchmal kicherte sie sogar mitten im Satz, eine ebenso irritierende wie liebenswerte Marotte. Casey dachte immer, dass es die akustische Entsprechung der Geste war, mit der ein junger Hund sich auf den Rücken warf, um sich den Bauch kraulen zu lassen.
Im Gegensatz zu Janine gab es bei Gail kein Vortäuschen, keine Hintergedanken und auch keine besonders tiefschürfenden Einsichten. Meistens hörte sie sich erst einmal an, was die anderen zu sagen hatten, bevor sie sich zu irgendetwas äußerte. Janine grummelte manchmal über Gails Naivität und ihren »gnadenlosen Optimismus«, aber auch sie musste zugeben, dass Gail ein angenehmer Mensch war, mit dem man gerne zusammen war. Außerdem bewunderte Casey Gails Gabe, beide Parteien eines Streits anzuhören und jeder Seite das Gefühl zu vermitteln, auf ihrer Seite zu sein. Vermutlich war sie deshalb eine so gute Verkäuferin.
»Alles in Ordnung?«, fragte Casey, wandte sich wieder Janine zu und betete, als Antwort ein schlichtes Ja zu hören.
»Alles bestens. Warum fragst du?«
»Ich weiß nicht. Du wirkst ein wenig... ich weiß nicht.«
»Tu nicht so. Du weißt doch immer alles besser.«
»Siehst du – genau das meine ich.«
»Was meinst du damit?«
»Was meinst du damit?«
»Hab ich irgendwas verpasst?«, fragte Gail und blickte aus großen braunen Augen nervös von einer Frau zur anderen.
»Bist du wütend auf mich?«, fragte Casey Janine direkt.
»Warum sollte ich denn wütend auf dich sein?«
»Ich weiß es nicht.«
»Und ich weiß wirklich nicht, was du meinst.« Janine berührte das goldene Medaillon an ihrem Hals und nestelte an dem steifen Kragen ihrer weißen Valentino-Bluse. Casey wusste, dass sie von Valentino war, weil sie sie vor Kurzem auf dem Titelblatt der Vogue gesehen hatte. Sie wusste auch, dass Janine es sich nicht leisten konnte, fast zweitausend Dollar für eine Bluse auszugeben, aber andererseits hatte ihre Freundin schon über ihre Verhältnisse gelebt, so lange Casey denken konnte. »Schöne Klamotten sind für mich wichtig«, hatte Janine erklärt, als Casey einmal Bedenken zu einer ihrer exorbitanteren Neuerwerbungen äußerte. Gefolgt von: »Ich bin vielleicht nicht mit einem Silberlöffel im Mund zur Welt gekommen, aber ich weiß, wie wichtig es ist, sich gut zu kleiden.«
»Okay«, sagte Casey jetzt, nahm den Silberlöffel neben ihrer Tasse und wendete ihn in der Hand, bevor sie ihn wieder weglegte. »Dann ist es ja gut.«
»Nun, ich bin vielleicht ein wenig verärgert«, räumte Janine mit einem Schütteln ihres neuen geometrischen Haarschnitts ein, sodass mehrere schwarze Strähnen einen Winkel ihres breiten Munds streiften, die sie ungeduldig zur Seite strich. »Nicht deinetwegen«, fügte sie hastig hinzu.
»Was ist denn das Problem?« Casey ließ die vergangenen sechzig Minuten wie im Schnelldurchlauf vor ihrem inneren Auge abspulen. Sie hatten ihre diversen Salate und jeweils ein Glas Wein genossen, ein wenig Klatsch und sämtliche Neuigkeiten ausgetauscht, die sich seit ihrem letzten Treffen vor zwei Wochen ereignet hatten. Alles schien bestens. Es sei denn, Janine haderte immer noch mit ihrer neuen Frisur …
»Es ist nur dieser kleine Blödmann Richard Mooney – erinnerst du dich an ihn?«, fragte Janine Casey.
»Der Typ, den wir bei Haskins & Farber untergebracht haben?«
»Genau der. Die Knalltüte hat im unteren Drittel seines Examensjahrgangs abgeschlossen«, erklärte Janine Gail. »Hat ein Sozialverhalten wie eine Mülltonne. Kann ums Verrecken keinen Job finden. Niemand, aber auch niemand will ihn einstellen. Er kommt zu uns. Ich sage zu Casey, der Typ ist ein Loser, wir sollten ihn gar nicht erst annehmen, aber ihr tut er leid, und sie meint, wir sollten ihm eine Chance geben. Warum nicht? Zumal sie ohnehin vorhat, uns bald zu verlassen, wie sich herausstellt.«
»Moment mal«, rief Casey und hob protestierend die Hände.
Janine tat Caseys Einwand mit ihrem Megawattlächeln und einem Wink ihrer langen French-Manicure-Fingernägel ab. »Ich wollte dich bloß ärgern. Außerdem haben wir ihn angenommen, und ein paar Monate später warst du weg. Oder stimmt das nicht?«
»Nun ja, schon, aber...«
»Mehr sage ich ja gar nicht.«
Casey hatte Probleme zu verstehen, was genau ihre Freundin eigentlich meinte. Sie dachte, dass Janine eine großartige Anwältin geworden wäre, und fragte sich, warum sie überhaupt über Richard Mooney redeten.
»Also zurück zu Richard Mooney«, sagte Janine, als hätte Casey ihre Verwirrung laut geäußert. Sie wandte sich wieder an Gail. »Wir konnten tatsächlich etwas für den kleinen Blödmann tun. Wie sich herausstellte, hat einer der Partner bei Haskins eine Schwäche für Casey. Sie klimpert ein paarmal mehr als üblich mit den Wimpern, und er willigt ein, es mit Mooney zu versuchen.«
»Das war wohl kaum der Grund«, unterbrach Casey.
»Jedenfalls fängt Mooney bei Haskins an und kann sich dort kaum ein Jahr halten, ehe er wieder rausfliegt. In der Zwischenzeit hat Casey natürlich ihr neues Leben als Dekorateurin der Stars angefangen. Und wer bleibt zurück, um sich mit den Folgen herumzuschlagen?«
»Welche Folgen?«, fragte Gail.
»Welche Stars?«, fragte Casey.
»Nun, ich kann mir nicht vorstellen, dass Haskins & Farber besonders glücklich sind«, sagte Janine. »Die werden in absehbarer Zeit wohl nicht mehr an meine Tür klopfen. Aber ratet mal, wer heute Morgen als Erstes vor meiner Tür stand? Der kleine Blödmann persönlich! Er will einen neuen Job, behauptet, wir haben mit seiner Vermittlung an Haskins Mist gebaut, weil wir haben wissen müssen, dass die Kanzlei für ihn nicht die richtige sei, weshalb es nun auch an mir liege, ihm eine besser geeignete Position zu verschaffen. Als ich ihm vorschlug, sich an jemand anderen zu wenden, wurde er ziemlich pampig und verlangte, die Chefin zu sprechen. Ich nehme an, er meinte dich«, fuhr Janine mit einem Nicken in Caseys Richtung fort, wodurch eine dicke Strähne blauschwarzer Haare über ihr linkes Auge fiel. »Er hat einen ziemlichen Aufstand gemacht. Ich hätte beinahe den Sicherheitsdienst rufen müssen.«
»Das ist ja furchtbar«, sagte Gail.
»Das tut mir sehr leid«, entschuldigte Casey sich. Janine hatte recht – es war ihre Idee gewesen, Richard Mooney anzunehmen; und er hatte ihr leidgetan; und vielleicht hatte sie bei Sid Haskins auch ein paarmal mehr als üblich mit den Wimpern geklimpert. »Tut mir leid«, sagte sie noch einmal, obwohl sie wusste, dass es nicht der einzige Fall war, bei dem ein Anwalt, den sie einer Kanzlei empfohlen hatten, sich nicht bewährt hatte. Janine war selbst für mindestens zwei Paarungen verantwortlich, die sich als alles andere als ideal erwiesen hatten, obwohl dies wahrscheinlich nicht der geeignete Zeitpunkt war, das anzumerken.
»Ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist«, gab Janine zu. »Ich weiß nicht, warum mir das Ganze so zugesetzt hat. Wahrscheinlich PMS.«
»Apropos... nun ja, nicht direkt«, sagte Casey, hielt inne, uneins mit sich, ob sie weitersprechen sollte, und sprudelte dann doch weiter. »Warren und ich haben darüber gesprochen, ein Kind zu bekommen.«
»Das ist nicht dein Ernst«, sagte Janine, und ihr schmallippiger Mund rutschte gemeinsam mit ihrem spitzen Kinn Richtung Tischdecke.
»Ich kann nicht glauben, dass du bis nach dem Essen gewartet hast, um uns so wichtige Neuigkeiten zu erzählen«, sagte Gail und unterstrich ihren Satz mit einem kurzen Lachen.
»Nun, bis jetzt waren es nur Gedankenspiele.«
»Und jetzt nicht mehr?«, fragte Janine.
»Ende des Monats setze ich die Pille ab.«
»Das ist ja toll!«, flötete Gail.
»Und du bist sicher, dass es der richtige Zeitpunkt ist?«, fragte Janine. »Ich meine, so lange seid ihr doch noch gar nicht verheiratet, und du hast gerade eine neue Firma gegründet.«
»Die Firma läuft super, meine Ehe könnte nicht besser sein, und wie du eben festgestellt hast, sind wir nicht mehr auf der Uni. Ich werde dreiunddreißig. Wenn alles nach Plan läuft, kommt das Baby vielleicht sogar schon um meinen Geburtstag herum zur Welt.«
»Und wann wäre bei dir irgendwas je nicht nach Plan gelaufen?«, fragte Janine mit einem Lächeln.
»Schön für dich.« Gail tätschelte Caseys Hand. »Ich finde es großartig. Du wirst bestimmt eine tolle Mutter.«
»Glaubst du wirklich? Ich hatte ja nicht gerade ein tolles Vorbild.«
»Du hast deine Schwester praktisch alleine großgezogen«, bemerkte Gail.
»Ja, und schau dir an, was aus ihr geworden ist.« Casey blickte wieder zu dem Stillleben an der Wand und atmete tief ein, als wollte sie den Duft der rosafarben leuchtenden Pfingstrosen in sich aufnehmen.
»Wie geht es Drew überhaupt?«, fragte Janine, obwohl ihr Ton erkennen ließ, dass sie die Antwort bereits kannte.
»Ich habe seit Wochen nichts von ihr gehört. Sie ruft nicht an und reagiert auch nicht auf meine Nachrichten.«
»Typisch.«
»Sie meldet sich bestimmt«, sagte Gail, diesmal ohne ein leises Lachen zur Untermalung.
Janine machte dem Kellner ein Zeichen, die Rechnung zu bringen, indem sie die Finger in der Luft schwenkte, als würde sie den Beleg schon unterschreiben. »Bist du ganz sicher, dass du diesen perfekten Körper aufgeben willst?«, fragte sie Casey, als der junge Mann die Rechnung brachte. »Du weißt ja, er wird nie mehr derselbe sein.«
»Das ist schon okay. Es ist Zeit...«
»... für etwas Neues?«, frotzelte Janine.
»Deine Brüste werden größer werden«, sagte Gail.
»Das ist doch nett«, sagte Casey, während Janine den Betrag dividierte.
»Fünfzig für jede inklusive Trinkgeld«, verkündete sie kurz darauf. »Warum gebt ihr mir nicht das Geld, und ich lasse alles auf meine Kreditkarte setzen, damit es schneller geht?«
Casey wusste, dass Janines Vorschlag nichts mit der Beschleunigung des Verfahrens, dafür jedoch alles mit der steuerlichen Absetzbarkeit ihres Lunchs als Geschäftsessen zu tun hatte. »Und was machst du am Wochenende?«, fragte sie und gab Janine das abgezählte Geld.
»Ich habe ein Date mit dem Banker, mit dem ich letzte Woche schon mal weggegangen bin.« Janines blaue Augen sprühten keineswegs vor Begeisterung.
»Das ist doch nett«, sagte Gail. »Oder nicht?«
»Eigentlich nicht. Aber er hat Karten für Jersey Boys, und ihr wisst ja, wie schwer man an Tickets kommt, wie hätte ich da ablehnen können?«
»Oh, es wird dir gefallen«, sagte Casey. »Es ist fantastisch. Ich habe das Original vor ein paar Jahren am Broadway gesehen.«
»Selbstredend.« Janine lächelte und stand auf. »Und diese Woche wirst du mit deinem fabelhaften Ehemann fabelhafte Babys machen. Sorry«, fügte sie im selben Atemzug hinzu. »Ich bin echt fies. Das muss PMS sein.«
»Wohin gehst du jetzt?«, fragte Gail Casey, während sie auf ihre Mäntel warteten.
»Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen hier. Eigentlich wollte ich noch joggen, aber die Zeit bis zu meinem nächsten Termin reicht wohl nicht mehr.« Casey sah auf ihre Uhr, eine goldene Cartier, die ihr Mann ihr zu ihrem zweiten Hochzeitstag im vergangenen Monat geschenkt hatte.
»Spar deine Kräfte für heute Nacht«, riet Janine ihr leise und beugte sich herab, um Casey auf die Wange zu küssen. »Komm, Gail, ich setz dich noch bei deiner Arbeit ab.«
Casey sah ihren beiden Freundinnen nach, die Arm in Arm die South Street hinuntergingen, und fand, dass sie einen markanten Gegensatz bildeten: Janine, hoch aufgeschossen und gefasst, Gail kleiner und in alle Richtungen quellend; Janine ein teures Glas Champagner, Gail ein Krug frisch gezapftes Bier.
Und was wäre sie dann, fragte Casey sich. Vielleicht sollte sie einen angesagteren Haarschnitt probieren, obwohl lange blonde Haare eigentlich nie aus der Mode gekommen waren. Und sie passten gut zu ihrem ovalen Gesicht, ihrer hellen Haut und ihren feinen Zügen. »Versuch gar nicht erst, mir zu erzählen, dass du nicht Prom Queen beim Abschlussball deiner Highschool warst«, hatte Janine gleich bei ihrer ersten Begegnung gemeint. Casey hatte damals nur gelacht und geschwiegen. Sie war Prom Queen gewesen, außerdem Vorsitzende des Debattierclubs und Mannschaftsführerin des Schwimmteams und hatte überdies einen beinahe perfekten Notendurchschnitt, aber die Leute hatten sich schon immer mehr dafür interessiert, wie sie aussah und wie viel Geld sie besaß. »Irgendjemand hat mir gerade erzählt, dass dein Alter milliardenschwer ist«, hatte Janine bei einer anderen Gelegenheit bemerkt, und wieder war Casey stumm geblieben. Ja, es stimmte, dass ihre Familie beinahe obszön reich war. Es stimmte auch, dass ihr Vater ein berüchtigter Schürzenjäger war, ihre Mutter eine egozentrische Alkoholikerin und ihre jüngere Schwester ein Drogen konsumierendes Partygirl auf dem Weg zum echten Problemfall. Vier Jahre nach Caseys Examen waren ihre Eltern bei dem Absturz ihres Privatjets bei widrigem Wetter über der Chesapeake Bay ums Leben gekommen, womit ihre Schwester auch offiziell zum Problemfall wurde.
Diese Gedanken nahmen Casey auch noch wenig später in Beschlag, als sie die South Street hinunterging, Philadelphias Entsprechung von Greenwich Village. Es war ein kunterbuntes Gemisch aus beißenden Essensgerüchen, schäbigen Tätowierungsstudios, hippen Lederboutiquen und Avantgarde-Galerien. Wahrhaftig eine Welt für sich, dachte sie, als sie South Philly erreichte und auf das große Parkhaus an der Washington Avenue zuging. Das war das Problem, wenn man in der Gegend essen ging – es war beinahe unmöglich, einen Parkplatz zu finden, und sobald man die South Street hinter sich hatte, die die Grenze zwischen Center City und South Philadelphia bildete, war man mehr oder weniger in Rocky-Territorium.
Casey betrat das Parkhaus, nahm den Fahrstuhl in den vierten Stock und zog den Wagenschlüssel aus ihrer großen schwarzen Lederhandtasche, während sie auf ihr weißes Lexus-Sport-Coupé zuging, das am Ende des Parkdecks stand. In der Ferne hörte sie einen Motor aufheulen und blickte sich um, sah jedoch nichts. Bis auf die Reihen bunter Pkw war das Stockwerk völlig verlassen.
Sie hörte den Wagen erst, als er schon fast über ihr war. Sie hatte den rechten Arm ausgestreckt, den Daumen auf dem Knopf der Zentralverriegelung, als ein silberner Van um die Ecke schlingerte und auf sie zugeschossen kam. Sie hatte keine
KAPITEL 2
Sie öffnete die Augen in der Dunkelheit.
Und nicht bloß gewöhnliche Dunkelheit, dachte Casey, bemüht, auch nur einen winzigen Lichtschein auszumachen. Es war das schwärzeste Schwarz, das sie je gesehen hatte, eine Mauer, undurchdringlich und dicht, über die sie nicht hinweg- und an der sie nicht vorbeigucken konnte und die nicht den Hauch eines Farbtons oder Schattens erkennen ließ. Als wäre sie versehentlich in ein schwarzes Loch im Universum gefallen.
Wo war sie? Und warum war es so dunkel?
»Hallo? Ist da jemand?«
War sie allein? Konnte irgendjemand sie hören?
Sie erhielt keine Antwort. Casey spürte Panik in ihrer Brust aufsteigen und versuchte, sich mit ein paar tiefen Atemzügen zu beruhigen. Es musste eine logische Erklärung geben, und sie weigerte sich, ihrer Furcht nachzugeben, weil sie wusste, dass diese sich ausdehnen würde, bis kein Platz mehr für etwas anderes wäre. Ihre Angst war wie Gift, das in ihr Blut ausschüttet wurde und in jede Faser ihres Körpers vordrang.
»Hallo? Kann mich irgendjemand hören?«
Sie öffnete die Augen und blinzelte, Janines Tadel im Hinterkopf, dass Blinzeln Falten machte. »Janine«, flüsterte Casey, als sie sich vage an ihr gemeinsames Mittagessen erinnerte. Wann war das gewesen? Wie lange war das her?
Noch nicht lange, entschied Casey. Hatte sie sich nicht eben noch von ihr verabschiedet? Ja, genau. Sie hatte mit Janine und Gail in der South Street zu Mittag gegessen – sie hatte einen köstlichen warmen Salat mit Hühnchen und Papayas und ein Glas Pinot Grigio genossen – und war dann zur Washington Street gelaufen, wo ihr Wagen parkte. Und was dann?
Und dann... nichts.
Casey sah sich über das schräge Deck des alten Parkhauses zu ihrem Wagen gehen, hörte die klickenden Absätze ihrer schwarzen Ferragamo-Pumps auf dem unebenen Betonboden und ein weiteres Geräusch, ein leises Grollen wie ferner Donner, der näher kam. Was war das? Warum konnte sie sich nicht daran erinnern?
Was war passiert?
In exakt diesem Moment merkte Casey, dass sie sich nicht bewegen konnte. »Was...?«, begann sie und brach ab. Warum konnte sie sich nicht bewegen? War sie festgebunden?
Sie versuchte, die Hände zu heben, konnte sie jedoch nicht spüren. Dann versuchte sie, mit den Füßen auszutreten, konnte diese jedoch ebenfalls nicht verorten. Es war, als wären sie gar nicht da, als wäre sie ein körperloser Kopf, ein Leib ohne Gliedmaßen. Wenn es nur ein wenig Licht gäbe. Wenn sie nur irgendwas sehen könnte. Irgendetwas, das ihr einen Hinweis auf ihre Lage geben konnte. Sie wusste nicht einmal, ob sie lag oder aufrecht saß, wie ihr jetzt bewusst wurde. Sie versuchte, den Kopf zu drehen und mühte sich, als das misslang, ihn wenigstens zu heben.
Ich bin entführt worden, dachte sie, nach wie vor bemüht, ihre Situation zu begreifen. Irgendein Verrückter hatte sie in dem Parkhaus geschnappt und in seinem Garten lebendig begraben. Hatte sie nicht vor Urzeiten einen Film mit genau dieser Handlung gesehen? Mit Kiefer Sutherland als Held und Jeff Bridges als Bösewicht, wenn sie sich recht erinnerte, sowie Sandra Bullock in einer Nebenrolle als Kiefer Sutherlands bedauernswerte Freundin, die an einer Tankstelle mit Chloroform betäubt wurde und in einem unterirdischen Sarg wieder zu sich kam.
O Gott, o Gott. Hatte irgendein Irrer diesen Film auch gesehen und beschlossen, ihn nachzuspielen? Ruhig bleiben. Ruhig. Ganz ruhig.
Casey bemühte sich, ihren abgerissenen Atem wieder unter Kontrolle zu bekommen. Wenn sie tatsächlich entführt worden war und in einem Sarg unter der Erde lag, war ihr Sauerstoffvorrat begrenzt, und sie durfte keinesfalls verschwenderisch damit umgehen. Obwohl es sich nicht besonders stickig anfühlte. Oder kalt. Oder heiß. Oder irgendwas.
Sie spürte überhaupt nichts.
»Okay, okay«, flüsterte sie und strengte sich an, Spuren ihres Atems in der Dunkelheit auszumachen. Aber sie sah wieder nichts. Casey schloss die Augen, zählte stumm bis zehn und öffnete sie wieder.
Nichts. Nichts außer tiefer, unendlicher Schwärze.
War sie tot?
»Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht sein.«
Natürlich war es nicht wahr, erkannte sie dann unendlich erleichtert. Es war ein Traum. Ein Albtraum. Was war los mit ihr? Warum hatte sie das nicht früher begriffen? Sie hätte sich eine Menge nutzlosen Kummer und vergeudete Energie ersparen können. Sie hätte die ganze Zeit wissen können, dass sie nur träumte.
Jetzt musste sie nur noch aufwachen. Los, Dummerchen. Du kannst es. Wach auf, verdammt noch mal. Wach auf.
Sie konnte sich bloß nicht erinnern, ins Bett gegangen zu sein.
»Aber so muss es gewesen sein. So und nicht anders.« Offensichtlich war der ganze Tag ein einziger Traum gewesen. Das Treffen um neun Uhr mit Rhonda Miller, bei dem es um die Gestaltung der neuen Eigentumswohnung der Millers am Flussufer ging, hatte in Wahrheit gar nicht stattgefunden. Sie hatte auch nicht mehrere Stunden lang die große Auswahl an Stoffen bei Fabric Row begutachtet. Oder ihre Freundinnen zum Mittagessen im Southwark getroffen. Sie hatten nicht über Janines Frisur und ihre unangenehme Begegnung mit Richard Mooney gesprochen. Der kleine Blödmann, wie Janine ihn genannt hatte.
Seit wann erinnerte sie sich so lebhaft und detailliert an ihre Träume, fragte Casey sich. Vor allem, wenn sie noch mitten im Traum war. Was für ein Albtraum war das? Warum konnte sie nicht einfach die Augen aufmachen?
Wach auf, drängte sie sich und wiederholte es laut: »Wach auf!« Dann noch einmal noch lauter: »Wach auf!« Sie hatte irgendwo gelesen, dass man sich manchmal mit einem lauten Schrei, der einen buchstäblich von einer Ebene des Bewusstseins auf eine andere schubsen würde, aus dem Schlaf reißen konnte. »Wach auf!«, schrie sie aus Leibeskräften und hoffte, Warren zu erschrecken, der zweifelsohne in ihrem großen Doppelbett neben ihr friedlich schlief, die Arme locker um sie gelegt.
Vielleicht konnte sie sich deshalb nicht bewegen. Vielleicht war Warren halb auf ihr liegend eingeschlafen oder sie hatte sich in ihre Daunendecke gewickelt wie in einen Kokon, sodass sie sich jetzt nicht mehr rühren und ihre Arme und Beine nicht mehr spüren konnte. Aber noch während Casey diese Gedanken dachte, wusste sie, dass das nicht stimmte. Sie konnte immer spüren, wenn ihr Mann in ihrer Nähe war. Und jetzt spürte sie gar nichts.
Warren Marshall war beinahe 1,80 Meter groß und knapp 85 Kilo schwer mit einem muskulösen Körper, den er dreimal die Woche in einem kleinen schicken Fitnessstudio in dem Nobelvorort Rosemont trainierte, wo sie wohnten. Casey konnte keinen Hauch seiner Gegenwart ausmachen, keine Spur seines sauberen, männlichen Geruchs.
Nein, Warren war nicht hier, wie ihr klar wurde, während neue Panik sie befiel. Niemand war hier. Sie war ganz allein.
Und sie träumte auch nicht.
»Hilfe«, rief sie. »Irgendjemand, bitte helfen Sie mir.«
Ihre Worte hallten in ihrem Kopf wider. Casey lag in ihrem schwarzen Loch, wartete vergeblich darauf, dass ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, und begann leise zu weinen.
Sie schlief ein und träumte, dass sie mit ihrem Vater Golf spielte. Sie war erst zehn, als er sie zum ersten Mal mit in den exklusiven Merion Golf Club genommen hatte, dessen Mitglied er war. Stundenlang hatte er mit ihr geduldig an der Perfektion ihres Schwungs gearbeitet und jedem in Hörweite stolz erklärt, dass sie ein Naturtalent sei. Sie war zwölf, als sie zum ersten Mal unter hundert Schlägen geblieben war, fünfzehn, als sie ihre erste Runde unter neunzig gespielt, zwanzig, als sie zum ersten Mal vom Abschlag eingelocht hatte. Sie erinnerte sich, ihrer jüngeren Schwester Hilfe angeboten zu haben, was Drew jedoch rundweg abgelehnt hatte, um lieber hilflos um sich zu dreschen, wütend den Schläger auf den Boden zu werfen und beleidigt vom Platz zu stürmen. »Lass sie«, hörte sie ihren Vater sagen. »Du bist die Sportlerin in der Familie, Casey.« Schließlich hatte er sie nach Casey Stengel benannt, erinnerte er sie. »Okay, schon gut, falsche Sportart, ich weiß«, pflegte er lachend zu sagen, und ihre Mutter verdrehte jedes Mal die Augen und wandte sich ab, um ein Gähnen zu unterdrücken, weil sie die Anekdote schon zu oft gehört hatte, um sie noch im Entferntesten amüsant zu finden. Wenn sie überhaupt je darüber hatte lachen können.
»Okay, kann mich bitte jemand auf den neuesten Stand bringen?«, hörte Casey ihren Vater jetzt sagen.
Sie spürte einen Wirbel in der Luft um ihren Kopf, als ob jemand in der Nähe ihres Gesichts ein Tamburin schlug.
»Ja, Dr. Peabody«, sagte ihr Vater.
Wer war Dr. Peabody? Ihr Hausarzt war, so lange Casey sich erinnern konnte, schon immer Dr. Marcus gewesen. Wer also war dieser Dr. Peabody? Und was hatte er in ihrem Traum zu suchen?
Erst jetzt wurde Casey bewusst, dass sie nicht mehr schlief und dass die Stimme, die sie gehört hatte, nicht die ihres verstorbenen Vaters, sondern die eines Menschen war, der gesund und munter nicht weit entfernt von ihr stand. Es war nach wie vor stockfinster, sodass sie niemanden sehen konnte. Aber sie war zumindest nicht mehr alleine, wie sie dankbar registrierte. Und die Stimmen kamen definitiv aus der Nähe. Früher oder später musste jemand auf sie stoßen. Sie musste sich nur bemerkbar machen.
»Hier bin ich«, rief sie.
»Die Patientin«, antwortete irgendjemand, ohne sie zu beachten, »ist eine zweiunddreißigjährige Frau, Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht vor etwa drei Wochen. Am 26. März, um genau zu sein.«
»Hey, Sie«, rief Casey. »Dr. Peabody, nehme ich an! Ich bin hier!«
»Sie wird künstlich ernährt und beatmet, nachdem sie ein schweres Polytrauma inklusive multipler Frakturen von Becken, Beinen und Armen erlitten hat, die komplizierte Operationen erforderlich gemacht haben«, fuhr der Arzt fort. »Die externe Fixation ist noch mindestens einen weiteren Monat notwendig, genau wie die Gipsverbände an ihren Armen. Gravierender waren massive Unterleibsblutungen, die zu Blutfluss in die Bauchhöhle geführt haben. Bei einem Bauchschnitt wurde ein Milzriss festgestellt, worauf eine Splenektomie durchgeführt wurde.«
Wovon zum Teufel redete er?, fragte Casey sich. Über wen redete er? Und warum drang die Stimme nur in Wellen zu ihr vor, in einem Moment klar und kräftig, im nächsten schwach und beinahe unverständlich? War es überhaupt eine Männerstimme? Und warum klang sie schwerfällig, wie von einer dicken Sirupschicht belegt? Waren sie unter Wasser? »Hey«, rief sie. »Können Sie das vielleicht später besprechen? Ich würde hier wirklich gern rauskommen.«
»Die CT hat zum Glück ergeben, dass es keine Wirbel-, Hals-, oder Rückenfrakturen gab, die zu einer Lähmung der unteren Gliedmaßen hätten führen können...«
»Glück scheint mir in diesem Fall eine etwas sonderbare Wortwahl, Dr. Peabody, finden Sie nicht?«, unterbrach die erste Stimme. »Wenn man bedenkt, dass die Patientin womöglich für den Rest ihres Lebens im Koma bleibt.«
Welche Patientin, fragte Casey sich. Wer waren diese Leute? Befand sie sich im Kellertunnel eines Krankenhauses? Und warum hörte sie niemand? Waren die Leute doch weiter weg, als sie zunächst angenommen hatte?
»Stimmt, Sir. Ich wollte keinesfalls andeuten...«
»Möchten Sie vielleicht fortfahren, Dr. Benson?«
Dr. Benson? Wer war Dr. Benson?
»Bei der Patientin wurden Subduralhämatome lokalisiert«, fuhr jemand anders fort, obwohl es zunehmend schwierig wurde, die einzelnen Stimmen auseinanderzuhalten, »worauf Dr. Jarvis die Schädelplatte durchbohrt hat, damit das unter der harten Hirnhaut angestaute Blut abfließen konnte.«
»Und die Prognose?«
»In den meisten Fällen allgemein gut, vor allem wenn der Patient so jung und in so guter körperlicher Verfassung ist wie Mrs. Marshall...«
Mrs. Marshall? Mrs. Marshall? »Verzeihung, aber so heiße ich.« Über wen redeten sie? Gab es noch eine andere Mrs. Marshall? Oder war das Ganze ein Streich, den Janine sich ausgedacht hatte? »Okay, Leute, ihr hattet euren Spaß. Genug ist genug. Würde mir jetzt bitte jemand sagen, was los ist?«
»Aber die Patientin hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, das zu dem Koma geführt hat. Wir haben in den letzten drei Wochen mehrere CTs durchgeführt, die zeigen, dass die Subduralhämatome abschwellen, aber der Schockzustand des Gehirns dauert an. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob Schäden bleiben oder nicht.«
»Und wie, Dr. Rekai«, sagte der Oberarzt, »lautet die endgültige Prognose?«
»Die lässt sich zurzeit unmöglich stellen«, kam die Antwort. »Das Gehirn der Patientin ist ordentlich durchgerüttelt worden, wie man so sagt.«
»Wer sagt das?«, wollte Casey wissen, empört über die beiläufige Brutalität der Diagnose. Irgendeine arme Frau lag im Koma, und diese Leute machten unsensible Scherze über ihren Zustand.
»Wie lange wird sie Ihrer Einschätzung nach an die lebenserhaltenden Apparate angeschlossen bleiben?«
»Ihre Familie wird im Moment wohl kaum darüber nachdenken, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Genauso wenig wie das Krankenhaus irgendwelchen diesbezüglichen Absichten zustimmen würde. Die Patientin hat ein kräftiges Herz, ihr Körper funktioniert, und wir wissen, dass auch ihr Gehirn funktioniert, obgleich sehr eingeschränkt. Casey Marshall könnte noch jahrelang künstlich beatmet werden. Sie könnte aber auch ebenso gut morgen aufwachen.«
»Casey Marshall?«, wiederholte Casey ungläubig. Wovon redete er? Die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als eine Casey Marshall gab …
»Ist die Tatsache, dass sie gestern die Augen geöffnet hat, von irgendeiner Bedeutung?«, fragte irgendjemand.
»Leider nicht«, kam unverzüglich die Antwort. »Es ist nicht ungewöhnlich, dass Komapatienten die Augen öffnen. Wie Sie wissen, ist es genau wie das Blinzeln ein unwillkürlicher Reflex. Sie sieht nichts, obwohl ihre Pupillen auf Licht reagieren.«
Wieder spürte Casey um sich herum Bewegung, obwohl sie sich keinen Reim darauf machen konnte, was das zu bedeuten hatte. Und welches Licht meinten sie?
»Und der Endotrachealtubus?«
»Wir führen morgen Nachmittag eine Tracheotomie durch.«
»Eine Tracheotomie?«, fragte Casey. »Was zum Teufel ist das?«
»Dr. Benson, möchten Sie uns vielleicht erklären, was bei einer Tracheotomie passiert?«
»Sie haben mich gehört?« Eine Woge der Erleichterung rollte über Casey hinweg. »Sie haben meine Frage tatsächlich gehört! Gott sei Dank. O Gott sei Dank. Ich bin nicht die Frau, von der Sie sprechen, die arme Frau im Koma. Ich hatte mir schon solche Sorgen gemacht.«
»Eine Tracheotomie wird in der Regel bei einem Patienten durchgeführt, der seit mehreren Wochen durch einen Endotrachealtubus beatmet wird«, antwortete Dr. Benson. »Wenn der Patient nicht unter akuter Lungeninsuffizienz leidet und wie diese Patientin einen relativ stabilen Eindruck macht, sollte man eine Tracheotomie durchführen, weil der Schlauch sonst die Trachea beschädigt.«
»Und was genau passiert bei diesem Eingriff, Dr. Zarb?«
Dr. Zarb? Dr. Rekai? Dr. Benson? Dr. Peabody? Wie viele Ärzte gab es hier? Warum konnte sie keinen von ihnen sehen? Und warum ignorierten sie sie so beharrlich? Sie war nicht die arme Frau, über die sie sprachen, die Frau, die im Koma lag. Möglicherweise für Jahre. Nein, das konnte nicht sein. Vielleicht für den Rest ihres Lebens. Lieber Gott, bitte, nein! Das kann nicht sein. Der Gedanke war einfach zu schrecklich. Ich muss hier raus. Ich muss sofort hier raus.
»Wir machen ein Ostium, eine Inzision in den Hals, um den Tubus nicht mehr durch den Mund, sondern direkt in die Luftröhre einzuführen«, erläuterte Dr. Zarb ohne weitere Aufforderung. »Wenn die Patientin später wieder ohne die Hilfe des Beatmungsgeräts atmen kann, entfernen wir den Schlauch und lassen die Trachea wieder zuwachsen.«
»Besteht in diesem Fall eine große Chance, dass das geschieht, Dr. Ein?«
»Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich sagen. Es gibt Faktoren, die für die Patientin sprechen: Casey Marshall ist jung. Sie ist sehr fit. Ihr Herz arbeitet tadellos...«
Nein. Das höre ich mir nicht an. Das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich bin nicht die Frau, über die sie sprechen. Ich bin nicht im Koma. Nein. Bin ich nicht. Bitte, lieber Gott. Hol mich hier raus.
»Nicht zu vergessen: Sie ist Ronald Lerners Tochter.«
Ich kann euch hören! Wie kann ich im Koma sein, wenn ich euch hören kann?
»Für diejenigen unter Ihnen, die zu jung sind, um sich zu erinnern: Ronald Lerner war ein Geschäftsmann mit zweifelhafter Moral, der immens erfolgreich an der Börse spekuliert hat und dann vor einigen Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Er hat den Großteil seines überaus ansehnlichen Vermögens der jungen Frau hinterlassen, die Sie im Koma vor sich liegen sehen, was wieder einmal nur beweist, dass man sich mit Geld sein Glück nicht kaufen kann. Niemand ist letztlich gegen die Launen des Schicksals gefeit. Obwohl Casey Marshall sich zumindest die beste Pflege leisten kann, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird.«
Das ist nicht wahr. Das passiert nicht wirklich.
»Wann kann die PEG-Sonde entfernt werden?«, hörte sie irgendjemanden – Dr. Peabody? Dr. Zarb? – fragen. Was zum Teufel war eine PEG-Sonde?
»Erst wenn die Patientin wieder selbst essen kann«, kam die Antwort, sodass Casey vermutete, dass es irgendein mit ihrem Bauch verbundener Ernährungsschlauch sein musste.
Ich will nach Hause. Bitte, lassen Sie mich einfach nach Hause gehen.
»Und die antibiotische Infusion?«
»Frühestens in einer Woche. Die Patientin ist nach den zahlreichen Eingriffen sehr entzündungsgefährdet. Hoffentlich können wir mit der Physiotherapie beginnen, sobald der Gips entfernt ist. Okay? Noch irgendwelche Fragen, bevor wir weitergehen?«
Ja! Sie müssen noch mal ganz von vorn anfangen. Erklären Sie mir alles, was passiert ist, den Unfall, wie ich hierhergekommen bin und was jetzt weiter mit mir geschieht. Sie können mich nicht einfach im Dunkeln allein lassen. Sie können nicht weggehen und so tun, als würde ich gar nicht existieren. Sie müssen zurückkommen. Ich kann Sie hören! Zählt das vielleicht gar nichts?
»Dr. Ein«, sagte irgendjemand.
»Ja, Dr. Benson.«
»Die Patientin scheint ein Unwohlsein zu empfinden. Sie verzieht das Gesicht, und ihre Herzfrequenz ist erhöht.«
Was passiert hier?
»Möglicherweise hat sie Schmerzen. Wir erhöhen die Dosis Dilaudid, Demerol und Ativan, die sie bekommt.«
Nein, ich brauche keine Medikamente. Ich habe keine Schmerzen. Sie müssen mir nur zuhören. Bitte, irgendjemand, hören Sie mich!
»Damit sollten Sie sich wohler fühlen, Casey«, sagte der Arzt.
Nein, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl.
»Gut, dann jetzt weiter.«
KAPITEL 3
»Casey«, hörte sie irgendjemanden leise sagen. Und dann noch einmal lauter: »Casey, wach auf, Schatz.«
Nur widerwillig ließ sich Casey von der Stimme ihres Mannes wecken. Sie öffnete die Augen, sah Warren, der sich über sie beugte, seine attraktiven Züge durch die Nähe verzerrt, seltsam aufgedunsen und wie ein gruseliger Wasserspeier. »Was ist los?«, fragte sie, versuchte, ihren seltsamen Traum abzuschütteln und stellte mit einem Blick auf den Radiowecker fest, dass es 3.00 Uhr in der Früh war.
»Da ist jemand im Haus«, flüsterte Warren und warf einen besorgten Blick über seine linke Schulter.
Casey folgte seinem Blick durch die Dunkelheit und richtete sich ängstlich im Bett auf.
»Ich glaube, dass vielleicht jemand durchs Kellerfenster eingestiegen ist«, fuhr Warren fort. »Ich habe versucht, den Notruf zu erreichen, aber die Leitungen sind tot.«
»O Gott.«
»Keine Sorge. Ich habe die Pistole.« Er hielt sie hoch. Ihr Lauf glänzte im Licht des Halbmondes vor dem Fenster.
Casey nickte und erinnerte sich an den Streit, den sie gehabt hatten, weil er unbedingt eine Waffe im Haus haben wollte. »Zu unserem Schutz«, hatte er gesagt und offenbar recht behalten. »Was machen wir jetzt?«, fragte sie.
»Wir verstecken uns im begehbaren Kleiderschrank, und wenn jemand dort nachsieht, mache ich ihn kalt.«
»Gott, das ist ja schauerlich«, sagte Casey mit Gails Stimme. »Redet wirklich noch irgendjemand so?«
»Im Fernsehen jedenfalls«, antwortete Warren.
Was? Was war los? Welches Fernsehen?
»Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen«, sagte Gail.
Was machte Gail in ihrem Schlafzimmer? Warum war sie ins Haus eingebrochen?
»Ich glaube, den hat noch niemand gesehen. Sieht aus wie einer dieser Filme, die direkt in den Videovertrieb gegangen sind. Aber die Ärzte meinen, dass ein laufender Fernseher vielleicht helfen könnte, Caseys Hirnaktivität zu stimulieren, und mir vertreibt es offen gesagt die Zeit.«
»Wie lange bist du schon hier?«, fragte Gail.
»Seit etwa acht Uhr.«
»Jetzt ist es fast eins. Hast du schon zu Mittag gegessen?«
»Eine der Krankenschwestern hat mir vor einer Stunde einen Kaffee gebracht.«
»Das ist alles?«
»Ich hab keinen besonders großen Hunger.«
»Du musst was essen, Warren. Du musst bei Kräften bleiben.«
»Mir geht es gut, Gail. Wirklich. Ich möchte nichts.«
»Sie kommen näher. Ich kann sie auf der Treppe hören. Uns bleibt keine Zeit mehr.«
Wovon redeten sie? Wer war auf der Treppe? Was war los?
»Los, kriech unters Bett. Beeil dich.«
»Ohne dich gehe ich nirgendwohin.«
Wer waren diese Leute?
»Genug von dem Mist«, sagte Warren.
Man hörte ein Klicken, und danach war es still.
Casey fragte sich, was vor sich ging, und stellte erschrocken fest, dass sie nicht wusste, ob ihre Augen offen oder geschlossen waren. Hatte sie geschlafen? Und wenn ja, wie lange? Hatte sie geträumt? Warum konnte sie nicht unterscheiden, was real war und was nicht? Waren diese Leute ihr Warren und ihre Gail? Wo war sie?
»Ihre Gesichtsfarbe sieht gesünder aus«, bemerkte Gail. »Gibt es irgendeine Veränderung?«
»Eigentlich nicht. Außer dass ihre Herzfrequenz ungewöhnlichen Schwankungen unterliegt...«
»Ist das gut oder schlecht?«
»Die Ärzte wissen es nicht.«
»Die scheinen überhaupt nicht viel zu wissen, oder?«
»Sie denken, dass sie vielleicht unter stärkeren Schmerzen leidet …«
»Was nicht unbedingt schlecht sein muss«, unterbrach Gail ihn. »Ich meine, vielleicht ist es ein Zeichen, dass sie zu uns zurückkommt.«
»Patienten in einem tiefen Koma können trotzdem noch unter Schmerzen leiden«, sagte Warren tonlos. »Wie gerecht ist das?«
Casey konnte förmlich sehen, wie er den Kopf schüttelte. Das war auf jeden Fall ihr Warren, sie erkannte den vertrauten Ton seiner Stimme, den Rhythmus seiner Worte. Warren, du hast mich gefunden. Ich wusste es. Ich wusste, dass du mich nicht an diesem schrecklichen, dunklen Ort allein lassen würdest.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass das Casey ist«, sagte Gail. »Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, sah sie so schön aus, so voller Leben.«
»Sie ist immer noch schön«, entgegnete Warren, obwohl Casey einen defensiven Unterton heraushörte. »Die schönste Frau der Welt«, sagte er, und seine Stimme verlor sich.
Casey stellte sich vor, wie ihm Tränen in die Augen schossen, gegen die er tapfer ankämpfte. Wenn sie diese Tränen nur wegwischen könnte. Wenn sie ihn nur küssen und alles gutmachen könnte.
»Worüber habt ihr bei eurem Mädelstreffen eigentlich gesprochen?«, fragte er. »Du hast mir noch gar nichts von dem Mittagessen erzählt.«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte Gail, der kurze Satz eingerahmt von einem zweimaligen Kichern. »Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, worüber wir geredet haben. Das Übliche, nehme ich an.« Sie lachte erneut, obwohl es eher traurig als fröhlich klang. »Mir war nicht klar, dass ich unserem Treffen mehr Bedeutung als üblich hätte zumessen sollen. Mir war nicht bewusst, dass es vielleicht unsere letzte Begegnung sein könnte. O Gott.« Ein lautes Schluchzen zerriss die Luft wie ein Donnerschlag aus dem Nichts.
O Gail, bitte nicht weinen. Alles wird gut. Ich werde wieder gesund. Versprochen.
»Tut mir leid, das vergesse ich immer wieder«, sagte Warren. »Für dich wühlt es bestimmt schmerzhafte Erinnerungen auf.«
Casey malte sich aus, wie Gail sanft mit den Schultern zuckte und ein paar widerspenstige Strähnen hinter ihr rechtes Ohr strich. »Mike war die letzten beiden Monate vor seinem Tod in einem Hospiz«, sagte Gail über ihren Mann, der vor fünf Jahren an Leukämie gestorben war. »Man konnte nichts für ihn tun außer zuzusehen, wie er langsam immer mehr abbaute. Aber wir hatten wenigstens ein paar Jahre, um uns darauf vorzubereiten«, fuhr sie fort. »Obwohl man im Grunde nie wirklich darauf vorbereitet ist«, sagte sie im nächsten Atemzug. »Nicht bei jemandem, der so jung ist.«
»Casey wird nicht sterben«, beharrte Warren.
Er hat recht. Die Ärzte haben eine Fehldiagnose gestellt. Das Ganze ist ein großer Irrtum.
»Ich denke nicht mal darüber nach, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden.«
»Die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden?«, fragte Gail. »Wann haben die Ärzte denn vorgeschlagen, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden.«
»Gar nicht. Sie waren sich mit mir einig, dass es noch viel zu früh ist, um in diese Richtung zu denken.«
»Natürlich. Wer dann?«
»Was glaubst du?«
»Oh«, sagte Gail. »Ich wusste nicht, dass Drew in letzter Zeit hier war.«
Meine Schwester war hier?
»Soll das ein Scherz sein? Sie war nur einmal hier, direkt nach dem Unfall. Sie sagt, sie erträgt es nicht, ihre Schwester in diesem Zustand zu sehen.«
»Klingt wie Drew«, sagte Gail.
»Gestern Abend hat sie angerufen und nach dem neuesten Stand gefragt«, fuhr Warren fort. »Als ich ihr erzählt habe, dass Caseys Zustand unverändert ist, wollte sie wissen, wie lange ich sie so leiden lassen wolle. Sie sagte, sie kenne ihre Schwester viel länger als ich und wisse, dass sie auf keinen Fall als hirntoter Krüppel enden wollte...«
Hirntoter Krüppel? Nein, die Ärzte haben sich geirrt und alle unnötig verrückt gemacht.
»... der nur von ein paar Schläuchen und einem Beatmungsgerät am Leben erhalten wird.«
»Nur so lange, bis sie wieder allein atmen kann«, sagte Gail entschieden. So eindringlich hatte Casey ihre Freundin lange nicht erlebt. »Casey wird das durchstehen. Die gebrochenen Knochen wachsen wieder zusammen. Ihr Körper heilt sich selbst. Sie kommt wieder zu sich. Du wirst sehen, Casey wird wieder so wie eh und je sein. Das Koma ist nur eine Reaktion ihres Körpers, um sich selber zu heilen. Wir sollten dankbar sein, dass sie nicht wach ist und weiß, was los ist...«
Nur dass sie es trotzdem wusste, musste Casey sich eingestehen, als ihr der Ernst ihrer Lage plötzlich mit aller Wucht deutlich wurde.
Die Patientin ist eine zweiunddreißigjährige Frau, Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht vor etwa drei Wochen... Sie wird künstlich ernährt und beatmet... Polytrauma... komplizierte Operationen... externe Fixation... massive Unterleibsblutungen... Splenektomie durchgeführt... Patientin womöglich für den Rest ihres Lebens im Koma.
Für den Rest ihres Lebens im Koma.
»Nein, nein, nein!«, rief Casey. Aber sosehr sie es auch leugnete, wegerklärte und vorgab, die Ärzte könnten sich irren, so wenig ließ sich die grausame Wahrheit ihres Zustands noch länger verdrängen: Sie war eine zweiunddreißigjährige Frau, gefangen in einem möglicherweise irreparablen Koma, in dem sie gemeinerweise hören, jedoch nichts sehen, denken, sich jedoch nicht mitteilen, existieren, aber nicht agieren konnte. Ohne die Hilfe einer Maschine konnte sie nicht einmal atmen. Das war schlimmer als in einer dunklen, feuchten, unterirdischen Höhle verloren zu sein. Oder als lebendig begraben. Schlimmer noch als tot zu sein. War sie dazu verdammt, den Rest ihrer Tage in dieser dunklen Bewegungslosigkeit zu verharren und nicht unterscheiden zu können, was wirklich passierte und was sie sich nur einbildete? Wie lange konnte das so gehen?
Subduralhämatome… Schädelplatte durchbohrt… angestautes Blut abfließen... schweres Schädel-Hirn-Trauma... Casey Marshall könnte noch jahrelang künstlich beatmet werden. Sie könnte aber auch ebenso gut morgen aufwachen.
Wie viele Stunden, Tage, Wochen konnte sie hier im Dunkeln liegen und einer Folge von Stimmen lauschen, die wie Wolken durch ihren Kopf schwebten? Wie viele Wochen, Monate, Jahre – Gott behüte – konnte sie überleben, ohne die Menschen zu erreichen, die sie liebte?
Das Gehirn der Patientin ist ordentlich durchgerüttelt worden.
Und wie lange konnte es dauern, bis die Besuche ihrer Freundinnen weniger wurden und ganz aufhörten, wie lange, bis am Ende auch ihr Mann weiterzog? Gail sprach kaum noch von Mike. Und Warren war erst siebenunddreißig. Vielleicht umsorgte er sie noch ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder zwei, aber irgendwann würde er sich in die allzu bereitwilligen Arme einer anderen locken lassen. Und nach und nach würden auch alle anderen wieder in den gewohnten Trott ihres Alltags verfallen. Irgendwann würden selbst die Ärzte das Interesse verlieren. Man würde sie in eine Reha-Einrichtung bringen, wo sie am Ende eines muffigen Flures in einem Rollstuhl festgeschnallt einer endlosen Folge von trostlos schlurfenden Schritten lauschen musste. Wie lange konnte es dauern, bis sie verrückt wurde vor frustrierter Wut, schierer Langeweile und der Vorhersehbarkeit des Ganzen?
Sie könnte aber auch ebenso gut morgen aufwachen.
»Ich könnte auch morgen aufwachen«, wiederholte Casey und versuchte, Trost aus dem Gedanken zu ziehen. Wie sie mitbekommen hatte, hatte der Unfall sich vor drei Wochen ereignet. Also war Gails Optimismus vielleicht nicht ganz unbegründet. Vielleicht war es ein gutes Zeichen, dass sie jetzt hörte, ein Indiz dafür, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befand. Ihr Hörsinn war zurückgekehrt. Sie hatte die Augen geöffnet. Vielleicht würde sich die Dunkelheit morgen lichten, und sie konnte wieder sehen. Wenn erst mal der Schlauch aus ihrem Mund entfernt war – War das bereits geschehen? Hatten die Ärzte die Tracheotomie, über die sie gesprochen hatten, schon durchgeführt? Und wenn ja, wann? -, dann würde sie vielleicht lernen, ihre Stimmbänder wieder zu benutzen. Sie hatte schon gelernt, die Stimmen der anderen besser zu unterscheiden. Sie verschwammen nicht mehr miteinander wie am Anfang oder klangen, als würden sie durch eine dicke Mauer zu ihr dringen. Vielleicht war es morgen noch besser. Vielleicht konnte sie mit Blinzeln auf Fragen reagieren. Vielleicht konnte sie den anderen irgendwie mitteilen, dass sie wach war und mitbekam, was gesagt wurde.
Vielleicht wurde sie sogar wieder gesund.
Genauso gut konnte es aber auch sein, dass ihr überhaupt nicht zu helfen war, dachte sie plötzlich ernüchtert. Und in diesem Fall hatte ihre Schwester recht.
Dann wäre sie lieber tot.
»Verfolgt die Polizei eine neue Spur?«, hörte sie Gail fragen.
»Nicht dass ich wüsste«, sagte Warren. »Keine Kfz-Werkstatt in Philadelphia hat die Reparatur eines Wagens durchgeführt, der so schwer beschädigt war, wie man es nach einem solchen Unfall vermuten würde. Und trotz der ganzen Berichterstattung haben sich auch keine Zeugen gemeldet. Der Wagen hat sich scheinbar in Luft aufgelöst.«
»Wie kann jemand etwas so Schreckliches tun?«, fragte Gail. »Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass er sie angefahren hat, aber sie dann einfach so liegen zu lassen...«
Casey stellte sich vor, dass Warren den Kopf schüttelte. Sie sah eine Strähne seines hellbraunen Haars in seine Stirn und seine dunkelbraunen Augen fallen.
»Vielleicht hatte der Fahrer getrunken. Wahrscheinlich ist er in Panik geraten«, spekulierte er. »Wer weiß was in den Köpfen der Leute vor sich geht?«
»Man sollte doch meinen, dass sein schlechtes Gewissen inzwischen die Oberhand gewonnen hat«, sagte Gail.
»Sollte man meinen«, stimmte Warren ihr zu.
Wieder schwiegen beide.
»Oh«, rief Gail plötzlich.
»Was?«
»Mir ist gerade eingefallen, worüber wir beim Mittagessen geredet haben«, sagte sie plötzlich sehr traurig.
»Worüber denn?«
»Casey hat erzählt, dass ihr über Kinder gesprochen habt. Dass sie aufhören wollte, die Pille zu nehmen.«
Casey verspürte ein stechendes Schuldgefühl. Das hätte ihr Geheimnis bleiben sollen. Sie hatte Warren versprochen, niemandem irgendwas zu erzählen, bis sie alle vor vollendete Tatsachen stellen konnten. »Willst du, dass du von Monat zu Monat gefragt wirst, ob es geklappt hat?«, hatte er sanft eingewandt, und sie hatte ihm zustimmen müssen. War er jetzt enttäuscht oder vielleicht sogar wütend, dass sie ihr Wort nicht gehalten hatte?
»Ja«, hörte sie ihn sagen. »Sie war ganz aufgeregt. Und natürlich auch ein bisschen nervös. Wegen ihrer Mutter, nehme ich an.«
»Ja, ihre Mutter war eine Marke für sich.«
»Richtig. Du kanntest sie, oder? Das hatte ich vergessen.«
»Ich glaube nicht, dass irgendjemand Alana Lerner wirklich gekannt hat«, sagte Gail.
»Casey spricht fast nie über sie.«
»Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Sie hätte besser keine Kinder haben sollen.«
»Und trotzdem hat sie zwei bekommen«, bemerkte Warren.
»Nur weil Mr. Lerner einen Jungen wollte. Nach der Geburt hatte sie nicht mehr viel mit ihnen zu tun. Sie wurden mehr oder weniger von Kindermädchen erzogen.«
»Kindermädchen, die nach kurzer Zeit wieder gefeuert wurden, soweit ich weiß. Eins nach dem anderen.«
»Weil Mrs. Lerner überzeugt war, dass ihr Mann mit ihnen schlief. Was er wahrscheinlich auch tat. Er hat aus seinen Affären jedenfalls bestimmt kein Geheimnis gemacht.«
»Schöne Familie.«
»Es ist ein Wunder, dass Casey so ein guter Mensch geworden ist«, sagte Gail und brach in Tränen aus. »Tut mir leid.«
»Es muss dir nicht leidtun. Ich weiß, wie sehr du sie magst.«
»Wusstest du, dass sie meine Brautjungfer war?«, fragte Gail und fuhr fort, bevor Warren antworten konnte. »Kaum zu glauben, aber ich habe Mike direkt nach der Highschool geheiratet. Ich war achtzehn, Herrgott noch mal. Ein Baby. Mike war zehn Jahre älter, und man hatte bei ihm gerade Leukämie diagnostiziert. Alle haben gesagt, ich würde mein Leben ruinieren, dass es Wahnsinn wäre, ihn zu heiraten. Alle bis auf Casey. Sie hat gesagt: ›Mach es. Trau dich.‹« Wieder ging Gails Stimme in lautem Schluchzen unter.
»Sie wird wieder gesund, Gail.«
»Versprichst du mir das?«, fragte Gail wie ein Echo von Caseys stummer Frage.
Aber bevor Warren antworten konnte, brach auf einmal geschäftiges Treiben aus. Casey hörte, wie eine Tür aufgestoßen wurde, Schritte robuster Schuhe und Stimmen. »Ich fürchte, wir müssen Sie bitten, den Raum für ein paar Minuten zu verlassen«, verkündete eine Frau. »Wir müssen die Patientin waschen und in eine andere Lage betten, damit sie sich nicht wund liegt.«
»Wir brauchen zehn, höchstens fünfzehn Minuten«, fügte eine zweite, höhere Stimme hinzu.
»Warum gehen wir nicht in die Cafeteria und essen eine Kleinigkeit?«, schlug Gail vor.
»Na gut«, sagte Warren.
Casey hörte den Widerwillen in seiner Stimme und spürte, wie er aus dem Zimmer gezogen wurde.
»Keine Sorge, Mr. Marshall«, beruhigte die erste Krankenschwester ihn. »Patsy und ich werden uns gut um Ihre Frau kümmern.«
»Ich bin gleich zurück, Casey«, sagte Warren.
Casey war, als spüre sie, wie er sich über sie beugte und vielleicht sogar ihre Hand unter dem Laken tätschelte. Oder bildete sie sich das bloß ein?
»Also, das ist mal ein reizender Mann«, verkündete Patsy eine halbe Oktave tiefer, nachdem die Tür geschlossen worden war. »Er tut mir ja so leid.«
»Ja, in seinen Schuhen möchte ich jedenfalls nicht stecken«, sagte die andere Krankenschwester. »Hast du übrigens ihre Schuhe gesehen?«
»Was? Nein, Donna. Hab ich nicht.«
»Sehr schick. Sehr teuer.«
»Ist mir nicht aufgefallen. Okay, Mrs. Marshall«, sagte Patsy und wandte ihre Aufmerksamkeit Casey zu. »Jetzt machen wir Sie schön sauber für Ihren reizenden Mann.«
Casey hörte das Rascheln des Lakens und fühlte sich, obwohl sie nichts spürte, entblößt. Trug sie einen Krankenhauskittel oder ein Nachthemd aus ihrem eigenen Kleiderschrank? Hatte sie überhaupt etwas an? Fassten sie sie an? Und wenn ja, wo?
»Was glaubst du wohl, wie lange es ihn hier hält?«, formulierte Donna Caseys Frage von vorhin laut. »Sobald er erkennt, dass es nicht besser wird...«
»Psst. Sag das nicht«, ermahnte Patsy sie.
»Was? Sie kann mich sowieso nicht hören.«
»Das kann man nicht mit Sicherheit wissen. Sie hat schließlich die Augen aufgemacht, oder nicht?«
»Das hat nichts zu bedeuten. Ich habe einen der Ärzte reden hören. Er hat gesagt, wenn sie die Augen öffnen, ist das oft ein schlechtes Zeichen. Es könnte den Beginn eines tiefen vegetativen Stadiums markieren.«
»Na, hoffen wir, dass er sich irrt.«
Casey fragte sich, wie Donna und Patsy aussahen, und stellte sich die eine groß und blond, die andere klein und dunkelhaarig vor. Oder vielleicht groß und dunkelhaarig, spekulierte sie, tauschte die äußeren Merkmale der beiden Frauen aus und probierte verschiedene Köpfe auf verschiedenen Körpern. Erst stellte sie sich Schwester Patsy mit Dolly-Parton-Brüsten und Donna flach wie das sprichwörtliche Brett vor. Vielleicht war Patsy auch ein Rotschopf. Und Donna hatte weiche, samtschwarze Haut. Wie auch immer sie aussahen, in einem hatten sie recht: Warren Marshall war ein verdammt attraktiver Mann.
Casey lachte, weil sie wusste, dass sie sie nicht hören konnten. Für sie war sie bloß ein lebloses Objekt. Ein Körper, der regelmäßig gewendet und gewaschen werden musste, um wund gelegene Stellen und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Ein ödes Stillleben, das ist aus mir geworden, dachte sie, und ihr Lachen erstarb.
»Oh, schau mal, ihr Gesicht«, sagte Patsy plötzlich.
»Was ist denn mit ihrem Gesicht?«, wollte Donna wissen.
»Sie sieht auf einmal so traurig aus.«
»Wovon redest du?«, fragte Donna.
»Findest du nicht, dass ihre Augen traurig aussehen.«
»Ich finde, dass ihre Augen offen sind. Mehr nicht. Okay, ich bin mit der Vorderseite fertig. Hilfst du mir, sie umzudrehen?«
Casey hatte das Gefühl, dass ihr Körper angefasst und ihr Kopf gedreht wurde, obwohl sie sich nicht sicher war, ob sie irgendwas davon wirklich spürte oder sich alles bloß vorstellte.