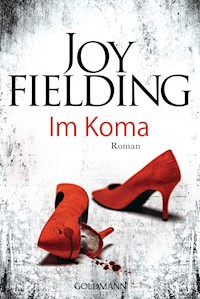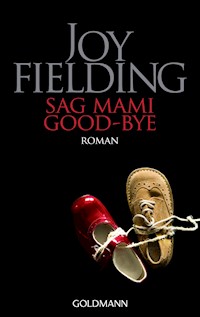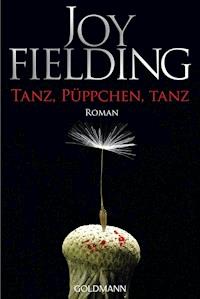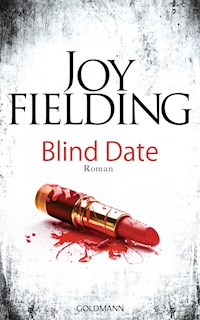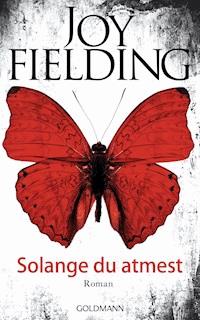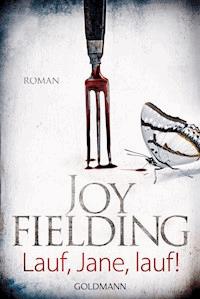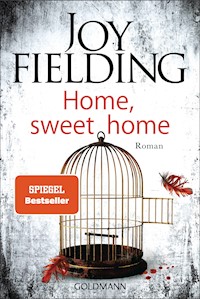
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf gute Nachbarschaft ...
Nach einem traumatischen Erlebnis zieht Maggie mit ihrer Familie nach Palm Beach Gardens in Florida. Sie hofft, in der gepflegten Gegend mit den freundlichen Nachbarn ihre Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Doch dann verlässt sie ihr Mann, und auch die Idylle ihres Viertels erweist sich als trügerisch: Eine lautstarke Auseinandersetzung im Haus gegenüber, zwielichtiger Besuch nebenan, spitze Bemerkungen bei einem gemeinsamen Grillfest. Schnell gerät Maggie zwischen die Fronten und muss um ihre und die Sicherheit ihrer Kinder fürchten. Und als an einem heißen Sommermorgen der Knall eines Schusses die Stille zerreißt, ist allen klar: Hier ist mehr passiert als ein gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Nach einem traumatischen Erlebnis zieht Maggie mit ihrer Familie nach Palm Beach Gardens in Florida. Sie hofft, in der gepflegten Gegend mit den freundlichen Nachbarn ihre Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Doch dann verlässt sie ihr Mann, und auch die Idylle ihres Viertels erweist sich als trügerisch: Eine lautstarke Auseinandersetzung im Haus gegenüber, zwielichtiger Besuch nebenan, spitze Bemerkungen bei einem gemeinsamen Grillfest. Schnell gerät Maggie zwischen die Fronten und muss um ihre und die Sicherheit ihrer Kinder fürchten. Und als an einem heißen Sommermorgen der Knall eines Schusses die Stille zerreißt, ist allen klar: Hier ist mehr passiert als ein gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit …
Weitere Informationen zu Joy Fielding und lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Joy Fielding
Home, sweet home
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristian Lutze
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Cul-de-sac« bei Ballantine Books, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2021
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Joy Fielding
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ulla Mothes
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotiv: FinePic c/o Zero Werbeagentur GmbH (441994)
CN · Herstellung: Han
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-26279-2V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Hayden und Skylar
PROLOG
Normalerweise ist es eine so ruhige Straße. Klein, unauffällig, solide Mittelschicht. Kein Ort, wie man ihn für gewöhnlich mit den schockierenden Ereignissen jener heißen Julinacht in Verbindung bringen würde. Man kann jeden der Anwohner fragen, und sie werden einhellig erklären, dass keiner ihrer Nachbarn fähig schien, eine derart kaltblütige, abscheuliche Tat zu begehen.
Wie konnte das passieren, werden alle sich fragen, wenn sie am nächsten Morgen zusammenkommen, kopfschüttelnd und trotz der drückenden Hitze zitternd. Ich bin fassungslos. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte,es wären Fehlzündungen eines Autos. Oder vielleicht übriggebliebene Feuerwerkskörper.
Die Straße ist eine Sackgasse oder Cul-de-sac, wie sie hierzulande genannt wird. Der Begriff stammt aus dem Französischen, bedeutet wörtlich übersetzt »Boden eines Sacks« und ist vom lateinischen »culus« abgeleitet, was so viel heißt wie »Grund« oder »Boden«. Ursprünglich war es ein anatomischer Ausdruck, der »ein Gefäß oder eine Röhre mit nur einer Öffnung« bezeichnete, aber hier in Palm Beach Gardens, Florida, versteht man darunter eine kurze Sackgasse mit einer Wendeschleife.
Man stelle sich ein Hufeisen vor und fünf praktisch identische Häuser – bescheiden, zweistöckig in zarten Pastelltönen, jedes mit einer Doppelgarage –, die in gleichmäßigen Abständen um dieses Hufeisen verteilt sind, eins an der Rundung, jeweils zwei an jeder Seite. Zwischen den Häusern stehen Palmen, und es gibt keine Bürgersteige, sondern lediglich einen erhöhten Rinnstein, der die asphaltierte Straße von den kleinen Vorgärten trennt. Jeder Vorgarten ist wiederum durch einen kurzen, von Blumen gesäumten Pfad geteilt, der bis zu den zwei Stufen vor der Haustür führt.
Die Straße heißt offiziell und ohne erkennbaren Grund Carlyle Terrace und geht von der Hood Road ab, einer nur mäßig befahrenen Durchgangsstraße, die in ost-westlicher Richtung vom Florida Turnpike zum Military Trail verläuft, etwa zehn Minuten Fahrt vom Ozean und einen Steinwurf entfernt von mehreren privaten, gesicherten Golf-Wohnanlagen, mit denen die Gegend bebaut ist.
Oberflächlich betrachtet wirken die Menschen, die in dieser Straße leben, durchschnittlich, ja langweilig: eine frisch getrennte, alleinerziehende Mutter mit ihren beiden Kindern; ein Arzt mit Gattin, einer Zahnärztin, und ihren beiden Söhnen; ein weiteres Ehepaar mit drei Kindern; eine verwitwete Großmutter; ein junges, kaum ein Jahr verheiratetes Paar. Sie haben das übliche Spektrum von Problemen – Geldsorgen, schwierige Teenager, kleine Eifersüchteleien, die alltäglichen Konflikte einer Ehe. Niemand würde behaupten, alles sei nur Kerzenlicht und leise Musik gewesen. Hin und wieder konnte man eine erhobene Stimme, einen durch ein offenes Fenster dringenden Streit, eine laute Auseinandersetzung, vielleicht sogar eine zuknallende Tür hören.
Gerüchte im Überfluss – dieser könnte eine Affäre haben, jener ein Alkoholproblem, und die denkt wohl, sie sei zu gut für uns. Nachbarn tratschen halt.
Vor allem wenn man ihnen etwas zum Tratschen bietet.
Wer weiß, welches Böse im Herzen der Menschen lauert, zitiert Sean Grant, einer der Bewohner der Carlyle Terrace, gern eine uralte Radiosendung, die seine Eltern immer gehört hatten, als sie Kinder waren. Der Schatten weiß es, wird er im nächsten Atemzug antworten und zum Ende des Zitats andeutungsvoll die Stimme senken.
Es gibt jede Menge Schatten in dieser von Bäumen gesäumten Cul-de-sac, dieser hufeisenförmigen Sackgasse, die exakt nirgendwohin führt. Und Schatten sind Orte, wo Geheimnisse im Verborgenen vorzüglich wachsen und blühen können. Bis einige von ihnen zu groß und zu mächtig werden, um sie zu verbergen; bis sie explodieren wie eine achtlos geworfene Handgranate welche die nach außen so sorgfältig präsentierten, stillen Fassaden für immer einreißt und Knochen, Blut und Illusionen verspritzt, so weit das Auge reicht, jenseits von allem, was der Verstand begreifen kann.
Deshalb könnte man zunächst durchaus entschuldbar vermuten, dass die Schüsse, die mitten in jener heißen Julinacht widerhallten, von vom Unabhängigkeitstag übriggebliebenen Feuerwerkskörpern oder Fehlzündungen eines Wagens auf der Hauptstraße und nicht von einer Waffe stammten, die nur Zentimeter vor den Kopf des Opfers gehalten wurde.
Ich kann es nicht glauben. Wie konnte das passieren, werden die Nachbarn immer wieder murmeln. Dies ist normalerweise so eine friedliche Nachbarschaft. Eine so ruhige Straße.
KAPITEL EINS
Anfang Mai, einige Monate vor den fatalen Ereignissen jener schwülen Sommernacht, wird Maggie McKay wie jeden Morgen seit Beginn des Schuljahrs um sechs Uhr von ihrem Radiowecker geweckt. Sie streckt die Hand über die leere Hälfte des Doppelbetts zu dem Nachttisch auf der anderen Seite aus und bringt die süßlichen Klänge von Oh, What a Beautiful Morning mit einem entschlossenen Klaps zum Verstummen, bevor der Refrain wiederholt wird.
Wahrscheinlich sollte sie den Radiowecker auf ihre Seite des Bettes stellen, damit sie den Arm nicht so weit ausstrecken muss. Zumindest sollte sie ihn neu programmieren, damit er eine andere Melodie spielt. Dieser blöde Song geht ihr mittlerweile nur noch auf die Nerven. Sie braucht keine Erinnerung daran, dass Florida das Land der schönen Vormittage ist. Sie konnte das Lied noch nie ausstehen.
Aber sie stellt weder den Radiowecker um, noch programmiert sie einen neuen Song ein und wird es wahrscheinlich auch nicht tun. In ihrem Leben hat es in letzter Zeit genug Veränderungen gegeben. Zu viele.
Die Musik war Craigs Idee. Eine sanftere Art aufzuwachen als das schrille Piepen, das sie vorher aus dem Schlaf gerissen hatte. Ihre Nerven lägen ohnehin blank, erinnerte er sie unnötigerweise. Was sie bräuchte, sei weniger Stress, sagte er. Was er brauchte und nicht sagte – vielleicht war es ihm damals selbst noch nicht bewusst –, war weniger Maggie.
Nicht dass sie ihm die Schuld für das Zerbrechen ihrer Ehe gibt, zumindest nicht ausschließlich. Der Umzug nach Palm Beach Gardens war ihre Idee gewesen. Ein Neuanfang, hatte sie ihm erklärt, als sie zum ersten Mal die Idee aufgeworfen hatte, ihre Familie zu entwurzeln, Haus, Freunde und ihr berufliches Umfeld in Los Angeles zurückzulassen und auf die andere Seite des Landes zu ziehen. Es würde ein Neustart werden. Ein neuer Anfang. Besser für alle.
Praktisch dieselben Worte, die Craig benutzt hatte, als er vor drei Monaten seine persönlichen Habseligkeiten gepackt hatte und ausgezogen war. »Es tut mir leid«, hatte er hinzugefügt und es geschafft, so auszusehen, als meinte er es ernst. »Ich kann einfach nicht mehr.«
»Arschloch«, murmelt sie jetzt, so ziemlich das erste Wort, das ihr jeden Morgen über die Lippen kommt, seit er ausgezogen ist. »Beschissener Feigling.« Das Laken fühlt sich kühl an unter ihrem dünnen Baumwollpyjama, als sie sich zurück auf ihre Hälfte des Bettes rollt und die oberste Schublade ihres Nachttischs neben dem Kissen aufzieht. Sie tastet nach der kalten glatten Oberfläche der massiven Glock 19, die sie in einem Chiffon-Wirbel aus bunten Halstüchern versteckt hat. Die 9-Millimeter-Pistole ist wegen ihrer Größe und Verlässlichkeit die beliebteste Handfeuerwaffe in den USA. Hatte zumindest der Verkäufer gesagt, bei dem sie die Pistole noch am selben Nachmittag gekauft hatte, an dem Craig ausgezogen war.
Craig hatte sich hartnäckig dagegen gewehrt, eine Waffe im Haus zu haben, trotz allem, was geschehen war. Trotz allem, was, Gott behüte, geschehen könnte und wahrscheinlich auch geschehen würde, sobald sie zu selbstgefällig wurden, hatte sie vergeblich eingewandt. Wenn du mein Stresslevel wirklich hättest reduzieren wollen, denkt sie, als sie die relativ leichte Waffe hochhebt, hätte mich dieses kleine Ding sehr viel effektiver entspannen können als ein blöder Song aus einem alten Broadway-Musical.
Aber es ist ein Klassiker, kann sie ihn sagen hören.
»Leck mich«, sagt sie, trotzig unempfänglich für seinen Charme, und legt die Waffe wieder in die Schublade. Sie schwingt die Beine aus dem Bett und tappt barfuß über den Laminatboden des schmalen Flurs zu den Zimmern ihrer beiden Kinder. »Erin«, ruft sie und klopft an die Tür ihrer Tochter, bevor sie sie öffnet und den Teenager unter einem Berg von Decken stöhnen hört. »Zeit zum Aufstehen, Schätzchen.«
»Geh weg«, kommt die gedämpfte Antwort.
Maggie zieht sich in den Flur zurück, weil sie weiß, dass jede Diskussion zwecklos ist. Erin wird im Bett liegen bleiben, bis sie den Klang der Ermahnungen ihrer Mutter nicht mehr aushält, und erst dann aufstehen und sich anziehen. Die nächsten zwanzig bis dreißig Minuten wird sie sich im Badezimmer ihrer Frisur und ihrem Make-up widmen. Sie wird es ablehnen, irgendetwas zu frühstücken, und sich allem verweigern, was einer Unterhaltung mit ihrer Mutter oder ihrem jüngeren Bruder ähneln könnte. Sie wird ihr Handy checken, ihr Haar hin und her werfen und öfter die Augen verdrehen, als Maggie zählen kann. Und wenn sie schließlich neben ihrer Mutter in das schwarze SUV gestiegen ist, wird ihr einfallen, dass sie etwas von entscheidender Wichtigkeit vergessen hat – gelegentlich Schulaufgaben, die sie nicht fertig gemacht hat, meistens ihr Handy, das sie bei einer letzten Überprüfung ihrer Erscheinung im Badezimmer hat liegen lassen –, wodurch sie sich weiter verspäten. Vielleicht wird sie daran denken, die Alarmanlage wieder einzuschalten, vielleicht auch nicht, worauf Maggie aus dem Wagen steigen muss, um es selbst zu tun. Dann wird Maggie die Kinder zu ihren jeweiligen Schulen chauffieren, wobei sie zunächst Leo und dann Erin absetzen wird, die aussteigen wird, ohne sich umzusehen, wenn es gerade zur ersten Stunde läutet.
»Das ließe sich alles vermeiden, weißt du«, hört sie Erin sagen. »Du musst nur …«
»Du kriegst keinen eigenen Wagen.«
»Warum nicht? Dad könnte mir wahrscheinlich günstig einen besorgen …«
»Du kriegst keinen eigenen Wagen.«
»Wozu hab ich einen Führerschein, wenn du mich nicht fahren lässt? Außerdem müsstest du uns nicht jeden Tag zur Schule bringen und wieder abholen, wenn ich mein eigenes Auto habe. Du könntest dir einen Job suchen, ein Leben …«
»Ich habe ein Leben.«
»Du hattest ein Leben. Du hast es weggeworfen.«
»Okay, das reicht.«
»Ich glaube, du genießt es, die Märtyrerin zu spielen …«
»Ich sagte, das reicht.«
Und es reicht wirklich, beschließt Maggie und verdrängt die unangenehmen Gedanken, als sie das Zimmer ihres Sohnes betritt und sanft seine Schulter berührt. »Leo, Schatz. Aufwachen.«
Der schüchterne Achtjährige dreht sich auf den Rücken und öffnet die dunkelblauen Augen, die er von seinem Vater geerbt hat. »Welcher Tag ist heute?«
»Mittwoch. Wieso?«
»Dann essen wir heute mit Dad zu Abend?«
»Genau.«
»Und er holt uns von der Schule ab?«
Maggie nickt. »Falls er nicht da ist, wenn du rauskommst, ruf mich sofort an.«
Ohne weitere Aufforderung schlägt Leo seine Star-Wars-Decke zur Seite, steigt mit seiner Lieblings-Super-Mario-Stoffpuppe in der Hand aus dem Bett und macht sich auf den Weg zu dem Badezimmer, das er sich mit seiner Schwester teilt, weil er aus Erfahrung weiß, dass er es besser nutzt, solange er noch eine Chance hat.
Maggie geht zurück in ihr Schlafzimmer, duscht kurz in ihrem eigenen Bad, streift T-Shirt und Shorts über und bauscht ihr kinnlanges mausbraunes Haar auf, das früher üppig und schulterlang war. Früher, seufzt sie innerlich, eingedenk all der Dinge, die sie früher war: berufstätig, selbstbewusst, verheiratet. »Nicht zu vergessen hübsch«, sagt sie laut und starrt die besiegt und geschlagen aussehende Fremde an, die ihr aus dem Ganzkörperspiegel auf der Innenseite ihrer Kleiderschranktür entgegenblickt. »Wer bist du?«, flüstert sie. »Und was hast du mit Maggie McKay gemacht?«
»Erin!«, ruft sie auf dem Weg die Treppe hinunter, während ihr wachsamer Blick nach allem Ausschau hält, was auch nur vage fehl am Platz wirken könnte. »Zeit zum Aufstehen.« Rasch kontrolliert sie die Zimmer im Erdgeschoss – das Wohn-Esszimmer auf der einen Seite der Treppe, Küche, Gästetoilette und Arbeitszimmer auf der anderen –, bevor sie die Alarmanlage neben der Haustür ausschaltet.
Sie weiß, dass sie albern ist – Craig würde das Wort paranoid verwenden, hat es genau genommen bei mehreren Gelegenheiten verwendet –, dass es unnötig ist, jedes Zimmer des Hauses zu kontrollieren, wie sie es seit ihrem Einzug vor achtzehn Monaten jeden Morgen getan hat, weil niemand die topmoderne Alarmanlage überwinden könnte, auf deren Installation sie trotz der geradezu verboten hohen Kosten bestanden hatte, und dass sie, selbst wenn es doch jemand schaffte, garantiert seine Schritte auf der Treppe gehört hätte, auf der sie genau aus diesem Grund keinen Teppich verlegt hat.
Sie öffnet die Haustür und scannt kurz die kleine Sackgasse, während sie sich nach der Zeitung bückt. Ihr Haus steht an der Rundung am Ende der Straße, ein Standort, der ihr freie Sicht auf die Häuser zu beiden Seiten ermöglicht. Vor dem Haus unmittelbar rechts von ihrem parkt schon der gelbe Schulbus, der darauf wartet, Tyler und Ben Wilson zu ihrer schicken Privatschule in North Palm Beach zu bringen. Maggie erwidert das Nicken des Busfahrers mit einem bangen Winken und einem Seufzer der Erleichterung. Es ist derselbe Mann, der sie seit vier Monaten abholt. Kein Grund, in Panik zu geraten, wie es ihr passiert ist, als der letzte Fahrer in den Ruhestand gegangen und unvermittelt dieser sehr viel jüngere aufgetaucht ist. Sie hat sogar bei der Benjamin School angerufen, um sich bestätigen zu lassen, dass jemand Neues angestellt worden war, und dann seine Referenzen hinterfragt.
»Verzeihung, wer sind Sie?«, hat die Schulsekretärin gefragt.
»Du bist paranoid«, hat Craig ihr erklärt.
»Okay, dann bin ich eben paranoid«, murmelt Maggie jetzt und kehrt ins Haus zurück. Besser paranoid als tot.
Sie würde ihre Kinder auch gern auf eine Privatschule schicken wie die Wilsons, aber das ist viel zu teuer. Die Wilsons arbeiten beide in gut bezahlten Berufen – er ist ein angesehener Onkologe, sie Zahnärztin –, Maggie hingegen hat ihren Beruf aufgegeben, und auch wenn Craig als Verkäufer von Luxusautos gutes Geld verdient, reicht es nicht annähernd für die Schulgebühren von zwei Kindern, vor allem jetzt, da er zwei Wohnsitze finanzieren muss. Und alle Ersparnisse, die sie einmal hatten, sind in den Umzug geflossen.
»An öffentlichen Schulen gibt es absolut nichts auszusetzen«, erinnert sie sich, weil sie die Bestätigung ihrer laut ausgesprochenen Worte braucht. Sie hat schließlich früher selbst an einer unterrichtet.
Früher, denkt sie, als sie den ovalen weißen Tisch in der Mitte der kleinen Küche deckt. Sie kocht ein Ei für Leo, steckt zwei Scheiben Rosinenbrot in den Toaster und wirft einen Blick auf die deprimierenden Schlagzeilen des Tages, bevor sie zum Kreuzworträtsel weiterblättert, dem einzigen Grund, warum sie die Zeitung überhaupt noch bezieht. »Erin!«, ruft sie, und dann noch einmal: »Erin! Du solltest jetzt langsam wach und auf sein.«
»Ich bin auf!«, ruft Erin zurück. »Entspann dich, Herrgott noch mal!« Im ersten Stock knallt die Badezimmertür zu.
Würde ich, wenn du mich lässt, denkt Maggie, wohlwissend, dass sie ungerecht ist. Ihre halbwüchsige Tochter kann nichts dafür, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt worden ist. »Selbst schuld«, sagt Maggie zu sich. „Trotzdem widerlich.«
»Was ist widerlich?«, fragt Leo, als er die Küche betritt.
Beim Klang seiner Stimme fährt sie zusammen. Wieso hat sie ihn nicht kommen hören? »Wo sind deine Schuhe?«
Leo blickt auf seine nackten Füße. »Oh«, sagt er und zeigt auf seinen Rucksack auf dem Boden. »Ich glaub, ich hab sie eingepackt.«
Maggie lächelt. Mein kleiner Traumtänzer, denkt sie und überlegt, ob er und Ben Wilson deshalb bestenfalls oberflächlichen Kontakt pflegen. Sie war so aufgeregt gewesen, als sie gehört hatte, dass ihre Nachbarn einen Sohn in Leos Alter haben, und hatte gehofft, dass die beiden sich schnell anfreunden würden, aber so ist es nicht gekommen. Sie hat den Verdacht, dass das mehr mit Dani Wilson als mit ihrem Sohn zu tun hat, die sich laut allgemein vorherrschender Meinung für zu gut für ihre Nachbarschaft hält und lieber in einer schickeren Siedlung leben würde, einer mit einer repräsentativeren Adresse, angemessener für eine Familie mit zwei Ärzten. Vielleicht nimmt sie den Bewohnern der Carlyle Terrace auch die Hochachtung übel, die diese dem Beruf ihres Mannes entgegenbringen, während sie solchen Respekt als bloße Zahnärztin nur selten genießt.
Oder vielleicht ist sie auch einfach nur eine blöde Zicke.
»Ist es eine Spinne?«, fragt Leo.
»Eine Spinne?«
»Was widerlich ist«, greift er seine ursprüngliche Frage wieder auf und sieht sie ängstlich an.
Ich habe ihm diese Angst eingepflanzt, denkt Maggie. »Oh«, sagt sie. »Nein, keine Spinne. Nichts weiter.«
Damit offenbar zufrieden setzt er sich auf einen der vier weißen Plastikstühle, zieht seine Sneakers aus dem Rucksack, schlüpft hinein und müht sich mit den Schnürbändern ab.
»Komm, ich helf dir.« Maggie kniet schon mit ausgestreckten Armen vor ihm.
»Nein, schon okay. Dad sagt, ich muss anfangen, Sachen selber zu machen.«
»Dein Vater …« Maggie beißt sich auf die Zunge, um nichts zu sagen, was sie bereuen wird. Sie bereut ohnehin schon zu viel. Ihr geht langsam der Platz aus. Sie hört, wie der Toaster die beiden Scheiben Brot ausspuckt. »Möchtest du deinen Toast selber bestreichen?«, fragt sie. Mit einem Buttermesser kann er sich doch bestimmt nicht verletzen.
»Nein«, sagt er. »Das kannst du machen.«
»Okay.« Sie unterdrückt den Impuls, sich zu bedanken. »Erin!«, ruft sie, als Leo seine letzten Bissen isst. »Es ist nach sieben. In weniger als einer halben Stunde fängt die Schule an. Wir kommen zu spät.« Warum Schulen so verdammt früh anfangen müssen, hat sie nie begreifen können.
»Ich bin im Bad.«
»Ich weiß, dass du im Bad bist. Es wird Zeit, dass du aus dem Bad rauskommst.« Sie geht zur Treppe.
»Gott, kannst du noch nerviger sein?«, murmelt Erin, die die Badezimmertür aufreißt, als Maggie den Treppenabsatz erreicht. Verschwommen huscht eine Gestalt mit hüftlangen hellbraunen Haaren und langen nackten Beinen an ihr vorbei.
»Wahrscheinlich«, sagt Maggie, geht in ihr Schlafzimmer und zieht die oberste Schublade ihres Nachttischs auf. Sie nimmt die Glock 19, wendet sie bewundernd in ihrer Hand und steckt sie in ihre große Stofftasche.
Florida hat Maggie unter anderem deshalb ausgewählt, weil der Staat als »kulant« in Bezug auf Waffen gilt. Das heißt, es ist legal, versteckt eine Waffe zu tragen, und relativ leicht, eine Lizenz dafür zu bekommen. Das hat Maggie veranlasst, sie hat die nötigen Formulare ausgefüllt und mit ihren Fingerabdrücken und einem aktuellen Foto zur Überprüfung nach Tallahassee geschickt und dann fünf Tage auf ihre Lizenz gewartet.
Binnen einer Woche nach Kauf der Waffe hat sie den obligatorischen dreistündigen Kurs in Schusswaffentraining absolviert. Seitdem trägt sie die Pistole immer bei sich.
Nur für den Fall, dass es eines Tages nötig wird, sie zu benutzen.
KAPITEL ZWEI
Dani Wilson blickt aus dem Küchenfenster und sieht den Schulbus, der im Leerlauf in der Straße steht. »Jungs«, ruft sie zu dem Arbeitszimmer auf der Rückseite des Hauses. »Der Bus ist da. Tyler! Ben! Auf geht’s! Manuel mag’s nicht, wenn man ihn warten lässt, wisst ihr doch.« Sie zählt stumm bis zehn, atmet ein paarmal gegen ihren wachsenden Ärger über die ausbleibende Reaktion an und versucht, es nicht persönlich zu nehmen.
Schließlich ist es nichts Neues. Sie erlebt es täglich bei der Arbeit, wo ihre Patienten auf ihre höflichen Nachfragen – über ihren Tag, ihre Gesundheit, ihr Leben – nur selten mehr als einsilbig antworten. »Gut«, grunzen sie oder: »Okay.« Zugegeben, ihre Münder stehen weit offen und sind mit Watte ausgepolstert, aber wäre es wirklich so schwer zurückzufragen: »Und selbst?«
Die brutale Wahrheit ist, dass es niemanden einen Dreck kümmert, ob Dani Wilson glücklich ist. Niemand interessiert sich für die Probleme einer ehemaligen Südstaaten-Schönheit mit attraktivem Arztgatten, einer florierenden Praxis und einem sechsstelligen Jahreseinkommen. Sie ist sich allzu bewusst, dass die Leute, mit denen sie den Großteil ihrer Zeit verbringt, lieber irgendwo sonst auf der Welt wären als bei ihr.
Ist es ein Wunder, dass die Selbstmordrate unter Zahnärzten höher ist als in jedem anderen Berufsstand?
Sie blickt zu der Kücheninsel mit den auf einer Seite aufgereihten vier Barstühlen. »Was ist mit euch, Jungs? Wie geht’s?«, fragt sie die beiden Kampffische, einen roten und einen blauen, beide bildhübsch, die in getrennten Gläsern auf dem Marmortresen ziellos vor sich hin schwimmen. Zwei Gläser sind notwendig wegen eines heftigen Territorialinstinkts, der die Fische bis zum Tod kämpfen lässt, wenn man sie mit anderen Fischen einsperrt. Selbst getrennt durch ein Glas müssen sie in angemessenem Abstand voneinander gehalten werden.
»Ich dachte, wir wären uns einig: keine Haustiere«, hatte Nick gesagt, als Dani sie eines Tages nach der Arbeit mitgebracht hatte, ein Spontankauf, den sie bis heute nicht erklären kann.
»Nun, sie waren so hübsch, und ich dachte …«
»Was hast du gedacht?«
»Na ja, es ist kein Hund und keine Katze …«
»Darum geht es nicht.«
»Ich dachte, es wäre gut für die Jungs«, hatte sie gesagt.
»Glaub mir«, hatte Nick erwidert. »Sie werden binnen einer Woche das Interesse verlieren.«
Er hatte natürlich recht. Zumindest was ihren jüngeren Sohn Ben betraf. Nachdem er lautstark darauf bestanden hatte, dass der blaue Kampffisch seiner war, ignorierte er ihn weitgehend. »Er ist langweilig«, erklärte er. Tyler hingegen brachte Stunden damit zu, seine Stirn an das Glas des roten Kampffischs zu drücken und so lange mit dem Fisch zu reden, den er Neptun getauft hatte, dass der Junge inzwischen tatsächlich seine Hand in das Glas stecken und ihn streicheln darf.
Dani findet das erstaunlich. Nick ist unbeeindruckt. »Ich mache mir Sorgen um den Jungen«, pflegt er kopfschüttelnd zu sagen.
»Er ist sensibel.«
Ein weiteres Kopfschütteln. »Wer baut eine Beziehung zu einem Fisch auf?«
Dani seufzt und geht zu dem Raum auf der Rückseite des Hauses. »Jungens! Auf geht’s. Der Bus fährt gleich ohne euch los.«
»Nein, fährt er nicht«, widerspricht ihr Mann mit dem Rücken zu ihr. Er steht vor einer Vitrine, die seine imposante Waffensammlung beherbergt, den zehnjährigen Tyler zu seiner Linken, den achtjährigen Ben zu seiner Rechten. »Er ist zu früh. Er kann ein paar Minuten warten. Und es heißt ›auf geht es‹«, fügt er mit Betonung auf der letzten Silbe hinzu. »Nicht ›geht’s‹. Man soll das e nicht verschlucken.« Er sieht seine Söhne an. »Korrekte Aussprache ist wichtig«, erklärt er ihnen. »Die Leute beurteilen einen danach, wie man spricht. Merkt euch das.«
Dani nickt. Sie weiß, dass er recht hat. Wie meistens. Aber sie ist in Atlanta geboren und aufgewachsen, und auch wenn sie seit ihrer Hochzeit vor fast fünfzehn Jahren in Florida lebt, wird man einen Südstaatenakzent nicht so leicht los.
Darauf würde Nick ohne Zweifel antworten, dass Florida seines Wissens nach ebenfalls als Teil des Südens gelte, dass die Angewohnheit, ihre Sätze mit abgedroschenen Sinnsprüchen zu würzen, sie klingen ließe wie ein Landei und dass das ständige Verschleifen von Worten nichts mit Geografie und alles mit grammatikalischer Trägheit zu tun habe.
Und er hätte recht. Weil er immer recht hatte. Obwohl sie sich an eine Zeit erinnert, in der er solche sprachlichen Eigenheiten liebenswert fand. Komisch, dass genau die Dinge, die uns anfangs verzaubert haben, zu denen werden, die uns am meisten ärgern, denkt sie und erinnert sich daran, dass sie sein Selbstbewusstsein – manche würden es vielleicht Arroganz nennen – attraktiv fand. Ihr Vater, ein erfolgreicher Internist, hatte ihre Mutter, eine Hausfrau, mit ähnlich beiläufiger Geringschätzung behandelt. War sie selbst unter anderem nicht auch deshalb so entschlossen gewesen, einen Beruf auszuüben?
Natürlich hatte es nicht geschadet, dass beide Männer groß und gutaussehend waren und nur von ihrem Haar, das nicht dunkel, sondern hell war, davor bewahrt wurden, zum wandelnden Klischee zu werden. Dani ist schon immer davon ausgegangen, dass Arroganz zu dem entsprechenden Status gehört. Und Nick steht als weithin geachteter, ja sogar verehrter Onkologe ziemlich weit oben in der medizinischen Hierarchie. Seine Patienten bewundern ihn ohne Frage. Seine Website quillt über von Lobeshymnen, die sein diagnostisches Genie und seine warmherzige Art preisen.
Sie ist natürlich auch Ärztin, erinnert sie sich. Obwohl ihr Vater einwenden würde, dass ein Zahnarzt eigentlich kein richtiger Arzt im strengen Wortsinn ist.
Und sie muss nicht daran erinnert werden, dass niemand gern zum Zahnarzt geht, ungeachtet von dessen Kompetenz.
Vielleicht wäre es anders, wenn sie jung und hübsch wäre und nicht vierzig, eher klein, mit immer noch knapp fünf Kilo zu viel auf den Rippen, die sie seit Bens Geburt nicht mehr losgeworden ist.
»Vielleicht wenn du mehr auf deine Ernährung achten und regelmäßig Sport treiben würdest«, hatte Nick einmal gesagt.
»Ich versuch’s.«
»Ich versuche es«, verbesserte er sie.
Er hatte natürlich recht. Er hat immer recht. Sie kann ihrem jüngeren Sohn nicht für immer die Schuld für ihr Übergewicht geben. Ben ist acht Jahre alt, Herrgott noch mal. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen und selbst aktiv zu werden, Kalorien zu reduzieren, sich bei einem Fitnessstudio anzumelden oder vielleicht sogar einen Personal Trainer zu engagieren.
»Was’n hier los?«, fragt sie jetzt, schon erschöpft von dem bloßen Gedanken an einen Trainer.
»Dad zeigt uns sein neues Gewehr«, antwortet Ben, dreht sich zu ihr um und richtet eine Waffe, die beinahe so lang ist wie er selbst, in Richtung ihres Herzens. »Und es heißt ›was ist‹, nicht ›was’n‹.«
Dani stockt der Atem, und sie weicht einen Schritt zurück, ob wegen der Waffe oder wegen der Zurechtweisung durch ihren Sohn, weiß sie nicht zu sagen.
»Whoa, Partner«, sagt Nick und nimmt seinem Sohn die Waffe eilig aus den Händen. »Was habe ich dir darüber gesagt, nie eine Waffe auf jemanden zu richten?«
»Sie ist nicht geladen«, protestiert Ben.
»Das ist egal.« Sein Vater legt die Waffe an ihren Platz und schließt die Tür des Vitrinenschranks. »Und jetzt hört auf eure Mutter. Abmarsch.«
Die Jungen reagieren unverzüglich, Tyler wirft ihr ein schüchternes Lächeln zu, als er an ihr vorbeihastet.
»Du hast mir nicht erzählt, dass du eine neue Waffe gekauft hast«, sagt Dani, als ihre Söhne außer Hörweite sind.
»Dachte nicht, dass dich das interessiert.«
Sie ist kurz versucht, die Angewohnheit ihres Mannes zu tadeln, häufig das Subjekt auszulassen, denkt dann aber, dass das kleinlich wäre. Vielleicht wäre es Fair Play, die Verhältnisse hin und wieder umzukehren, doch sie hat die Erfahrung gemacht, dass das nur selten zu ihren Gunsten ausgeht.
»Klar interessiert mich das. Wie viele sind das jetzt insgesamt?« Stumm zählt sie die zahlreichen ausgestellten Pistolen und Gewehre.
»Achtzehn.«
»Du meine Güte.« Dani hat die Leidenschaft ihres Mannes für Waffen nie geteilt und begleitet ihn auch nie, wenn er zum Schusstraining zu einer nahe gelegenen Schießanlage fährt.
»Dachte, ich nehm die Jungs an einem Wochenende mal mit zum Schießstand«, sagt er, als könne er ihre Gedanken lesen.
»Was?« Vor ihrem Auge blitzt das irritierende Bild des achtjährigen Ben auf, der eine Waffe auf ihre Brust richtet.
»Es wird Zeit, dass sie schießen lernen.« Er sieht sich in dem Zimmer um. »Wo hast du mein iPad hingelegt?«
»Was?«, fragt sie noch einmal.
»Hab es gestern Abend hier liegen lassen.«
»Ich habe es nicht angerührt.«
»Bist du sicher?«
»Klar bin ich sicher. Du hast es wahrscheinlich im Bad liegen lassen.«
»Ich habe es nicht im Bad liegen lassen, verdammt.«
Dani spannt sich innerlich an, als sie seinen unvermittelt verärgerten Unterton hört, und ist fast dankbar für das Geschrei, das im selben Moment in der Küche ausbricht.
»Hör auf!«
»Lass sie in Ruhe!«
»Mom!«
Sie läuft den Rufen entgegen und sieht ihre Jungen um die Fischgläser ringen, sodass die beiden Kampffische achtlos hin und her geschleudert werden und Wasser auf die Platte der Kücheninsel schwappt. »Meine Güte! Was’n hier los?«
»Ben schiebt immer wieder die beiden Gläser zusammen«, sagt Tyler mit bebender Stimme. »Neptun ist schon ganz aufgeregt.«
»Es ist ein Spaß«, sagt Ben lachend. »Du solltest sie sehen. Sie blasen sich auf und schlagen mit den Flossen gegen das Glas.«
»Sie werden sich verletzen«, entgegnet Tyler.
»Na und? Es sind bloß Fische.«
»Okay, jetzt reicht’s.« Dani stellt die Gläser mit reichlich Abstand dazwischen wieder auf den Tresen. »Höchste Zeit. Manuel wartet.«
»Jetztreicht es«, verbessert ihr Mann sie, als er mit seinem iPad in der Hand die Küche betritt. »Ihr habt eure Mutter gehört.«
»Kuss?«, fragt Dani, als sie zur Haustür rennen. Nur Tyler macht kehrt und hält ihr die Wange hin. Ihre Lippen streifen eine Locke seines goldbraunen Haars. »Schönen Tag«, ruft sie, als die Haustür geöffnet wird und wieder zufällt.
»Und worum ging es bei dem Geschrei?«
»Ben hat die Gläser wieder zu nahe nebeneinander geschoben.«
Nick lacht.
»Das ist nicht lustig. Es regt Tyler auf.«
»Der Junge ist zu weich. Er könnte ein bisschen Abhärtung gebrauchen.«
Dani beschließt, nicht zu widersprechen. »Wie ich sehe, hast du dein iPad gefunden.«
Er nickt.
»Wo hast du es gefunden?«
»Im Badezimmer.«
»Dann hatte ich also recht.«
»Sieht so aus. Ist dir das wirklich so wichtig?«
»Ich werd bloß nicht gern beschuldigt …«
»Niemand hat dich beschuldigt. Ich hab dich bloß gefragt, ob du es gesehen hast.«
»Nein, du hast gefragt, wo ich’s – ich es – hingelegt habe. Das ist ein Unterschied. Und du solltest mich nicht vor den Kindern verbessern.«
Nick schüttelt den Kopf. »Hör zu, ich habe jetzt weder die Zeit noch die Energie, mit dir zu streiten. Ich habe einen vollen Tag vor mir und letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen …«
»Wieso hast du nicht gut geschlafen?«
Ein erneutes Kopfschütteln, mehrere Strähnen seines ebenso goldblonden Haars wie Tylers fallen ihm in die Stirn und die Augen. »Ich weiß nicht. Irgendein blöder Vogel hat die ganze Zeit gekreischt. Und …« Er hält inne und streicht sein Haar zurück.
Frag nicht, denkt sie. »Und?«, tut sie es trotzdem.
»Na ja, ich zögere, irgendwas zu sagen, weil du heute Morgen anscheinend ziemlich reizbar bist …«
»Ich bin nicht reizbar …«
»Aber du musst etwas wegen deinem Schnarchen unternehmen«, unterbricht er sie. »Ich weiß, du machst es nicht mit Absicht …«
Dani seufzt. Das hatten sie schon. Es ist sinnlos, ihn daran zu erinnern, dass er ebenfalls schnarcht oder dass er es zumindest mit den Ohrstöpseln versuchen könnte, die sie ihm gekauft hat, als er sich das letzte Mal über ihr Schnarchen beschwert hat.
»Wie dem auch sei«, sagt er, »lassen wir das jetzt. Der vor mir liegende Tag wird auch so hart genug.« Ein drittes Kopfschütteln. »Ich muss einem Mann mitteilen, dass sein Krebs gestreut hat und er austherapiert ist.«
»Das tut mir sehr leid.« Dani hat sofort ein schlechtes Gewissen, dass sie ihm das Leben schwergemacht hat. Deine Patienten sind immerhin höflich genug zu sterben, denkt sie und bekommt ein noch schlechteres Gewissen. Wann ist sie so unsensibel gegenüber dem Leiden anderer geworden? Was ist los mit mir?
»Mir tut es auch leid«, sagt Nick, schlingt seine Arme um sie und zieht sie in einer festen Umarmung an sich. »Ich habe angedeutet, dass du mein iPad verlegt hast. Du hattest völlig recht, sauer zu sein. Und es steht mir auch nicht an, dich vor den Jungen zu verbessern«, fügt er ohne Aufforderung hinzu. »Das war verkehrt. Ich werde versuchen, es nicht noch einmal zu tun.«
»Danke«, flüstert sie, als er sich von ihr löst.
»Ich liebe dich«, sagt er.
»Ich liebe dich auch.«
Er kneift ihr in die Nase. »Aber du musst wirklich etwas gegen dein Schnarchen unternehmen.«
KAPITEL DREI
Von seinem üblichen Platz am Wohnzimmerfenster beobachtet Sean Grant den Schulbus, der vor dem Nachbarhaus losfährt und die privilegierten Sprösslinge des bedeutenden Dr. Wilson mit sich nimmt. Nicht zum ersten Mal fragt er sich, warum eine Familie, in der beide Eltern erfolgreich berufstätig sind, in dieser schlichten Sackgasse wohnt, wenn sie auch in einer der schicken, gesicherten privaten Wohnanlagen in der Nähe leben könnte. Zusammen verfügen die Eltern bestimmt über ein Jahreseinkommen von einer halben Million Dollar, wenn nicht mehr. Verdammt, als einer der führenden Krebsspezialisten in der Gegend verdient Nick Wilson wahrscheinlich allein so viel. Würde Sean so viel Geld machen, würde er auf jeden Fall richtig in Palm Beach wohnen oder sich vielleicht ein Haus im Bear Club kaufen, dem exklusiven Golf- und Country-Club von Jack Nicklaus an der Donald Ross Road. Er war früher mal ein ziemlich guter Golfer. Natürlich ist es schon eine Weile her, dass er zuletzt auf einem Platz gestanden hat, denn Golf ist ein ziemlich teures Hobby.
Eins, das er sich nicht mehr leisten kann.
»Sean!«, ruft seine Frau, und ihre hohen Absätze klackern über die beigefarbenen Keramikfliesen, die im gesamten Erdgeschoss des Hauses verlegt sind. »Wo bist du?«
Widerwillig verlässt er das Fenster und stößt zu seiner Frau in dem kleinen zentralen Flur am Fuß der Treppe, bevor sie noch einmal fragen kann. Er findet den Grundriss des Hauses merkwürdig – das Wohn-Esszimmer rechts der Treppe und praktisch alles andere links davon. Wer hat diese Häuser überhaupt geplant? Sollten Küche und Esszimmer nicht näher beieinanderliegen, fragt er sich stumm, obwohl ihn so etwas nie gestört hat, bevor er zum Chefkoch und obersten Flaschenspüler der Familie geworden ist.
Jetzt stört ihn alles Mögliche, was ihn vorher nie geärgert hat, zu vieles, um darüber nachzugrübeln, wenn er auf dem richtigen Fuß in den Tag starten will. Eins steht direkt vor ihm, wie ihm klar wird, während er versucht, die Verärgerung über seine Frau hinter einem Lächeln zu verbergen. Sie trägt ein perfekt geschnittenes Kostüm, das ihre ebenso perfekte Figur betont, und grinst ihr Katze-die-einen-Kanarienvogel-verschluckt-hat-Grinsen, die vollen Lippen durch den hellkorallenroten Lippenstift betont, den sie benutzt, seit sie wieder angefangen hat zu arbeiten. Ihr langes dunkles Haar ist im Nacken zu einem ordentlichen Dutt gebunden, den sie Chignon nennt. Mit neununddreißig sieht Olivia Grant sogar noch besser aus als die Dreiundzwanzigjährige, die er in den Tagen geheiratet hat, als er noch ein erfolgreicher Marketing-Manager war und sie eine kleine Account-Managerin bei einer Werbeagentur in der Nachbarschaft, mit der er manchmal zusammenarbeitete. Damals hatte sie es nicht als Karriere betrachtet wie heute, sondern als einen Job, den sie nach der Geburt ihrer mittlerweile zwölfjährigen Zwillinge Zane und Quentin bereitwillig aufgegeben hatte. Zwei Jahre später war dann Katie gekommen.
Sean hatte nichts dagegen gehabt, als seine Frau sich entschied, Hausfrau und Mutter zu sein. Er war beruflich überaus erfolgreich und sehr stolz darauf, seine wachsende Familie allein von seinem Einkommen ernähren zu können. Im Laufe der Jahre stieg er in der Hierarchie seines Unternehmens stetig auf, wurde einer von fünf Vizepräsidenten der mittelgroßen Agentur, die ihn beschäftigte, und war zuversichtlich auf dem Weg zum vollständigen Teilhaber.
Und dann hatte man ihm vor zwei Jahren – ironischerweise als sie gerade überlegten, in ein größeres Haus umzuziehen – die Kündigungspapiere überreicht. Die Geschäfte liefen schlecht, sehr schlecht. Die Firma konnte sich den Luxus von fünf Vizepräsidenten nicht mehr leisten, was er selbst schon seit Monaten vermutet hatte, ohne auf den Gedanken gekommen zu sein, dass es ihn betreffen könnte.
Nachdem er den Schock überwunden hatte, seinen Job zu verlieren – der Gedanke, dass er entbehrlich war, traf ihn sogar noch härter als die abrupte Entlassung –, genoss er die freie Zeit, um sich zu entspannen und neu zu überlegen, was er vom Leben wollte. Und er wollte, wie er nach jenen ersten Wochen entschied, mehr. Mehr Geld, mehr Macht, mehr Respekt. Er war überzeugt gewesen, dass ein Mann mit seiner Erfahrung und seinen Referenzen kein Problem haben würde, einen anderen Job zu finden. Außerdem konnte er es sich leisten zu warten. Die Abfindungsvereinbarung war sehr großzügig gewesen und sorgte zusammen mit einer kleinen Erbschaft von seinem Vater dafür, dass er keine Kompromisse eingehen musste. Er konnte auf die perfekte Position warten.
»Alles wird gut«, versicherte er Olivia.
»Ich mache mir nicht die geringsten Sorgen«, sagte sie.
Es dauerte mehrere Monate, bis seine Zuversicht nachließ, ein Jahr, bis sie ganz verschwunden war. Als die Wirtschaft wieder Fahrt aufnahm, wollte offenbar kein Unternehmen einen Mann an der Schwelle zur Fünfzig engagieren, ungeachtet seiner Erfahrung und Referenzen. Nicht wenn jemand halb so Altes für das halbe Gehalt eingestellt werden konnte. Sean senkte seine Ansprüche und bewarb sich um Positionen, die in Betracht zu ziehen er sich anfangs geweigert hatte.
Und er bekam für alle eine Ablehnung.
»Zu qualifiziert«, sagten sie. Zu alt, meinten sie.
Er wurde immer depressiver. Er hörte auf, ordentlich gebügelte Hemden und Seidenkrawatten zu tragen, die er sonst nicht mal an den Wochenenden abgelegt hatte. Er rasierte sich tagelang nicht. Er nahm zu. Welchen Sinn hatte es, seine Erscheinung zu pflegen, wenn es niemanden kümmerte, ob er überhaupt erschien?
Seine Frau – die stets unterstützende, unermüdlich optimistische Olivia – drängte ihn, einen Therapeuten zu konsultieren. Als er einwandte, dass Therapeuten teuer seien, bot sie an, seine Termine mit dem Geld zu bezahlen, das sie gespart hatte, um ein neues Auto zu kaufen, was ihn natürlich noch depressiver machte. Er wollte nicht, dass seine Frau Opfer für ihn brachte. Es war die Pflicht des Mannes, seine Familie zu ernähren, der Versorger zu sein, die »Brötchen zu verdienen«, wie sein Vater immer gesagt hatte.
Sein Vater war voller solcher Redensarten gewesen. »Die Brötchen verdienen« war eine. »Man soll einen Jungen nicht die Arbeit eines Mannes machen lassen« war eine andere.
Jetzt wollten Arbeitgeber anscheinend nur noch Jungen.
Oder Frauen.
Wie anders ließ sich die Leichtigkeit erklären, mit der Olivia einen Job gefunden hatte? Vor acht Monaten war seine Frau, die seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gearbeitet hatte, durch die Haustür spaziert und hatte stolz verkündet, dass sie zum Spaß bei Jupiter’s vorbeigefahren sei, um ihren alten Chef zu treffen, der sie auf der Stelle eingestellt hätte. Warum sollte sie nicht wieder arbeiten gehen, fragte sie, als er Einwände erhob. Nachdem nun alle drei Kinder zur Schule gingen, würde sie sich zu Hause mit nichts weiter zu tun, als zu waschen und zu kochen, allmählich langweilen. Außerdem hatten sie sowohl seine Erbschaft als auch seine Abfindung fast verbraucht, und sein Arbeitslosengeld würde bald auslaufen. Einfach ausgedrückt brauchten sie das Geld.
Dem konnte er nicht widersprechen.
Aber nun sitzt er den ganzen Tag zu Hause mit nichts weiter zu tun, als zu waschen und zu kochen, während sie in der Welt unterwegs ist, Geld verdient und sich prächtig amüsiert. Sich schick macht, Zehn-Zentimeter-Absätze trägt. Besser aussieht als seit Jahren. Meetings hat. Mit ihren langen Wimpern in Richtung ihrer Vorgesetzten klimpert. Verdammt, sie ist nach kaum sechs Monaten zum Account-Supervisor befördert worden. Wie soll das gehen, ohne ernsthaft zu flirten?
Nicht, dass Sean seiner Frau nicht vertrauen würde. Das tut er. Olivia war immer nur liebevoll, treu und unterstützend. »Du findest etwas anderes«, hatte sie gesagt, als er ihr erzählt hatte, dass er entlassen worden war. »Diesen kriegst du bestimmt«, sagte sie jedes Mal, wenn er zu einem Vorstellungsgespräch ging. »Denk dran, was dein Vater immer gesagt hat: ›Wenn eine Tür zuschlägt, geht eine andere auf.‹«
Aber als eine andere Tür aufging, war sie diejenige, die hindurchging.
Sie versucht es zu verbergen, doch er weiß, dass er ihr ein Dorn im Auge geworden ist. Er sieht die Enttäuschung in ihrem Blick. Das macht es schwer, sie anzusehen.
»Du riechst gut«, erklärt er ihr jetzt und zwingt sich, genau das zu tun. »Ist das ein neues Parfüm?«
»Ja, es heißt So Pretty.« Sie lacht. »Gute Nase«, sagt sie und küsst ihn auf die Spitze derselben. Mit den High Heels, die inzwischen zum festen Inventar ihrer Alltagsuniform gehören, ist sie ein Stück größer als er. Eine tägliche Erinnerung daran, dass sich ihre Positionen verkehrt haben. Warum kann sie nicht flache Schuhe tragen wie früher?
Warum kann nicht irgendwas so sein wie früher?
»Und was steht bei dir heute Morgen auf dem Plan?« Sie ist stehen geblieben, um ihn zu fragen, ob er ein Vorstellungsgespräch hat.
Er zuckt mit den Schultern und dreht sich zum Haus um, wo seine drei Kinder sich für den Tag fertig machen. In ein paar Minuten wird Olivia sie auf dem Weg zur Arbeit vor der Schule absetzen. Sein Job ist es, sie bei Schulschluss um halb drei wieder abzuholen. Wie soll er Pläne machen, wenn er am frühen Nachmittag zurück sein muss?
Natürlich hat die alte Mrs Fisher, die schräg gegenüber wohnt, angeboten, auf die Kinder aufzupassen und sie sogar von der Schule abzuholen, aber die Frau ist vierundachtzig, Herrgott noch mal. Er wird das Leben seiner Kinder nicht den Händen einer Frau anvertrauen, der man wahrscheinlich schon vor Jahren den Führerschein hätte abnehmen sollen.
»Mir ist aufgefallen, dass der Kaffee und die Cheerios bald aufgebraucht sind«, sagt Olivia.
Sean spannt sich innerlich an. Seine Frau verlangt nie direkt, dass er Einkäufe erledigt. Ihr »fällt« bloß »auf«, dass diverse Lebensmittel bald aufgebraucht sind. Kann sie nicht geradeheraus sagen, was sie wirklich meint? »Ich kauf später ein«, sagt er.
»Oh, und Zane hat sich zum Abendessen Makkaroni mit Käse gewünscht. Wie findest du das?«
Zum Kotzen, denkt Sean, antwortet jedoch: »Klingt gut.«
»Super. Es könnte heute Abend übrigens ein bisschen später werden«, fügt sie hinzu, fast so, als sei es ihr gerade eingefallen. »Wir haben heute Nachmittag eine Präsentation in Fort Lauderdale, und bei dem Verkehr … na ja, du weißt ja. Wenn ich bis sechs nicht zu Hause bin, fangt schon ohne mich an.«
»Kein Problem.«
»Ich ruf dich an, wenn das Meeting vorbei ist, wenn du also bis halb sechs nichts von mir gehört hast …«
»Weiß ich, dass wir ohne dich anfangen sollen.«
»Okay. Danke. Kinder«, ruft sie, »auf geht’s!«
Sofort sind die Kinder an der Haustür, lachend und mit ihren Rucksäcken kämpfend. Sean strengt sich an, in ihren Gesichtern eine Spur von sich zu erkennen, sieht jedoch nur ihre Mutter. Alle drei haben dunkle Haare und dunkelbraune Augen, während seine Augen dieselbe Farbe haben wie sein immer noch volles hellbraunes Haar. Immerhin etwas, denkt er.
»Auf Wiedersehen, Schatz«, sagt Olivia und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. »Wünsch mir viel Glück für heute Nachmittag.«
»Viel Glück für heute Nachmittag«, antwortet er gehorsam.
»Hab dich lieb«, sagt sie.
»Hab dich auch lieb.« Von seinem gewohnten Platz im Wohnzimmer beobachtet er, wie Olivia ihren Honda Accord rückwärts aus der Einfahrt setzt und Richtung Hauptstraße verschwindet.
Vor seinem inneren Auge sieht er einen Lkw, der aus dem Nichts kommt, frontal in den Wagen kracht und den alten Honda zusammendrückt wie ein Akkordeon. Der Kopf seiner Frau wird ruckartig nach hinten und wieder nach vorn gerissen, während das Lenkrad in ihrer Brust verschwindet. Er sieht zwei uniformierte Beamte, die mit herabgezogenen Mundwinkeln und niedergeschlagenen Blicken den Betonweg zu seiner Haustür hinaufkommen. »Es tut uns furchtbar leid, Ihnen mitteilen zu müssen …«
Mein Gott, was ist los mit mir, fragt er sich und verdrängt die entsetzlichen Bilder. Ich liebe meine Frau. Woher kommen diese Gedanken?
Wer weiß, welches Böse in den Herzen der Menschen lauert, flüstert ihm sein Vater ins Ohr, ein weiterer der Sprüche, die er so mochte.
Sean blickt auf seine Uhr und ist nur vage beunruhigt, als er feststellt, dass fast eine Stunde vergangen ist. »Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert, schätze ich«, sagt er lachend und beobachtet einen silbernen Tesla, der in die Sackgasse kommt und in Mrs Fishers Auffahrt biegt. »Oha«, sagt er, als beide Türen nach oben aufklappen und ein Mann und eine Frau gleichzeitig aussteigen. Die Frau zupft an ihrem kurzen engen Rock, als die beiden entschlossen auf die Haustür zumarschieren. »Riecht nach Ärger.«
KAPITEL VIER
Julia Fisher grübelt bei ihrer zweiten Tasse Kaffee über ein Wort mit neun Buchstaben für »verschwenderisch umgehen mit«. Es ist das einzige Wort des heutigen Kreuzworträtsels, das sie noch nicht herausbekommen hat, obwohl sie weiß, dass der erste Buchstabe ein V und der siebte ein E ist. Sie ist so konzentriert, dass sie das Klopfen, das am Rand ihrer bewussten Wahrnehmung schwebt, zunächst gar nicht auf sich bezieht. Erst als das Klopfen auch noch von beharrlichem Klingeln untermalt wird, begreift sie, dass jemand vor der Haustür steht.
Und sie ahnt auch, wer es ist.
»Mist«, sagt sie, obwohl sie den Besuch eigentlich schon erwartet hat. Sie atmet tief ein, drückt sich langsam aus ihrem Stuhl hoch und wirft einen flüchtigen Blick die Treppe hinauf, als sie den winzigen Flur betritt. Mit arthritisgeplagten Fingern tätschelt sie ihre kurzen, eisblond gefärbten Locken, eine Frisur, die sie seit ihren College-Tagen trägt, streckt widerwillig die Hand nach dem Türknauf aus und lässt sie wieder sinken. Wenn sie nicht öffnet, gehen sie vielleicht wieder.
Aber so viel Glück hat sie nicht.
»Mom!«, ruft eine Männerstimme, begleitet von weiterem Klingeln und Klopfen.
Julia atmet erneut tief ein und öffnet Norman und seiner Frau Poppy die Tür. Wer tauft sein Kind Poppy, denkt sie, als sie in besorgte Gesichter blickt. »Du meine Güte. Was soll das Theater?«
»Was meinst du, ›was soll das Theater?‹«, wiederholt ihr Sohn. »Hast du eine Ahnung, wie lange wir schon hier draußen stehen?«
»So lang kann es auch nicht gewesen sein …«
»Lange genug. Wir dachten, du wärst gefallen und könntest nicht aufstehen. Oder so was.«
Julia erkennt »oder so was« als den Euphemismus, der es ist. Eigentlich meint Norman, wir dachten, du könntest tot sein. Sie macht einen Schritt zurück, um ihren Sohn und seine Frau – seine vierte, falls noch jemand mitzählt – eintreten zu lassen. »Mir geht es bestens«, erklärt sie ihnen. »Und ihr müsst euch auch keine Sorgen darüber machen, dass ich stürze. Du hast mir doch diesen roten Notfallknopf an einer Kette gekauft, auf den ich drücken kann …«
»Damit das funktioniert, müsstest du sie auch tragen«, unterbricht Norman sie und blickt auf ihren nackten Hals.
»Ach komm, sei nicht so pingelig«, sagt Julia und hofft auf ein Lächeln, das sie nicht bekommt. War ihr Sohn schon immer so humorlos?
»Das ist nicht komisch«, sagt er, wie um ihren Verdacht zu bestätigen. Sein Blick folgt dem hohen runden Hintern seiner Frau, als jene sich um Julia herumwindet, ins Wohnzimmer wackelt und sich stirnrunzelnd und mit wie üblich herabgezogenen Mundwinkeln auf das chintzbezogene Sofa sinken lässt.
Julia setzt sich auf einen der beiden nicht zueinander passenden Sessel gegenüber der Couch und wartet, dass ihr Sohn ebenfalls Platz nimmt. Aber er bleibt stehen. Wie haben sie und Walter, mehr als fünfzig Jahre lang ihr Ehemann, es geschafft, einen Sohn hervorzubringen, dessen vier Ehen zusammengenommen nicht mal die Hälfte dieser Spanne abdecken? Nicht dass sie ihr einziges Kind nicht liebt. Sie mag ihn nur nicht besonders. »Gut siehst du aus«, erklärt sie ihm, wie um solche Gedanken zu vertreiben.
Außerdem stimmt es. Norman und seine junge Frau sind wirklich attraktive Exemplare, beide über einen Meter achtzig groß und dank täglichen Trainings und regelmäßigen Golfens in großartiger Form. Sie betrachtet Normans sonnengebräuntes Gesicht und findet es schwer zu glauben, dass ihr Sohn einundfünfzig Jahre alt ist. Noch schwerer zu glauben ist es, dass sie einen Sohn dieses Alters hat, denn abgesehen von der üblichen Ansammlung von Zipperlein fühlt sie sich selbst nicht viel älter.
Ihr Blick schweift zu Poppy – der schlanken, blonden, gut gebauten, porzellanhäutigen, unbestreitbar hübschen Poppy, mit der Norman seit drei Jahren verheiratet ist. Er hat sie im Fitnessstudio des Gebäudes kennengelernt, in dem die von ihm mitgegründete Hedgefonds-Firma residiert, und für sie prompt Ehefrau Nummer drei ausrangiert.
Julia seufzt. Nicht dass sie über den Verlust von Ehefrau Nummer drei besonders traurig gewesen wäre; sie kann sich kaum noch an ihr reizendes Gesicht erinnern. Tatsache war, dass Norman seine Frauen schon immer ebenso schön wie dumm mochte. Faltenlos, ahnungslos und harmlos, denkt sie und seufzt noch einmal.
»Was ist los?«, fragt ihr Sohn jetzt.
»Nichts ist los.«
»Du hast geseufzt.«
»Ach ja?«
»Zwei Mal.«
»Macht dir deine Arthritis Beschwerden?«, fragt Poppy und beugt sich auf dem Sofa vor, sodass ihre künstlich vergrößerten Brüste die Nähte ihres engen pinken Tops spannen.
»Nicht mehr als üblich.« Julia hält zwei deformierte Zeigefinger hoch, deren Spitzen sich beinahe konisch zueinander wenden. »Wie eine Parenthese«, sagt sie lachend. »Eine runde Klammer«, erklärt sie, bevor Poppy fragen kann. »Welchem Anlass verdanke ich das Vergnügen dieses Besuchs?«
»Mehreren Dingen«, sagt Norman. Er geht zum Fenster und starrt auf die Straße. »Hast du Mark gesehen?«
»Mark? Nein. Seit letzter Woche nicht.« Mark ist Normans einundzwanzigjähriger Sohn, ihr einziges Enkelkind, dank Ehefrau Nummer zwei. Sie hat sich fast zehn Jahre lang gehalten, länger als alle anderen von Normans Frauen, wahrscheinlich weil sie bei seinen permanenten Affären einfach weggeschaut hat. Als sie vor zwei Jahren wieder geheiratet hat und nach New York gezogen ist, hat Mark sich entschieden, in Florida zu bleiben und bei seinem Vater einzuziehen, eine unerwartete Entwicklung, die von der vierten Mrs Fisher nicht mit ungeteilter Begeisterung aufgenommen worden ist.
Fairerweise musste man sagen, dass Mark durchaus schwierig sein konnte.
Zum Teufel mit der Fairness, beschließt Julia. »Stimmt irgendwas nicht?«
»Wir haben ihn beim Grasrauchen erwischt … Marihuana«, erklärt Norman.
»Ich weiß, was Gras ist. Ich mag vierundachtzig sein, aber ich bin nicht senil.« Ganz zu schweigen davon, dass ich es in meiner Jugend selbst ein paarmal probiert habe, denkt sie, hält es jedoch für klüger, das nicht zu erwähnen.
»Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Geld aus meinem Portemonnaie gestohlen hat«, fährt Poppy fort.
»Du bist dir ziemlich sicher?«, wiederholt Julia. »Aber nicht hundertprozentig überzeugt?«
»Ich bin ziemlich überzeugt«, sagt Poppy, als würde das die Angelegenheit klären. »Ich meine, neulich sind ungefähr vierzig Dollar aus meinem Portemonnaie verschwunden, und er ist der Einzige, der sie genommen haben kann.«
»Hast du ihn danach gefragt?«
»Ja. Er hat es bestritten.«
»Vielleicht hat er das Geld nicht genommen.«
»Jedenfalls hatten wir einen Riesenstreit deswegen«, sagt Poppy und wischt die Frage von Marks möglicher Unschuld mit einem Wink ihrer langen manikürten Fingernägel beiseite, »und er hat mich mit dem F-Wort beschimpft …«
»Fotze?«, fragt Julia mit mehr Entzücken als beabsichtigt.
»Mutter, wirklich …«
»Wie kannst du dieses Wort überhaupt aussprechen?«, fragt Poppy und kräuselt die Nase.
Julia zuckt die Schultern. Sie hat den Klang eigentlich immer gemocht.
»Wie dem auch sei, er ist aus dem Haus gestürmt«, sagt Norman. »Wir haben ihn seit zwei Tagen nicht gesehen.«
»Ich meine, bestimmt geht es ihm gut«, sagt Poppy. »Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass er so etwas abzieht.«
»Aber es wird das letzte Mal sein«, beharrt Norman. »Unsere Toleranz hat Grenzen. Er hat das College abgebrochen; und er schafft es nicht, sich länger als ein paar Wochen in einem Job zu halten. Wenn er sich nicht am Riemen reißt, müssen wir ihn rauswerfen.«
Julia will etwas einwenden, doch die Tatsache, dass sie einen Sohn zur Welt gebracht hat, der Sachen sagt wie »sich am Riemen reißen«, macht sie vorübergehend sprachlos.
»Wie dem auch sei, ich weiß, dass ihr beiden eine besondere Beziehung habt«, fährt Norman fort und schafft es, das Wort »besondere« halbwegs anstößig klingen zu lassen. »Wenn er also zufällig vorbeikommen sollte, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns sofort anrufst. Und was immer du tust, gib ihm kein Geld.«
»Damit er mal sieht, wie es ist, wenn Norman nicht mehr zur Stelle ist, um seine Rechnungen zu bezahlen«, fügt Poppy hinzu.
In ein paar Jahren kannst du bestimmt selbst ein Lied davon singen, denkt Julia und beißt sich auf die Zunge, um den Gedanken nicht laut auszusprechen. »Was noch? Du hast gesagt, es seien mehrere Dinge …«
»Das haben wir alles schon zig Mal beredet«, sagt Norman. »Es geht um dieses Haus.«
»Oje. Nicht schon wieder.«
»Hör zu«, sagt Norman über ihr aufragend. »Ich habe verstanden, dass du dich an dieses Haus geklammert hast, als Dad gestorben ist. Ich meine, alle Experten raten dazu, im ersten Jahr nach dem Tod eines Menschen keine größeren Veränderungen vorzunehmen, aber es ist jetzt fast zwei Jahre her, und du wirst nicht jünger. Du solltest nicht jeden Tag Treppen steigen, du könntest stürzen und dir das Hüftgelenk brechen …«
»Genau genommen«, unterbricht Julia ihn, »bricht man sich zuerst die Hüfte, heißt es …«
»Was?«
»Man bricht sich zuerst die Hüfte«, wiederholt Julia. »Und stürzt deshalb. Nicht umgekehrt.«
»Okay, gut. Was auch immer«, sagt Norman abschätzig. »Tatsache ist, dass es für dich immer beschwerlicher wird, dich um das Haus zu kümmern. Es hat zu viele Stufen, zu viele Zimmer, die geputzt werden müssen. Außerdem ist es gefährlich für eine Frau deines Alters, allein zu leben. Jemand könnte einbrechen …«
»Niemand wird einbrechen.«
»… und du wärst hilflos der Gnade eines Räubers ausgesetzt …«
»Unsinn«, erklärt Julia entschieden, um die Diskussion zu beenden. »Außerdem habe ich eine Waffe.«
»Was? Seit wann hast du eine Waffe?«
»Sie hat deinem Vater gehört.«
»Oh, um Gottes willen. Die Antiquität? Funktioniert das alte Ding überhaupt noch?«
»Warum sollte es nicht funktionieren?« In Wahrheit hat sie keine Ahnung, ob die alte Pistole funktioniert. »Jedenfalls verkaufe ich das Haus nicht, also …«
»Der Markt ist gerade heiß. Wir könnten einen guten Preis erzielen …«
»Wir?«
»Du könntest in eine Wohnung ziehen, von Menschen deines eigenen Alters umgeben sein.«
»Ich will nicht von Menschen meines eigenen Alters umgeben sein.«
»Ich könnte das Geld für dich investieren. Du könntest sehr gut leben …«
»Ich lebe schon sehr gut.«
»Versprichst du, dir Manor Born mir zuliebe wenigstens einmal anzusehen?«
»Manor Born? Du willst mich in ein Heim stecken?«
»Es ist kein Heim. Es ist eine erstklassige Residenz für betreutes Wohnen.«
»Es ist mir verdammt egal, wie du es nennst. Ich ziehe nicht dorthin.«
»Du bist uneinsichtig«, erklärt Norman seiner Mutter.
»Du bist ein Arsch«, erklärt Julia ihrem Sohn.
»Er versucht bloß, sich um dich zu kümmern«, meldet sich Poppy zu Wort.
»Wie süß.« Julia stemmt sich aus ihrem Sessel und marschiert, so rüstig sie kann, zur Haustür. »Danke, dass du vorbeigeschaut hast, Schatz. Ich weiß, wie beschäftigt du bist.« Sie öffnet die Tür, als das junge Paar, das vor Kurzem nebenan eingezogen ist, gerade seinen blauen Hyundai aus der Garage fährt.
»Schicke Karre!«, sagt der junge Mann und bleibt in der Auffahrt stehen, um den silbernen Tesla zu bewundern. »Haben Sie den neu gekauft?«
Julia lacht, geschmeichelt, dass er überhaupt auf den Gedanken gekommen ist. »Es ist nicht meiner«, sagt sie, als Norman und Poppy neben ihr auf die Schwelle treten.
»Schicke Karre«, wiederholt der junge Mann, diesmal an Norman gewandt.
Julia weiß nicht mehr, wie er heißt, glaubt jedoch, dass es einer dieser modernen Namen war. Seine Frau – auch an ihren Namen kann Julia sich nicht erinnern, glaubt jedoch, dass es ein überraschend altmodischer ist – winkt ihr zu.
»Wirst du wenigstens darüber nachdenken, was ich gesagt habe?«, fragt Norman seine Mutter.
»Nein, werde ich nicht«, entgegnet Julia.
»Er will sich bloß um dich kümmern«, sagt Poppy noch einmal, folgt ihrem Mann zu ihrem Wagen und tritt einen Schritt zurück, als die Türen nach oben aufklappen.
Wie ein Rieseninsekt vor dem Abheben, denkt Julia. Viel zu einschüchternd. Da ist ihr der schnörkellose Chevrolet viel lieber, den ihr Mann gekauft hatte, ein Jahr bevor man seinen Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostizierte. Sie blickt über die Straße zum Haus von Dr. Nick Wilson, wie immer dankbar für die wunderbare Pflege, die er ihrem Mann in den Monaten vor seinem Tod hat angedeihen lassen. Kann das wirklich schon fast zwei Jahre her sein? Sie atmet einmal tief durch, kehrt ins Haus zurück und schließt die Haustür, bevor der Tesla ganz aus der Ausfahrt verschwunden ist.
»Sind sie weg?«, fragt eine Stimme vom oberen Treppenabsatz.
»Ja.« Julia beobachtet, wie ihr Enkel die Stufen hinunterkommt; zuerst tauchen lange dürre Beine auf, gefolgt von einem langen dünnen Oberkörper und zuletzt einem langen schmalen Gesicht, gerahmt von langem welligem braunem Haar, das bis auf seine knochigen Schultern fällt. »Du musst sie wirklich anrufen, hörst du.«
»Ich weiß. Das mach ich auch. Danke, dass du mich nicht verraten hast. Und dass du meinen guten Ruf verteidigt hast, obwohl …«
»Du hast das Geld genommen?«
»Hab ich«, gibt Mark zu, geht in die Küche und nimmt sich einen von den gekauften mürben Muffins aus dem Brotkorb. »Ich meine, sie hat ihr Portemonnaie auf dem Küchentresen liegen lassen, als ob es eine Art Test wäre.«
»Den du nicht bestanden hast.«
»Oder doch, je nachdem wie man es sieht.«
Julia lächelt. Zumindest hat irgendjemand in ihrer Familie Humor.
»Hast du wirklich eine Pistole?«, fragt er.
»Offenbar eine Antiquität.«
Nun ist es an ihrem Enkel zu lächeln. »Wo ist sie?«
»Ich habe keine Ahnung.« Julia vermutet, dass sie in einer der Kisten mit Walters Sachen in der Garage ist, doch das behält sie für sich.
Mark beißt in den Muffin. »Nana …«
»Ja?«
»Ich hab nachgedacht …«
Wer weiß, ob das eine gute Idee ist, denkt Julia und wartet, dass er fortfährt.
»Vielleicht könnte ich eine Weile bei dir einziehen«, überrascht er sie. »Dann müsste ich nicht zurück nach Hause, und du wärst nicht allein. Ich bin sogar ein ziemlich guter Koch.«
»Wirklich? Wann hast du denn kochen gelernt?«
Er zuckt die Schultern. »Keine von Dads Frauen war besonders gut in der Küche, meine Mutter inklusive. Mir ist eigentlich gar nichts anderes übriggeblieben, wenn ich überleben wollte. Außerdem überleg doch mal. Wenn ich bei dir einziehe, würde das die Probleme von allen lösen.«
Julia ist sich nicht sicher, ob sein Einzug nicht einen Haufen neuer schaffen würde, doch Tatsache ist auch, dass sie ihren Enkelsohn seit dem Tag seiner Geburt vergöttert. Und es ist nicht seine Schuld, dass sein Vater ein humorloser Blödmann ist und seine diversen Mütter eine Folge ichbezogener Tussis waren. Sie muss an die Pointe des alten Witzes denken, warum sich Großeltern und ihre Enkel so gut verstehen: Sie haben einen gemeinsamen Feind.
Mark nimmt die Zeitung vom Tresen. »›Verjubeln‹«, sagt er und tippt mit seinen feingliedrigen Fingern auf das Kreuzworträtsel.
»Was?«
»Das Wort, das dir noch fehlt. Für ›verschwenderisch umgehen mit‹. Es ist ›verjubeln‹.«
»Du hast recht.« Julia füllt die Felder aus. »Danke.«
Er lacht und nimmt sich noch einen Muffin. »Die sind übrigens ungenießbar«, sagt er und isst trotzdem weiter. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die besser hinkriege.«
»Du darfst es auf jeden Fall sehr gern versuchen.«
»Heute Nachmittag gehen wir einkaufen. Du wirst sehen«, sagt er lächelnd. »Es wird dir gefallen, mich um dich zu haben.«
KAPITEL FÜNF
»Das war mal ein Auto«, sagt Aiden, als er mit dem blauen Hyundai in die Hood Road biegt.
»Ein bisschen schlicht«, sagt seine Frau, »bis auf die Türen.«
»Die Türen sind echt speziell.«
»Eine Corvette ist mir trotzdem lieber«, sagt Heidi. Vor ihrer Hochzeit vor mehr als einem Jahr hatte Aiden ihr eine Corvette versprochen. Aber Aidens Mutter Lisa hatte darauf bestanden, dass ein Sportwagen sowohl zu teuer als auch zu unpraktisch sei, und da das Geld, mit dem der Wagen bezahlt wurde, ihres war – ehrlich gesagt wird fast alles von ihrem Geld bezahlt, inklusive der Anzahlung und der Hypothek für das Haus –, hatte Aiden sich ihrer Wahl angeschlossen. Das war nicht ungewöhnlich. Zu Heidis großer und andauernder Verzweiflung schließt Aiden sich fast jeder Entscheidung seiner Mutter an.
Heidi ist die einzige Ausnahme.
Lächelnd klappt sie die Sonnenblende herunter, überprüft ihre Erscheinung in dem kleinen Spiegel und ist zufrieden mit dem, was sie sieht: große braune Augen, hohe Wangenknochen wie ein Model, schulterlange bernsteinfarbene Locken, die sich bei Luftfeuchtigkeit wundersamerweise nicht kräuseln, volle bogenförmige Lippen.
Alle sagen immer, sie und Aiden seien ein hübsches Paar, wie Ken und Barbie zum Leben erweckt. Und der Vergleich stimmt – soweit er trägt. Ihr Mann ist in der Tat schlank und muskulös. Aber in ihm steckt mehr, als sein nichtssagend attraktives Äußeres vermuten lässt; hinter diesen dunkelblauen Augen geht etwas Tiefes, sogar Geheimnisvolles vor.