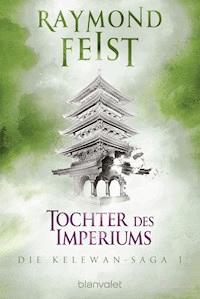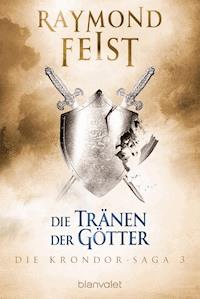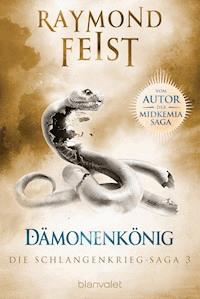9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE ERBEN VON MIDKEMIA
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker der heroischen Fantasy in überarbeiteter Neuausgabe!
Der junge Talon steht kurz davor, als Mann in die Gemeinschaft seines Stammes aufgenommen zu werden. Dafür muss er alleine auf dem Gipfel eines einsamen Berges überleben, bis die Götter ihn erlösen. Als ihn ein seltener Silberfalke angreift, hält er es für ein Zeichen und kehrt in sein Dorf zurück. Doch seine Heimat liegt in Schutt und Asche, alle Bewohner wurden bei einem heimtückischen Überfall ermordet. Entschlossen, seine toten Freunde und Verwandten zu rächen, bricht er auf, um das Unmögliche zu vollbringen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Einsam wandert Kieli im Schatten der Berggipfel umher. Der Junge aus dem Volk der Orosini wartet auf eine göttliche Vision, die ihm Auskunft über sein weiteres Schicksal gibt. Als ihn ein seltener Silberfalke angreift, hält er es für ein Zeichen und kehrt in sein Dorf zurück. Doch seine Heimat liegt in Schutt und Asche, alle Bewohner wurden bei einem Überfall getötet. Kieli, der sich von nun an Silberfalke nennt, ist entschlossen, seine Familie zu rächen, und begibt sich auf eine gefährliche Suche nach den Mördern.
Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt seiner Romane: Midkemia. Die in den 80er Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Von Raymond Feist bereits erschienen
Die Midkemia-Saga
Die Kelewan-Saga
Die Midkemia-Chronik
Die Schlangenkrieg-Saga
Die Erben von Midkemia
Die Krondor-Saga
Die Legenden von Midkemia
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Raymond Feist
Die Erben von Midkemia 1
Der Silberfalke
Roman
Deutsch von Regina Winter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Talon of the Silver Hawk. Conclave of Shadows (Vol 1)« bei Harper Collins Publishers, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2002 by Raymond E. Feist
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2003 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
Karten: © Melanie Korte, Inkcraft
DN · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24518-4V003
www.blanvalet.de
Für Jamie Ann,
die mir Dinge beigebracht hat,
von denen ich nicht einmal wusste,
dass ich sie lernen musste.
Der Tod beugt sich über mich
Und flüstert mir leise ins Ohr.
WALTER SAVAGE LANDOR
Der Übergang
Der Junge wartete.
Schaudernd rückte er näher zu den niedergebrannten Überresten seines jämmerlich kleinen Feuers. Er hatte viel zu wenig geschlafen und daher dunkle Ringe unter den hellblauen Augen. Leise wiederholte er die Rezitation, die er von seinem Vater gelernt hatte; er hatte die heiligen Worte schon so oft gesprochen, dass seine trockenen Lippen aufgerissen waren und seine Stimme heiser war.
Sein beinahe schwarzes Haar war verfilzt und staubig, weil er auf dem Boden geschlafen hatte – und dabei war er doch so entschlossen gewesen, wach zu bleiben, während er auf seine Vision wartete! Aber am Ende hatte ihn die Erschöpfung doch überwältigt. Er war ohnehin schlank, aber nun hatte er so abgenommen, dass er hager und bleich geworden war und sich seine ausgeprägten Wangenknochen noch deutlicher abzeichneten. Er war nur mit dem Lendenschurz eines Suchenden bekleidet. Schon in der ersten Nacht hier draußen hatten ihm sein Lederhemd und die Hose, seine festen Stiefel und der dunkelgrüne Umhang sehr gefehlt.
Am Himmel wich das Dunkel jenem Grau, das den Tagesanbruch ankündigt, und die Sterne verblassten allmählich. Es war, als hielte sogar der Wind die Luft an und wartete auf das erste Atemholen, die ersten Regungen des neuen Tages.
Diese Stille war ungewöhnlich, ebenso beunruhigend wie faszinierend, und der Junge hielt im Einklang mit seiner Umgebung ebenfalls einen Augenblick die Luft an. Dann berührte ihn ein Hauch, der sanfte Atem der Nacht erklang seufzend, und der Junge holte wieder Luft.
Als der Himmel im Osten heller wurde, streckte der Junge den Arm aus und griff nach einer Kürbisflasche. Er trank das Wasser darin und versuchte, es zu genießen, denn das war alles, was er zu sich nehmen durfte, bis er seine Vision gehabt hatte und den Bach erreichen würde, der auf seinem Rückweg zum Dorf den Weg kreuzte.
Seit zwei Tagen hatte er unterhalb des Gipfels des Shatana Higo gesessen, an jenem Ort, an dem die Jungen seines Volkes zu Männern wurden, und auf seine Vision gewartet. Er hatte bereits die letzten beiden Tage im Dorf gefastet und nur Kräutertee und Wasser getrunken, dann hatte er die traditionelle Kriegermahlzeit zu sich genommen – Trockenfleisch, hartes Fladenbrot und Wasser mit bitteren Kräutern – und war einen halben Tag den staubigen Weg zum Osthang des heiligen Bergs hinaufgestiegen bis zur kleinen Senke ein Dutzend Schritte unter dem Gipfel. Diese Lichtung war kaum groß genug, um einem halben Dutzend Menschen Platz zu bieten, aber als der Junge sie nach seiner Wanderung am dritten Tag der Zeremonie erreichte, war sie ihm riesig und leer vorgekommen. Seine Kindheit in einem großen Haus mit vielen Verwandten hatte ihn nicht auf solche Isolation vorbereitet, und dies war das erste Mal in seinem Leben, dass er mehr als ein paar Stunden allein verbracht hatte.
Wie es bei den Orosini üblich war, hatte der Junge die rituelle Vorbereitung auf den Tag, an dem er zum Mann werden würde, am dritten Tag vor dem Mittsommerfest begonnen, das die Tiefländer Banpis nannten. Er würde das neue Jahr und das Ende seiner Kindheit feierlich begehen, indem er über die Überlieferung seiner Familie und seines Clans, seines Stammes und seines Volkes nachdachte und versuchte, damit die Weisheit seiner Ahnen heraufzubeschwören. Es war eine Zeit tiefer Innenansicht und Meditation, in der ein Junge versuchte, seinen Platz im Universum zu begreifen, die Rolle, die die Götter ihm zugedacht hatten. Und an diesem Tag sollte er sich auch seinen Männernamen erwerben. Wenn alles so verlief, wie es geschehen sollte, würde er am Abend des Mittsommerfests wieder bei seiner Familie und seinem Clan sein.
Als Kind war er Kieli gerufen worden, eine Kurzform von Kielianapuna, dem Wort, mit dem sein Volk das Rote Eichhörnchen bezeichnete. Diese Waldbewohner, die man selten zu sehen bekam, obwohl sie sich stets in der Nähe aufhielten, wurden von den Orosini als Glücksbringer betrachtet, und man hielt Kieli im Dorf für ein Glückskind.
Der Junge konnte sein Zittern kaum mehr beherrschen, denn sein geringes Körperfett schützte ihn kaum vor der Kälte. Selbst jetzt, mitten im Sommer, wurde es nach Sonnenuntergang auf den Berggipfeln im Land der Orosini recht kalt.
Kieli wartete auf seine Vision. Er sah, wie der Himmel heller wurde, ein langsamer, aber stetiger Übergang von Grau zu Graublau und dann zu einem zarten Rosa, als sich die Sonne dem Horizont näherte. Er sah, wie sich die ersten Sonnenstrahlen über die Berge tasteten und dann die helle, weiß-golden leuchtende Scheibe selbst erschien, die ihm einen weiteren Tag der Einsamkeit ankündigte. Er wandte den Blick ab, als die Sonne endgültig aufgegangen war, um nicht geblendet zu werden.
Das Zittern ließ allmählich nach, als ihm ein wenig wärmer wurde. Er blieb sitzen, zunächst erwartungsvoll, aber dann überfiel ihn eine tiefe, von Erschöpfung geprägte Hoffnungslosigkeit.
Jeder Orosini-Junge musste sich an dem Mittsommertag, der seinem Geburtstag am nächsten lag, an einen der vielen heiligen Orte seines Volkes begeben und sich diesem Ritual unterziehen. Es schien, als wären schon vor Anbeginn der Zeit Jungen zu Aussichtspunkten wie dem aufgestiegen, an dem Kieli nun saß, und als Männer in ihre Dörfer zurückgekehrt.
Der Junge verspürte kurz so etwas wie Neid, als er daran dachte, dass die Mädchen seines Alters im Dorf im Augenblick mit den Frauen im Rundhaus saßen, wo sie aßen und schwatzten, sangen und beteten. Irgendwie gelang es den Mädchen, ihre Frauennamen ohne die Entbehrungen zu finden, die die Jungen über sich ergehen lassen mussten. Kieli ließ den Augenblick vorübergehen – sein Großvater hatte es immer für Zeitverschwendung gehalten, wenn man sich wegen Dingen Gedanken machte, die man nicht ändern konnte.
Er dachte an seinen Großvater, Lachende Augen. Der alte Mann war der Letzte gewesen, der mit Kieli gesprochen hatte, bevor sich der Junge auf den einsamen Weg aus dem Tal, in dem sein Volk lebte, zum Berggipfel gemacht hatte. Großvater hatte gelächelt wie immer – Kieli konnte sich kaum an einen Zeitpunkt erinnern, an dem nicht ein Lächeln auf dem Gesicht des alten Mannes gelegen hätte. Sein Gesicht war von beinahe achtzig Jahren in den Bergen gegerbt wie braunes Leder, aber die Clantätowierungen auf seiner linken Wange waren trotz vielen Jahren in der Sonne immer noch schwarz. Der alte Mann hatte immer noch scharfe Augen und ausgeprägte Züge, und sein Gesicht war von stahlgrauem Haar gerahmt, das ihm bis auf die Schultern fiel, und Kieli sah seinem Großvater ähnlicher als seinem Vater, denn sie hatten beide diese bräunliche Haut, die im Sommer nussbraun wurde und nur selten in der Sonne verbrannte, und als er noch jünger gewesen war, hatte auch Kielis Großvater rabenschwarzes Haar gehabt. Die Leute sagten hin und wieder, sie müssten wohl vor ein paar Generationen einen Fremden in ihre Familie aufgenommen haben, denn die Orosini waren überwiegend blond, und schon braunes Haar war ungewöhnlich.
»Wenn der Kürbis am Mittsommertag leer ist, vergiss eins nicht«, hatte Kielis Großvater seinem Enkel zugeflüstert. »Wenn die Götter nicht bereits einen Namen für dich vorgesehen haben, bedeutet das einfach, dass sie dir gestatten, selbst einen zu wählen.« Und dann hatte ihn der alte Häuptling fest umarmt und ihn mit einem spielerischen, aber immer noch kräftigen Schlag auf den Rücken auf den Weg geschickt. Die anderen Männer des Dorfes Kulaam hatten zugesehen, lächelnd oder lachend, denn die Zeit der Namensvision war eine Zeit der Freude, und bald würde es im Dorf ein Fest geben.
Nun erinnerte sich Kieli wieder an die Worte seines Großvaters und fragte sich, ob überhaupt ein Junge seinen Namen jemals tatsächlich von den Göttern erhalten hatte. Er warf einen Blick in den Kürbis. Das Wasser würde ihm voraussichtlich gegen Mittag ausgehen. Er wusste, dass er auf halbem Weg zum Dorf welches finden würde, aber dazu würde er den Berg spätestens dann verlassen müssen, wenn die Sonne ihren Höchststand erreicht hatte.
Er dachte eine Weile nach. Gedanken über sein Dorf plätscherten durch seinen Kopf wie der kleine Bach, der hinter dem Langhaus entlangrauschte. Er nahm an, dass sein Geist nur dann frei umherschweifen konnte, wenn er sich nicht zu sehr bemühte, seine Vision zu finden. Er wollte so schnell wie möglich zurückkehren, denn seine Familie fehlte ihm. Sein Vater war alles, was der Junge einmal werden wollte: stark, freundlich, sanft, entschlossen, furchtlos im Kampf und liebevoll zu seinen Kindern. Kieli vermisste seine Mutter, seine jüngere Schwester Miliana und vor allem seinen älteren Bruder Sonnenhand, der selbst erst vor zwei Jahren von seiner Namenssuche zurückgekehrt war, von der Sonne rot verbrannt bis auf einen hellen Abdruck seiner eigenen Hand, die den Tag über auf seiner Brust gelegen hatte. Großvater hatte erzählt, dass Sonnenhand nicht der erste Junge war, zu dem die Vision im Schlaf gekommen war.
Sonnenhand war immer sehr nett zu seinem kleinen Bruder und seiner kleinen Schwester, hatte auf die beiden aufgepasst, wenn ihre Mutter auf dem Feld gearbeitet hatte, und ihnen die besten Plätze zum Beerenpflücken gezeigt. Die Erinnerung an diese Beeren, zerdrückt, mit Honig gesüßt und auf frisches warmes Brot gestrichen, ließ Kieli das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Das Fest würde wunderschön werden, und als Kieli an das Essen dachte, das schon auf ihn wartete, fing sein Magen laut an zu knurren. Wenn er ins Dorf zurückkehrte, würde er zusammen mit den Männern im Langhaus sitzen dürfen, und er bräuchte nicht mehr im Rundhaus mit seiner Mutter, den anderen Frauen und den Kindern zu bleiben. Ein klein wenig bedauerte er das, denn der Gesang der Frauen, wenn sie arbeiteten, ihr Lachen und Schwatzen, der Klatsch und die Scherze waren, so lange er sich erinnern konnte, Teil seines Alltags gewesen. Aber er freute sich auch voller Stolz darauf, bei den Männern des Clans zu sitzen.
Wieder schauderte er, wenn auch nur kurz, dann seufzte er, entspannte sich und ließ sich weiterhin von der Sonne wärmen. Er wartete, bis die steifen Muskeln etwas lockerer geworden waren, dann kam er auf die Knie hoch und kümmerte sich um sein Feuer. Er legte ein paar neue Zweige auf die glimmende Asche, blies hinein, und schon bald züngelten kleine Flammen hoch. Er würde das Feuer wieder niederbrennen lassen, wenn es am Berg erst wärmer geworden war, aber im Augenblick war er dankbar für die Wärme.
Er lehnte sich gegen die Felsen, die sich trotz der Kälte, die immer noch in der Luft hing, ebenfalls allmählich aufwärmten, und trank noch einen Schluck. Dann seufzte er tief und schaute zum Himmel. Warum habe ich keine Vision?, fragte er sich. Warum hatte er noch keine Botschaft von den Göttern erhalten, die ihm seinen Männernamen nannte?
Sein Name würde der Schlüssel zu seinem Na’ha’tab sein, der geheimen Natur seines Wesens, die nur er und die Götter wirklich kannten. Andere Menschen würden zwar den Namen erfahren, denn er würde ihn voller Stolz verkünden, aber niemand würde wissen, um was es in seiner Vision gegangen war und was ihm sein Name über seinen Platz im Universum, seinen Auftrag von den Göttern oder sein Schicksal verraten hatte. Sein Großvater hatte ihm einmal erzählt, dass nur wenige Männer ihr Na’ha’tab wirklich verstanden, selbst wenn sich die meisten einbildeten, es zu begreifen. Die Vision war nur ein erster Hinweis von den Göttern auf die Pläne, die sie mit einem Mann hatten. Manchmal, hatte Großvater gesagt, waren diese Pläne recht schlicht: Die Götter wollten, dass einer ein guter Ehemann und Vater war, dass er zum Wohl des Dorfes und des Volkes beitrug und ein gutes Beispiel für andere war, und es konnte sein, dass die Rolle eines Mannes einfach darin bestand, Vater eines ganz besonderen Kindes zu werden, eines Na’rif, und solch ein Plan fand erst lange nach dem Tod des Vaters seine wirkliche Erfüllung.
Kieli wusste, was sein Großvater jetzt zu ihm sagen würde: dass er sich zu viele Gedanken machte und er einfach die Sorgen beiseiteschieben und sich von den Göttern dorthin bringen lassen sollte, wo sie ihn haben wollten. Kieli wusste, dass ihm sein Vater das Gleiche raten und noch hinzufügen würde, dass man, um ein guter Jäger zu sein, um im Langhaus gute Ratschläge geben zu können und ein guter Ehemann zu sein, zunächst einmal lernen müsse, still zu sein und zuzuhören.
Er schloss die Augen und lauschte dem Geräusch des Windes in den Bergen. Der Wind sprach zu ihm, wenn die Zedern und Kiefern rauschten. Manchmal konnte der Wind grausam sein und mit einer bitteren, eisigen Klinge durch die dicksten Pelze schneiden. Zu anderen Zeiten brachte er ersehnte Erleichterung und kühlte selbst die heißesten Sommertage. Sein Vater hatte Kieli von den Stimmen des Windes erzählt und ihm beigebracht, dass man sie verstehen konnte, wenn man lernte, eins mit dem Wind zu werden, wie es die Falken und Adler taten, die ihre Nester oben auf den zerklüfteten Gipfeln bauten.
Ein Kreischen gellte durch die Morgenluft, und Kieli fuhr herum, als ein Silberfalke keine zehn Schritte von ihm entfernt ein Kaninchen riss. Dieser seltenste Vogel des Hochgebirges hatte eigentlich graue Federn und ein paar schwarze Flecken an Kopf und Schultern, aber ein Schimmer auf den Flügeln ließ diese manchmal wie Silber blitzen, wenn sich der Falke in den klaren Himmel schraubte.
Der Raubvogel hatte das sich heftig wehrende Kaninchen fest gepackt und erhob sich mit kräftigen Flügelschlägen in die Luft. Das Kaninchen hing schlaff herab, ganz ähnlich wie ein kleines Kätzchen, das von seiner Mutter getragen wurde, als hätte es sich seinem Schicksal ergeben. Kieli wusste, dass sich das Tier in einem Schockzustand befand – eine Freundlichkeit der Natur, die die Schmerzen und die Angst verringerte. Er hatte einmal einen Hirsch reglos am Boden liegen sehen, den Gnadenstoß erwartend, den ihm der Jäger mit dem Messer versetzen würde, nachdem ihn ein Pfeil gefällt, aber nicht getötet hatte.
In der Ferne sah er Truthahngeier träge kreisen und die Aufwinde von den sich schnell erwärmenden Felsen ausnutzen, um im Segelflug nach Beute Ausschau zu halten. Ihre gewaltige Spannweite erlaubte es ihnen, auf den Aufwinden zu schweben, während sie sich nach Totem und Sterbendem am Boden umsahen. Wenn sie zu einem Tierkadaver hüpften, wirkten sie ungeschickt und hässlich, aber in der Luft bewegten sie sich geschmeidig und majestätisch.
Im Süden entdeckte Kieli eine Gabelweihe, die in der Luft zu hängen schien, den schwarzen Schwanz nach unten gerichtet, während sie rasch zwei- oder dreimal flatterte, dann innehielt, um ein Stück abzusacken, dann wieder flatterte, um über der erspähten Beute an Ort und Stelle zu verharren. Dann stieß sie mit verblüffender Geschwindigkeit zu, die Krallen nach unten gerichtet, und traf mit ans Übernatürliche grenzender Präzision ihr Ziel, nur um sich sogleich wieder zu erheben, eine quiekende Wühlmaus in den Krallen.
Aus der Ferne drangen die Geräusche des Waldes zu Kieli. Seine tagaktiven Bewohner ließen sich sehen, während die Nachttiere ihre Schlafplätze aufsuchten. Ein Specht pickte in der Rinde eines nahen Baumes fleißig nach Insekten. Dem Muster des Geräuschs entnahm Kieli, dass es einer von den Spechten mit rotem Kopf war; das Klopfen war langsam, laut und eindringlich, anders als das immer wieder abbrechende Stakkato seines Vetters mit den blauen Flügeln.
Die Sonne stieg höher in den Morgenhimmel, und bald schon ging das Feuer aus. Es brauchte es auch nicht mehr, denn nun war die Tageshitze in die Berge zurückgekehrt. Kieli widerstand der Versuchung, den letzten Rest seines Wassers zu trinken, denn er musste es aufheben, bis er ins Dorf zurückkehren konnte. Er würde unten am Bach trinken können, aber den musste er erst einmal erreichen, und wenn er sein Wasser jetzt verschwendete, konnte es durchaus sein, dass er es nicht bis dorthin schaffte.
Es kam nur sehr selten vor, dass ein Junge in den Bergen umkam, aber es war schon passiert. Der Stamm bereitete jeden Jungen so gut wie möglich auf das Namensritual vor, doch man glaubte, dass jene, die es nicht überlebten, von den Göttern für unzureichend gehalten wurden, und die Trauer ihrer Familien bildete einen bitteren Kontrast zum Mittsommerfest.
Es war heißer geworden, die Luft war trockener, und Kieli wurde klar, dass sich ein Sa’tana näherte. Der Wind, der aus dem Norden kam, war das ganze Jahr über kalt, aber der Westwind konnte im Sommer schnell trocken und heiß werden. Der Junge hatte schon erlebt, wie Gras in weniger als drei Tagen braun und brüchig wurde und Obst durch diesen Wind an den Zweigen vertrocknete. Männer wurden ruhelos und Frauen gereizt, wenn der Sa’tana länger als ein paar Tage anhielt, und die Haut begann zu jucken. Wenn Kieli und sein Bruder an solchen Tagen im Fluss geschwommen waren, waren sie schon wieder trocken gewesen, wenn sie das Dorf erreichten, so als hätte es die kühle Berührung des Wassers überhaupt nicht gegeben.
Kieli wusste, dass der Sa’tana ihm die Feuchtigkeit aus dem Körper saugen würde, wenn er hierblieb. Er warf einen Blick zum Himmel und erkannte, dass es nur noch zwei Stunden bis zur Mitte des Tages waren. Die Sonne hatte mehr als die Hälfte ihres Wegs zum Zenit zurückgelegt, und Kieli blinzelte, weil ihm von der Helligkeit Tränen in die Augen traten.
Er ließ seine Gedanken einen Augenblick schweifen, während er sich fragte, wen man wohl auswählen würde, um an seiner Seite zu sitzen. Denn während er sich selbst am Berg aufhielt, würde sich sein Vater mit dem Vater eines der jungen Mädchen aus den Dörfern treffen. In Kielis eigenem Dorf gab es drei mögliche Gefährtinnen für Kieli: Rapanuana, die Tochter von Waldrauch, Janatua, die Tochter von Gebrochener Speer, und Türkisauge, die Tochter von Windgesang.
Türkisauge war ein Jahr älter als Kieli und hatte schon im Jahr zuvor ihren Frauennamen erhalten, aber es hatte im Dorf keinen Jungen im richtigen Alter gegeben, der für eine Verbindung geeignet gewesen wäre. Dieses Jahr waren es sechs, Kieli eingeschlossen. Türkisauge hatte einen etwas merkwürdigen Sinn für Humor, und Kieli fragte sich oft, was sie eigentlich so komisch fand, wenn sie lachte oder lächelte. Sie schien sich häufig über ihn zu amüsieren, und er wurde dann in ihrer Gegenwart verlegen. Obwohl er es gut verbarg, hatte er sogar Angst vor ihr. Aber Rapanuana war dick und launisch, und Janatua hatte ein spitzes Gesicht und war so schüchtern, dass ihr in Gegenwart von Jungen die Worte fehlten. Türkisauge hatte einen geschmeidigen, hochgewachsenen Körper und leuchtende honigfarbene Augen, die sie stets zusammenkniff, wenn sie lachte. Ihre Haut war heller als die der anderen Mädchen, sie hatte ein paar Sommersprossen, und ihr herzförmiges Gesicht war umgeben von einer Haarmähne von der Farbe reifen Weizens. Kieli betete zu den Göttern, dass sich sein Vater am Abend vor Mittsommer mit ihrem Vater und nicht mit einem der Väter der anderen Mädchen zusammengesetzt hatte. Dann wurde ihm mit aufflackernder Panik klar, dass sein Vater sich vielleicht auch mit dem Vater eines der Mädchen aus den Nachbardörfern getroffen haben könnte, mit dem der trägen Pialua oder der hübschen, aber immer unzufriedenen Mandia!
Er seufzte. Er hatte darauf keinen Einfluss. Manchmal berichteten die Geschichtenerzähler am Feuer von Männern und Frauen, die sich nacheinander sehnten – viele von diesen Geschichten hatten sie von Sängern aus dem Tiefland gehört, die hin und wieder in die Berge kamen. Aber bei seinem Volk wählte ein Vater die Braut für seinen Sohn oder einen Mann für seine Tochter. Manchmal kehrte ein Junge – nein, verbesserte er sich, ein Mann – von seiner Suche zurück und musste feststellen, dass keine Braut auf ihn wartete und bei seinem Namensfest neben ihm sitzen würde, und er musste noch ein Jahr auf eine Braut warten. Und manchmal, wenn auch sehr selten, geschah es auch, dass kein Vater seine Tochter mit einem bestimmten jungen Mann verheiraten wollte, und er musste das Dorf verlassen, um sich eine Frau zu suchen, oder sich damit abfinden, allein zu leben. Er hatte einmal von einer Witwe gehört, deren Vater gestorben war, bevor er ihr einen Mann hatte aussuchen können, und danach hatte sie einen solch alleinstehenden Mann in ihre Hütte aufgenommen, aber niemand hielt das für eine richtige Ehe.
Wieder seufzte er. Er wollte die ganze Sache endlich hinter sich bringen. Er wollte etwas essen, er wollte wieder in seinem Bett schlafen, und er wollte Türkisauge, obwohl sie ihn verlegen machte.
Der Wind trug ein Geräusch heran, das er als das Knurren einer Bärin mit Jungen erkannte. Sie klang erschrocken, und Kieli wusste, dass ihre Jungen nun auf einen Baum klettern würden, um Schutz zu suchen.
Kieli setzte sich aufrecht hin. Was konnte einen Schwarzbären so nahe am Berg in Schrecken versetzen? Vielleicht eine große Katze wie ein Leopard oder Puma. Für die mächtigen Felsenlöwen waren sie zu hoch am Berg. Oder vielleicht war einer dieser geflügelten Drachen auf der Jagd, dachte er und fühlte sich hier draußen auf den Felsen plötzlich sehr klein und verwundbar.
Die kleineren Vettern der großen Drachen, die hier in den Bergen nisteten, konnten ein halbes Dutzend oder mehr erfahrene Krieger beschäftigen, und ein Junge mit nur einem Ritualdolch und einem Wasserkürbis wäre für ein solches Tier nichts weiter als ein leicht zu erbeutendes Frühstück.
Auch ein jagendes Rudel könnte die Bärin erschreckt haben. Wilde Hunde und Wölfe gingen Bären zwar für gewöhnlich lieber aus dem Weg, aber ein Junges wäre eine willkommene Mahlzeit, wenn man die Mutter von ihm weglocken konnte.
Oder es waren Menschen.
In der Ferne wurde der Kreis von Truthahngeiern größer. Der Junge erhob sich, um besser sehen zu können, und spürte, dass ihm schwindlig wurde, denn er war zu schnell aufgestanden. Er stützte sich mit einer Hand an die Felsen und spähte in die Ferne.
Die Sonne stand nun schon hoch am Himmel und hatte den morgendlichen Dunst weggebrannt, darum konnte Kieli die kreisenden Geier und Weihen deutlich sehen. Kieli war im Dorf für sein Sehvermögen berühmt; er konnte besser sehen als alle anderen. Großvater sagte immer, was dem Jungen sonst auch fehlen mochte, er hatte die Augen eines Falken.
Seine Augen sahen es tatsächlich ganz genau, aber sein Kopf wollte es noch nicht begreifen. Es dauerte einige Zeit, bis ihm wirklich klar wurde, dass die Vögel über Kapoma kreisten. Panik zündete in ihm wie ein Funke und, ohne zu zögern, rannte er los.
Kapoma war die Siedlung neben seinem eigenen Dorf!
Es gab nur eine mögliche Erklärung für so viele Aasfresser über Kapoma: einen Kampf!
Kieli spürte, wie seine Panik größer wurde. Die Vögel bedeuteten auch, dass sich niemand um die Toten kümmerte. Wenn sich Banditen in den Tälern herumtrieben, wäre Kulaam das nächste Dorf auf ihrer Liste.
Kielis Gedanken überschlugen sich bei der Vorstellung, dass seine Familie um ihr Leben kämpfen musste und er nicht bei ihr war. Als Junge war er zweimal im Rundhaus bei den Frauen geblieben, während die Männer das Dorf gegen einen Angriff verteidigt hatten. Einmal war es ein Kampf mit den Männern aus dem Dorf Kahanama gewesen, und ein anderes Mal hatte ein Trupp von Gnomen Kinder für ihre widerwärtigen Opferrituale gesucht, aber die feste Palisade hatte sie ferngehalten. Wer könnte es diesmal sein?, fragte er sich, während er weiter den Weg hinunterrannte und stolperte.
Die Moredhel, die im Tiefland Bruderschaft des Dunklen Pfades genannt wurden, hatten sich in diesen Bergen nicht mehr sehen lassen, seit Kielis Großvater noch ein Junge gewesen war, und Trolle machten für gewöhnlich einen großen Bogen um die Orosini-Dörfer. Derzeit gab es auch keine Clanfehden. Die Leute, die in den hohen Bergen im Nordosten lebten, waren friedlich, und Latagore und das Herzogtum Farinda im Süden hatte ebenfalls keinen Grund, die Orosini anzugreifen.
Es mussten Banditen sein – Sklavenhändler entweder aus Inaska oder aus der Hohen Wacht unten in Miskalon; die wagten sich manchmal in die Berge. Die hochgewachsenen rothaarigen oder blonden Orosini brachten auf den Sklavenmärkten unten in Groß-Kesh einen guten Preis.
Die Angst überwältigte Kieli nun beinahe. Es war, als beherrsche sie all seine Gedanken.
Er trank den Rest Kräuterwasser, der ihm noch geblieben war, band sich den Kürbis mit einer Schnur um die Taille und rannte dann ein halbes Dutzend zittriger Schritte weiter den Weg entlang, bis er abermals ins Stolpern geriet. Er versuchte, den Sturz mit der rechten Hand abzufangen, aber er stürzte dennoch, drehte sich im Fallen und prallte gegen einen großen Felsen. Ein stechender Schmerz war die Folge, und ihm wurde noch schwindliger, als er erkannte, dass sein linker Arm verletzt war. Es fühlte sich nicht an, als wäre der Knochen gebrochen, aber von seiner Schulter bis zum Ellbogen breitete sich bereits ein großer roter Fleck aus. Es tat weh, wenn er Arm und Schulter bewegte.
Kieli versuchte aufzustehen, und ihm wurde vor Schmerzen so übel, dass er sich übergeben musste.
Vor seinen Augen verschwamm alles, und die Landschaft färbte sich grellgelb. Kieli fiel mit dem Rücken auf den Weg. Der Himmel über ihm wurde gleißend weiß, und er spürte die Sonne, die ihm die Haut verbrannte. Er starrte nach oben, aber schon bald konnte er überhaupt nichts mehr sehen. Der Boden unter ihm schien sich zu drehen, bis alles weggefegt wurde und er durch einen Tunnel ins Dunkel fiel.
Schmerzen weckten ihn. Er öffnete die Augen, als sie durch seinen linken Arm zuckten. Sein Blickfeld verengte sich, zog sich zusammen und wurde wieder weiter, als ihn abermals Schwindel überfiel. Dann sah er es.
Auf seinem Arm ruhte etwas, das aussah wie die Krallen eines Vogels. Kieli verdrehte die Augen, bewegte den Kopf aber nicht. Nur wenige Zoll von seiner Nase entfernt stand ein Silberfalke, ein Bein leicht angehoben, die Krallen auf Kielis Arm, wo sie sich in die Haut drückten, sie aber nicht aufrissen. Beinahe so, als wollte er den halb betäubten Jungen wecken, bog der Falke die Krallen noch einmal und drückte fester.
Kieli starrte in die schwarzen Augen des Vogels. Wieder krallte der Vogel, und wieder zuckte Schmerz durch Kielis Arm. Er starrte den Vogel an, und dann hörte er die Worte: Erhebe dich, kleiner Bruder. Erhebe dich und sei eine Waffe für dein Volk. Du spürst meine Krallen an deinem Arm, und so wie sie kannst auch du festhalten und schützen, aber auch zerfetzen und vernichten.
Kieli hörte die Worte nicht laut, aber sie waren in seinem Kopf. Abrupt stand er auf, wobei er den Falken auf dem Arm mit hochhob. Der Vogel breitete die Flügel ein wenig aus, um die Bewegung auszubalancieren.
Als er dem Vogel direkt in die Augen sah, vergaß der Junge einen Augenblick alle Schmerzen. Der Falke starrte zurück, dann beugte er den Kopf vor, als würde er zustimmend nicken. Noch einmal sahen sie einander an, dann sprang der Vogel mit einem Kreischen in die Luft, und ein einziger Flügelschlag brachte ihn direkt am Ohr des jungen Mannes vorbei. Kieli spürte einen weiteren geringfügigen Schmerz und hob die Hand an die rechte Schulter. Am Arm sah er die Spuren der Vogelkrallen.
War das meine Vision?, fragte er sich. Ihm war nie zu Ohren gekommen, dass sich ein Falke so verhalten hätte, nicht einmal in einer der vielen wundersamen Geschichten. Dann erinnerte er sich mit dumpfem Schrecken an den Grund, wieso er so eilig den Berg hinuntergerannt war.
Die Tageshitze lag immer noch drückend auf den Felsen rings um ihn. Kieli fühlte sich schwach, und sein linker Arm pochte, aber sein Geist war klar, und er wusste, er würde den Bach rechtzeitig erreichen. Er achtete mehr auf den Weg, der zwischen den Felsen hindurchführte, denn er wollte nicht noch einmal stürzen und sich verletzen. Wenn seinem Dorf ein Kampf bevorstand, würde er neben seinem Vater, seinen Onkeln und dem Großvater stehen, um sein Heim zu verteidigen, denn er war nun ein Mann.
Kieli stolperte weiter den staubigen Pfad entlang, und bei jeder Bewegung zuckten heiße Schmerzen durch seinen linken Arm in die Schulter. Er erinnerte sich an eine bestimmte Art der Selbstversenkung, die angeblich Schmerzen dämpfen konnte, und murmelte leise die entsprechenden Worte. Bald schon wurden die Schmerzen tatsächlich schwächer, obwohl es nicht so gut funktionierte, wie sein Großvater ihm gegenüber behauptet hatte; der Arm tat immer noch weh, aber zumindest wurde ihm vor Schmerzen nicht mehr schwindlig.
Er erreichte den Bach und ließ sich vornüber hineinfallen, was so etwas wie eine Explosion von Schmerzen in seinem Arm bewirkte. Er keuchte gequält, wurde aber mit einem Mund voll Wasser belohnt. Dann rollte er sich auf den Rücken und spuckte das Wasser aus, wischte sich die Nase und hustete. Schließlich kam er auf die Knie und trank nun vorsichtiger. Danach füllte er schnell den Kürbis, band ihn wieder um seine Taille und machte sich erneut auf den Weg.
Er hatte Hunger, aber vom Bach aus waren es noch zwei Wegstunden bis in sein Dorf. Wenn er in gleichmäßigem Tempo lief, würde er in einem Drittel dieser Zeit dort sein. Doch so schwach, wie er nach dem Fasten war, und mit dem verletzten Arm konnte er kein gleichmäßiges Tempo halten.
Hinter dem Bach wurde der Wald dichter, und dort war es kühler. Kieli entschied sich für schnelles Gehen, und auf offenen Strecken lief er, beides so lautlos er konnte, und er konzentrierte sich auf den bevorstehenden Kampf.
Als er sich seinem Dorf näherte, hörte Kieli die Kampfgeräusche. Der Geruch nach Rauch hing in der Luft, und der Schrei einer Frau drang dem Jungen so tief ins Herz wie eine Messerklinge. War das seine Mutter gewesen? Aber es war ohne Bedeutung – wer immer es sein mochte, es handelte sich um eine Frau, die er sein Leben lang gekannt hatte.
Er nahm den Ritualdolch fest in die rechte Hand und wünschte sich sehnlichst, zwei gesunde Arme und ein Schwert oder einen Speer bei sich zu haben. Vom Laufen und von der Sonne war ihm so warm geworden, dass er vollkommen vergessen hatte, wie spärlich er bekleidet war, aber nun fühlte er sich besonders verwundbar. Dennoch eilte er weiter, und die Aussicht auf den Kampf dämpfte den Schmerz in seinem Arm noch mehr und zwang seine Müdigkeit beiseite.
Dicke Rauchwolken und das Knistern von Flammen warnten ihn schon vor dem Anblick, der sich ihm einen Moment später bot. Der Weg ließ den Wald hinter sich und zog sich durch die großen Gemüsegärten des Dorfes auf die Palisade zu. Das Tor stand offen, wie immer in friedlichen Zeiten. Kein Feind hatte je zu Mittsommer angegriffen, denn dies war ein Tag beinahe universellen Waffenstillstands, selbst in Kriegszeiten.
Der unversehrte Zustand des hölzernen Walls und der Erdwälle sagte dem Jungen, dass der Feind das Tor gestürmt hatte, bevor jemand hatte Alarm schlagen können. Die meisten Bewohner waren sicher auf dem Dorfplatz gewesen, um dort das Fest vorzubereiten.
Überall loderten Flammen, und Kieli konnte Gestalten im Rauch erkennen, viele davon zu Pferd, und reglose Menschen auf dem Boden. Er hielt inne. Einfach weiter den Pfad entlangzurennen, hätte ihn sofort zu einem Ziel gemacht. Es war besser, das Dorf hinter den Bäumen halb zu umkreisen, bis er zu der Stelle kam, wo der Wald direkt ans Dorf heranreichte.
Als er sich nach rechts bewegte, bemerkte er, dass der Rauch von ihm weggeweht wurde. Nun konnte er sehen, was die Angreifer im Dorf angerichtet hatten.
Viele seiner Freunde lagen reglos am Boden. Es fiel ihm schwer zu begreifen, was er da vor sich sah.
Männer zu Pferd, geschützt von bunt zusammengeflickten Rüstungen, ritten durchs Dorf, und viele von ihnen steckten mit Fackeln die Häuser und Hütten in Brand. Kieli wusste nun ganz sicher, dass er es mit Söldnern oder Sklavenhändlern zu tun hatte. Aber dann sah er auch Soldaten mit dem Wappen des Herzogs von Olasko, des Herrschers des mächtigen Herzogtums im Südosten. Warum unterstützten herzogliche Soldaten eine Bande von Banditen?
Kieli hatte die Rückseite des Hauses erreicht, das dem Wald am nächsten stand, und er schlich weiter. Er sah einen Soldaten aus Olasko reglos direkt neben dem Gebäude liegen und beschloss, sich das Schwert des Mannes zu holen. Wenn ihn dabei niemand bemerkte, würde er auch noch versuchen, den runden Schild zu nehmen, den der Mann am linken Arm trug. Es würde zwar wehtun, den Schild an seinem verletzten Arm zu tragen, aber es bedeutete vielleicht den Unterschied zwischen Leben und Tod.
Die Kampfgeräusche kamen vom anderen Ende des Dorfes, also nahm Kieli an, es wäre möglich, sich von hinten an die Eindringlinge anzuschleichen und sie anzugreifen. Er bewegte sich weiter auf den Soldaten am Boden zu, dem er Schild und Schwert abnehmen wollte, dann hielt er einen Augenblick inne.
Im Rauch konnte er mühsam ein paar Gestalten erkennen, und Zorn- und Schmerzensschreie wurden vom Wind auf ihn zugetragen, als seine Leute versuchten, die Eindringlinge abzuwehren.
Seine Augen brannten von dem beißenden Rauch, und er blinzelte Tränen weg, als er den am Boden liegenden Soldaten erreichte. Er drehte die Leiche um, um sich das Schwert zu nehmen, aber als er die Hand an den Schwertgriff legte, riss der Soldat die Augen auf. Kieli erstarrte einen kurzen Moment, und als er dann das Schwert wegzog, schlug der Soldat mit dem Schild zu und traf ihn im Gesicht.
Kieli stolperte nach hinten. Er konnte nur noch verschwommen sehen, und die Welt schien unter seinen Füßen zu schwanken. Nur seine Schnelligkeit rettete ihn, denn sobald der Soldat auf den Beinen war und mit dem Dolch nach ihm stach, wich Kieli aus.
Eine Sekunde glaubte er, der Klinge entgangen zu sein, dann spürte er die Schmerzen an der Brust und fühlte das Blut. Es war keine tiefe Wunde, aber sie war lang und zog sich von unter seinem linken Schlüsselbein bis zur rechten Brustmitte und von dort unter die Rippen.
Kieli stach mit der eigenen Waffe zu und spürte den Aufprall in seinem Arm, als der Soldat den Schlag geschickt mit dem Dolch abwehrte.
Ein weiterer Angriff, und der Junge wusste, dass er keine Chance hatte, denn er entging nur knapp dem Tod durch eine Bauchwunde. Hätte ihn der Soldat mit seinem Schwert angegriffen und nicht mit dem Dolch, dann hätte Kieli bereits mit hervorquellenden Gedärmen am Boden gelegen.
Die Angst drohte ihn zu überwältigen, aber der Gedanke, dass seine Verwandten nur Schritte entfernt um ihr Leben kämpften, verdrängte alles andere.
Der Soldat sah, dass der Junge zögerte, grinste boshaft und kam näher. Kieli wusste, dass sein einziger Vorteil in der Länge seiner Klinge bestand, also bot er seine bereits verwundete Brust als Ziel und hob das Schwert ungeschickt mit beiden Händen, als wollte er damit von oben dem Soldaten den Schädel einschlagen. Wie er gehofft hatte, hob der Soldat im Reflex den Schild, um den Schlag abzufangen, und zog den Dolch zum Todesstoß zurück.
Kieli jedoch ließ sich mit einer Drehung auf die Knie fallen, riss das Schwert in einem schwungvollen Bogen zur Seite und nach unten und durchtrennte das Bein des Soldaten.
Der Mann fiel schreiend zu Boden. Blut spritzte aus der durchtrennten Arterie unterhalb des Knies.
Kieli kam auf die Beine, trat auf die Dolchhand des Mannes und rammte ihm das Schwert in die Kehle.
Er bemerkte, dass die Wunde an seiner Brust weiterhin blutete, und er wusste, dass er bald keine Kraft mehr haben würde, wenn er sie nicht verband, obwohl sie wahrscheinlich erheblich schlimmer aussah, als sie war.
Als er auf die Kampfgeräusche zueilte, fegte ein Windstoß einen Augenblick den Rauch davon, sodass er für einen Moment klare Sicht auf den Dorfplatz hatte. Die Tische, die mit Essen beladen gewesen waren, waren umgekippt, das Festmahl des Tages und die Blumengirlanden waren in den Schlamm aus Erde und Blut getrampelt. Für einen panischen Augenblick erstarrte Kieli, und ihm wurde vor Entsetzen beinahe übel. Er blinzelte die Tränen weg – er wusste nicht einmal, ob es der Rauch oder sein Zorn war, der sie hervorgerufen hatte.
Ganz in der Nähe lagen die Leichen von drei Kindern, die man offenbar hinterrücks erschlagen hatte, als sie versucht hatten davonzulaufen. Dahinter konnte er sehen, wie die Männer seines Dorfes verzweifelt das Rundhaus verteidigten. Kieli wusste, dass sich dort drinnen die überlebenden Frauen und Kinder befanden – die Frauen mit Messern und Dolchen bewaffnet, um die Kinder zu schützen, falls die Männer fallen sollten.
Männer, die Kieli sein Leben lang gekannt hatte, wurden niedergemetzelt. Die Soldaten hatten eine Schildmauer gebildet und drängten mit gesenkten Speeren vorwärts, während hinter ihnen Soldaten zu Pferd mit Armbrüsten auf die Dorfbewohner schossen.
Die Bogenschützen der Orosini erwiderten den Beschuss, aber wie dieser Kampf enden würde, war selbst für einen unerfahrenen Jungen wie Kieli offensichtlich. Für ihn war klar, dass er diesen Tag nicht überleben würde, aber er konnte auch nicht einfach hinter den Eindringlingen stehen bleiben und überhaupt nichts unternehmen.
Mit zitternden Knien ging er vorwärts, auf einen Mann auf einem schwarzen Pferd zu, der offenbar der Anführer dieser Mörder war. Neben ihm befand sich ein anderer Reiter in einem schwarzen Waffenrock. Sein Haar war so dunkel wie seine Kleidung, hinter die Ohren zurückgestrichen und schulterlang.
Er schien irgendwie zu spüren, dass jemand hinter ihm war, denn er drehte sich genau in dem Augenblick um, als Kieli auf ihn zurannte. Kieli sah das Gesicht des Mannes ganz deutlich: den kurz geschnittenen dunklen Bart, die lange Nase, die ihm ein strenges Aussehen verlieh, und die nachdenkliche Miene, als wäre er gerade vollkommen in Gedanken versunken gewesen, als er Kielis Angriff bemerkte. Die Augen wurden ein wenig größer, als er den bewaffneten und bluttriefenden Jungen bemerkte, dann machte er eine Bemerkung zu dem Anführer der Soldaten, der sich daraufhin ebenfalls umdrehte. Der Mann in Schwarz hob den Arm. Er hatte eine kleine Armbrust in der Hand, mit der er in aller Ruhe zielte.
Kieli wusste, dass er zuschlagen musste, bevor der Mann den Finger am Abzug krümmte. Aber zwei Schritte von dem Reiter entfernt gaben seine Knie beinahe nach. Kielis neues Schwert fühlte sich an, als wäre es aus Blei und Stein, und sein Arm weigerte sich zu tun, was Kieli wollte, nämlich dem Eindringling einen tödlichen Schlag zu versetzen.
Der Junge war nur noch einen Schritt entfernt, als der Mann in Schwarz die Armbrust abschoss. Dann gaben Kielis Knie nach. Der Bolzen traf ihn in die Brust, hoch oben in den Muskel oberhalb der ersten Wunde.
Die Wucht des Treffers riss ihn herum, und Blut spritzte aus seiner Wunde, das Schwert fiel ihm aus der Hand, die es nicht mehr halten konnte. Seine Knie schlugen auf den Boden, und er sackte nach hinten; sein Blick trübte sich, als Schmerz und Schock ihn überwältigten.
Stimmen erklangen, aber die Laute waren gedämpft, und er konnte nicht verstehen, was gesagt wurde. Einen kurzen Moment lang sah er hoch am Himmel einen kreisenden Silberfalken, und es kam Kieli so vor, als blicke der Vogel direkt zu ihm herab. Im Kopf hörte er abermals die Stimme: Lebe, kleiner Bruder, denn deine Zeit ist noch nicht gekommen. Sei meine Waffe und zerfetze unsere Feinde, wie ich es mit meinen Krallen tun würde.
Sein letzter Gedanke galt dem Vogel.
Kendricks Gasthaus
Die Schmerzen bohrten sich durch die Dunkelheit.
Er konnte sich nicht dazu zwingen, die Augen zu öffnen, aber er wusste, dass er noch am Leben war. Er spürte Hände, die ihn berührten, und hörte wie aus weiter Ferne: »Der hier lebt noch.«
»Schaffen wir ihn auf den Wagen«, sagte eine andere Stimme. »Er hat viel Blut verloren.«
Mit einem Teil seines Verstandes registrierte Kieli, dass er Worte in der Händlersprache hörte, die man die Allgemeine Sprache nannte, nicht in der Sprache der Orosini.
Er spürte ein weiteres Paar Hände. Als sie ihn bewegen, stöhnte er und verlor abermals das Bewusstsein.
Schmerzen durchzuckten seinen ganzen Körper, als er erwachte. Diesmal zwang er sich, die Augen zu öffnen und den Kopf zu heben. Die Anstrengung verursachte eine neue Welle von Qualen, und sein Magen zog sich zusammen, aber es war nichts mehr drin, was er hätte herauswürgen können. Die Schmerzen ließen ihn laut aufstöhnen.
Er konnte nicht richtig sehen, also erkannte er auch nicht, zu wem diese Hände gehörten, die ihn sanft aufs Lager zurückdrückten. Eine Stimme erklang: »Bleib still liegen, Junge, und atme gleichmäßig.«
Kieli erkannte undeutlich Gestalten vor sich: Köpfe im Schatten, Licht am Himmel über ihnen. Er blinzelte, um klarer sehen zu können.
»Hier«, sagte eine andere Stimme über ihm, und eine Kürbisflasche wurde ihm an die Lippen gehalten.
»Trink langsam«, sagte die erste Stimme. »Du hast viel Blut verloren. Wir dachten schon, du würdest es nicht schaffen.«
Der erste Schluck Wasser bewirkte, dass er wieder Magenkrämpfe bekam, und er gab das winzige Schlückchen Wasser gleich wieder von sich.
»Noch vorsichtiger«, sagte die Stimme.
Er tat, was man ihm gesagt hatte, und diesmal blieb das Wasser im Magen. Plötzlich hatte er unglaublichen Durst, aber der Mann nahm ihm die Kürbisflasche wieder ab. Er wollte die Hand heben, um sie festzuhalten, aber sein Arm gehorchte ihm nicht.
»Vorsichtig, hab ich gesagt«, mahnte die Stimme. Wieder wurde ihm das Gefäß an die Lippen gehalten, und er trank in kleinen Schlucken und spürte das kalte Wasser in seiner Kehle.
Er konzentrierte seine geringe Kraft darauf, das Wasser zu trinken und im Magen zu behalten. Dann hob er den Blick über den Rand der Kürbisflasche und bemühte sich, die Züge seines Wohltäters zu erkennen, aber er konnte nur verschwommen ein Gesicht und graues Haar ausmachen.
Dann sackte er wieder zurück in die Dunkelheit.
Irgendwann machten sie ein paar Tage Rast. Er bemerkte ein Gebäude um sich herum – eine Scheune oder ein Schuppen –, und für einige Zeit spürte er, dass es regnete, denn die Luft war schwer vom Geruch nach feuchter Erde und Schimmel auf Holz.
Danach kamen und gingen die Bilder. Er lag auf einem Wagen, und irgendwann, an einem Nachmittag, spürte er, dass er im Wald war, aber nicht im Wald in der Nähe seines Dorfes. Er wusste nicht, warum ihm das so klar war – vielleicht hatte er einen kurzen Blick auf die Bäume erhascht, die nicht die hohen Zedern und Espen des Waldes waren, den er kannte.
Er fiel wieder in unruhigen Schlaf.
Er erinnerte sich daran, dass man ihm kleine Bissen Essen in den Mund gesteckt hatte, er sie schluckte, wie sich sein Hals zusammengezogen und seine Brust beim Atmen gebrannt hatte. Er erinnert sich an Fieberträume, und dass er mehrmals schweißgebadet und mit heftig klopfendem Herzen erwacht war. Er erinnerte sich daran, nach seinem Vater gerufen zu haben.
Eines Nachts träumte er, dass er im Warmen war, zu Hause im Rundhaus bei seiner Mutter und den anderen Frauen. Er fühlte sich umgeben von ihrer Liebe. Dann erwachte er auf dem harten Boden, es roch nach nasser Erde, der Rauch eines vor Kurzem abgedeckten Lagerfeuers stach ihm in die Nase, und zu beiden Seiten von ihm schliefen Männer. Wieder sank er zurück und fragte sich, wie er an diesen Ort gekommen war. Dann erinnerte er sich an den Angriff auf sein Dorf. Tränen traten ihm in die Augen, und er weinte, als er spürte, wie alle Hoffnung und Freude in ihm starben.
Er konnte die Tage, die er unterwegs war, nicht zählen. Er wusste, dass sich zwei Männer um ihn kümmerten, aber er konnte sich nicht erinnern, ob sie ihm ihre Namen gesagt hatten. Er wusste, dass sie ihm Fragen gestellt hatten, und er hatte geantwortet, aber er konnte sich nicht mehr daran erinnern, um was es gegangen war.
Und dann kehrte eines Morgens die Klarheit zurück. Kieli schlug die Augen auf, und obwohl er sich immer noch schwach fühlte, begriff er nun mehr von seiner Umgebung. Er befand sich in einer großen Scheune mit Toren an beiden Enden. In einer Box in der Nähe konnte er Pferde fressen hören. Er lag auf einem Strohsack, über den eine doppelte Decke gelegt worden war, und war mit zwei weiteren Decken zugedeckt. Die Luft war rauchig von einem kleinen Lagerofen, einem Kasten aus gehämmertem Eisen mit glühenden Kohlen darin.
Kieli stützte sich auf den Ellbogen und sah sich um. Der Rauch brannte ihm ein wenig in den Augen, aber der größte Teil davon verschwand durch eine offene Klappe zum Heuboden. Es war still, also nahm Kieli an, dass es nicht mehr regnete.
Ihm tat alles weh, und er fühlte sich steif, aber wenn er sich ein wenig bewegte, verursachte das keine so stechenden Schmerzen mehr wie zuvor.
Ein Mann saß auf einem Holzhocker und sah ihn aus dunklen Augen an. Das Haar war überwiegend grau, obwohl noch ein wenig Schwarz geblieben war. Sein Schnurrbart hing zu beiden Seiten des Mundes nach unten, den er fest zusammengekniffen hatte, als würde er sich konzentrieren. Stirnfransen verbargen den größten Teil seiner Stirn, und das Haar hing ihm bis auf die Schultern.
Kieli blinzelte sich den Schlaf vollends aus den Augen und fragte: »Wo bin ich?«
Der Mann sah ihn neugierig an. »Du bist also wieder unter uns?«, fragte er überflüssigerweise. Er hielt einen Augenblick inne, dann rief er über die Schulter hinweg zum Scheunentor: »Robert!«
Einen Moment später öffnete sich das Tor, und ein anderer Mann kam herein und ließ sich neben Kieli auf die Knie nieder.
Dieser Mann war noch älter, sein Haar vollständig ergraut, sein Blick der eines Mannes, der daran gewöhnt war, Autorität auszuüben, und er sah den Jungen unverwandt an. »Nun, Talon, wie geht es dir?«, fragte er leise.
»Talon?«
»Du hast uns gesagt, dass du Talon Silberfalke heißt«, erklärte der ältere Mann.
Der Junge blinzelte und fragte sich, wieso er so etwas gesagt hatte. Dann erinnerte er sich an die Vision, und er begriff, dass es tatsächlich eine Namensvision gewesen war. Talon … das bedeutete »Kralle« … Er war die Kralle des Silberfalken!
Eine weit entfernte Stimme erklang in seinem Kopf: Erhebe dich und sei eine Waffe für dein Volk.
»Woran kannst du dich noch erinnern?«
»Ich erinnere mich an den Kampf …« Eine finstere Grube öffnete sich in seinem Magen, und er spürte, dass ihm Tränen in die Augen traten. Er zwang die Traurigkeit nieder und sagte: »Sie sind alle tot, nicht wahr?«
»Ja«, antwortete der Mann namens Robert. »Woran kannst du dich aus der Zeit danach erinnern?«
»Ein Wagen …« Kieli schloss kurz die Augen, dann sagte er: »Ihr habt mich weggebracht.«
»Ja«, bestätigte Robert. »Wir konnten schließlich nicht zulassen, dass du an deinen Wunden stirbst.« Leise fügte er hinzu: »Außerdem gibt es vieles, was wir über dich und über den Kampf wissen wollen.«
»Was denn?«, fragte Talon.
»Das kann warten.«
»Wo bin ich?«, wiederholte der Junge seine Frage von vorhin.
»Du bist in der Scheune von Kendricks Gasthaus.«
Talon versuchte, sich zu erinnern. Er hatte von diesem Ort gehört, wusste aber keine Einzelheiten mehr. »Warum bin ich hier?«
Der Mann mit dem hängenden Schnurrbart lachte. »Weil wir dich gerettet haben, und das hier war ohnehin unser Ziel, also haben wir dich – oder das, was von dir übrig war – mitgeschleppt.«
»Und«, fuhr Robert fort, »das hier ist ein sehr guter Ort, um sich auszuruhen und gesund zu werden.« Er stand auf und ging davon, in leicht geduckter Haltung, weil die Decke so niedrig war. »Kendrick gestattet uns, diese Scheune zu benutzen. Im Gasthaus gibt es wärmere Zimmer, saubereres Bettzeug und besseres Essen …«
»Aber auch zu viele Augen und Ohren«, unterbrach ihn der erste Mann.
Robert warf ihm einen Blick zu und schüttelte beinahe unmerklich den Kopf.
»Du trägst einen Männernamen«, sagte der erste Mann, »aber ich sehe keine Tätowierungen in deinem Gesicht.«
»Der Tag des Kampfes war mein Namenstag«, erwiderte Talon mit leiser Stimme.
Der zweite Mann, Robert, sah erst seinen Gefährten an, dann wandte er sich wieder dem Jungen zu. »Das war vor über zwei Wochen, Junge. Du bist mit uns unterwegs gewesen, seit Pasko dich in deinem Dorf gefunden hat.«
»Hat außer mir nicht doch noch jemand überlebt?«, fragte Talon mit brüchiger Stimme.
Robert kehrte an die Seite des Jungen zurück, ging auf ein Knie nieder, legte ihm sanft die Hand auf die Schulter und sagte: »Sie sind alle tot.«
Und Pasko fügte hinzu: »Diese Dreckskerle haben gründliche Arbeit geleistet, das muss man ihnen lassen.«
»Wer waren sie?«, fragte Talon.
Sanft drückte Robert den Jungen zurück auf den Strohsack. »Ruh dich aus. Pasko wird dir bald ein wenig Suppe bringen. Du bist dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Lange Zeit haben wir befürchtet, dass du nicht überleben wirst. Wir haben dich mit kleinen Schlucken Wasser und kalter Brühe versorgt. Jetzt ist es Zeit für etwas Kräftigeres.« Er hielt inne. »Es gibt vieles, worüber wir reden müssen, aber dazu wird später noch Zeit sein. Und wir haben viel Zeit, Talon Silberfalke.«
Talon wollte sich nicht ausruhen, er wollte Antworten, aber sein geschwächter Körper ließ ihn im Stich, und sogleich schlief er wieder ein.
Vogelgezwitscher begrüßte ihn, als er ausgehungert erwachte. Pasko brachte ihm eine große Schale mit Brühe und nötigte ihn, nicht zu schnell zu trinken. Der andere Mann, Robert, war nirgends zu sehen.
Nachdem sich Talon an der heißen Flüssigkeit den Mund verbrannt hatte, fragte er: »Was ist das hier für ein Ort?«
»Kendricks Gasthaus, mitten im Wald von Latagore.«
»Warum?«
»Warum was? Warum sind wir hier, oder warum lebst du noch?«
»Beides«, antwortete Talon.
»Das Zweite zuerst«, erklärte Pasko, setzte sich auf den kleinen Hocker und griff nach seiner eigenen Schale Brühe. »Wir haben dich auf einem Schlachtfeld gefunden, wie ich es seit meiner Jugend nicht mehr gesehen habe, als ich Soldat im Dienst des Herzogs von Dungareen unten in Loren war. Wir hätten dich beinahe ebenso wie die anderen den Krähen überlassen, aber ich habe gehört, wie du gestöhnt hast … Nun, es war nicht mal ein richtiges Stöhnen, eher ein lautes Seufzen. Es war wirklich eine glückliche Fügung des Schicksals, dass du überlebt hast. Du hattest so viel Blut auf dir und eine lang gezogene Wunde über der Brust … Wir dachten beide zunächst, du wärst tot. Aber du hast noch geatmet, also hat mein Herr gesagt, dass wir dich mitnehmen sollten. Er ist ein weichherziger Mann, das kann ich dir sagen.«
»Ich sollte mich bei ihm bedanken«, sagte Talon, obwohl er sich absolut elend fühlte, weil er als Einziger überlebt hatte, während der Rest seines Volkes ausgelöscht worden war, und diese Empfindung ließ Dankbarkeit gegenüber seinem Lebensretter beinahe unangemessen wirken.
»Ich nehme an, er wird schon eine Möglichkeit finden, wie du es ihm zurückzahlen kannst«, sagte Pasko und erhob sich. »Möchtest du dir ein bisschen die Beine vertreten?«
Talon nickte. Er wollte aufstehen, aber ihm wurde schwindlig, und alles tat ihm weh. Er hatte nicht genug Kraft.
»Schön langsam, mein Junge.« Pasko reichte ihm die Hand. »Du bist schwächer als ein neugeborenes Kätzchen. Du wirst noch viel Ruhe und Essen brauchen, aber du solltest tatsächlich versuchen, dich ein bisschen zu bewegen.«
Pasko half Talon zum Scheunentor, und sie gingen nach draußen. Es war ein frischer Morgen, und Talon sah, dass sie sich in einem Tal im Tiefland befanden.
Die Luft roch anders als in den Bergen. Talons Knie zitterten, und er konnte nur ganz kleine Schritte machen. Pasko hielt inne und ließ dem Jungen Zeit, sich ein wenig umzusehen.
Sie befanden sich in einem großen Hof mit Ställen, umgeben von einer hohen Steinmauer. Talon erkannte sofort, dass es sich um eine Verteidigungsmauer handelte, denn an mehreren Stellen führten Steintreppen nach oben, und die Mauerkrone hatte Schießscharten und Zinnen und einen Wehrgang, der breit genug für zwei Männer nebeneinander war.
Das eigentliche Gasthaus war das größte Gebäude, das Talon je gesehen hatte, viel größer als das Rundhaus und das Langhaus seines Dorfes. Es war drei Stockwerke hoch, und das Dach war mit Steinschindeln gedeckt und nicht mit Stroh oder Holz. Das Haus selbst war weiß verputzt, mit Holzleisten rings um Türen und Fenster, und die Läden und Türen selbst waren leuchtend grün gestrichen. Durch mehrere Schornsteine quoll grauer Rauch in den Himmel.
Ein Wagen war neben die Scheune geschoben worden, und Talon nahm an, dass es sich um den handelte, auf dem er hierhergeschafft worden war. In einigem Abstand vom Anwesen konnte er ein paar Baumwipfel sehen; also hatte man den Wald direkt rings um das Gasthaus herum wahrscheinlich gerodet.
»Was siehst du?«, fragte Pasko zu Talons Erstaunen.
Talon drehte sich um und bemerkte, dass der ältere Mann ihn forschend betrachtete. Er setzte dazu an, etwas zu sagen, dann erinnerte er sich daran, dass Großvater immer gesagt hatte, er solle über das Offensichtliche hinausschauen, also antwortete er nicht, sondern bedeutete Pasko stattdessen, ihm zur nächsten Treppe und auf die Mauer zu helfen. Er stieg langsam nach oben, bis er imstande war, über die Mauer hinwegzusehen.
Das Gasthaus stand in der Mitte einer natürlichen Lichtung, aber die Stümpfe vieler Bäume zeigten, dass man sie schon vor Jahren erweitert hatte, denn die Stümpfe waren mit Gras und Brombeerranken überwachsen, aber die Straße in den Wald war frei.
»Was siehst du?«, fragte Pasko noch einmal.
Talon antwortete immer noch nicht, sondern wandte sich wieder dem Gasthaus zu, und während er das tat, konnte er nach und nach die gesamte Anlage vor seinem geistigen Auge erkennen. Er zögerte. Er beherrschte die Allgemeine Sprache besser als die meisten Jungen seines Dorfes, aber er hatte seine Kenntnisse selten anwenden können, es sei denn, wenn Händler kamen …
Er dachte an sein Dorf, und die kalte Hoffnungslosigkeit kehrte zurück. Er drängte den Schmerz beiseite und dachte darüber nach, wie er sich am besten ausdrücken sollte. Schließlich sagte er: »Das hier ist kein Gasthaus, sondern eine Festung.«
Pasko grinste. »Tatsächlich ist es beides. Kendrick hat für einige seiner Nachbarn nicht viel übrig.«
Talon nickte. Die Mauern waren fest, und der Wald war auf allen Seiten weit genug gerodet worden, dass Bogenschützen ein freies Schussfeld hatten. Die Straße führte aus dem Wald auf das Gasthaus zu, aber auf halbem Weg dorthin bog sie sich und führte um die Mauer herum zu einem Tor, das sich wohl auf der anderen Seite des Anwesens befand. Keine Ramme und kein brennender Wagen konnten einfach geradeaus auf das Tor zugeschoben werden.
Talon dachte auch über die Platzierung des Hauptgebäudes nach. Bogenschützen in den oberen Fenstern konnten den Verteidigern auf der Mauer zusätzlichen Schutz bieten.
Er wandte den Blick wieder den Türen zu und sah, dass sie schwer mit Eisen beschlagen waren, und er nahm an, dass man sie zusätzlich von innen verbarrikadieren konnte. Es würde kräftige Männer mit schweren Äxten brauchen, um diese Türen aufzubrechen. Er sah auch Pechnasen über jeder Tür. Man konnte durch sie auf jeden, der vor der Tür stand, heißes Öl oder Wasser gießen und Pfeile abschießen.
»Das müssen recht schwierige Nachbarn sein.«
Pasko lachte leise. »Da könntest du recht haben.«
Während sie noch auf dem Hof standen und zum Gasthaus schauten, wurde eine Tür geöffnet, und ein junges Mädchen mit einem Eimer in der Hand kam heraus. Sie blickte auf, sah die beiden und winkte. »Hallo, Pasko!«
»Hallo, Lela!«
»Wen hast du denn da mitgebracht?«, fragte sie vergnügt. Sie schien ein paar Jahre älter zu sein als Talon, und anders als die Mädchen seines Volkes hatte sie dunkles Haar. Auch ihre Haut war viel dunkler als die der Orosini, und ihre großen braunen Augen schienen zu leuchten, wenn sie lachte.
»Einen Jungen, den wir unterwegs aufgelesen haben. Lass ihn in Ruhe. Du hast schon genug Bewunderer.«
»Bewunderer kann man nie genug haben!«, erwiderte sie, schwang den Eimer, drehte sich einmal um die eigene Achse und ging dann weiter. »Ich könnte ein bisschen Hilfe beim Wasserholen gebrauchen«, erklärte sie mit verlockendem Lächeln.
»Du bist kräftig genug, um das allein zu schaffen, und der Junge war schwer verletzt.« Pasko sah sich kurz um, dann fragte er: »Wo stecken denn Lars und Gibbs?«
»Kendrick hat sie ausgeschickt, um etwas für ihn zu erledigen«, sagte Lela und verschwand hinter der anderen Seite der Scheune.
Nachdem sie weg war, blieb Talon noch einen Augenblick schweigend stehen, dann fragte er: »Was soll ich tun?« Tief in seinem Inneren empfand er finsterste Hoffnungslosigkeit, einen Mangel an Entschlossenheit und Willenskraft, wie er ihn in seinem jungen Leben noch nie verspürt hatte. Die Erinnerung an sein Dorf ließ ihm Tränen in die Augen treten. Die Orosini konnten sehr gefühlsbetont sein, neigten zu lauten Freudenfesten, wenn es ihnen gut ging, und weinten ganz offen, wenn sie Kummer hatten. Da ihm nun alles vollkommen sinnlos vorkam, ließ Talon einfach zu, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen.
Pasko ignorierte seine Tränen und sagte: »Du musst Robert danach fragen, wenn er zurückkehrt. Ich tue einfach nur, was man mir sagt. Du verdankst ihm dein Leben, also musst du diese Schuld begleichen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren, und dann bringen wir dich wieder rein, damit du dich ausruhen kannst.«
Talon hätte sich gern noch ein wenig umgesehen und die Wunder im Inneren des Gasthauses erforscht, denn ein so großes Gebäude hatte bestimmt viele zu bieten. Aber Pasko brachte ihn wieder zur Scheune, und als er seinen Strohsack erreicht hatte, war Talon froh darüber, denn er war zutiefst erschöpft. Seine Wunden stachen und brannten, und er wusste, dass selbst diese geringfügige Bewegung das Narbengewebe wieder zerrissen hatte. Er würde tatsächlich noch viel Zeit brauchen, um richtig gesund zu werden. Er erinnerte sich daran, wie Stehender Bär von einem wilden Eber angegriffen worden war. Danach hatte er beinahe ein halbes Jahr gehinkt, bis er sein Bein wieder vollkommen hatte bewegen können.
Talon lehnte sich zurück und schloss die Augen, während sich Pasko mit ein paar Sachen beschäftigte, die er vom Wagen mit hereingebracht hatte. Obwohl er hellwach gewesen war, als er vor einer knappen halben Stunde aufgewacht war, schlief Talon wieder ein.
Talon war ein geduldiger Mensch, und ganze Tage vergingen, ohne dass er Pasko mit Fragen behelligte. Ihm war klar, dass der Mann nicht sonderlich gesprächig war und man ihn vermutlich auch noch angewiesen hatte, sich zurückzuhalten. Talon würde sich auf seine eigenen Beobachtungen verlassen müssen.
Der Schmerz über die Vernichtung seines Volkes wich niemals ganz. Talon hatte eine Woche lang jede Nacht geweint, aber im Lauf der Zeit wandte er sich von seinem Schmerz ab und gab sich mehr dem Zorn hin. Er wusste, irgendwo dort draußen waren die Männer, die für die Vernichtung seines Volkes verantwortlich waren. Irgendwann würde er sie finden und Rache nehmen – das war die Art der Orosini. Aber er war auch realistisch genug, um zu begreifen, dass ein einzelner junger Mann nicht viele Möglichkeiten hatte, sich an ihnen zu rächen. Er würde stärker werden müssen, und er musste mehr über Waffen und über viele andere Dinge erfahren. Er war überzeugt, dass seine Ahnen ihn dabei anleiten würden. Der Silberfalke war sein Zeichen – der Junge, der einmal Kielianapuna geheißen hatte, würde sein Volk in diesem Zeichen rächen.