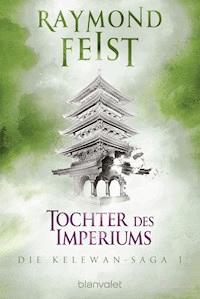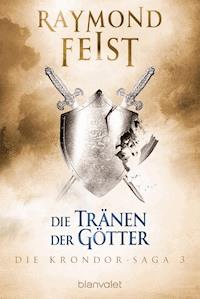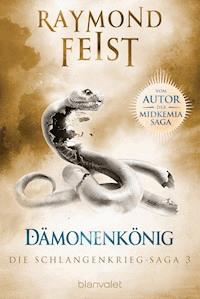7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE KELEWAN-SAGA
- Sprache: Deutsch
Mara von Acona ist die mächtigste Frau des Reiches. Doch der gefürchtete Magierorden der Schwarzen Roben sieht seine uralte Herrschaft durch ihre Macht bedroht und versucht, Mara mit Anschlägen und Intrigen vom Thron zu stürzen. Doch auch die rivalisierenden Adelshäuser sind daran interessiert, Maras Regiment ein Ende zu setzen. Auf der Suche nach Verbündeten überschreitet Mara die Grenzen der Zivilisation und schließt einen Pakt mit den mysteriösen Cho-ja. Unaufhaltsam rückt der Tag der letzten, alles entscheidenden Schlacht näher …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1382
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Raymond Feist und Janny Wurts
Die Kelewan-Saga III
Herrin des Imperiums
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Gerold
Das Buch
Mara von Acona ist die mächtigste Frau des Reiches. Doch der gefürchtete Magierorden der Schwarzen Roben sieht seine uralte Herrschaft durch ihre Macht bedroht und versucht, Mara mit Anschlägen und Intrigen vom Thron zu stürzen. Doch auch die rivalisierenden Adelshäuser sind daran interessiert, Maras Regiment ein Ende zu setzen. Auf der Suche nach Verbündeten überschreitet Mara die Grenzen der Zivilisation und schließt einen Pakt mit den mysteriösen Cho-ja. Unaufhaltsam rückt der Tag der letzten, alles entscheidenden Schlacht näher …
Der Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt Midkemia seiner Romane. Die in den 80er Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Mistress of the Empire« bei Doubleday, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Juni 2016 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Dieser Roman erschien bisher in zweigeteilter Ausgabe unter den Titeln »Die schwarzen Roben« und »Tag der Entscheidung« Deutsche Erstveröffentlichung © 1998 bei Verlagsgruppe Random House GmbH, München Copyright © der Originalausgabe 1992 by Raymond Elias Feist Umschlaggestaltung: Design Team München
Dieses Buch ist Kyungund Jon Conning gewidmet,
Inhaltsverzeichnis
Eins
Tragödie
Die Morgensonne schien.
Tautropfen brachten das Gras am Ufer zum Funkeln, und der Wind trug die Rufe der nistenden Shatra-Vögel heran. Lady Mara von den Acoma genoss die kühle Luft, die schon bald der mittäglichen Hitze weichen würde. Sie saß in ihrer Sänfte; neben ihr saß ihr Ehemann, und auf ihrem Schoß schlummerte ihr jüngerer Sohn, der zwei Jahre alte Justin. Sie schloss die Augen und seufzte voller Zufriedenheit.
Ihre Finger glitten in die Hand ihres Mannes. Hokanu lächelte. Er sah ohne jeden Zweifel sehr gut aus und war ein fähiger Krieger; auch die leichteren Zeiten hatten seine athletische Erscheinung nicht verweichlicht. Seine Hand schloss sich besitzergreifend um ihre, doch Sanftheit milderte die Kraft.
Die vergangenen drei Jahre waren gute Jahre gewesen. Zum ersten Mal seit ihrer Kindheit fühlte sie sich sicher, geschützt vor den tödlichen, niemals endenden politischen Intrigen des Spiels des Rates. Der Feind, der ihren Vater und ihren Bruder getötet hatte, konnte sie nicht länger bedrohen. Er war nur noch Staub und Erinnerung, genau wie seine Familie, die mit ihm gefallen war; das Land und das herrlich gelegene Herrenhaus seiner Ahnen hatte Mara vom Kaiser erhalten.
Einem alten Aberglauben nach überfiel Unglück das Land einer gefallenen Familie; an einem wunderbaren Morgen wie diesem war jedoch von Unheil weit und breit nichts zu spüren. Als sich die Sänfte langsam am Ufer entlang bewegte, genoss das Paar den friedlichen Augenblick und betrachtete das Heim, das es zusammen aufgebaut hatte.
Das Tal, das einst den Lords der Minwanabi gehört hatte, lag zwischen steilen, steinigen Hügeln und war dank dieser natürlichen Gegebenheiten nicht nur leicht zu verteidigen, sondern auch so schön, als hätten es die Götter selbst berührt. Der friedlichstille Himmel spiegelte sich im See, dessen Oberfläche sich kräuselte, als die schnellen Ruderer eines Botenskiffs Berichte für die Makler in die Heilige Stadt brachten. Dort würden von singenden Sklaven vorwärtsgestakte Kornbarken die Ernte dieses Jahres zur Aufbewahrung in ein Lager bringen, bis der Fluss im Frühjahr wieder mehr Wasser führen und damit den Weitertransport flussabwärts gestatten würde.
In der trockenen Herbstbrise wogte das goldene Gras hin und her, und die Morgensonne ließ die Wände des Herrenhauses wie Alabaster erstrahlen. Lujan und Xandia, die beiden Kommandeure, hielten eine Übung mit einer gemischten Truppe aus Kriegern der Shinzawai und der Acoma ab. Da Hokanu eines Tages den Titel seines Vaters erben würde, hatte seine Heirat mit Mara ihre beiden Häuser nicht miteinander verschmelzen lassen. Krieger im Grün der Acoma marschierten Seite an Seite neben solchen im Blau der Shinzawai, die Reihen hier und da unterbrochen von schwarzen Flecken, Divisionen der insektenähnlichen Choja. Zusammen mit den Ländereien der Minwanabi hatte Lady Mara eine Allianz mit zwei weiteren Schwärmen erhalten, und damit auch die Kampfstärke von drei Kompanien von Kriegern, die von ihren Königinnen nur für den Kampf ausgebrütet worden waren.
Ein Feind, der dumm genug wäre, einen Angriff zu riskieren, würde rasch vernichtet werden. Die Truppen ihrer loyalen Vasallen und Verbündeten hinzugerechnet, geboten Mara und Hokanu über eine Armee, die im Kaiserreich unübertroffen war. Nur die Truppen des Kaisers – die Kaiserlichen Weißen –, verstärkt um die Kontingente anderer Häuser unter seiner Oberherrschaft, konnten ihnen diesen Rang streitig machen. Doch als würden gut ausgebildete Truppen und eine nahezu uneinnehmbare Festung nicht schon allein den Frieden garantieren, hatte Mara für ihre Dienste gegenüber Tsuranuanni den Titel Gute Dienerin des Kaiserreiches erhalten, der mit einer ehrenhalber ausgesprochenen Adoption in die Familie des Kaisers verbunden war. Die Kaiserlichen Weißen würden zu ihrer Verteidigung aufmarschieren, denn nach dem Ehrenkodex der Tsurani war eine Beleidigung oder Bedrohung der Guten Dienerin gleichbedeutend mit einem Angriff auf die Familie des Lichts des Himmels selbst.
»Du siehst heute Morgen erfreulich selbstzufrieden aus, meine Liebe«, meinte Hokanu dicht an ihrem Ohr.
Mara beugte den Kopf an seiner Schulter etwas nach hinten und öffnete die Lippen zum Kuss. Wenn sie auch tief in ihrem Innern die wilde Leidenschaft vermisste, die sie mit dem rothaarigen Barbaren, Justins Vater, erlebt hatte, so hatte sie sich mit diesem Verlust abgefunden. Hokanu besaß einen verwandten Geist; er teilte ihre politische Kühnheit und ihre Neigung zu Neuerungen. Er hatte eine rasche Auffassungsgabe, war freundlich und ihr treu ergeben, und er besaß eine Toleranz gegenüber ihrem halsstarrigen Wesen, die nur wenige Männer in ihrer Kultur aufzubringen vermochten. Bei ihm war Mara gleichberechtigt. Die Heirat hatte eine tiefe und dauerhafte Zufriedenheit hervorgerufen, und obwohl sie ihre Interessen im Großen Spiel des Rates nicht vernachlässigte, spielte sie jetzt nicht mehr aus Furcht. Hokanus Kuss erwärmte den Augenblick wie Wein, bis ein hoher Ton die Stille zerriss.
Mara richtete sich aus Hokanus Umarmung auf; ihr Lächeln spiegelte sich in den dunklen Augen ihres Mannes. »Ayaki«, sagten sie gleichzeitig. Im nächsten Augenblick donnerten Hufschläge den Pfad am See entlang.
Hokanu legte seinen Arm fester um die Schultern seiner Frau, als die beiden sich etwas aus der Sänfte lehnten, um einen Blick auf die Eskapaden von Maras ältestem Sohn und Erben zu werfen.
Ein pechschwarzes Pferd brach durch die Lücke in den Bäumen, Mähne und Schweif flogen im Wind. Grüne Troddeln schmückten die Zügel, und ein perlenbesetzter Brustgurt hinderte den Sattel daran, nach hinten wegzurutschen. In den mit Lackarbeiten versehenen Steigbügeln stand ein Junge, der gerade erst zwölf geworden war und ebenso schwarze Haare hatte wie sein Reittier. Er wendete den Wallach mit den Zügeln und preschte auf Maras Sänfte zu, das Gesicht gerötet vom Rausch der Geschwindigkeit. Sein paillettenbesetzter Umhang flatterte wie ein Banner hinter ihm her.
»Er wird ein ziemlich kühner Reiter«, meinte Hokanu bewundernd. »Und das Geburtstagsgeschenk scheint ihm zu gefallen.«
Mara betrachtete Ayaki mit glühendem Gesicht, als er das Tier auf den Pfad lenkte. Der Junge war ihre ganze Freude, der Mensch, den sie am meisten liebte.
Der schwarze Wallach warf protestierend den Kopf zurück. Er war temperamentvoll und brannte darauf, seine Geschwindigkeit unter Beweis zu stellen. Mara, die sich mit den riesigen Tieren aus der barbarischen Welt immer noch nicht ganz angefreundet hatte, hielt besorgt den Atem an. Ayaki hatte das wilde Wesen seines Vaters geerbt, und in den Jahren seit er knapp dem Messer eines Attentäters entkommen war, ergriff ihn manchmal eine tiefe Unruhe. Beizeiten schien er den Tod geradezu zu verhöhnen, als könnte er sich dadurch, dass er der Gefahr trotzte, des Lebens in seinen Adern versichern.
Doch heute war kein solcher Augenblick, und der Wallach war sowohl wegen seines Gehorsams wie auch seiner Schnelligkeit ausgewählt worden. Er schnaubte und stieß eine Staubwolke vor sich auf, während er sich dem Zügel fügte und neben Maras Sänftenträgern hertrottete, die gegen ihr spontanes Bedürfnis ankämpften, sich von dem großen Tier zu entfernen.
Die Lady schaute auf, als der Junge und das Pferd in ihr Blickfeld gerieten. Ayaki würde breite Schultern bekommen, ganz der Erbe beider Großväter. Er hatte die typische schlanke Figur der Acoma geerbt, genauso wie den störrischen Mut seines Vaters. Obwohl Hokanu nicht sein leiblicher Vater war, verband die beiden Freundschaft und Respekt. Ayaki war ein Junge, auf den alle Eltern stolz sein konnten, und er offenbarte bereits jetzt jenen Verstand, den er benötigen würde, sobald er das Erwachsenenalter erreicht haben und als rechtmäßiger Lord der Acoma in das Spiel des Rates eintreten würde.
»Du junger Angeber«, neckte ihn Hokanu. »Unsere Träger besitzen möglicherweise als einzige im ganzen Kaiserreich das Privileg, Sandalen zu tragen, doch wenn du meinst, wir rasen jetzt mit dir zu den Weiden, muss ich dir eine entschiedene Absage erteilen.«
Ayaki lachte. Seine dunklen Augen hefteten sich auf seine Mutter; in ihnen spiegelte sich seine Begeisterung über den Augenblick. »Eigentlich wollte ich Lax’l fragen, ob ich unsere Geschwindigkeit mit einem seiner Krieger messen kann. Es wäre interessant zu wissen, ob seine Krieger eine Einheit der barbarischen Kavallerie überholen können.«
»Wenn wir einen Krieg hätten – was im Augenblick, den Göttern sei Dank, nicht der Fall ist«, sagte Hokanu mit einer Spur mehr Ernst in seiner Stimme. »Vergiss nicht deine Manieren und beleidige nicht Kommandeur Lax’ls Würde, wenn du fragst.«
Ayaki grinste breit. Er war mit den Cho-ja in seiner Umgebung aufgewachsen, und ihre seltsame Art flößte ihm ganz und gar keine Furcht ein. »Lax’l hat mir immer noch nicht vergeben, dass ich ihm eine Jomach-Frucht mit einem Stein gab.«
»Er hat dir vergeben«, unterbrach ihn Mara. »Doch seither ist er etwas vorsichtiger gegenüber deinen Tricks, was sehr vernünftig ist. Die Cho-ja haben nicht den gleichen Sinn für Scherze wie Menschen.« Sie warf Hokanu einen Blick zu. »Tatsächlich zweifle ich daran, dass sie unseren Humor verstehen.«
Ayaki zog eine Grimasse, und der Rappe unter ihm bockte. Die Sänftenträger wichen vor den tänzelnden Hufen ein wenig zur Seite, und der Ruck weckte den kleinen Justin. Er erwachte mit wütendem Geschrei.
Das schwarze Pferd scheute bei dem Krach. Ayaki hielt das Tier mit sicherer Hand fest, doch der feurige Wallach trat ein paar Schritte zurück. Hokanus Gesicht blieb gelassen, obwohl er den Drang verspürte, über die stürmische Bestimmtheit und Beherrschung seines Sohnes zu lachen. Justin trat seiner Mutter kraftvoll in den Bauch. Sie beugte sich vor, um ihn hochzunehmen.
Dann schwirrte von hinten etwas an Hokanus Ohr vorbei und brachte die Vorhänge der Sänfte zum Flattern. In der Seide war genau dort ein winziges Loch zu erkennen, wo noch eine Sekunde zuvor Maras Kopf gewesen war. Hokanu warf sich mit seinem ganzen Gewicht gegen seine Frau und das Kind; er wandte den Kopf, um in die andere Richtung zu schauen. In den Schatten der Büsche am Rande des Pfads bewegte sich etwas Schwarzes. Im Kampf geschärfte Instinkte veranlassten Hokanu ohne langes Nachdenken zum Handeln.
Er stieß seine Frau mit dem Kind aus der Sänfte, seinen Körper weiterhin schützend über sie gebeugt. Sein plötzlicher Stoß ließ die Sänfte umstürzen und gewährte ihnen zusätzliche Deckung. »Der Busch!«, rief er den Trägern zu, die sich rasch verteilten.
Die Wachen zogen ihre Klingen, bereit, ihre Mistress zu verteidigen. Doch da sie kein deutliches Ziel sahen, das sie angreifen konnten, zögerten sie.
Aus dem Gewirr von Kissen und zerrissenen Vorhängen und über den Lärm von Justins Geschrei hinweg rief Mara verwirrt: »Was –«
Hokanu wandte sich an die Wachen. »Hinter den Akasi-Büschen!«, schrie er.
Das Pferd stampfte auf, als wäre es von einer Stechfliege gestochen worden. Ayaki spürte, wie der Wallach unter ihm erbebte. Das Tier legte die Ohren an, dann schüttelte es die schwarze Mähne, während der Junge versuchte, es mit den Zügeln zu beruhigen. »Ruhig, Großer. Ganz ruhig.« Die Warnung seines Stiefvaters hörte er nicht; er war viel zu sehr damit beschäftigt, das Pferd in den Griff zu bekommen.
Hokanu warf einen Blick über die Sänfte. Die Wachen durchkämmten jetzt die Büsche, die er gemeint hatte. Als er sich umwandte, um nach einem möglichen Angriff von der anderen Seite Ausschau zu halten, sah er Ayaki bei dem verzweifelten Versuch, ein Pferd zu beruhigen, dessen Aufregung inzwischen gefährlich geworden war. Im Sonnenlicht aufblitzender Lack verriet einen winzigen Pfeil, der aus der Flanke des Wallachs ragte. »Ayaki! Spring ab!«
Das Pferd trat wild um sich. Der Pfeil in seiner Flanke tat seine Wirkung, und Nervengift strömte durch die Adern des Tieres. Es rollte mit den Augen, verdrehte sie, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Der Wallach bäumte sich auf den Hinterbeinen auf, und ein beinahe menschlicher Schrei drang aus seiner Kehle.
Hokanu sprang von der Sänfte. Er griff nach den Zügeln des Wallachs, doch die wild trampelnden Hufe zwangen ihn zurück. Er wich aus, versuchte es noch einmal, bekam die Zügel aber wieder nicht zu fassen, als das Pferd sich um die eigene Achse zu drehen begann. Er war vertraut genug im Umgang mit Pferden, um zu wissen, dass dieses hier wahnsinnig geworden war, und so schrie er den Jungen an, der sich mit beiden Händen am Nacken des Tieres festklammerte.
»Ayaki! Spring ab! Sofort, Junge!«
»Nein!«, rief das Kind, nicht im Trotz, sondern voller Mut. »Ich kann ihn beruhigen!«
Hokanu griff erneut nach den Zügeln; seine Furcht verdrängte jeden Gedanken an seine eigene Sicherheit. Ayakis Behauptung wäre möglicherweise gerechtfertigt gewesen, wenn das Tier einfach nur Angst gehabt hätte. Doch Hokanu hatte einmal die Wirkung eines vergifteten Pfeils gesehen; er erkannte das bebende Fleisch und den plötzlichen Mangel an Koordination sofort als das, was es war: die Symptome eines rasch wirkenden Gifts. Hätte der Pfeil Mara getroffen, wäre der Tod innerhalb weniger Sekunden eingetreten. Bei einem Tier, das zehnmal größer war als sie, würde das Ende länger dauern und schmerzvoller sein. Das Pferd brüllte seine Qual heraus, und Zuckungen schüttelten den großen Körper. Es entblößte gelbliche Zähne und kämpfte gegen die Gebissstange, während Hokanu wieder die Zügel verfehlte. »Es ist Gift, Ayaki!«, rief er über den Lärm des tobenden Pferdes hinweg. Hokanu sprang, um den Steigbügel zu erreichen; er hoffte, den Jungen herunterreißen zu können. Die Vorderbeine des Pferdes versteiften sich, scherten auseinander, als die Muskeln in der Verlängerung erstarrten. Dann brachen die Hinterbeine zusammen; es stürzte und begrub den Jungen unter sich.
Das dumpfe Dröhnen, mit dem der schwere Körper auf den Boden fiel, vermischte sich mit Maras Schrei. Ayaki hatte sich bis zuletzt geweigert abzuspringen. Immer noch rittlings auf dem Pferd, wurde er zur Seite geschleudert; sein Nacken zuckte wild zurück, als die Kraft des Sturzes ihn auf den Pfad warf. Das Pferd bebte und rollte auf den Jungen.
Ayaki gab keinen Laut von sich. Hokanu wich einer Barriere aus um sich stoßenden Hufen aus, als er um das gequälte Tier herumrannte. Er erreichte den Jungen mit einem Satz, doch zu spät. Gefangen unter dem Gewicht des sterbenden, zitternden Pferdes wandte Ayaki seine dunklen Augen Honaku zu, und seine freie Hand griff nur einen Herzschlag vor seinem Tod nach der seines Stiefvaters.
Hokanu spürte, wie die kleinen, schmutzigen Finger in seiner Hand erschlafften. Er klammerte sich an die Wut des nicht Wahrhabenwollens. »Nein!«, schrie er, als würde er die Götter anrufen. Maras Schreie klangen in seinen Ohren, und er war sich der Krieger ihrer Ehrengarde bewusst, die ihn beiseite drängten, als sie sich bemühten, das sterbende Pferd umzudrehen. Der Wallach wurde zur Seite gerollt; ein Stöhnen drang aus seiner Kehle, als die Lungen die Luft entließen. Für Ayaki würde es einen solchen Protest gegen den vernichtenden, frühzeitigen Tod nicht mehr geben. Der Widerrist des Wallachs hatte seine Brust eingedrückt, und seine Rippen standen wie die zerbrochenen Teile eines Schwertes heraus.
Das junge Gesicht mit den allzu weißen Wangen starrte jetzt aus offenen, überraschten Augen zu dem klaren Himmel über sich. Die Finger, die vertrauensvoll nach dem Stiefvater gegriffen hatten, der den Schrecken der Dunkelheit abwenden sollte, lagen jetzt leer und geöffnet da, die verschorften Überbleibsel einer Blase an einem Daumen ein letztes Zeugnis für die sorgfältigen Übungen mit einem Holzschwert. Dieser Junge würde niemals die Ehren oder die Schrecken eines Krieges kennenlernen, auch nicht den süßen Kuss seines ersten Mädchens, den Stolz und die Verantwortung des Herrschermantels, der ihm bestimmt gewesen war.
Die Endgültigkeit des plötzlichen Endes verursachte einen Schmerz wie eine blutende Wunde. Hokanu spürte unermessliche Trauer und verwirrte Ungläubigkeit. Sein Verstand arbeitete angesichts des Schocks nur noch mit Reflexen, die er auf dem Schlachtfeld gelernt hatte. »Bedeckt das Kind mit euren Schilden«, befahl er. »Seine Mutter darf ihn so nicht sehen.«
Doch die Worte waren zu spät über seine betäubten Lippen gedrungen. Mara rannte zu ihm, und er spürte das Rauschen ihrer Seidenroben gegen seine Wade, als sie sich neben ihrem Sohn auf die Knie warf. Sie streckte die Arme aus, um ihn zu umarmen, um ihn vom staubigen Boden zu heben, als könnte die bloße Kraft ihrer Liebe ihn wieder zum Leben erwecken. Doch ihre Hände erstarrten mitten in der Luft über den blutigen Fetzen, die einmal Ayakis Körper gewesen waren. Ihr Mund öffnete sich lautlos. Irgendetwas in ihr zerbrach. Instinktiv hielt Hokanu sie am Rücken fest und zog sie an seine Schulter.
»Er ist in die Halle des Roten Gottes gegangen«, murmelte er. Mara antwortete nicht. Hokanu spürte den raschen Herzschlag unter seinen Händen. Erst jetzt bemerkte er das Handgemenge in den Büschen neben dem Pfad. Maras Ehrengarde hatte sich voller Wut auf den schwarzgekleideten Attentäter gestürzt. Sie brachten die Angelegenheit zu Ende, noch bevor Hokanu seinen Verstand zusammennehmen und die Männer zur Zurückhaltung ermahnen konnte, da der Mann nur lebendig sagen konnte, wer ihn angeheuert hatte.
Die Schwerter der Krieger hoben und senkten sich in leuchtendem Rot. Sekunden später lag der Mörder zerhackt da wie ein Needra-Bulle im Stall eines Schlachters.
Hokanu hatte kein Mitleid mit dem Mann. Trotz des Blutes erkannte er das kurze schwarze Hemd und die Hose, und als die Soldaten die Leiche auf den Rücken rollten, sah er die rot gefärbten Hände. Die Kopfbedeckung, die nur die Augen des Mannes freiließ, wurde zur Seite gezogen, und eine blaue Tätowierung auf der linken Wange kam zum Vorschein. Diese Markierung wurde nur von einem Mitglied der Hamoi Tong benutzt, einer Bruderschaft von Attentätern.
Hokanu stand langsam auf. Es spielte keine Rolle, dass die Soldaten den Mörder getötet hatten: Der Attentäter wäre freudig gestorben, bevor er Informationen hätte preisgeben können. Die Tong arbeiteten nach einem strikten Geheimcode, und ganz sicher wusste der Mörder nicht, wer seinen Anführer für dieses Attentat bezahlt hatte. Und der einzige Name von Bedeutung war der des Mannes, der die Hamoi-Bruderschaft angeheuert hatte.
Irgendwo in einer kühlen Ecke seines Kopfes wusste Hokanu, dass dieser Angriff auf Mara keine billige Angelegenheit gewesen war. Dieser Mann hatte niemals damit rechnen können, seine Mission zu überleben, und ein Selbstmordauftrag war ein Vermögen in Metall wert.
»Durchsucht die Leiche und verfolgt seine Spuren zurück«, hörte er sich mit einer Stimme sagen, die von den in seinem Innern brodelnden Gefühlen hart klang. »Seht, ob ihr Hinweise darauf finden könnt, wer den Tong angeheuert haben mag.«
Der befehlshabende Truppenführer der Acoma verbeugte sich vor dem Lord und gab seinen Männern knappe Befehle.
»Lasst eine Wache bei der Leiche des Jungen«, fügte Hokanu hinzu. Er beugte sich hinab, um sich um Mara zu kümmern. Es überraschte ihn nicht, dass sie noch immer sprachlos war und gegen den Schrecken und das Unglaubliche kämpfte. Ihr Ehemann warf ihr das Unvermögen, Haltung zu bewahren und die angemessene tsuranische Gelassenheit zu zeigen, nicht vor. Ayaki war viele Jahre die einzige Familie für sie gewesen; sie hatte keine anderen Blutsverwandten. Ihr Leben war bis zu seiner Geburt bereits zu sehr von Verlust und Tod gezeichnet gewesen. Er presste ihren kleinen, zitternden Körper gegen seinen, während er noch weitere notwendige Anweisungen hinzufügte, die den Jungen betrafen.
Doch als er damit fertig war und sanft versuchte, sie von der Leiche wegzuziehen, wehrte sie sich. »Nein!«, sagte sie mit schmerzerstickter Stimme. »Ich werde ihn hier nicht alleine lassen!«
»Mylady, Ayaki ist jenseits unserer Hilfe. Er steht bereits in den Hallen des Roten Gottes. Trotz seiner Jahre ist er dem Tod mutig gegenübergetreten. Er wird dort willkommen sein.« Er streichelte ihre dunklen Haare, die feucht von Tränen waren, und versuchte sie zu beruhigen. »Es wäre besser, wenn du im Haus bei denen bist, die dich lieben, und Justin in die Obhut seiner Ammen gibst.«
»Nein«, wiederholte Mara. Es war ein Ton in ihrer Stimme, der ihn instinktiv davor warnte, sie weiter zu bedrängen. »Ich gehe nicht weg.«
Zwar stimmte sie nach einiger Zeit zu, Justin zurück zum Herrenhaus und in den Schutz einer Kompanie Krieger bringen zu lassen, doch sie selbst blieb während der Morgenhitze auf dem staubigen Boden sitzen und starrte auf das leblose Gesicht ihres Erstgeborenen.
Hokanu ließ sie keine Sekunde allein. Der Gestank des Todes vermochte ihn nicht zu vertreiben und auch nicht die Fliegen, die herumschwirrten und summten und sich an der aus den Augen des toten Wallachs austretenden Flüssigkeit labten. So beherrscht, als wäre er auf einem Schlachtfeld, stellte er sich dem Schlimmsten entgegen und ertrug es. Mit ruhiger Stimme befahl er einem Läufer, ein paar Bedienstete kommen zu lassen und einen kleinen Seidenpavillon herbeizuschaffen, um etwas Schatten zu erhalten. Mara schaute nicht einmal auf, als die Markise über ihr aufgebaut wurde. Als würden die Menschen um sie herum nicht existieren, ließ sie aufgelockerte Erde durch die Hände gleiten, bis ein Dutzend ihrer besten Krieger in zeremoniellen Rüstungen herbeikamen, um den gefallenen Sohn fortzubringen. Niemand hatte gegen Hokanus Vorschlag, dass der Junge die Ehren des Schlachtfelds verdiente, etwas einzuwenden. Ayaki war durch den Pfeil eines Feindes gestorben, so sicher, als hätte das Gift sein eigenes Fleisch durchdrungen. Er hatte sich geweigert, sein geliebtes Pferd allein zu lassen, und solcher Mut, solches Verantwortungsgefühl in einem so jungen Menschen verdienten Beachtung.
Mit einem maskenhaft starren Gesicht sah Mara zu, wie die Krieger ihren toten Sohn hochhoben und auf einer mit Bannern ausgelegten Bahre niederlegten. Die meisten waren im Grün der Acoma gehalten, doch eine war scharlachrot als Anerkennung des Roten Gottes, der alles Leben zu sich holt.
Die morgendliche Brise hatte sich gelegt, und die Krieger schwitzten bei ihrer Aufgabe. Hokanu half Mara auf die Beine; er zwang sie, nicht zusammenzubrechen. Es kostete ihn selbst sehr viel Anstrengung, die Beherrschung zu bewahren, und das nicht nur wegen Ayaki. Tief in seinem Innern blutete sein Herz auch wegen Mara. Er stützte sie, als sie neben der Bahre herging, und die kleine Gefolgschaft wandte sich in Richtung des Herrenhauses, das noch wenige Stunden zuvor ihnen allen als ein vom Glück gesegneter Ort erschienen war.
Es kam ihm vor wie ein Verbrechen gegen die Natur, dass die Gärten noch immer so üppig aussahen, das Seeufer so grün und saftig, während der Junge zerschmettert und leblos auf seiner Bahre lag.
Die Ehrenträger stoppten vor dem Vordereingang, der für zeremonielle Anlässe benutzt wurde. Im Schatten des gewaltigen Steinportals standen die treuesten Diener des Haushalts. Sie verbeugten sich einer nach dem anderen vor der Bahre, um Ayaki die Ehre zu erweisen. Der Erste Kriegsberater Keyoke führte sie an, die Haare silbrig vom Alter und die Krücke, die ihm trotz der Amputation eines Beines wegen einer Kriegsverletzung zu gehen erlaubte, unauffällig in einer Falte seines offiziellen Mantels verborgen. Als er die rituellen Beileidsworte sprach, betrachtete er Mara mit der Trauer eines Vaters. Neben ihm wartete Lujan, Kommandeur der Acoma, dessen übliches schelmisches Lächeln jetzt ganz verschwunden und einem festen Blick gewichen war, den er durch häufiges Blinzeln, um die Tränen zurückzuhalten, zu bewahren versuchte. Ein Krieger durch und durch, hatte er äußerste Mühe, die Beherrschung aufrechtzuerhalten. Er hatte dem Jungen auf der Bahre den Umgang mit dem Schwert beigebracht und erst an diesem Morgen die Entwicklung seiner Fähigkeiten gelobt.
Er drückte Maras Hand, als sie an ihm vorbeiging. »Ayaki mag zwar erst zwölf Jahre alt gewesen sein, Mylady, aber er war bereits ein außerordentlicher Krieger.«
Die Mistress nickte kaum merklich. Geführt von Hokanu ging sie weiter zu ihrem Hadonra. Klein und schüchtern, wie er war, blickte Jican trostlos drein. Es war ihm erst kürzlich gelungen, den sprunghaften Ayaki für die Kunst der finanziellen Verwaltung der Güter zu interessieren. Nie mehr würde Geklimper aus der Frühstücksecke des Anrichteraums davon künden, dass sie mit Muschelmarken anstelle der verkäuflichen Güter der Acoma die Verwaltung eines Landsitzes durchspielten. Jican geriet bei den formalen Beileidsbekundungen gegenüber seiner Herrin ins Stottern. In seinen ernsten braunen Augen schien sich ihr eigener Schmerz widerzuspiegeln, als sie und ihr Mann weiterschritten, zu ihrem jungen Berater Saric und seinem Assistenten Incomo. Beide waren erst später in den Haushalt der Acoma gekommen, doch Ayaki hatte ihre Sympathie so sehr wie die der anderen errungen. Die Beileidsworte, die sie Mara boten, waren ehrlich gemeint, doch sie brachte keine Antwort zustande. Nur Hokanus Hand auf ihrem Ellenbogen bewahrte sie vor dem Stolpern, als sie die Treppe hinauf und in den Flur schritt.
Hokanu zitterte plötzlich, als er in den Schatten trat. Zum ersten Mal boten die wunderschön bearbeiteten Steine nicht das Gefühl von Schutz. Den hübsch bemalten Läden, die er und Mara in Auftrag gegeben hatten, schenkte er nicht einen einzigen bewundernden Blick. Statt dessen spürte er Zweifel an sich nagen: Möglicherweise war der Tod des jungen Ayaki ein Ausdruck des Missfallens der Götter, weil Mara den Besitz ihrer gefallenen Feinde als Beute übernommen hatte? Die Minwanabi, die einst in diesen Hallen gelebt hatten, waren mit den Acoma in einer durch einen Schwur zu Turakamu verstärkten Blutfehde verfeindet gewesen. Mara hätte in Ablehnung der Tradition den Natami der Minwanabi nicht vergraben, den Talisman-Stein, der die Geister der Toten sicher an das Rad des Lebens band, solange das Sonnenlicht auf ihn fiel. Konnten die Schatten ihrer besiegten Feinde Unglück für sie und ihre Kinder heraufbeschwören?
Doch dann rückte die Sorge um die Sicherheit des jungen Justin erneut in den Vordergrund. Hokanu erteilte sich selbst eine kleine Rüge, dass er sich mit solch abergläubischen Gedanken beschäftigte, und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Mara zu. Während sonst Tod und Verlust ihren Mut und ihre Handlungsbereitschaft gestärkt hatten, schien sie jetzt vollkommen am Boden zerstört. Sie sorgte dafür, dass die Leiche des Jungen in die große Halle kam; ihre Schritte erschienen ihm dabei wie die einer Marionette, die vom Zauberspruch eines Magiers bewegt wurde. Sie saß reglos neben der Bahre, während Diener und Dienerinnen den zerschmetterten Körper ihres Kindes wuschen und ihn in Seide und Juwelen kleideten, wie es seiner Stellung als Erbe eines großen Hauses entsprach. Hokanu wartete neben ihr; das Gefühl seiner eigenen Hilflosigkeit schmerzte ihn. Er hatte etwas zu essen gebracht, doch seine Lady wollte nichts zu sich nehmen. Er hatte einen Heiler gebeten, ein Schlafmittel zuzubereiten, in der Erwartung – oder Hoffnung – ihr eine wütende Antwort zu entlocken.
Mara schüttelte nur geistesabwesend den Kopf und schob den Becher beiseite.
Die Schatten auf dem Boden wurden länger, als die Sonne über den Himmel wanderte und das Licht in immer spitzeren Winkeln durch die Fenster im Dach fiel. Als der Schreiber, den Jican geschickt hatte, diskret ein drittes Mal an die Tür klopfte, kümmerte sich Hokanu schließlich darum und trug dem Mann auf, Saric oder Incomo aufzusuchen und mit ihnen die Liste der Edlen durchzugehen, die über diese Tragödie in Kenntnis gesetzt werden sollten. Mara war ganz offensichtlich nicht in der Lage, die Entscheidung selbst zu treffen. Sie hatte sich seit Stunden nur ein einziges Mal bewegt: als sie die kalten, steifen Finger ihres Sohnes in die Hand genommen hatte.
Als die Abenddämmerung sich herabsenkte, tauchte Lujan auf; seine Sandalen waren staubig, und in seinen Augen stand eine Müdigkeit, wie er sie noch nicht einmal auf einem Feldzug gezeigt hatte. Er verbeugte sich vor seiner Mistress und ihrem Gemahl und wartete auf die Erlaubnis, sprechen zu dürfen.
Maras Augen blieben weiter benommen auf ihren Sohn gerichtet.
Hokanu berührte sie sanft an der Schulter. »Meine Liebe, dein Kommandeur hat Neuigkeiten.«
Die Lady der Acoma bewegte sich, als würde sie von irgendwo in weiter Ferne zurückkehren. »Mein Sohn ist tot«, sagte sie schwach. »Bei der Barmherzigkeit der Götter, es hätte mich treffen sollen.«
Es zerriss Hokanu beinahe das Herz vor Mitleid, als er ihr eine herausgefallene Haarsträhne zurückstrich. »Wenn die Götter gütig wären, hätte es diesen Angriff niemals gegeben.« Dann, als er sah, dass seine Lady wieder in ihre Teilnahmslosigkeit zurückgefallen war, wandte er sich ihrem Offizier zu.
Ihre Blicke trafen sich. Sie hatten Mara wütend erlebt, verletzt, selbst voller Angst um ihr Leben. Sie hatte immer mit Eifer und Einfallsreichtum reagiert. Diese Apathie passte so gar nicht zu ihr, und alle, die sie liebten, fürchteten, dass ein Teil ihrer Lebenskraft mit dem Tod ihres Sohnes zerstört war.
Hokanu bemühte sich, so viel wie möglich auf seine Schultern zu nehmen. »Sagt mir, was Eure Männer gefunden haben, Lujan.«
Wäre Maras Kommandeur stärker an die Traditionen gebunden gewesen, hätte er jede Auskunft verweigert, denn wenn Hokanu auch ein Edler war, so war er doch nicht der Herr der Acoma. Aber die Shinzawai-Gruppe des Haushalts hatte eine Allianz mit den Acoma geschlossen, und Mara war nicht in der Verfassung, wichtige Entscheidungen zu treffen. Lujan seufzte hörbar erleichtert auf. Der Shinzawai-Erbe besaß eine beträchtliche Stärke, und die Neuigkeiten, die Lujan brachte, waren nicht angenehm. »Mylord, unsere Krieger durchsuchten die Leiche – ohne Erfolg. Unsere besten Fährtenleser schlossen sich der Suche an und fanden dies hier in einer kleinen Mulde, in der der Attentäter offensichtlich geschlafen hatte.«
Er reichte ihm eine runde Muschelmarke mit einer Bemalung in Scharlachrot und Gelb, in die das dreieckige Zeichen des Hauses Anasati eingeritzt war. Hokanu nahm den Gegenstand mit einer Geste an sich, aus der seine Empörung sprach. Die Marke zählte zu denen, die ein Herrscher oder eine Herrscherin einem Boten als Beweis dafür gaben, dass ein wichtiger Auftrag ausgeführt worden war. Ein solches Abzeichen war eigentlich nicht geeignet, dass ein Feind es einem Attentäter anvertraute. Andererseits hatte der Lord der Anasati niemals ein Geheimnis aus seinem Hass auf Mara gemacht. Jiro war mächtig und offen mit den Häusern verbündet, die die neue Politik des Kaiserreiches abzuschaffen wünschten. Er war eher ein Gelehrter als ein Mann des Krieges und eigentlich zu klug, um sich zu groben Taten hinreißen zu lassen. Doch Mara hatte einmal seine Männlichkeit beleidigt: Sie hatte seinen jüngeren Bruder als ersten Ehemann vorgezogen, und seit diesem Tag hatte Jiro ihr unverhohlene Antipathie entgegengebracht.
Dennoch zeugte die Muschelmarke von unverfrorener Direktheit für eine Handlung des Großen Spiels. Und die Bruderschaft der Hamoi Tong bevorzugte eigentlich zu verschlungene Wege, um einer solchen Torheit zuzustimmen, wie sie das Mitführen eines Beweises, welches Haus sie angeheuert hatte, bedeutete. Die Geschichte der Bruderschaft reichte Jahrhunderte zurück, und sie hatten ihre Aufträge stets in aller Heimlichkeit erledigt. Wer sie mit einem Mord beauftragte, konnte sich absoluter Diskretion sicher sein. Die Marke konnte daher auch ein Versuch sein, den Anasati die Schuld zuzuschieben.
Hokanu richtete besorgte Blicke auf Lujan. »Glaubt Ihr, dass Jiro für dieses Attentat verantwortlich ist?«
Es war zwar eine Frage, aber es schwang auch ein unausgesprochener Zweifel darin mit. Dass Lujan ebenfalls Vorbehalte über die Bedeutung der Muschelmarke hatte, wurde ersichtlich, als er tief Luft holte und zur Antwort ansetzte.
Doch der Name des Lords der Anasati hatte Mara aus ihrer Lethargie gerissen. »Jiro hat das getan?« Sie wirbelte herum und sah auf die rot-gelbe Scheibe in Hokanus Hand. Ihr Gesicht verzerrte sich zu einer erschreckenden Maske der Wut. »Die Anasati werden Staub im Wind sein. Ihr Natami wird im Abfall begraben und der Geist ihrer Ahnen wird der Dunkelheit übergeben werden. Ich werde ihnen gegenüber weniger Gnade zeigen als gegenüber den Minwanabi!« Ihre Hände krampften sich zu Fäusten zusammen. Sie starrte zwischen ihrem Ehemann und ihrem Kommandeur hindurch, ohne wirklich etwas zu sehen, als könnte sie den verabscheuten Feind durch die bloße Kraft ihres Hasses heraufbeschwören. »Nicht einmal damit wird das Blut meines Sohnes bezahlt werden können. Nicht einmal damit.«
»Lord Jiro ist möglicherweise nicht verantwortlich für die Tat«, erklärte Lujan, dessen gewöhnlich feste Stimme vor Trauer brüchig klang. »Ihr wart das Ziel, nicht Ayaki. Der Junge ist schließlich immer noch der Neffe des Lords der Anasati. Der Tong-Attentäter kann von jedem anderen Feind des Kaiserreiches geschickt worden sein.«
Doch Mara schien ihn nicht zu hören. »Jiro wird bezahlen. Mein Sohn wird gerächt werden.«
»Glaubt Ihr, dass Jiro dafür verantwortlich ist?« Hokanu wiederholte seine Frage an den Kommandeur. Dass der junge Erbe der Anasati immer noch die gleichen Gefühle hegte, selbst nachdem er den Mantel und die Macht geerbt hatte, die einst seinem Vater gehört hatten, zeugte von Sturheit und einem kindischen Stolz. Ein erwachsener Geist würde einen solchen Groll nicht länger nähren; doch konnte es sehr wohl sein, dass der Lord der Anasati in eitler Arroganz wünschte, die ganze Welt möge erfahren, wessen Hand für Maras Unglück verantwortlich war.
Wenn Mara, die Gute Dienerin des Kaiserreiches, nicht allenthalben so beliebt gewesen wäre. Jiro mochte sich aus Gründen verletzter Männlichkeit wie ein Narr verhalten, doch sicherlich würde er nicht so weit gehen, sich freiwillig den Zorn des Kaisers zuzuziehen.
Lujan richtete seine dunklen Augen auf Hokanu. »Dieses Ding hier ist der einzige Beweis, den wir haben. Seine allzu klare Offensichtlichkeit mag ein Trick sein, damit das Haus Anasati scheinbar entlastet ist und wir woanders nach den Schuldigen suchen.« Hinter seinen Worten war seine Wut spürbar. Auch er sehnte sich danach, aus Zorn über diese Gräueltat zuzuschlagen. »Es spielt nur eine geringe Rolle, was ich denke«, endete er grimmig. Denn die Ehre verlangte von ihm, dass er den Willen seiner Lady befolgte, absolut und unhinterfragt. Wenn Mara ihn bat, die Garnison der Acoma aufzustellen und in selbstmörderischer Absicht in den Krieg zu ziehen, würde er gehorchen.
Durch die Oberlichter in der großen Halle fiel jetzt nur noch dämmriges Licht. Bedienstete traten auf leisen Sohlen ein und entzündeten die Lampen um Ayakis Bahre. Wohlriechender Rauch verlieh der Luft eine leichte Süße. Das Spiel des warmen Lichts milderte die Kälte des Todes, und Schatten verdeckten die zerschmetterten Konturen unter den Seidenroben. Mara hielt allein Wache. Sie betrachtete das ovale Gesicht ihres Sohnes, seine pechschwarzen Haare, die zum ersten Mal, seit sie sich erinnern konnte, länger als eine Stunde gekämmt blieben.
Ayaki war ihre ganze Zukunft gewesen, bis zu dem Augenblick, da der Wallach zusammengebrochen war. Er hatte ihre Hoffnung verkörpert, ihre Träume – und er war der zukünftige Wächter ihrer Ahnen gewesen, Garant für den Weiterbestand des Namens der Acoma.
Ihre Selbstgefälligkeit hatte ihn getötet.
Mara verkrampfte ihre Finger so sehr in ihrem Schoß, dass sie weiß wurden. Niemals hätte sie sich in dem Glauben wiegen dürfen, dass ihre Feinde sie nicht treffen konnten. Die Schuld, die sie mit ihrer nachlassenden Wachsamkeit auf sich geladen hatte, würde sie den Rest ihrer Tage verfolgen. Doch wie trostlos jede Betrachtung eines weiteren Morgens geworden war! Neben ihr lag ein Tablett mit den Resten einer Mahlzeit, die sie kaum angerührt hatte; das Essen hatte keinen Geschmack, an den sie sich hätte erinnern können. Hokanus Fürsorge hatte sie nicht getröstet; sie kannte ihn zu gut, und der Widerhall ihres eigenen Schmerzes und ihrer eigenen Wut, den sie hinter seinen Worten spürte, zogen sie nur noch tiefer in Selbstvorwürfe.
Nur der Junge machte ihr keinen Vorwurf wegen ihrer Dummheit. Ayaki war jenseits jeden Gefühls, jenseits jeder Trauer oder Freude.
Mara unterdrückte einen Anfall von Trauer. Wie sehr sie sich wünschte, der Pfeil hätte sie getroffen, und die Dunkelheit, die alles Streben beendete, würde ihr gelten, nicht ihrem Sohn. Dass sie noch ein anderes, lebendes Kind hatte, linderte ihre Verzweiflung nicht. Denn obwohl er älter gewesen war, hatte Ayaki weniger von der Fülle des Lebens kennengelernt. Er war von Buntokapi von den Anasati, dessen Familie ein Feind der Acoma gewesen war, gezeugt worden, aus einer Verbindung heraus, die Mara viel Schmerz und wenig Glück gebracht hatte. Politische Zweckdienlichkeit hatte sie zu Täuschungen und Betrug verleitet, zu Handlungen, die ihr aus heutiger reiferer Sicht als nichts anderes als Mord erschienen. Ayaki war ihre Sühne für den unnötigen Selbstmord seines Vaters, den Maras Machenschaften herbeigeführt hatten. Obwohl sie nach den Lehrsätzen des Spiels des Rates einen wirkungsvollen Sieg errungen hatte, wertete sie Buntokapis Tod im stillen als Niederlage. Es machte für sie keinen Unterschied, dass seine Familie ihn vernachlässigt und erst dadurch zu einem für sie leicht nutzbaren Werkzeug gemacht hatte. Ayaki war eine Möglichkeit gewesen, dem Schatten ihres ersten Ehemannes dauerhafte Ehre zu erweisen. Sie war fest entschlossen gewesen, seinen Sohn zu der Größe zu erziehen, die Buntokapi vorenthalten worden war.
Doch jetzt hatte diese Hoffnung ein Ende gefunden. Lord Jiro von den Anasati war Buntokapis Bruder, und die Tatsache, dass diese Intrige gegen sie fehlgeschlagen war und zum Tod seines Neffen geführt hatte, verlagerte das politische Gleichgewicht erneut. Denn ohne Ayaki stand es den Anasati frei, die Feindschaft wieder aufleben zu lassen, die seit der Zeit ihres Vaters geruht hatte.
Ayaki war mit den besten Lehrern großgeworden, mit der ganzen Wachsamkeit ihrer Soldaten zu seinem Schutz; und doch hatte er für die Privilegien seines Rangs bezahlen müssen. Im Alter von neun Jahren hätte er beinahe durch das Messer eines Attentäters sein Leben verloren. Zwei Ammen und eine geliebte, alte Dienerin waren vor seinen Augen ermordet worden, eine Erfahrung, die ihm lange Albträume beschert hatte. Mara widerstand dem Drang, tröstend seine Hand zu reiben. Die Haut war kalt, und seine Augen würden sich niemals mehr voller Freude und Vertrauen öffnen.
Mara musste nicht gegen Tränen ankämpfen; Wut über die Ungerechtigkeit unterdrückte ihre Trauer. Die persönlichen Dämonen, die das Wesen seines Vaters verdreht und ihm eine gewisse Grausamkeit verliehen hatten, hatten bei Ayaki eine Tendenz zur Melancholie und zum Brüten hervorgebracht. Erst in den vergangenen drei Jahren, seit Maras Hochzeit mit Hokanu, war die sonnigere Seite des Jungen stärker um Vorschein gekommen.
Die Festung der Minwanabi, wie Ayaki immer gerne aufgezeigt hatte, war niemals erstürmt worden; die Verteidigungsanlagen waren für jeden Feind uneinnehmbar. Darüber hinaus war Mara eine Gute Dienerin des Kaiserreichs. Der Titel trug die Gunst der Götter in sich und genug Glück, um Unheil abzuwenden.
Jetzt haderte Mara mit sich, weil sie sich von seinem kindischen, blinden Glauben hatte anstecken lassen. Sie hatte Traditionen und Aberglauben oft genug zu ihrem Vorteil genutzt. Sie war eine eitle Närrin gewesen, dass sie nicht gesehen hatte, wie dieselben Dinge auch gegen sie arbeiten konnten.
Es kam ihr wie eine große Ungerechtigkeit vor, dass nicht sie, sonder ihr Kind dafür hatte bezahlen müssen.
Sein kleiner Halbbruder Justin hatte geholfen, Ayakis trostlose Stimmungen aufzuheitern. Ihr zweiter Sohn war das Kind des barbarischen Sklaven, den sie noch immer liebte. Sie musste ihre Augen nur einen kurzen Augenblick schließen, und schon sah sie Kevins Gesicht vor sich – wie fast immer lächelte er über irgendeinen dummen Witz, und seine roten Haare und sein Bart glänzten kupfern in der Sonne Kelewans. Mit ihm hatte sie kein harmonisches Verhältnis verbunden, wie sie es jetzt zu Hokanu besaß. Nein, Kevin war stürmisch gewesen, impulsiv, beizeiten leidenschaftlich unlogisch. Er hätte seine Trauer nicht vor ihr verborgen, sondern seinen Gefühlen stürmisch freien Lauf gelassen; in seiner intensiven Lust zu leben hätte sie vielleicht die Kraft gefunden, mit dieser Gräueltat fertig zu werden. Der kleine Justin hatte das sorglose Wesen seines Vaters geerbt. Er lachte häufig, stellte dauernd etwas an und bewies bereits jetzt eine schnelle Zunge. Wie sein Vater hatte auch Justin das Talent gehabt, Ayaki aus seinen Grübeleien herauszureißen. Er rannte dann auf seinen pummeligen Beinen, stolperte und kippte vor Lachen um, oder er schnitt so lange Grimassen, bis es unmöglich war, neben ihm zu stehen und sich ihm nicht zuzuwenden.
Doch Ayaki würde niemals mehr gemeinsam mit seinem kleinen Bruder in fröhliches Gelächter ausbrechen.
Mara zitterte, und erst jetzt bemerkte sie die Gegenwart einer anderen Person. Hokanu war so unheimlich leise ins Zimmer gekommen, wie er es von den Förstern in der barbarischen Welt gelernt hatte.
Als er sah, dass sie ihn bemerkt hatte, nahm er ihre kalten Finger in seine warme Hand. »Mylady, Mitternacht ist vorüber. Es würde dir guttun, ein wenig zu ruhen.«
Mara wandte sich ein Stück von der Bahre ab. Ihre dunklen Augen hefteten sich auf Hokanu, und das Mitgefühl in seinem Blick brachte sie zum Weinen. Sein gutaussehendes Gesicht verschwamm vor ihr, und er verlagerte seinen Griff etwas, zog ihren Körper gegen seine Schulter. Genau wie sein Vater war er nicht übermäßig muskulös, aber kräftig. Und wenn er auch nicht die wilde Leidenschaft in ihr entfachte wie Kevin, so verband ihn mit Mara doch ein tiefes Verständnis. Er war ihr ein Ehemann, wie Ayakis Vater es niemals gewesen war, und seine Gegenwart, als der Kummer ihre Haltung zusammenbrechen ließ, war alles, was sie davor bewahrte, verrückt zu werden. Die Berührung, die versuchte, ihren Schmerz zu lindern, stammte von einem Mann, der durchaus in der Lage war, auf dem Schlachtfeld zu bestehen. Er zog wie sie selbst den Frieden vor, doch wenn es notwendig sein sollte, das Schwert zu gebrauchen, dann besaß er den Mut der Tiger, die die Welt auf der anderen Seite des Spalts bewohnten.
Jetzt würden die Acoma diese Fähigkeiten im Kampf benötigen.
Als Mara die Tränen über die Wangen rannen, schmeckte sie grenzenlose Bitterkeit. Die Schuld in ihrem Innern hatte einen Namen, den sie als Sündenbock missbrauchen konnte: Jiro von den Anasati hatte ihren Sohn ermordet, und dafür würde sie sein Haus vernichten, es für allezeit aus der Erinnerung der Lebenden tilgen.
Als hätte Hokanu ihre Gedanken gespürt, schüttelte er sie sanft. »Mylady, du wirst gebraucht. Justin schreit die ganze Zeit während des Essens und will wissen, was mit seiner Mama geschehen ist. Keyoke fragt jede Stunde nach neuen Anweisungen, und Lujan muss wissen, wie viele Kompanien er von der Garnisons-Pflicht auf dem Landgut bei Sulan-Qu entbinden und hierherkommen lassen soll.«
In seiner unnachahmlich feinfühligen Weise diskutierte Hokanu nicht mit ihr über die Notwendigkeit eines Krieges. Das erleichterte sie ein wenig. Hätte er Fragen gestellt, hätte er versucht, sie davon abzubringen, sich aufgrund einer wenig beweiskräftigen Muschelmarke an Jiro zu rächen, sie hätte sich voller Wut gegen ihn gewandt. Wer in diesem Augenblick nicht für sie war, war gegen sie. Den Acoma war ein Schlag versetzt worden, und die Ehre verlangte nach Taten.
Doch der Anblick ihres ermordeten Sohnes schwächte ihren Willen; jeder Lebensmut in ihr versiegte.
»Lady?«, drängte Hokanu. »Es ist notwendig für den Weiterbestand deines Hauses, dass du Entscheidungen triffst. Denn jetzt bist du Acoma.«
Nachdenklich runzelte Mara die Stirn. Die Worte ihres Mannes waren wahr. Bei ihrer Heirat hatten sie sich darauf geeinigt, dass Justin nach Hokanu Erbe der Shinzawai werden würde. Jetzt stieg in Mara plötzlich der heiße Wunsch auf, diese Worte wären unausgesprochen geblieben. Niemals hätte sie sich damit einverstanden erklärt, wenn sie Ayakis Sterblichkeit bedacht hätte.
Der Kreis schloss sich wieder. Sie war nachlässig gewesen. Hätte sie sich nicht dieser gefährlichen Selbstzufriedenheit hingegeben, würde ihr schwarzhaariger Sohn jetzt nicht in offiziellen Gewändern von Lampen umgeben auf der Bahre liegen. Er würde umherrennen, wie ein Junge es tun sollte, oder sich in den Fähigkeiten eines Kriegers üben oder mit seinem großen, schwarzen Wallach schnell wie der Wind über die Hügel jagen.
Wieder sah Mara vor ihrem geistigen Auge den Bogen, als das gewaltige Tier sich aufbäumte, sah die schrecklichen, um sich stoßenden Hufe, als es stürzte …
»Lady«, schalt Hokanu sanft. Zärtlich öffnete er ihre verkrampften Finger und bemühte sich, ihr etwas von der Spannung zu nehmen. »Es ist vorbei. Wir müssen fortfahren, uns um die Lebenden zu kümmern.« Er wischte ihre Tränen weg, doch immer neue quollen zwischen den Lidern hervor. »Mara, die Götter waren grausam. Doch meine Liebe für dich ist unendlich, und der Glaube deines Haushalts an deine Kraft leuchtet wie eine Lampe in der Dunkelheit. Ayaki hat nicht umsonst gelebt. Er war mutig und stark, und er scheute nicht vor seiner Verantwortung zurück, nicht einmal im Augenblick seines Todes. Wir müssen genauso sein, oder der Pfeil, der das Pferd niederstreckte, hat mehr als nur einen tödlichen Treffer erzielt.«
Mara schloss die Augen und versuchte, den nach wohlriechendem Öl duftenden Rauch der Lampen zu ignorieren. Sie musste nicht daran erinnert werden, dass das Leben Tausender von Menschen von ihr, der Herrscherin, abhing; heute hatte sie für den Beweis gezahlt, dass sie ihr Vertrauen nicht verdiente. Sie war nicht länger die Herrscherin für ihren heranwachsenden Sohn. Es schien keine Kraft, kein Mut mehr in ihr zu sein, und doch musste sie sich auf einen großen Krieg vorbereiten und Vergeltung üben, um die Ehre ihrer Familie zu bewahren, und dann brauchte sie einen neuen Erben.
Doch die Hoffnung, die Zukunft, die Begeisterung und die Träume, für die sie so lange so viel geopfert hatte, waren alle zu Staub zerfallen. Sie fühlte sich wie betäubt, bestraft jenseits aller Maßen.
»Mylord, mein lieber Mann«, sagte sie mit rauer Stimme. »Kümmere du dich um meine Berater und lass sie tun, was du für richtig hältst. Ich habe nicht die Kraft, Entscheidungen zu fällen, und doch müssen die Acoma sich auf einen Krieg vorbereiten.«
Hokanu sah sie mit schmerzerfülltem Blick an. Seit langem schon bewunderte er ihren unbeugsamen Geist, und es quälte ihn zu sehen, dass ihre Kühnheit so durch Trauer zunichte gemacht wurde. Er wusste um ihren tiefen Schmerz und presste sie fest an sich. »Lady«, flüsterte er leise, »ich werde dir ersparen, was ich kann. Wenn du gegen Jiro von den Anasati marschieren willst, werde ich mich an die rechte Seite deines Kommandeurs stellen. Doch früher oder später musst du die Führung deines Hauses wieder übernehmen. Der Name der Acoma unterliegt deiner Obhut. Ayakis Tod darf nicht Zeichen für das Ende sein, sondern muss die Erneuerung deines Geschlechtes bedeuten.«
Unfähig, etwas zu sagen oder auch nur einen vernünftigen Gedanken zu fassen, ließ Mara ihr Gesicht gegen die Schulter ihres Mannes sinken, und eine lange, lange Zeit sickerten ihre Tränen geräuschlos in die kostbare blaue Seide seines Umhangs.
Zwei
Konfrontation
Jiro runzelte die Stirn.
Obwohl die schlichte Robe, die er trug, leicht war und der Portikus um den an seine Bibliothek angrenzenden Hof zu dieser frühen Stunde noch kühl, bildeten sich feine Schweißperlen auf seiner Stirn. Ein Tablett mit halb aufgegessenen Speisen stand unbeachtet neben ihm, während er mit angespannten Fingern auf die bestickten Kissen klopfte, auf denen er saß; seine Augen studierten unbewegt das Brettspiel vor seinen Knien. Eingehend betrachtete er die Position jeder einzelnen Figur und versuchte vorauszusehen, welche Entwicklung jeder Zug nach sich ziehen würde. Eine falsche Entscheidung würde sich nicht unbedingt sofort als solche zeigen, doch bei seinem heutigen Gegenspieler war die Gefahr groß, dass sie sich einige Züge später vernichtend auswirkte. Die Gelehrten behaupteten, das Shah-Spiel würde den Instinkt eines Mannes für Schlachten und Politik schärfen, und Jiro, Lord der Anasati, genoss geistige Herausforderungen mehr als jeden körperlichen Wettstreit. Für ihn besaßen die Feinheiten des Spiels an sich bereits eine beinahe hypnotische Faszination.
Schon früh hatte er sich seinem Vater und anderen Lehrern gegenüber als überlegen erwiesen. Als Junge hatte er von seinem älteren Bruder Halesko und seinem jüngeren Bruder Buntokapi wegen der geringschätzigen Leichtigkeit, mit der er sie besiegte, oft Schläge einstecken müssen. Jiro hatte sich ältere Gegner gesucht und sogar gegen midkemische Händler gespielt, die immer häufiger das Kaiserreich besuchten, um neue Märkte für ihre exotischen Waren zu finden. Sie nannten das Spiel Schach, doch die Regeln waren die Gleichen. Aber auch in ihren Reihen fand Jiro nur wenige, die für ihn eine echte Herausforderung darstellten.
Der einzige Mann, den er niemals geschlagen hatte, saß ihm jetzt gegenüber und warf abwesend einige Blicke über eine Reihe fein säuberlich neben seinen Knien aufgestapelter Dokumente. Chumaka, Erster Berater der Anasati schon unter Jiros Vater, war ein gertenschlanker, schmalgesichtiger Mann mit einem spitzen Kinn und schwarzen, undurchdringlichen Augen. Er betrachtete das Brettspiel wie im Vorbeigehen, hielt hier und da inne, um die Züge seines Herrn zu beantworten. Doch die abwesende Weise, in der sein Erster Berater ihn immer wieder besiegte, machte Jiro keineswegs wütend, ganz im Gegenteil erfüllte es ihn mit Stolz, dass ein solch gewandter Geist den Anasati diente.
Chumakas Fähigkeit, komplexe politische Situationen vorauszuberechnen, grenzte manchmal ans Unheimliche. Seinen klugen Ratschlägen hatte Jiros Vater einen großen Teil seines Aufstiegs im Spiel des Rates verdankt. Während Mara von den Acoma die Anasati früh auf ihrem Weg zu Größe und Macht gedemütigt hatte, hatte Chumaka mit weisem Rat zur Seite gestanden und so die Interessen der Familie vor Rückschlägen in jenem Konflikt bewahrt, der sich zwischen den Acoma und den Minwanabi entsponnen hatte.
Jiro kaute an seiner Unterlippe; er war hin und her gerissen zwischen zwei Zügen, die schnelle kleine Vorteile versprachen, und einem anderen, der eine langfristigere Strategie erforderte. Während er nachdachte, wanderten seine Gedanken zurück zum Großen Spiel: Die Auslöschung des Hauses Minwanabi hätte ein Grund zum Feiern gewesen sein können, da sie auch Gegner der Anasati gewesen waren – wenn der Sieg nicht von der Frau errungen worden wäre, die Jiro mehr hasste als alles andere auf der Welt. Seine Feindseligkeit rührte von dem Augenblick her, da Lady Mara die Wahl ihres Ehemannes bekanntgegeben hatte und seinen jüngeren Bruder Buntokapi ihm vorgezogen hatte.
Es spielte keine Rolle, dass, hätte sein Ego nicht einen solchen Schlag erhalten, Jiro anstelle Buntos derjenige gewesen wäre, den die Machenschaften der Lady getötet hätten. So angetan der letzte lebende Sohn des Anasati-Geschlechts auch sonst von gelehrten Gedanken sein mochte, verschloss er sich, was diesen Punkt betraf, jeder Logik. Er nährte seine Gehässigkeit durch Grübeleien. Dass die Hexe kaltherzig den Tod seines Bruders geplant hatte, war Grund genug für blutige Rache, es spielte keine Rolle, dass Bunto von seiner Familie verachtet worden war und sich von allen Verbindungen zu den Anasati losgesagt hatte, als er zum Lord der Acoma wurde. So tief und so brennend war Jiros Hass, dass er sich hartnäckig der Erkenntnis verschloss, dass er zu seiner eigenen Herrschaft nur deshalb gekommen war, weil Mara ihn verschmäht hatte. Im Laufe der Jahre war sein jugendlicher Durst nach Rache zur dauerhaften Obsession eines gefährlichen, schlauen Rivalen geworden.
Jiro warf einen Blick auf das Shah-Spiel, doch er rührte noch keinen Finger, um eine Figur zu verrücken. Chumaka bemerkte dies, während er seine Papiere durchblätterte. Er wölbte die Augenbrauen. »Ihr denkt wieder an Mara.«
Jiro wirkte verärgert.
»Ich habe Euch gewarnt«, erklärte Chumaka mit seiner rauen, emotionslosen Stimme. »Wenn Ihr zu lange über Eure Feindschaft nachdenkt, gerät Euer inneres Gleichgewicht durcheinander, und Ihr bringt Euch am Ende um den Sieg.«
Der Lord der Anasati verlieh seiner Geringschätzung Ausdruck, indem er sich für den kühneren der beiden kurzsichtigen Züge entschied.
»Aha.« Chumaka machte sich nicht einmal die Mühe, seine Freude zu verbergen, als er seine geschlagene Figur vom Spielbrett nahm. Während seine linke Hand immer noch mit den Papieren raschelte, schob er mit der rechten seinen Priester vor.
Der Lord der Anasati biss sich verärgert auf die Lippe; warum hatte sein Erster Berater das getan? Voll darauf konzentriert, die Logik hinter diesem Zug zu erfassen, nahm Jiro den Boten kaum wahr, der ins Zimmer geeilt kam.
Der Ankömmling verbeugte sich vor seinem Herrn. Sobald ihm mit einer lässigen Geste gestattet worden war, sich wieder zu erheben, reichte er Chumaka ein versiegeltes Päckchen.
»Mit Eurer Erlaubnis, Herr?«, murmelte Chumaka.
»Die Nachricht ist verschlüsselt, nicht wahr?«, fragte Jiro. Er wollte nicht, dass die Unterbrechung seine Gedanken über den nächsten Zug beeinflusste. Seine Hand schwebte reglos über den Figuren, während Chumaka sich räusperte. Jiro nahm dies als Zustimmung. »Das dachte ich mir«, sagte er. »Öffnet also Eure Berichte. Und mögen die Neuigkeiten endlich einmal Eure Konzentration für das Spiel lähmen.«