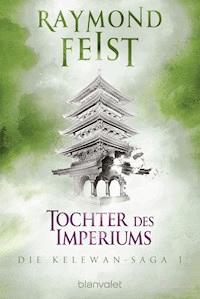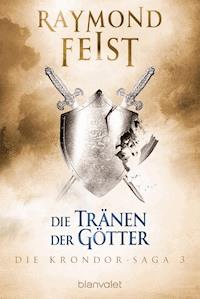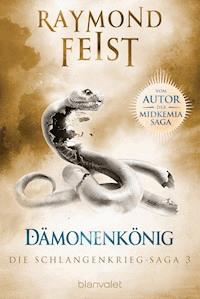9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE ERBEN VON MIDKEMIA
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker der heroischen Fantasy in überarbeiteter Neuausgabe!
Der junge Talon und das Konklave der Schatten haben den skrupellosen Herzog Olasko gestürzt und ihn ins Exil in ein fernes, wildes Land verbannt. Dort muss der frühere Tyrann nun täglich um sein Überleben kämpfen. Er kennt nur noch ein Ziel: zurückzukehren und sich an Talon und seinen Verbündeten zu rächen. Doch während seiner beschwerlichen Odyssee nach Kaspar beginnt Olasko allmählich, sein Leben mit anderen Augen zu betrachten. Denn er erfährt von einer dunklen Macht, die seine Heimat und ganz Midkemia bedroht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Der junge Talon und das Konklave der Schatten haben den skrupellosen Herzog Olasko gestürzt und ihn ins Exil in ein fernes, wildes Land verbannt. Dort muss der frühere Tyrann nun täglich um sein Überleben kämpfen. Er kennt nur noch ein Ziel: zurückzukehren und sich an Talon und seinen Verbündeten zu rächen. Doch während seiner beschwerlichen Odyssee nach Kaspar beginnt Olasko allmählich, sein Leben mit anderen Augen zu betrachten. Denn er erfährt von einer dunklen Macht, die seine Heimat und ganz Midkemia bedroht …
Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt seiner Romane: Midkemia. Die in den 80er Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Von Raymond Feist bereits erschienen
Die Midkemia-Saga
Die Kelewan-Saga
Die Midkemia-Chronik
Die Schlangenkrieg-Saga
Die Erben von Midkemia
Die Krondor-Saga
Die Legenden von Midkemia
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Raymond Feist
Die Erben von Midkemia 3
Konklave der Schatten
Roman
Deutsch von Regina Winter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Exile’s Return. Conclave of Shadows (Vol. 3)« bei Harper Collins Publishers, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2004 by Raymond E. Feist
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2006 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
Karten: © Melanie Korte, Inkcraft
DN · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24240-4V001
www.blanvalet.de
Für James,
mit aller Liebe,
die ein Vater geben kann.
Gefangen
Die Reiter kamen auf ihn zu.
Kaspar, der bis zum Vortag den Titel eines Herzogs von Olasko getragen hatte, wartete und hielt seine Ketten bereit. Augenblicke zuvor hatte ihn ein hochgewachsener, weißhaariger Magier mit ein paar dürftigen Abschiedsworten auf dieser staubigen Ebene abgesetzt und war verschwunden, und nun näherte sich dem Adligen im Exil eine Gruppe von Nomaden.
Kaspar hatte sich noch nie so lebendig und stark gefühlt. Er grinste, holte tief Luft und federte leicht in den Knien. Die Reiter schwärmten aus, und Kaspar wusste, dass sie ihn für gefährlich hielten, obwohl er allein und barfuß war und außer den schweren Ketten mit Hand- und Fußfesseln an den Enden nichts hatte, womit er sich verteidigen konnte.
Die Reiter wurden langsamer. Kaspar zählte sechs von ihnen. Sie waren fremdartig gekleidet, in weite indigoblaue Obergewänder über weißen weiten Hemden, die in der Taille mit Schnüren gegürtet waren, und Pumphosen, die in schwarzen Lederstiefeln steckten. Dazu trugen sie Turbane, bei denen jeweils an der rechten Seite ein Stück Stoff herunterhing. Kaspar nahm an, dass dieser Schal rasch benutzt werden konnte, um Mund und Nase vor einem Staubsturm zu schützen oder das Gesicht zu verbergen. Die Kleidung kam ihm weniger wie eine Uniform als wie Stammeskleidung vor. Und die Männer hatten diverse gefährlich aussehende Waffen dabei.
Der Anführer rief etwas in einer Sprache, die Kaspar nicht verstand, obwohl sie etwas seltsam Vertrautes an sich hatte. Kaspar erwiderte: »Ich nehme an, keiner von euch spricht Olaskisch?«
Der Mann, den Kaspar für den Anführer hielt, sagte etwas zu seinen Leuten, machte eine Geste und wartete. Zwei Männer stiegen ab, zogen ihre Waffen und gingen auf Kaspar zu. Ein dritter hinter ihnen nahm eine Lederschnur vom Sattel, mit der er den neuen Gefangenen offenbar fesseln wollte.
Kaspar ließ die Ketten ein Stück sinken und die Schultern hängen, als würde er sich seinem Schicksal ergeben. Der Art, wie die Männer sich näherten, entnahm er zweierlei: Es handelte sich um erfahrene Kämpfer – zähe, sonnenverbrannte Bewohner der Steppe, die wahrscheinlich in Zelten lebten –, aber sie waren keine ausgebildeten Soldaten. Ein kurzer Blick verriet Kaspar, dass keiner der drei Männer, die noch auf den Pferden saßen, bisher einen Bogen in der Hand hatte.
Kaspar ließ den Mann mit der Lederschnur näher kommen, und dann trat er im letzten Augenblick zu und traf ihn an der Brust. Der Mann war von den dreien, die sich ihm genähert hatten, der ungefährlichste. Kaspar schwang die Ketten, ließ ein Ende davon los, und der Schwertkämpfer rechts von ihm, der geglaubt hatte, außer Reichweite zu sein, wurde von der behelfsmäßigen Waffe im Gesicht getroffen und sackte lautlos zu Boden.
Der andere Schwertkämpfer reagierte schnell, hob sein Schwert und schrie etwas. Kaspar hätte nicht zu sagen vermocht, ob es sich dabei um eine Beleidigung, einen Kriegsruf oder ein Stoßgebet handelte. Der ehemalige Herzog wusste nur, dass er schnell handeln musste.
Statt dem Angreifer auszuweichen, warf er sich auf den Mann und stieß mit Wucht gegen ihn, während das Schwert des Nomaden ins Leere traf.
Kaspar schob die Schulter in die Achselhöhle des Mannes, und der Schwung des danebengegangenen Schlages trug den Nomaden über Kaspars Schulter hinweg. Kaspar half mit beiden Armen nach, und der Mann flog durch die Luft und prallte hart auf den Boden. Der Atem entwich geräuschvoll aus seiner Lunge. Kaspar hielt es sogar für möglich, dass sich sein Gegner das Rückgrat gebrochen hatte.
Er spürte mehr, als dass er es sah, wie zwei der Reiter nun ihre Bögen bereitmachten, also warf er sich nach vorn, überschlug sich und kam mit dem Schwert eines der am Boden liegenden Männer in der Hand wieder auf die Beine. Der Nomade, der die Lederschnur gehalten hatte, versuchte aufzustehen, doch Kaspar versetzte ihm einen Schlag mit der flachen Seite der Klinge, und der Mann ging wieder zu Boden.
Kaspar war kein so guter Schwertkämpfer wie Tal Falkner, doch er war den größten Teil seines Lebens als Soldat ausgebildet worden, und Nahkampf war sein Element. Er rannte auf die drei Reiter zu, von denen zwei mit Bögen bewaffnet waren und einer eine schlanke Lanze in der Hand hatte, die er nun ausrichtete, während er seinem Pferd die Hacken in die Flanken bohrte. Das Tier war vielleicht kein erfahrenes Streitross, aber es war gut ausgebildet. Es sprang vorwärts wie ein Rennpferd beim Start, und Kaspar konnte gerade noch ausweichen, sonst wäre er niedergetrampelt worden.
Der Reiter hatte mit seiner Lanze auf seine Brust gezielt, aber mit einer raschen Bewegung nach links entging der ehemalige Herzog der Waffe. Wäre das Pferd nur ein wenig früher losgeprescht, wäre es für Kaspar zu spät gewesen. So aber vollendete er die Drehung, griff mit der linken Hand nach oben, packte den Reiter hinten am Gewand und riss ihn aus dem Sattel.
Kaspar wartete nicht, bis der Mann auf dem Boden aufschlug, sondern nutzte seinen Schwung, um sich weiterzudrehen, bis er dem nächsten Reiter gegenüberstand, der versuchte, seinen Bogen zu spannen. Kaspar griff mit der linken Hand zu und packte den Fußknöchel des Mannes, riss ihn nach hinten und nach oben, und auch dieser Reiter fiel vom Pferd.
Kaspar fuhr herum, um zu sehen, wo sich der letzte Gegner befand und ob einer der Männer, die er zu Fall gebracht hatte, versuchte, wieder auf die Beine zu gelangen. Er drehte sich zweimal um die eigene Achse, und dann …
Dann richtete er sich langsam auf und ließ das Schwert fallen.
Der letzte Reiter hatte sein Pferd in aller Ruhe ein paar Schritte nach hinten gelenkt, saß nun gelassen im Sattel und zielte mit einem Pfeil auf Kaspar. Es war hoffnungslos. Nur wenn der Mann ein wirklich schlechter Schütze war, hätte der ehemalige Herzog dem Pfeil, der auf seine Brust gerichtet war, entgehen können.
Der Nomade lächelte, nickte und sagte etwas, das Kaspar als »gut« deutete, dann richtete er den Blick auf etwas, das sich hinter dem ehemaligen Herzog befand.
Einer der Reiter, die Kaspar vom Pferd gezogen hatte, stieß Kaspar den Unterarm in den Nacken und warf ihn damit auf die Knie. Kaspar versuchte, sich umzudrehen, als er Metall klirren hörte, und er begriff, dass jemand seine Ketten ergriffen hatte. Als er den Kopf wandte, krachte kaltes Eisen gegen sein Kinn. Helles Licht explodierte in seinem Kopf, dann verlor er das Bewusstsein.
Kaspars Kinn pochte. Sein Hals tat weh, und überhaupt hatte er am ganzen Körper Schmerzen. Einen Augenblick wusste er nicht, wo er sich befand, dann erinnerte er sich an den Kampf mit den Nomaden. Er blinzelte, versuchte, klarer zu sehen, und erkannte, dass es Abend war. Die Sonne ging gerade unter.
Aus den Schmerzen, die er verspürte, als er sich zu bewegen versuchte, schloss er, dass die Reiter eine ganze Weile lang auf ihn eingetreten hatten, nachdem er bewusstlos geworden war. Wahrscheinlich hatten sie auf diese Weise ihrer Missbilligung darüber Ausdruck verleihen wollen, wie er auf ihre Forderung, sich zu ergeben, reagiert hatte.
Es war wahrscheinlich gut, dass er keinen von ihnen getötet hatte, denn das hätte ihm sicher eine durchgeschnittene Kehle eingebracht. Kaspar begriff, dass er den Männern von Anfang an nicht hatte entrinnen können.
Mühsam richtete er sich auf, was nicht einfach war, denn seine Hände waren ihm mit Lederschnüren auf dem Rücken gefesselt. Aber er wusste auch, dass ein ausgebildeter Kämpfer wie er mehr Aussichten hatte, unter Menschen wie diesen zu überleben, als ein einfacher Landarbeiter oder Hausdiener.
Als er sich umsah, erkannte er, dass man ihn hinter einem Zelt angebunden hatte. Die Schnüre um seine Handgelenke waren fest, und sie waren ihrerseits mit einem dicken Seil an eine Zeltstange gebunden. Er konnte sich ein wenig bewegen, aber das Seil war nicht lang genug, dass er aufstehen konnte. Eine rasche Untersuchung der Zeltstange ergab, dass er sie vielleicht herausziehen konnte, aber damit hätte er das gesamte Zelt zum Einsturz gebracht und seine Gastgeber alarmiert.
Er trug dieselbe Kleidung wie zuvor. Er konzentrierte sich auf die Schmerzen in seinem Körper und kam zu dem Schluss, dass nichts gebrochen oder zu schwer verrenkt war.
Er setzte sich und dachte nach. Sein Instinkt hatte sich, was diese Leute anging, bisher als zutreffend erwiesen. Nach dem wenigen zu schließen, was er um das Zelt herum ausmachen konnte, war dies ein kleines Lager, das wahrscheinlich kaum mehr als den sechs Reitern und ihren Familien Unterschlupf bot. Aber er sah auch die angepflockten Pferde, und nach grober Schätzung gab es mindestens zwei oder drei Reittiere für jeden im Lager.
Auf der anderen Seite des Zelts hörte er leise Stimmen. Er strengte sich an, die fremde Sprache zu verstehen, denn das eine und andere Wort kam ihm bekannt vor.
Kaspar hatte ein Gespür für Fremdsprachen. Als Erbe des Throns seines Vaters hatte er alle Hochsprachen der Länder der Umgebung lernen müssen, also beherrschte er die Königssprache, die Sprache des Königreichs der Inseln, fließend und akzentfrei, ebenso wie jene Sprachen, die dem Olaskischen verwandt waren und wie Kaspars Muttersprache Varianten des Roldemischen waren. Er beherrschte auch die Hochsprache von Kesh perfekt und hatte sich Zeit genommen, ein wenig Queganisch zu lernen, das sich nach der Abspaltung des Königreichs Queg vom Kaiserreich Groß-Kesh vor zwei Jahrhunderten aus dem Keshianischen entwickelt hatte.
Auf seinen Reisen hatte er die Dialekte eines halben Dutzends von Regionen dieser Länder aufgeschnappt, und etwas an dem, was er gerade hörte, kam ihm vertraut vor. Er schloss die Augen und ließ die Gedanken schweifen, während er weiterhin das Gespräch belauschte.
Dann hörte er ein Wort: Ak-Káwa. Acqua! Der Akzent war ausgeprägt und die Betonung anders, aber das war das queganische Wort für »Wasser«! Sie redeten darüber, irgendwo unterwegs Rast zu machen, wo es Wasser gab. Er lauschte weiter und ließ die Wörter über sich hinwegtreiben, ohne allzu angestrengt zu versuchen, sie zu verstehen. Er gestattete seinen Ohren einfach, sich an die Rhythmen und Klänge, Muster und Töne zu gewöhnen.
Etwa eine Stunde saß er da und lauschte. Zunächst konnte er nur ein Wort von hundert erkennen, dann vielleicht eins von fünfzig. Als er etwa ein Wort aus einem Dutzend heraushörte, näherten sich Schritte, darum sackte er zusammen und stellte sich bewusstlos.
Er konnte die Schritte von zwei Menschen unterscheiden. Ein Mann sagte etwas. Kaspar hörte die Wörter »gut« und »stark«. Der zweite wandte etwas ein. Nach allem, was Kaspar begriff, war der eine der Männer der Meinung, man solle ihn auf der Stelle umbringen, weil er mehr Ärger machte, als er wert sei, und der andere widersprach und erklärte, der Gefangene sei stark und gut, wahrscheinlich beim Schwertkampf, denn das war die einzige Fähigkeit, die Kaspar demonstriert hatte, bevor er überwältigt worden war.
Kaspar musste sich beherrschen, um sich nicht zu rühren, als ein Nomade mit einem unsanften Tritt überprüfen wollte, ob der Gefangene wirklich noch bewusstlos war. Dann gingen die beiden Männer wieder.
Kaspar wartete, und als er sicher sein konnte, dass sie weit genug weg waren, wagte er einen Blick und spähte auf die Rücken der Männer, bevor sie um das Zelt herum verschwanden.
Er setzte sich wieder hin und bemühte sich, weiterhin zu lauschen, während er gleichzeitig begann, an seinen Fesseln zu zerren. Er durfte sich nur nicht zu sehr darauf konzentrieren, damit er es mitbekam, wenn sich jemand näherte. Er wusste, dass in dieser ersten Nacht seine Fluchtmöglichkeiten am besten waren, weil man ihn immer noch für bewusstlos hielt. Das war sein einziger Vorteil. Die Nomaden kannten die Umgebung wahrscheinlich sehr gut und waren erfahrene Fährtensucher.
Er würde nur dann entkommen können, wenn er sie überraschte. Kaspar war ein guter Jäger, und er wusste, wie schlaues Wild seinen Häschern entkam. Er brauchte mindestens eine Stunde Vorsprung, aber zuerst einmal musste er die Lederschnüre um seine Handgelenke loswerden.
Als Erstes prüfte er die Schnüre und musste feststellen, dass sie fest genug waren, um ihm wehzutun, wenn er versuchte, die Hände herauszuziehen. Er konnte sie nicht sehen, aber sie fühlten sich an wie Rohleder. Gelang es ihm, sie zu befeuchten, würden sie sich dehnen, und er würde sie vielleicht abstreifen können.
Nach einer Zeit vergeblicher Anstrengung wandte er die Aufmerksamkeit dem Teil des Seils zu, den er sehen konnte. Er wusste, dass er es nicht von der Stange losbinden konnte, ohne das ganze Zelt zum Einsturz zu bringen, aber ihm fiel nichts anderes ein. Er drehte sich erst in die eine, dann in die andere Richtung und kam zu dem Schluss, dass auch das mit auf dem Rücken gefesselten Händen unmöglich war.
Kaspar blieb still sitzen und wartete. Die Stunden zogen sich träge dahin, und allmählich wurde es im Lager ruhiger. Er hörte Schritte und stellte sich abermals bewusstlos, als jemand vorbeikam, um nach ihm zu sehen, bevor sich der Stamm schlafen legte.
Kaspar ließ Minuten vergehen, bis er sicher war, dass im Zelt alle schliefen. Dann setzte er sich wieder hin. Er blickte zum Himmel auf, wo vollkommen fremde Sterne blinkten. Wie die meisten Männer seines seefahrenden Volkes konnte er sich anhand der Sterne orientieren, sei es an Land oder auf dem Meer, aber über ihm befanden sich Konstellationen, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Er würde sich auf seine grundlegenden Orientierungsfähigkeiten verlassen müssen, bis er mit den Sternen hier vertraut war. Er wusste, wo die Sonne untergegangen war, denn er hatte sich die Stelle anhand des Felsens gemerkt. Und das bedeutete, dass er auch wusste, wo Norden war.
Wahrscheinlich lag Olasko irgendwo in nordöstlicher Richtung. Kaspar war gebildet genug, um zu wissen, wo sich der Kontinent Novindus in Bezug zu Olasko befand. Je nachdem, wohin der Magier ihn auf diesem Kontinent gebracht hatte, bestand seine beste Möglichkeit, wieder nach Olasko zu gelangen, darin, die Stadt am Schlangenfluss zu finden. Es gab so gut wie keine Handelsbeziehungen zwischen Novindus und den Ländern auf der anderen Seite der Welt, aber die wenigen Schiffe, die von einem Kontinent zum anderen fuhren, begannen ihre Reise in dieser Stadt. Von dort aus konnte er in die Endlose See gelangen und von dort aus nach Krondor. Wenn er sich erst im Königreich befand, konnte er wenn nötig sogar zu Fuß nach Hause gehen.
Er wusste, dass er es sehr wahrscheinlich nicht schaffen würde, aber was immer ihm zustoßen mochte, es war ihm lieber, wenn es geschah, während er versuchte, wieder nach Hause zu kommen.
Nach Hause, dachte er verbittert. Einen Tag zuvor war er noch zu Hause gewesen und hatte über sein Land geherrscht, aber dann hatte man ihn in seiner eigenen Zitadelle gefangen genommen, und er war von einem ehemaligen Diener besiegt worden, den er für tot gehalten hatte. Er hatte die Nacht in Ketten verbracht und über diese dramatische Wendung des Schicksals nachgedacht, und eigentlich hatte er erwartet, dass man ihn hängen würde.
Stattdessen hatte Talwin Falkner, sein ehemaliger Diener, ihn begnadigt, und man hatte ihn in dieses ferne Land verbannt. Kaspar war nicht sicher, was genau in den vergangenen Tagen geschehen war. Tatsächlich fragte er sich immer mehr, ob er in den vergangenen Jahren noch er selbst gewesen war.
Er hatte gehört, wie sich die Wachen vor seiner Zelle unterhielten, während er auf seine Hinrichtung gewartet hatte. Leso Varen, sein Berater und Hofmagier, war beim Kampf um die Zitadelle getötet worden. Der Magier war vor ein paar Jahren zu ihm gekommen und hatte Kaspar im Austausch gegen seinen Schutz große Macht versprochen. Seine Anwesenheit war zunächst nicht weiter störend gewesen, und er hatte tatsächlich hin und wieder nützliche Dienste geleistet.
Kaspar holte tief Luft und wandte seine Aufmerksamkeit wieder seinen Fluchtmöglichkeiten zu. Er würde später Zeit haben, über seine Vergangenheit nachzudenken, immer vorausgesetzt, er lebte lange genug, um eine Zukunft zu haben.
Er war ein breitschultriger Mann von ungewöhnlicher Kraft, aber das war nicht alles. Anders als viele Männer mit kräftigem Körperbau hatte er sich stets bemüht, beweglich zu bleiben. Nun atmete er aus, so gut er konnte, bog die Schultern nach vorn, zog die Knie fest gegen die Schultern, beugte den Kopf zwischen die Oberschenkel und zwang seine Füße über die gefesselten Handgelenke. Er konnte spüren, wie die Bänder in seinen Armen protestierten, als er sie so weit wie möglich streckte, aber es gelang ihm, die Hände nach vorn zu bringen.
Dabei hätte er allerdings beinahe das Zelt umgerissen. Schnell legte er sich hin, um die Spannung an Seil und Pflock zu verringern. Die Handfesseln bestanden tatsächlich aus Rohleder, also begann er, mit den Zähnen daran zu zerren. Mit Speichel befeuchtete er den einfachen Knoten so gut wie möglich und kaute darauf herum, bis er lockerer wurde. Lange Minuten nestelte er an den Schlingen des Knotens, dann öffneten sie sich plötzlich, und seine Hände waren frei.
Er bog die Finger und rieb sich die Handgelenke, bevor er vorsichtig aufstand. Er zwang sich, tief und gleichmäßig zu atmen, und schlich zur Vorderseite des Zelts. Als er um das Zelt herumspähte, entdeckte er einen einzigen Wachposten, der am anderen Ende des Lagers mit dem Rücken zum Feuer saß.
Kaspars Gedanken überschlugen sich. Jahre der Erfahrung hatten ihn eins gelehrt: Unentschlossenheit war schädlicher als falsche Entscheidungen. Er konnte versuchen, den Wachposten auszuschalten, und sich damit vielleicht mehrere Stunden Vorsprung verschaffen, bevor man ihm folgte, oder er konnte einfach davonschleichen und hoffen, dass der Mann nicht vor dem Morgen nach ihm sehen würde. Aber wie er sich auch entschied, er musste sofort handeln!
Ohne es auch nur zu bemerken, hatte er einen Schritt in Richtung des Wachpostens gemacht. Er verließ sich auf seine Instinkte: Der mögliche Vorteil war das Risiko wert. Der Wachposten summte leise vor sich hin, vielleicht um sich wach zu halten. Kaspar schlich leise weiter und näherte sich dem Mann von hinten.
Eine Veränderung im Licht, als Kaspar zwischen den Wachposten und das Feuer trat, ein leises Geräusch oder einfach nur Intuition sorgte dafür, dass sich der Nomade umdrehte. Kaspar schlug zu, so fest er konnte, und traf ihn hinter dem Ohr. Der Blick des Mannes wurde starr. Kaspar schlug ihm gegen das Kinn, der Wachposten kippte um, und Kaspar fing ihn auf.
Er wusste, dass seine Freiheit vielleicht nur noch in Augenblicken gemessen werden konnte, als er dem Mann das Schwert abnahm. Der Wachposten hatte kleinere Füße als Kaspar, also waren seine Stiefel nutzlos.
Er verfluchte den Soldaten, der ihm am Abend seiner Gefangennahme in der Zitadelle die Stiefel abgenommen hatte. Er konnte nicht barfuß fliehen. Er hatte keine Schwielen an den Füßen wie Menschen, die oft barfuß gingen, und er wusste zwar nicht viel über das Gelände, das ihm bevorstand, aber was er gesehen hatte, sagte ihm, dass es steinig und unangenehm werden würde.
Er erinnerte sich an ein paar Bäume an einem Hang nordöstlich des Lagers, aber er bezweifelte, dass er sich dort gut genug verbergen könnte. Andere Verstecke in der Nähe kannte er nicht; er hatte zwischen seiner Ankunft und dem Zusammenstoß mit den Männern, die ihn gefangen genommen hatten, keine Zeit gehabt, sich umzusehen. Er musste also unbedingt ein Paar Stiefel finden, die einigermaßen passten, damit er auf den felsigen Bergen klettern konnte, wo der Boden für Pferde schwierig war.
Einen Augenblick blieb er stehen, dann eilte er rasch zum größten Zelt. Das Schwert in der Hand, zog er vorsichtig die Zeltklappe zur Seite. Drinnen hörte er Schnarchen. Es klang, als schliefen hier zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Er konnte wenig erkennen, also wartete er, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Nach einem Moment entdeckte er links im Zelt eine dritte Person, der Größe nach ein Kind.
Kaspar sah ein Paar Stiefel neben einer kleinen Truhe, in der sich wohl die Schätze des Anführers befanden. Er bewegte sich mit einer katzenhaften Geschmeidigkeit, die für einen Mann seiner Größe ungewöhnlich war. Rasch griff er nach den Stiefeln, erkannte, dass sie groß genug waren, und bewegte sich rückwärts wieder zur Zeltklappe. Dann hielt er inne. Widerstrebende Bedürfnisse verwirrten ihn einen Moment. Er war beinahe sicher, dass man ihn wieder gefangen nehmen und diesmal vielleicht töten würde, es sei denn, er verfügte über einen Vorteil. Aber worin sollte der bestehen? Zu lange nachzudenken würde ihn wertvolle Zeit kosten, die er nie wieder würde einholen können und die zählen würde, wenn er versuchte, so weit wie möglich vom Lager fortzugelangen.
Unentschiedenheit gehörte nicht zu Kaspars Wesen. Er sah sich um und entdeckte die Waffen des Anführers dort, wo er sie vermutet hatte – ganz in der Nähe des Mannes, für den Fall, dass es Ärger geben sollte.
Er schlich an dem schlafenden Paar vorbei und griff nach dem Dolch des Mannes. Es war eine lange Waffe mit breiter Klinge, die nur für einen einzigen Zweck gedacht war: einem Mann aus der Nähe den Bauch aufzuschlitzen. Dieser Dolch hatte nichts Zierliches an sich, und er erinnerte Kaspar an die Klingen, die die Nomaden der Wüste von Jal-Pur von Kesh trugen. Er fragte sich, ob sie irgendwie mit diesem Volk verwandt waren. Die Sprache der Jal-Pur-Nomaden hatte allerdings nichts mit der von Kesh gemein, und die Sprache der Nomaden hier erinnerte ein wenig an das Queganische, einen Dialekt des Keshianischen.
Kaspar nahm die Klinge und schlich näher zur Zeltklappe. Er sah das Kind an. In dem trüben Licht konnte er nicht erkennen, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, denn das Haar war schulterlang, und das Kind hatte das Gesicht abgewandt. Mit einem raschen Stoß trieb Kaspar den Dolch in die Erde. Das leise Geräusch bewirkte, dass sich das Kind ein wenig bewegte, aber es wurde nicht wach.
Kaspar verließ das Zelt. Er sah sich rasch um und entdeckte, was er brauchte: einen gefüllten Wasserschlauch. Dann warf er einen sehnsüchtigen Blick zu den Pferden, aber er ging nicht zu ihnen. Mit einem Reittier wären seine Aussichten zu überleben größer gewesen, aber wenn er versuchte, eins der Pferde zu satteln, würde er sehr wahrscheinlich jemanden wecken, und wie immer seine Warnung im Zelt wirken mochte, der Diebstahl eines Pferdes würde sie zweifellos wieder ausgleichen.
Kaspar schlich aus dem Lager und auf die Bäume und Hügel dahinter zu. Was er vor seiner Gefangennahme gesehen hatte, wies darauf hin, dass es sich um felsiges Gelände handelte, und vielleicht würden ihm die Reiter auf so unwegsamem Boden nicht folgen. Vielleicht hatten sie anderswo Verpflichtungen, oder vielleicht würde Kaspars Botschaft sie innehalten lassen.
Denn falls der Anführer kein Narr war, würde er verstehen, was Kaspar getan hatte. Der Dolch neben dem Kind sagte: Ich hätte dich und deine Familie töten können, während ihr geschlafen habt, aber ich habe euch verschont. Lass mich jetzt also in Ruhe.
Kaspar hoffte, dass der Mann es so verstehen würde.
Im Morgengrauen war er bereits hoch oben in den Hügeln und kletterte über geborstene Felsen. Der kleine Hain, den er am Vortag gesehen hatte, bot so gut wie keine Deckung, also hoffte er, weiter oben ein Versteck zu finden.
Er konnte immer noch das Lager unten sehen, obwohl die Zelte mittlerweile wie winzige Flecken am Boden des weiten Tals aussahen. Von hier oben wurde deutlich, dass das Tal das Ende einer weiten Ebene war, auf beiden Seiten flankiert von zerklüfteten Hügeln. Auf der anderen Seite des Tals erhob sich in der Ferne eine gewaltige Gebirgskette. Schneebedeckte Gipfel ließen erahnen, dass diese Berge nur schwer zu überqueren waren. Der General in Kaspar bewunderte, wie gut dieser Ort zu verteidigen wäre, würde jemand dort, wo sich das Lager der Nomaden befand, eine Festung errichten. Als er sich weiter umsah, erkannte er jedoch, dass es hier nichts zu beschützen gab.
Nirgendwo im Tal war Wasser zu entdecken. Die Bäume, an denen er vorbeigekommen war, waren von einer Art, die er nicht kannte, dürr und mit zäher schwarzer Rinde und Dornen. Sie brauchten offenbar nur wenig Wasser. Wohin er auch blickte, sah er Steine und Staub. Das Tal und wie es sich durch die Felsen schnitt sagten ihm, dass hier einmal ein Fluss hindurchgeflossen war. Eine Klimaveränderung hatte den Fluss vermutlich austrocknen lassen, und nun stellte sein Bett nur noch einen schnellen Weg für Reiter zwischen einem Ort und einem anderen dar, die Kaspar beide unbekannt waren.
Geräusche aus der Ferne sagten ihm, dass man seine Flucht entdeckt hatte, und er kletterte weiter, obwohl ihm schwindlig war und er sich schwach fühlte. Er hatte mindestens seit zwei Tagen nichts mehr gegessen, je nachdem, wie er die Zeit berechnete. Man hatte ihn am Abend in Ketten vor Talwin Falkner und seine Verbündeten gezerrt und ihn sofort hierhertransportiert, aber hier war es Morgen gewesen. Er befand sich offenbar tatsächlich auf der anderen Seite der Welt.
Er brauchte unbedingt Essen und Ruhe. In einem Beutel, der an dem Wasserschlauch hing, hatte er ein wenig Trockenfleisch und Fladenbrot gefunden, und er plante, alles zu verschlingen, wenn die Zeit es zuließ, aber im Augenblick war es viel wichtiger, den Abstand zwischen sich und den Nomaden zu vergrößern.
Er erreichte einen Kamm, über den sich ein schmaler Pfad wand. Also zog er sich dort hinauf, dann drehte er sich um und warf einen Blick zum weit entfernten Lager. Zelte wurden abgebrochen, und die winzigen Flecken, die er für Menschen und Pferde hielt, schienen sich nicht allzu schnell zu bewegen. Nein, es gab keine Anzeichen, dass ihn jemand verfolgte.
Kaspar ließ sich einen Moment Zeit, um zu Atem zu kommen, und betrachtete den Pfad, der breiter als ein Wildpfad war. Kaspar kniete nieder und sah ihn sich näher an. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, die Erde festzustampfen.
Kaspar folgte dem ansteigenden Weg, und bald schon wurde deutlich, dass die Felsen rechts von ihm mit Werkzeugen bearbeitet worden waren. Diese Felsen schützten auch zum Teil vor der Sonne, also setzte er sich und aß das Fladenbrot und ein wenig Trockenfleisch, trank etwa ein Drittel des Wassers in dem Schlauch und ruhte sich aus.
Es schien, als wäre er tatsächlich entkommen und als hätte der Anführer der Nomaden seine Botschaft verstanden. Keine Reiter schwärmten aus, um nach ihm zu suchen, keine Spurenleser kletterten unter ihm in die Hügel. Er war frei.
Die Luft war trocken. Kaspar versuchte, sich anhand der aufgehenden Sonne zu orientieren. Der Pfad, auf dem er sich befand, musste einmal eine Militärstraße gewesen sein, die aus irgendeinem Grund nicht mehr benutzt wurde. Das felsige, karge Land in der Nähe bot kaum einen Grund, über diese Region herrschen zu wollen. Vielleicht war der Weg vor langer Zeit von einer Nation angelegt worden, die das Land nun nicht mehr beanspruchte.
Er wusste, dass es am Tag schrecklich heiß werden würde, also suchte er nach einer Zuflucht. In unmittelbarer Nähe war nichts Geeignetes zu entdecken. Er beschloss, eine Weile auf der alten Militärstraße weiterzuziehen, vor allem, da man die Umgebung von dort aus gut im Auge behalten konnte. Er gestattete sich noch einen großen Schluck Wasser, dann verschloss er den Schlauch wieder, denn schließlich hatte er keine Ahnung, wann er neues Wasser finden würde.
Die Gesprächsfetzen, die er am Abend zuvor aufgefangen hatte, ließen darauf schließen, dass Wasser für die Nomaden ein Problem war. Er vermutete, dass sie zu einer neuen Wasserstelle zogen, also beschloss er, einen Weg einzuschlagen, der parallel zu dem ihren verlief.
Eine Stunde verging, und er bemerkte, dass die Entfernung zwischen ihm und den Nomaden wuchs. Sie ließen ihre Pferde im Schritt gehen, aber sie bewegten sich im Flachland, und er war auf zerklüfteten Felsen unterwegs. Die Straße war hin und wieder ein paar Dutzend Schritte weit flach, dann wurde sie unterbrochen von Rissen, weil sich der Hang darunter verschoben hatte. Einmal musste Kaspar ein halbes Dutzend Schritte nach unten klettern, um einen vollkommen eingestürzten Bereich zu umgehen.
Gegen Mittag war er erschöpft. Er zog sein Hemd aus und band es sich als behelfsmäßige Kopfbedeckung um. Er wusste nicht, woher, aber er erinnerte sich vage, dass man ihm in seiner Kindheit einmal erzählt hatte, der menschliche Körper könne die Sonne länger ertragen, solange der Kopf Schatten hatte.
Er trank noch einen Schluck Wasser und kaute den Rest Trockenfleisch. Es war zäh und salzig und hatte kaum Fett. Er widerstand der Versuchung, mehr zu trinken, und beschloss, sich erst einen weiteren Schluck zu erlauben, wenn er gegessen hatte.
Es dauerte eine Weile, das Fleisch zu kauen, aber schließlich war er fertig und trank einen letzten Schluck. Dann sah er sich um.
Kaspar war ein Jäger. Vielleicht war er nicht so gut wie Tal Falkner, aber er kannte sich in der Wildnis genügend aus, um zu wissen, dass seine Situation verzweifelt war. Es schien hier nur selten zu regnen, denn außer den zähen Bäumen, die sich hin und wieder an die Felsen klammerten, war keinerlei Vegetation zu entdecken. Zwischen den Steinen, auf denen er saß, drängte sich kein Gras nach oben, und als er einen Stein umdrehte, gab es auf der Schattenseite auch kein Moos und keine Flechten. Dieses Land war die meiste Zeit trocken.
Er folgte mit dem Blick dem Kamm, auf dem er sich bewegte, und sah, dass er nach Süden verlief. Im Osten gab es nichts als eine rissige Ebene und im Westen das trockene Tal. Er beschloss, dem Weg weiterhin zu folgen und nach etwas Ausschau zu halten, das ihn am Leben erhalten konnte. Die Nomaden waren nach Süden unterwegs, und er wusste, dass sie irgendwann Wasser erreichen würden. Und um zu überleben, brauchte er Wasser.
Denn darum ging es hier: überleben. Kaspar hatte im Augenblick so manchen Ehrgeiz: Er wollte nach Opardum zurückkehren und sich den Thron von Olasko zurückerobern, und er wollte sich an dem verräterischen Hauptmann Quentin Havrevulen und an Talwin Falkner rächen, die einmal zu seinem Haushalt gehört hatten.
Als er sich wieder auf den Weg machte, kam ihm ein Gedanke: Tatsächlich konnte er die beiden Männer wohl kaum als Verräter betrachten, denn er selbst hatte sie als Gefangene auf die Insel geschickt, die als Festung der Verzweiflung bekannt war.
Aber wie auch immer, er würde sie beide umbringen!
Er würde Leute finden müssen, die immer noch treu zu ihm standen, und seine Burg zurückerobern. Wahrscheinlich hatte Talwin seine Schwester Natalia gezwungen, ihn zu heiraten, um Anspruch auf den Thron erheben zu können. Und Havrevulen würde mit Sicherheit die Armee kommandieren. Aber Kaspar würde Männer um sich scharen, die wussten, wer der rechtmäßige Herrscher von Olasko war, und er würde sie gut belohnen, sobald er wieder an der Macht war.
Seine Gedanken überschlugen sich, und er entwickelte einen Plan nach dem anderen, während er weiter die Straße entlangtrottete. Ganz gleich, für welchen Plan er sich schließlich entscheiden würde, zunächst musste er mit einigen sehr naheliegenden Hindernissen zurechtkommen, vor allem damit, dass er sich auf der falschen Seite der Welt befand. Das bedeutete, er brauchte ein Schiff und eine Besatzung, und dafür wiederum würde er Gold benötigen. Und um das zu erlangen, musste er zivilisierte Ansiedlungen finden oder was immer auf diesem Kontinent als Zivilisation durchging. Und um Menschen zu finden, musste er zunächst einmal überleben.
Er sah sich um, als die Sonne ihren Höchststand erreichte, und kam zu dem Schluss, dass es momentan recht unwahrscheinlich war, dass er überlebte. Nichts regte sich, wohin er auch blickte, wenn man einmal von der kleinen Staubwolke absah, die die Nomaden hinterließen.
Dennoch, dachte er, wenn er nun stehen bliebe, würde er ganz bestimmt sterben, also würde er sich weiterbewegen, solange er noch Kraft hatte.
Er marschierte weiter.
Überleben
Kaspar wusste, dass er starb.
Er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb, als er unter einem Felsüberhang Schutz vor der Nachmittagssonne suchte. Er war jetzt drei Tage unterwegs, und am Morgen dieses Tages hatte er das letzte Wasser getrunken. Ihm war schwindlig, und er war vom Weg weggetaumelt, um Schutz vor der Hitze zu suchen. Er wusste, wenn er bis zum Abend kein Wasser fand, würde er wahrscheinlich am nächsten Morgen nicht mehr erwachen. Seine Lippen waren aufgerissen, und seine Nase und die Wangen schälten sich vom Sonnenbrand.
Er legte sich auf den Rücken und ignorierte die Schmerzen von den Brandblasen, als seine Schultern die Steine berührten. Er war zu müde, um sich noch an Schmerzen zu stören, und außerdem sagten sie ihm, dass er immer noch lebte. Er würde warten, bis die Sonne tiefer gesunken war, und dann hinunter ins flache Land steigen. Die Landschaft war trostlos: geborstene Felsen und ausgetrockneter Boden in allen Richtungen. Er erkannte, dass der Magier, der ihn hierhergeschickt hatte, ihm wenig Aussichten zum Überleben gegönnt hatte. Das hier war eine Wüste, selbst wenn es die wogenden Sanddünen nicht gab, die man normalerweise mit diesem Begriff in Zusammenhang brachte.
Die wenigen Bäume, auf die er stieß, waren leblos und vertrocknet, und selbst an der Unterseite großer Steine befand sich keine Spur von Feuchtigkeit. Einer von Kaspars Lehrern hatte ihm vor vielen Jahren gesagt, dass man unter der Oberfläche von Wüsten Wasser finden konnte, aber Kaspar war sicher, dass das in solcher Höhe unmöglich war. Falls es hier vor langer Zeit einmal Bäche gegeben hatte, dann war ihr Wasser längst verschwunden.
Kaspar hatte noch nie einen so trostlosen Ort gesehen. Die große Sandwüste von Jal-Pur im Norden von Kesh war ihm exotisch vorgekommen, ein Ort stets wechselnder Horizonte, ein Meer aus Sand. Er war als Junge mit seinem Vater und einem gewaltigen Gefolge von Dienern des kaiserlichen Hofes von Kesh dort gewesen, und sie hatten ein ganzes Dorf aus bunten Zelten und bequemen Pavillons mitgeführt. Als sein Vater die legendären Sandeidechsen von Jal-Pur jagte, waren stets Diener mit erfrischenden Getränken in der Nähe gewesen – Wasser mit Kräutern oder Obstsäfte, kühl gehalten in Kisten voller Schnee aus den Bergen. Jeden Abend hatte es ein königliches Festessen gegeben mit kaltem Bier und gewürztem Wein.
Schon an diese Getränke zu denken verursachte Kaspar beinahe körperlichen Schmerz. Er richtete sich auf und wandte seine fiebrigen Gedanken wieder der unmittelbaren Umgebung zu.
Es gab Farben hier, aber nichts, was angenehm anzusehen gewesen wäre, nur harsches Ocker, schmutziges Gelb, das Rot von verrostetem Eisen und gräuliches Braun. Alles war mit Staub überzogen, und es gab nicht die geringste Spur von Grün oder Blau, die auf Wasser hingewiesen hätte, obwohl er einen Schimmer im Nordwesten bemerkte, der die Reflexion von Wasser in der heißen Luft hätte sein können.
Er hatte nur einmal in der trockenen Zone von Kesh gejagt, aber er erinnerte sich an alles, was man ihm gesagt hatte. Die Keshianer stammten von den Löwenjägern ab, die einmal die Savannen durchstreift hatten, und sie pflegten ihre Traditionen immer noch. Der alte Führer, ein Mann namens Kulmaki, hatte Kaspar geraten: »Haltet bei Sonnenuntergang nach Vögeln Ausschau, junger Herr, denn sie werden zum Wasser fliegen.« In den letzten zwei Tagen hatte Kaspar vergeblich den Himmel abgesucht und nicht einen einzigen Vogel erblickt.
Er ließ sich wieder nach hinten sinken, und während er erschöpft und durstig dalag, verlor er immer wieder für kurze Zeit das Bewusstsein, wobei sich in seinem Kopf Fieberträume, Erinnerungen und Illusionen abwechselten.
Er erinnerte sich an einen Tag in seiner Kindheit, als sein Vater ihn mit auf die Jagd genommen hatte – das erste Mal, dass man ihm gestattet hatte, die Männer zu begleiten. Sie hatten Eber jagen wollen, und Kaspar war kaum stark genug gewesen, den Eberspeer mit seiner schweren Spitze zu tragen. Er war ganz in der Nähe seines Vaters gewesen, als dieser die beiden ersten Eber erlegte, aber als er seinem eigenen Wildschwein gegenüberstand, hatte er gezögert, und das Tier war der breiten Spitze der Waffe ausgewichen. Kaspar hatte mit einem Seitenblick die Missbilligung seines Vaters erkannt und war dem Eber ins Unterholz nachgejagt, ohne sich um die Warnungen der anderen zu kümmern.
Bevor die Männer ihn einholen konnten, hatte Kaspar den Eber in ein Dickicht getrieben, wo das Tier nicht mehr fliehen konnte. Kaspar machte so gut wie alles falsch, aber als sein Vater und die anderen eintrafen, stand er triumphierend neben dem noch zuckenden Tier und ignorierte die Risswunde in seinem Bein. Der oberste Jäger tötete das Tier rasch mit einem Pfeil, und Kaspars Vater beeilte sich, das Bein seines Sohnes zu verbinden.
Der Stolz, den Kaspar in den Augen seines Vaters sah, stand im Widerspruch zu den mahnenden Worten und hatte den Jungen für sein ganzes Leben geprägt. Hab keine Angst. Er wusste, ganz gleich, was geschah, er musste seine Entscheidungen ohne jede Furcht treffen, oder er würde Fehler begehen.
Kaspar erinnerte sich an den Tag, als der Mantel des Regenten um seine Schultern gelegt wurde. Er hatte still dagestanden und die Hand seiner kleinen Schwester gehalten, als die Priester den Scheiterhaufen seines Vaters angezündet hatten. Als Rauch und Asche zum Himmel aufstiegen, hatte der junge Herzog von Olasko erneut geschworen, stets furchtlos zu sein und sein Volk zu schützen, als stünde er wieder diesem Eber gegenüber.
Irgendwie war alles schiefgegangen. Er hatte nur versucht, Olasko einen angemessenen Platz an der Sonne zu verschaffen, aber dieses Bemühen hatte sich in nackten Ehrgeiz verwandelt, und Kaspar war schließlich zu der Überzeugung gelangt, er müsse König von Roldem werden. Als Achter in der Thronfolge hätte es nur ein paar Unfälle und das vorzeitige Dahinscheiden der anderen Kandidaten gebraucht, und er hätte die unterschiedlichen Nationen des Ostens unter dem Banner von Roldem vereinen können.
Als er nun dalag und darüber nachdachte, erschien sein Vater plötzlich vor ihm, und einen Augenblick fragte sich Kaspar, ob er vielleicht schon gestorben und sein Vater gekommen war, um ihn in die Halle des Todes zu geleiten, wo Lims-Kragma das Gewicht seines Lebens auf die Waage legen und entscheiden würde, wo sein Platz bei der nächsten Drehung des Rades sein sollte.
»Habe ich dir nicht gesagt, du sollst vorsichtig sein?«
Kaspar versuchte zu sprechen, aber es kam nur ein krächzendes Flüstern dabei heraus. »Was …?«
»Von allen Schwächen, unter denen ein Mann leiden kann, ist Eitelkeit die übelste. Eitelkeit kann selbst einen weisen Mann zu einem Dummkopf machen.«
Kaspar setzte sich hin, und sein Vater war verschwunden.
In seinem Fieberwahn hatte er keine Ahnung, was diese Vision zu bedeuten hatte, aber irgendetwas sagte ihm, dass es wichtig war.
Er wusste, er würde nicht bis zum Sonnenuntergang warten können, sein Leben dauerte vielleicht nur noch Minuten. Er kämpfte sich auf die Beine, stolperte hinunter ins Flachland, wo Hitzeschlieren über den grauen und ockerfarbenen Felsen hingen, taumelte über die geborstenen Überreste von Steinen, die einmal von Wasser glatt geschliffen worden waren.
Wasser.
Er sah Dinge, die nicht da waren. Er wusste, dass sein Vater tot war, aber nun schien sein Geist vor ihm herzumarschieren.
»Du hast dich zu sehr auf die verlassen, die dir gesagt haben, was du hören wolltest, und jene ignoriert, die versuchten, dir die Wahrheit zu sagen.«
»Aber ich war eine Kraft, die alle fürchteten!«, wollte Kaspar schreien, doch die Worte kamen nur als unartikuliertes Grunzen aus seiner Kehle.
»Angst ist nicht das einzige Werkzeug von Diplomatie und Herrschaft, mein Sohn. Loyalität entsteht aus Vertrauen.«
»Vertrauen!«, schrie Kaspar, seine Stimme ein abgerissenes Keuchen, und das Wort schien seinen pergamenttrockenen Hals entlangzukratzen. »Vertraue niemandem!« Er blieb stehen und wäre beinahe vornübergefallen, als er einen anklagenden Zeigefinger auf seinen Vater richtete. »Das hast du mir beigebracht!«
»Ich hatte mich geirrt«, sagte die Erscheinung traurig und verschwand.
Kaspar sah sich um und erkannte, dass er in die Richtung taumelte, wo er die Reflexion des Schimmerns bemerkt hatte. Er stolperte weiter, setzte einen Fuß vor den anderen.
Seine Gedanken wanderten weiter, und er sah Ereignisse aus seiner Kindheit und dann das Ende seiner Herrschaft. Eine junge Frau, an deren Namen er sich nicht erinnern konnte, erschien, ging eine Minute langsam vor ihm her und verschwand wieder. Wer war sie? Dann erinnerte er sich. Die Tochter eines Kaufmanns, ein Mädchen, das ihm gefallen hatte, aber sein Vater hatte ihm verboten, sie zu sehen. »Du wirst aus Staatsgründen heiraten«, hatte er seinem Sohn gesagt. »Schlaf mit ihr, wenn du unbedingt willst, aber vergiss diese dummen Gedanken an Liebe.«
Das Mädchen hatte einen anderen geheiratet.
Hätte er sich doch nur an ihren Namen erinnern können!
Er stolperte weiter, fiel mehrmals auf die Knie und kam durch reine Willenskraft wieder auf die Beine. Minuten, Stunden oder Tage vergingen. Seine Gedanken drehten sich um sich selbst, als er spürte, dass seine Lebenskraft schwand.
Er blinzelte und bemerkte, dass es Abend wurde und er sich nun in einer Rinne im ausgetrockneten Boden befand und abwärtstaumelte.
Dann hörte er es.
Ein Vogelruf. Kaum mehr als das Piepsen eines Spatzes, aber ein Vogelruf.
Kaspar zwang sich aus seiner Lethargie und blinzelte, dann hörte er den Ruf noch einmal. Er neigte den Kopf zur Seite und lauschte, und der Ruf erklang zum dritten Mal.
Er taumelte auf den Laut zu und achtete nicht auf den unsicheren Boden. Er fiel, konnte sich aber an den Wänden der tiefer werdenden Rinne festhalten.
Raues Gras tauchte unter seinen Füßen auf, und er konzentrierte sich auf einen einzigen Gedanken: Wenn es hier Gras gab, musste der Boden Feuchtigkeit haben. Er sah sich um und konnte keine Spur von Wasser entdecken, bemerkte aber ein paar Bäume weiter vorn. Er trieb sich an, bis er nicht mehr konnte, dann fiel er auf die Knie und schließlich auf den Bauch.
Er lag keuchend da, das Gesicht im Gras, und er spürte die Halme an seinem Gesicht. Mühsam riss er das Gras aus und krallte die Finger in den Boden. Dort spürte er Feuchtigkeit. Mit dem letzten Rest seiner Willenskraft kam er auf die Knie und zog das Schwert, das er dem Wachposten abgenommen hatte. Aus irgendeinem Grund musste er daran denken, dass sein Schwertmeister ihn verprügelt hätte, hätte er gesehen, dass er eine Klinge auf solche Weise benutzte, aber dann ignorierte er diese alberne Idee und stieß das Schwert in den Boden. Er grub. Er benutzte die Klinge, wie ein Gärtner einen Spaten benutzt hätte, und grub.
Er grub und wühlte mit letzter Kraft und zwang mit beinahe hysterischer Entschlossenheit ein Loch in den Boden, fegte die Erde beiseite wie ein Dachs, der eine Höhle gräbt. Dann roch er es. Und dem Geruch nach Feuchtigkeit folgte eine Spur glitzernder Nässe an der Klinge.
Er stieß die Hand in das Loch und spürte Schlamm, warf das Schwert beiseite und grub mit bloßen Händen weiter, und schließlich stieß er auf Wasser. Es war schlammig und schmeckte nach Lehm, aber er konnte sich auf den Bauch legen und eine jämmerliche Handvoll schöpfen. Er füllte die leicht gebogene Hand, hob sie an die ausgetrockneten Lippen und trank. Er rieb sich auch ein wenig Wasser auf Hals und Gesicht, aber vor allem hob er wieder und wieder die Hand an den Mund und trank. Er hatte keine Ahnung, wie oft er das tat, aber schließlich brach er zusammen, der Kopf sackte ihm auf den Boden, er verdrehte die Augen und verlor das Bewusstsein.
Der Vogel kratzte an den Samenkörnern, als spüre er die nahe Gefahr. Kaspar lag reglos einige Fuß entfernt in einer Senke, verborgen hinter ein paar Dornbüschen, als der Vogel – eine Art Wildhuhn, die er nicht kannte – nach den Körnern pickte, sie dann in den Schnabel nahm und schluckte.
Kaspar war am Morgen genügend erholt aufgewacht, um sich in den Schatten zu schleppen, den er nur kurz verließ, um mehr aus seinem behelfsmäßigen Brunnen zu trinken. Jedes Mal gab es weniger Wasser, und er wusste, dass sein kleines Reservoir bald erschöpft sein würde. Am Nachmittag hatte er beschlossen, weiter die Rinne entlangzugehen und zu sehen, wohin sie führte, und einen neuen Platz zu finden, an dem er nach Wasser graben konnte.
Als die Sonne unterging, fand er den Baum. Er wusste nicht, was für ein Baum es war, aber er trug Früchte mit zäher Haut. Kaspar riss mehrere davon ab und entdeckte, dass das Fruchtfleisch essbar war, wenn man die Schale abschnitt. Es war mehlig und zäh, und der Geschmack war nichts für einen verwöhnten Gaumen, aber Kaspar war verzweifelt. Er aß zunächst nur ein paar Bissen, obwohl er schrecklichen Hunger hatte, und wartete.
Die Früchte schienen nicht giftig zu sein. Er aß mehrere, bevor die Krämpfe begannen. Die Früchte waren vielleicht nicht giftig, aber schwer zu verdauen. Oder vielleicht riefen auch drei Tage ohne Essen diese Reaktion seines Magens hervor.
Kaspar hatte immer einen gesunden Appetit gehabt und nie Hunger gelitten; das Schlimmste war schon gewesen, wegen einer Jagd oder dem Segeln vor der Küste eine Mahlzeit ausfallen zu lassen.
Der Vogel kam näher.
Kaspar hatte die Samenkörner so ausgelegt, dass sie zu einer Schlinge führten, die er aus dem wenigen hergestellt hatte, was zur Hand war. Mühsam hatte er zähe Fasern aus der Knolle eines seltsam aussehenden Kaktus verflochten; das hatte er von dem Führer aus Kesh gelernt. Er hatte das Ende der Knospe abgerissen und fest daran gezogen, was zu einer Spitze geführt hatte, an der eine lange Faser hing. »Nadel und Faden von Mutter Natur«, hatte der Führer gesagt. Nach längerer Anstrengung war es Kaspar gelungen, eine Schnur herzustellen, die doppelt so lang war wie sein Arm. Seine Hände und Arme waren mit Schnitt- und Stichwunden übersät – Zeugnisse seiner Entschlossenheit, eine Falle aus den dornigen Zweigen der hiesigen Pflanzen zu basteln.
Kaspar brauchte seine ganze Willenskraft, um reglos sitzen zu bleiben, als sich der Vogel seiner Schlinge näherte. Er hatte bereits ein kleines Feuer entzündet, das nun abgedeckt war und darauf wartete, wieder angefacht zu werden, und bei dem Gedanken an gebratenes Wildgeflügel lief ihm das Wasser im Mund zusammen.
Der Vogel ignorierte ihn und kümmerte sich weiter um das Samenkorn, an dem er gerade pickte, und versuchte, die feste Hülse aufzubrechen und an den weicheren Kern zu gelangen. Dann war er fertig mit dem Korn und trippelte zum nächsten. Einen Augenblick lang zögerte Kaspar, und Zweifel überfielen ihn. Er wurde von beinahe überwältigender Angst erfasst, dass der Vogel irgendwie entkommen und er selbst an diesem einsamen Ort verhungern würde.
Der Vogel warf das Korn in die Luft, und es landete weit genug von der Stelle entfernt, an der Kaspar die Schlinge ausgelegt hatte, sodass dieser fast sicher war, seine Beute würde entkommen. Dennoch, als er an der Schnur zog, schnappte die Falle über dem Vogel zu.
Der Vogel flatterte und krächzte und versuchte, aus dem dornigen Käfig zu entkommen. Kaspar stach sich mehrmals an den spitzen Dornen, als er den kleinen Käfig hob, um den Vogel darunter hervorzuholen.
Er drehte dem Tier rasch den Hals um, und schon auf dem Weg zum Feuer begann er, den Vogel zu rupfen. Das Tier mit der Schwertspitze auszunehmen war eine knifflige Angelegenheit. Er wünschte sich, er hätte den Dolch behalten, statt mit ihm dem Nomadenanführer eine Warnung zu hinterlassen.
Schließlich steckte der Vogel auf einem Spieß, den Kaspar über dem Feuer drehte. Er konnte es kaum erwarten, dass das Fleisch gebraten war. Während die Minuten vergingen, zog sich sein Magen vor Hunger immer wieder zusammen.
Kaspar hatte sich sein Leben lang um Selbstdisziplin bemüht, aber diesen Vogel nicht halb roh hinunterzuschlingen war die schwerste Prüfung, der er sich je unterzogen hatte. Allzu schnell war er fertig, hatte jede Fleischfaser und das bisschen Fett an dem mageren Tier verschlungen. Es war die beste Mahlzeit, an die er sich erinnern konnte, aber sie hatte seinen Appetit nur noch größer werden lassen.
Er stand auf und sah sich um, in der verzweifelten Hoffnung, einen weiteren Vogel zu entdecken, der nur darauf wartete, gefangen und gegessen zu werden.
Und da sah er den Jungen!
Das Kind schien nicht älter als sieben oder acht Jahre zu sein. Es trug Kleidung aus grob gewebtem Stoff und Sandalen, beides mit Staub bedeckt. Es war ein ausgesprochen hübscher Junge mit sehr ernster Miene, dunkelblond, und er betrachtete Kaspar mit großen hellblauen Augen.
Kaspar regte sich nicht, und nach einem Augenblick, der ihm minutenlang vorkam, drehte sich der Junge um und lief davon.
Kaspar folgte ihm beinahe sofort, aber er war schwach vor Hunger und Anstrengung. Das Einzige, was ihn noch antrieb, war die Angst, dass der Junge seinen Vater oder die Männer aus seinem Dorf alarmieren würde, und Kaspar wusste, dass er zu schwach war, um sich gegen mehr als einen Mann wehren zu können.
Er bemühte sich, den Jungen wenigstens im Auge zu behalten, aber schon bald war das Kind in einer Rinne hinter ein paar Felsen verschwunden. Kaspar folgte ihm, so gut er konnte, aber nach ein paar Minuten Klettern in der Rinne, in der der Junge verschwunden war, musste er stehen bleiben, denn ihm wurde schwindlig. Sein Magen knurrte, und er rülpste, als er sich hinsetzte. Er tätschelte sich den Bauch, und in einem Augenblick der Heiterkeit lachte er bei dem Gedanken daran, was für einen Anblick er bot. Es war nur sechs oder sieben Tage her, seit man ihn in seiner Zitadelle in Olasko gefangen genommen hatte, aber er konnte bereits seine Rippen spüren. Der Hunger hatte seinen Preis gefordert.
Er zwang sich, ruhig zu bleiben, dann stand er auf und sah sich um. Er war für einen Adligen aus den östlichen Königreichen ein sehr guter Fährtenleser. Kaspar mochte sich auf dies oder jenes zu viel einbilden, aber seine Fähigkeiten als Jäger und Spurenleser waren tatsächlich außergewöhnlich.
Er sah Kratzspuren an den Steinen, und als er an dieser Stelle nach oben kletterte, fand er den Weg.
Wie die verlassene Straße war auch dies ein alter Weg, der vor langer Zeit für Karren oder Wagen gebaut worden war, aber nun nur von Tieren und ein paar Menschen benutzt wurde. Er sah die Spuren des Jungen, die von ihm wegführten, und folgte ihnen.
Kaspar fand den Gedanken amüsant, dass nur ein einziger Adliger, den er kannte, es mit ihm als Jäger aufnehmen konnte: Talwin Falkner, der Mann, der ihn besiegt und ihm alles genommen hatte, was ihm wichtig gewesen war. Kaspar blieb stehen und hielt den Atem an. Etwas stimmte nicht. Ihm war schwindlig, und er konnte sich nicht konzentrieren. Diese paar Bissen Obst und der kleine Vogel hatten gerade eben genügt, ihn am Leben zu halten. Seine Gedanken schweiften ab, und das störte ihn ebenso wie der andauernde Hunger und der Dreck.
Er schüttelte den Kopf, um wieder klar denken zu können, dann ging er weiter. Er versuchte, sich zu konzentrieren, versuchte, aufmerksam zu sein, und musste wieder an Talwin Falkner denken. Natürlich hatte Tal das Recht gehabt, Kaspar anzugreifen, denn Kaspar hatte ihn verraten. Kaspar hatte bemerkt, dass sich seine Schwester immer mehr zu dem jungen Adligen aus dem Königreich der Inseln hingezogen gefühlt hatte. Er selbst hatte Falkner durchaus gemocht und seine Fähigkeiten mit dem Schwert und als Jäger bewundert.
Kaspar hielt abermals inne. Nun konnte er sich kaum mehr erinnern, wieso er sich entschlossen hatte, Falkner bei seinem Plan, Herzog Rodoski von Roldem zu töten, zum Köder zu machen. Er hatte es damals für eine gute Idee gehalten, aber nun fragte er sich, wie er zu diesem Schluss gekommen war. Falkner war ein fähiger Diener gewesen und hatte außerdem noch diesen schlauen alten Attentäter Amafi mitgebracht. Zusammen hatten sie mehr als einmal ihren Wert unter Beweis gestellt. Und dennoch hatte er sich entschieden, Falkner die Schuld für den Mordversuch an Rodoski tragen zu lassen.
Kaspar schüttelte den Kopf. Seit er Olasko verlassen hatte, hatte er mehrmals das Gefühl, dass sich etwas in ihm veränderte, etwas, das nicht nur mit seiner verzweifelten Situation in diesem trostlosen Land zusammenhing. Nach einer Weile fiel ihm ein, dass es sein Freund Leso Varen gewesen war, der ihm nahegelegt hatte, Tal Falkner könne gefährlich werden.
Kaspar blinzelte und erkannte, dass seine Gedanken erneut abschweiften. Er versuchte, sich wieder darauf zu konzentrieren, den Jungen zu finden, bevor dieser Alarm schlagen konnte. In der Nähe gab es keine Spur von Ansiedlungen, also nahm Kaspar an, dass der Junge recht weit von zu Hause weg war. Er konzentrierte sich auf die Spuren, folgte ihnen und wurde schneller, als ihm klar wurde, dass Eile geboten war.
Die Zeit verging, und die Sonne zog weiter über den Himmel, und nachdem Kaspars Einschätzung nach etwa eine halbe Stunde vergangen war, roch er den Rauch. Der Weg hatte ihn in eine Senke geführt, aber nun zog sich das Gelände wieder nach oben, und als er dem Weg um eine hohe Felsformation folgte, sah er einen Bauernhof vor sich.
Es gab einen Pferch mit zwei Ziegen, und weiter entfernt waren Rinder zu sehen, eine seltsame Rasse mit langen, weit abstehenden Hörnern und weißem Fell mit braunen Flecken. Sie standen auf einer grünen Weide und fraßen Gras.
Hinter einem niedrigen Gebäude aus Schlammziegeln mit einem Strohdach wiegte die Ernte im Wind. Mais, dachte Kaspar, war sich aber nicht vollkommen sicher. Und vor der Hütte befand sich ein Brunnen!
Er eilte darauf zu und zog einen Eimer am Seil nach oben. Das Wasser war klar und kühl, und er trank sich satt.
Als er schließlich den Eimer wieder ins Wasser fallen ließ, sah er eine Frau in der Tür des Hauses, und der Junge spähte hinter ihr hervor. Die Frau zielte mit einer Armbrust auf ihn. Ihre Miene war entschlossen, ihre Stirn gerunzelt. Sie hatte die Augen zusammengekniffen und sagte etwas in derselben Sprache, die die Nomaden gesprochen hatten. Es war offensichtlich eine Warnung.
Kaspar sprach Queganisch und hoffte, dass sie ein paar Wörter erkannte oder zumindest seinem Tonfall entnahm, dass er nichts Böses wollte. »Ich werde dir nichts tun«, sagte er langsam und steckte das Schwert ein. »Aber ich brauche etwas zu essen.« Er vollführte eine kleine Pantomime, als würde er essen, dann zeigte er auf das Haus.
Ihre Antwort war knapp und zornig: Sie bedeutete ihm mit der Armbrust zu verschwinden. Kaspar wusste als Jäger, dass ein Weibchen, das seine Jungen beschützt, äußerste Vorsicht erfordert.
Er ging langsam auf sie zu und sagte bedächtig: »Ich will euch nichts tun. Ich muss nur essen.« Er hielt die Arme ein wenig zur Seite, die Handflächen nach außen.
Dann roch er es – frisches Brot! Und ein Eintopf oder eine Suppe!
Ruhig sagte er: »Wenn ich nicht bald etwas esse, werde ich sterben, Frau. Wenn du mich also umbringen willst, solltest du es lieber gleich tun.«
Sie zögerte einen Augenblick, bevor sie schoss, und das rettete Kaspar das Leben. Er warf sich nach links, und der Bolzen jagte dort durch die Luft, wo er einen Moment zuvor noch gestanden hatte. Kaspar rollte sich ab, sprang auf und griff an.
Sobald die Frau sah, dass sie ihn verfehlt hatte, hob sie die Armbrust wie eine Keule. Sie ließ sie auf Kaspars Schulter niedergehen, als er durch die Tür stürmte. »Verdammt!«, brüllte er, schlang die Arme um die Taille der Frau und zog sie zu Boden.
Der Junge schrie zornig und begann, auf Kaspar einzuschlagen. Er war klein, aber stark, und Kaspar spürte die Schläge. Er lag oben auf der sich wehrenden Frau und hielt ihre Hand fest, in der sie immer noch die Armbrust hielt. Er drückte zu, bis sie die Waffe losließ, dann stand er gerade noch rechtzeitig auf, um der Eisenpfanne auszuweichen, die der Junge nach seinem Kopf schwang.
Er packte das Handgelenk des Jungen und verdrehte es, woraufhin der Knabe aufschrie und die Pfanne fallen ließ. »Hör endlich auf!«, brüllte Kaspar.
Er zog das Schwert und zeigte damit auf die Frau. Der Junge erstarrte entsetzt.
»Also gut«, sagte Kaspar auf Queganisch. »Noch einmal: Ich will euch nichts tun.« Er steckte mit großer Geste das Schwert ein, ging an der Frau vorbei und hob die Armbrust vom Boden auf, dann reichte er sie dem Jungen. »Hier, Junge, geh und such den Bolzen und sieh zu, ob du sie spannen kannst. Wenn du mich unbedingt umbringen willst, kannst du es noch einmal versuchen.«
Er zog die Frau hoch und blickte sie forschend an. Sie war hager, aber es war nicht zu übersehen, dass sie einmal sehr hübsch gewesen war, bevor das Leben sie frühzeitig hatte altern lassen. Er hätte nicht sagen können, ob sie dreißig oder vierzig Jahre alt war, denn ihr Gesicht war von der Sonne wie zu Leder verbrannt. Aber ihre Augen waren leuchtend blau, und sie unterdrückte ihre Furcht. Leise sagte er: »Hol mir etwas zu essen, Frau.« Dann ließ er sie los.