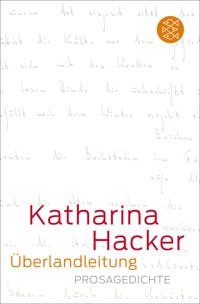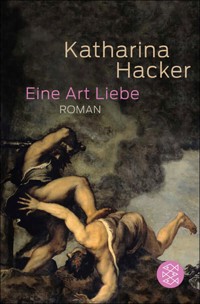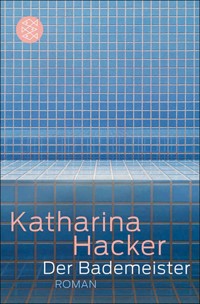8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anton ist Arzt in Kreuzberg, mit Sorge sieht er, wie seine Mutter, die in der niedersächsischen Provinz lebt, gegen eine schnell fortschreitende Demenz kämpft. Jedes Jahr schickt sie ihm und seinen Freunden Erdbeermarmelade nach Berlin. Die Erdbeeren wachsen auf dem »Acker«, wie sie ihren Garten nennt, den sie ihr Leben lang mit Hingabe gepflegt hat. Aber in diesem Jahr hat sie die Erdbeeren vergessen. Anton muss erkennen, wie seine Mutter ihm Stück für Stück verloren geht, und mit jeder ihrer Niederlagen verschwindet ein Teil seiner eigenen Existenz: Das vertraute Land der Kindheit. Dann trifft er Lydia und findet nach Jahren des Alleinseins jemanden, mit dem Liebe möglich zu sein scheint. Aber Lydia bringt eine Vergangenheit mit, die in beider Leben mit Vehemenz einbricht. In diesem vielstimmigen Roman gelingt Katharina Hacker das einfühlsame Porträt von Menschen, die zurückblicken müssen, um weitergehen und die zweite Lebenshälfte gestalten zu können. Selten ist so eindringlich über den Verlust einer Welt und den Gewinn einer neuen geschrieben worden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Katharina Hacker
Die Erdbeeren von Antons Mutter
Fischer e-books
Der kleine Garten, ein Acker eigentlich, der früher, in Antons Kindheit, ringsum an Felder gegrenzt hatte, jetzt an weitere Vorgärten stieß, nur an seiner Rückseite ins Freie überging, war umgegraben, die Erde sah frisch aus, vereinzelt stakten Gräser hervor, an einer Stelle war ein großer Löwenzahn gewachsen, und nahe am Zaun drängten sich die weichen Blätter von Beinwell.
Muß raus, brummte Helmer, der Bauer, der inzwischen eine kleine Gärtnerei betrieb. Das wächst, da haben Sie keine Vorstellung von! Er bückte sich, grub mit den Fingern, riß drei der langen Wurzeln aus. Immer das gleiche, wird man nie wieder los.
Anton stand neben ihm und blinzelte in das diffuse Licht.
Wie alt sind Sie jetzt eigentlich? fragte Helmer.
Dreiundvierzig, antwortete Anton.
Na auch schon. Und keine Kinder, und die Schwester immer noch in Amerika?
Immer noch, sagte Anton.
Da haben Sie für Ihre Eltern ja Zeit.
Ich bin Arzt, wandte Anton ein.
Paßt doch. Helmer schaute zu ihm, in seinen Augen mischten sich Kummer und ein freundlicher Spott.
Erst die Erdbeeren, sagte Anton.
An den Sträuchern, die in kleinen, schwarzen Töpfchen darauf warteten, wieder eingesetzt zu werden in die Erde, hingen schon grüne Früchte. Helmer schüttelte den Kopf. Anton wollte in zwei Wochen wiederkommen, und dann wieder zur Ernte.
Wässern kann ich sie Ihnen, heute und morgen, daß ein paar angehen. Stroh können Sie hintun nächstes Mal, sagte Helmer. Ist gut gegen die Fäule. Und gegen Schnecken. Viel werden wird das aber trotzdem nicht.
Sie war so unglücklich, sagte Anton. Sie kennen doch meine Mutter. Immer gefaßt. Aber diesmal hat sie geweint am Telefon, weil sie vergessen hat, die Erdbeeren zu pflanzen.
Und was wollen Sie ihr weismachen?
Daß es nicht zu spät ist. Daß sie es nicht vergessen hat.
Ob es richtig war, mit einer Lüge jemanden zu trösten oder glücklich machen zu wollen? Er würde seiner Mutter vorschlagen, in den Garten zu gehen, um nach den Erdbeeren zu schauen. Ihre Angst spürte er, eine Unruhe, die sich verbarg, immer wieder aufbrach, mit einem erschrockenen Reflex.
Er hatte sich zu Bett gelegt, als sie in sein Zimmer kam.
Anton?
Er sah im unregelmäßigen Licht der Straßenlaterne, die, von einer Weide halb verdeckt, vor dem Fenster stand, ihr Gesicht. Es sah männlich aus. Grobe, obenhin zusammengesetzte Flächen, scharf voneinander abgesetzt, nur die Augenpartie war verschwollen.
Mein Kind, sagte sie. Er kam sich groß vor. Da er schnell gewachsen war (mit dreizehn war er schon einen Meter achtzig groß), hatten seine Eltern ihm zum zwölften Geburtstag ein Erwachsenen-Bett geschenkt, auf das er stolz gewesen war. Das erste Jahr, bis zu seinem dreizehnten Geburtstag, war großartig, sein Zimmer war das Zimmer nicht eines großen Jungen, sondern eines jungen Mannes. Er hatte sich so danach gesehnt, ein junger Mann zu sein. Er war ein guter Sportler, ein Schwimmer und Basketballspieler, von seiner Schwester verehrt. Von ihren Mitschülerinnen, zwei Jahre jünger als er, verehrt. Sein Haar war hell, im Nacken und an den Schläfen gelockt. Wenn er Fotos von damals sah, staunte er selbst, was für ein hübscher Junge er gewesen war.
Dann wurde er dick. Keiner konnte sich erklären, was geschah. Seine Mutter war verzweifelt.
Die Kleider paßten in der Länge, denn er wuchs nicht mehr so rasch, sie waren aber alle eng und bald zu eng.
Sie nahm ihn mit einkaufen, sie fuhren zusammen nach Braunschweig. Sie nahm ihn mit, während sie all die Jahre zuvor für ihn ohne weiteres ausgesucht hatte, was ihm gefiel.
Sein Bund mit der Welt war zerfallen.
Kam seine Mutter mit einer Tüte von P&C, zog er sich in sein Zimmer zurück. Er legte sich auf sein Bett, aber auch das Bett verriet ihm den Verlust. Er hatte die harte Matratze geliebt, die präzise, kühle Berührung an seinem fast mageren Körper. Jetzt ließ sich nicht mehr bestimmen, wie er auflag. Er verschwamm, er fand sich nicht mehr. Auch nicht im Auge seiner Mutter. Sie erkannte ihn selbstredend, doch in ihrem Auge las er Unruhe und Verwirrung. Nicht er, sein Körper entfernte sich von ihr.
Als seine Mutter sich zu ihm an den Bettrand setzte, spürte er an seinem lange schon wieder schlanken Körper genau die neue Verteilung des Gewichtes. Er schaute sie an.
Das Gesicht eines Mannes, herb und unzugänglich. Sie seufzte. Mein Junge, murmelte sie leise. Ich mache mir solche Sorgen um dich.
Anton lag still, er war verlegen.
Du solltest heiraten, sagte sie. Ich bin hier so alleine. Und dein Vater ist keine große Hilfe.
Sie streichelte Antons Hand.
Deine Schwester, sagte sie plötzlich, ist noch so klein, ich habe immer Angst, daß sie aufhört zu atmen.
Caroline? fragte Anton. Er sah, wie seine Mutter den Kopf wiegte.
Morgens, wenn ich in ihr Zimmer gehe, liegt sie so still da. Dein Vater auch, übrigens.
Übernächste Woche komme ich wieder, sagte Anton, und bald können wir die Erdbeeren ernten, dann komme ich auch.
Wo sind die Erdbeeren?
Draußen auf dem Acker. Antons Augen hatten sich an das Licht gewöhnt, er sah, wie flach das früher widerspenstige Haar seiner Mutter jetzt an ihrem Kopf anlag, so daß er größer und kantiger erschien.
Seine Mutter nickte, murmelte etwas, dann sagte sie lauter, der Acker, den haben wir gekauft, damit euch nichts zustoßen kann, wenn es nichts zu essen gibt. Den Acker müßt ihr immer behalten, versprichst du mir das?
Aber ja, Mama.
Sie beugte sich zu ihm, er dachte, sie werde ihn auf die Stirn küssen, statt dessen sank ihr Kopf bis auf das Kopfkissen. Dann schreckte sie hoch, sie stand hastig auf.
Gute Nacht! Sie sagte es, als sie schon an der Tür war. Anstatt hinauszugehen, blieb sie jedoch, wo sie war, einen verstörten Augenblick lang, tastete die Tür hinauf und hinunter, unsicher anscheinend, was sie suchte.
Er war erleichtert, als sie hinausgegangen war und ihre Schritte sich entfernt hatten. Als Kind war das der ängstlichste Moment gewesen. Von Caroline, die doch im Nebenzimmer schlief, hatte er tatsächlich meist keinen Laut gehört. War seine Mutter den Flur entlang und wieder hinuntergegangen, ins Wohnzimmer, wo sein Vater vor dem Fernseher saß, ein Buch in der Hand, nachdenklich in sich versunken, weder lesend noch auf die Bilder, die sich vor ihm bewegten, achtend, dann bedeutete die Stille, daß Anton verlassen war von allem, was ihm Trost hätte gewähren können. Später, als erwachsener Mann, alleine in einem zu großen Bett liegend, hatte er sich gefragt, welche Einsamkeit die größere war, die des Kindes, das in Tränen ausbrechen wollte und es nicht wagte aus kluger Furcht, dem größten Schrecken zu begegnen, nämlich der Untröstlichkeit. Oder die Einsamkeit des Mannes, die endgültig schien. Und auch eine Art der Untröstlichkeit war, mithin.
Am nächsten Morgen fand er den Frühstückstisch für Vier gedeckt. Der Schrecken traf ihn unvorbereitet. Dann fragte er sich, wer fehlte. Caroline? Oder Lydia?
Neben dem überflüssigen Teller lag eine Papierserviette, an seinem Platz eine Serviette aus Stoff mit dem alten silbernen Serviettenring.
Seine Mutter kam lautlos herein, während er den Tisch betrachtete. Oh! rief sie aus. Habe ich jemanden vergessen?
Er drehte sich zu ihr. Alles Herbe war aus ihrem Gesicht verschwunden und verlegener Liebe gewichen. Ach, sagte sie, bist du alleine gekommen? Ich dachte, du bringst deine Freundin mit.
Das nächste Mal vielleicht, antwortete er. Für wen ist denn der vierte Teller?
Der vierte Teller? Sie schaute zum Tisch und zu ihm zurück.
Nach dem Frühstück wollte ihn sein Vater ein Stück begleiten. Zum Bahnhof vielleicht, sagte er, und holte seinen Mantel aus dem Schrank, obwohl es warm war. Ja, zum Bahnhof und wieder nach Hause, wiederholte er. Sie standen in der Haustür nebeneinander, sein Vater war jetzt kleiner als er, sie sahen einander aber ähnlich, Anton hatte silberblondes, sein Vater weißes Haar, Antons Mutter schaute sie verwirrt an. Wilhelm, sagte sie dann. Ja, Hilde, sagte er. Die beiden Männer gingen durch den Vorgarten davon.
Anton hatte seinen Vater am Arm gefaßt, sie drehten sich um und wollten winken, als seine Mutter aus dem Fenster etwas rief, Anton! Anton! Lachend hielt sie ihren Arm mit seiner Tasche durchs Wohnzimmerfenster. Du hast etwas vergessen, du hast deine Tasche vergessen! Sie verschwand, einen Moment später tauchte sie in der Haustür auf, sie lief ihnen entgegen wie eine junge Frau, ihr Mann fing auch an zu lachen und Anton auch, du hast etwas vergessen! riefen seine Eltern und umarmten ihn noch einmal zum Abschied. Wilhelm legte seine Hand auf die Schulter seiner Frau. Jetzt bleibe ich bei dir.
Bringst du mich nicht zum Bahnhof? fragte Anton.
Ach ja, sagte Wilhelm. Du mußt ja zum Bahnhof.
Und sie gingen ein zweites Mal los. Es waren nur zehn Minuten bis zum Bahnhof, man konnte gerade noch die große Tanne im Garten seiner Eltern sehen.
Weißt du, wie du nach Hause kommst? fragte Anton seinen Vater.
Ja, sagte sein Vater ruhig. Er schaute Anton in die Augen, als könnte er herauslesen, was er verloren hatte. Der Zug näherte sich, hielt.
Willkommen in Calberlah! tönte es aus dem Lautsprecher.
Anton stieg ein, sein Vater stand zu nahe an der Lichtschranke, die Tür konnte sich nicht schließen, der Bahnwärter rief in den Lautsprecher, nun geben Sie doch endlich die Türen frei!
Du mußt zurücktreten, Papa, sagte Anton.
Ach ja? fragte sein Vater ironisch.
Die Türen, sagte Anton. Sonst geht die Tür nicht zu.
Könnte der Herr freundlichst einsteigen oder einen Schritt zurücktreten? rief der Bahnwärter aufgebracht. Er kam aus dem Schaltraum gelaufen.
Papa, bat Anton. Der Bahnwärter nahm seinen Vater am Arm und zog ihn weg, die Tür schloß sich. Papa! rief Anton noch einmal gegen die Scheiben. Aber sein Vater sah ihn nicht, aufgebracht wehrte er sich gegen den Bahnbeamten, der ihn nicht loslassen wollte, aus Angst, der Mann könnte gegen den Zug stürzen.
Dann war nichts mehr zu sehen, denn der Zug fuhr an und gewann rasch an Fahrt.
Alix hatte er in sein Elternhaus mitnehmen wollen, seine Busenfreundin, die Frau seines Freundes Jan. Jan, Alix, Bernd und er, das war es, was gegolten hatte, seit Jahren. Alix hatte zugestimmt. Sie hatte ihn vergnügt angeschaut und aufmerksam, sie hatte gefragt, warum er nicht seine neue Liebe, seine frische Freundin Lydia mitnehme, ob sie zu dritt fahren sollten. Bernd hatte auch angeboten, ihn zu begleiten, er hatte auch gefragt, warum Anton nicht Lydia mitnehme?
In Lydia war er hineingerannt. Schlank war Anton zwar noch, mager war er nicht mehr, er hatte in den letzten Monaten zugenommen, mit seinem größeren Gewicht, mit der Geschwindigkeit, einer Art Schubkraft, die ihm neu war, hatte er eine Radfahrerin umgerannt, das war Lydia gewesen. Unachtsam war er auf den Fahrradweg gelaufen. Schnell und achtsam hatte er zugegriffen, so daß er das meiste ihres Sturzes abfangen konnte. Um so härter war er gestürzt; nicht einmal Bernd hatte er gestanden, daß er wegen der Blutergüsse und des verletzten Steißbeins tagelang nicht schlafen konnte. Ohne Schmerzen hätte er allerdings ebensowenig geschlafen.
Seine Hoffnung und die Erinnerung an ihren Anblick hielten ihn wach, ihre brüske, freundliche Art, ihr Zorn, der sie nicht hinderte, neugierig zu sein, erst zu langsam, dann etwas zu schnell, hatte Lydia gesagt und sich aus seinen Armen gewunden. Dann hatte sie sich Zeit genommen, ihn zu mustern, während er, seine Schmerzen verbergend, sich mühsam aufrichtete und aufstand, verblüfft über ihr Gesicht, das trotz der Jahreszeit ein bißchen bräunlich war, so daß ihre eigentlich dunklen Augen hell wirkten, eine Art Violett, in Kontrast zu dem kastanienbraunen Haar.
War sie schön? Sie war schön, nicht wie Alix es war, aber schön. Vielleicht harscher als Alix, lebhafter noch.
Sie war schlank, aber nicht grazil, auch ihr Körper wirkte herb, es war schwer vorstellbar, wie sie mit zwanzig oder dreißig Jahren ausgesehen haben mochte. Er wollte es auch nicht wissen, dachte er, ein wenig verlegen. Sie hatte dies Alter erreicht, dachte er, damit er ihr begegnen könnte als die, die er brauchte, eine Frau, die ihre Lebensmitte erreicht hatte, die seinen Blick teilen konnte. Was genau er zu sehen vermeinte, konnte er nicht ohne weiteres erklären. Etwas sah er aber, ganz ohne Zweifel, und in der ersten Nacht, die sie miteinander verbrachten, in dem Gefühl von glücklicher Aufregung und Erleichterung auch, daß er endlich sie gefunden hatte, in dieser ersten Nacht lachte er und sagte, es sei ein Stück von Gott, ein Stück Tod, ein Stück Hinfälligkeit auch und die größte, gespannteste Neugierde, etwas, das ihn schier zerriß, so viel Glück, und jede Berührung ließ ihn erschauern. Er würde sie beschützen. Er würde für sie alles tun, mit Schrecken empfand er, daß er zu ihrem Glück sogar von ihr lassen würde, wenn es besser für sie wäre. Denn sie hatte Zweifel. Sie hatte eine Tochter, sie war in ihrem Leben glücklich geworden, jetzt, alleine. Und sie war Kollegin, Allgemeinärztin, die, wie er auch, beschlossen hatte, in diesem Teil Kreuzbergs zu bleiben, stets darum kämpfend, daß genug Geld blieb, in den Kindergartenferien zu verreisen. Ihre Eltern hatten eine kleine Wohnung für sie gekauft, als Rachel zur Welt gekommen war, drei Zimmer, in die einstweilen Anton nicht eingeladen war, und Lydia machte keinen Hehl daraus, daß es lange dauern würde, bis er zu ihr nach Hause kommen dürfe. Rachels wegen. Ihretwegen auch.
Was ihr geblieben sein mußte, dachte er, als er versuchte seine Chancen abzuwägen, was geblieben sein mußte, war der Glaube daran, geborgen zu sein. Oder der Glaube, weiterzuleben, nicht nur zu bewahren, was jetzt ihr Leben war. Nichts war seiner Erfahrung nach stärker als die Gewißheit, längst selber für die Geborgenheit anderer zu sorgen, von anderen aber derlei keinesfalls mehr zu erwarten.
Anton fragte sich, ob er recht daran täte, in Lydia zu wecken, was sie wahrscheinlich nur mit Mühe aufgegeben hatte. Und mußte er sie denn beschützen? Könnte er sie nicht auf eine andere Weise lieben? Doch sein Wunsch war übermächtig.
Wenn er nicht arbeitete, wenn er nicht eine Mail an Lydia schrieb, wenn er nicht bei Jan und Alix war oder mit Bernd ausging, malte er sich ein Haus aus, das er für sie kaufen würde. Ein Haus mit einem Garten, damit Rachel darin spielen könne und später mit ihren Freundinnen in einer Hollywoodschaukel sitzend plaudern, ein bißchen abseits, ungestört von ihrer Mutter und ihrem Ziehvater.
Rachel liebte er auch schon, er hatte ein Foto von ihr lange angeschaut, staunend und unruhig, daß sie seine Tochter werden könnte.
Sie könnte ein Zimmer haben mit Fenstern in zwei Richtungen.
Und Lydia würde für sich ein Schlaf- und ein Arbeitszimmer mit einem eigenen Bad haben. Um keinen Preis würde er sie bedrängen.
Aber sie würde nach Hause kommen abends, sie würde die Tür öffnen, beruhigt und heiter, sie würde wissen, es wäre da jemand, der sie um jeden Preis beschützte.
Und ihr Leben würde sich verändern, um das Leiseste und Zarteste. Wenn sie es so wollte.
Er durfte sie in nichts drängen. Sie zu seinen Eltern mitzunehmen, dazu war es zu früh.
Die Anrufe seiner Mutter waren immer unerwartet. Dachte er daran, daß sie sich wohl melden würde, tat sie es nicht.
Dann klingelte, in der Praxis und in der Sprechstunde, das Telefon. Anton erwartete, Alix’ Stimme zu hören.
Die Stimme seiner Mutter war rauh, ein bißchen matt, man hörte ihr an, daß sie sich nicht sicher war, mit wem sie sprechen würde, auch dann noch, wenn sie seinen Namen schon ausgesprochen hatte, Anton. In ihrem Mund ging sein Name verloren.
Anton, sagte sie aus der andrängenden Dunkelheit, in der sein und seiner Schwester Name die vorletzten Grenzlinien sein würden.
Er stand vor dem Regal mit den Kompressen und Wechselverbänden und mußte ein Zittern unterdrücken, unsichtbar überlief ihn ein Schauder, und die Empfindung quälte ihn, daß er mit seiner Mutter in einer Dunkelheit lief, in der sie beide einander verloren gingen, es war ein Raum der Leere, ohne ein Licht, ohne einen Halt, ausgefüllt von Verwunderung und Entsetzen, so daß er sich fragte, was sie jemals miteinander verbunden hatte. Sie war seine Mutter. Er war ihr Sohn. Was für eine Liebe konnte ihnen helfen, diese bittere Zeit zu überstehen?
Denn sein Herz schlug schneller, wenn er ihre Stimme hörte, auch das war die Wahrheit. Im Spiegel seines Arztzimmers sah er sich stehen, einen groß gewachsenen Mann, dessen blonde Haare im ersten Moment darüber hinwegtäuschten, daß er nicht mehr jung war, die besten Jahre, wie eine ganz junge Arzthelferin in altmodischer Wendung einmal gesagt hatte, hinter ihm lagen.
Ich wollte zur Post gehen, sagte seine Mutter ins Telefon, aber ich habe vergessen, daß ich erst das Paket packen muß, und ich finde die Gläser nicht.
Welche Gläser, Mama?
Die Marmeladengläser, es ist doch längst Zeit, dir neue Marmelade zu schicken und deinen Freunden auch.
Mach’ dir keine Sorgen, Mama, sagte Anton. Ich glaube, ich habe sogar noch zwei Gläser Quittengelee, davon kann ich Alix eines abgeben. Dann hast du Zeit bis zum Sommer!
Ist noch nicht Sommer, es ist hier so heiß? fragte seine Mutter.
Noch nicht, sagte Anton.
Dein Vater, sagte sie, möchte, daß du zu Besuch kommst.
Ich war doch gerade erst zu Besuch.
Ja, aber das ist schon eine Weile her.
Nächstes Wochenende komme ich. Anton hörte im Hintergrund die Stimme seines Vaters, sie wurde lauter, sie klang brüsk, wie er sie als Junge gefürchtet hatte, jetzt hörte er aber in der harschen Anweisung ein Zögern, die Angst, man könnte ihm nicht gehorchen, er hörte, daß sein Vater nicht wußte, wie er um etwas bitten sollte.
Ich komme, sagte Anton, ich komme nächste Woche.
Du meinst, am Freitag?
Nicht diesen Freitag, Mama, ich komme die Woche drauf.
Es gab ein Geräusch, das wie ein Seufzer klang, der mit der Hand gedämpft wurde, ein müder Atemzug, dann hörte er, wie seine Mutter sich mit der Hand durch die Haare fuhr.
Doktor Weber! Er hörte die Stimme Nurays, seiner langjährigen Arzthelferin. Wir brauchen Sie hier mal!
Ich rufe euch morgen an, dann machen wir genau aus, wann ich komme, sagte Anton und legte auf, ohne eine Antwort abzuwarten. Nuray lächelte ihn mitleidig an, als er sich bedankte.
Es war kindisch, doch immer, wenn die Tür der Praxis aufging, während er im Vorzimmer stand, um ein Rezept zu unterschreiben oder die nächste Patientenakte zu holen, hob er den Kopf in der verrückten Hoffnung, es könnte Lydia sein, die eintrat. Sie war nie bei ihm gewesen. So sah er, wie der etwa Fünfzigjährige eintrat, ein kleiner, schmaler Mann, das graue Haar stoppelig kurz geschnitten, sein eigentlich feines Gesicht aufgebracht und beherrscht zugleich, es sah aus, als hätten Kummer und Einsamkeit abgenutzt, was freundlich gewesen war.
Sind Sie der Idiot, der in meine Freundin reingerannt ist?
Doktor Weber, stellte Anton sich vor. Wer ist denn Ihre Freundin?
Der Mann schaute sich suchend um. Ihr Fahrrad ist kaputt!
Nun, das hat mit uns hier nichts zu tun, sagte Anton vorsichtig.
Haben Sie keine Augen im Kopf? fuhr der Mann ihn an.
Hören Sie mal, mischte sich Nuray ein, das ist hier kein Fahrradladen.
Ihr feiner Chef hat sie auf der Straße umgerannt! Er zeigte auf Anton. Dann zog er etwas aus der Jacke.
Paß auf! rief Nuray und zog Anton zurück. Es war aber kein Messer, es war ein Foto, daß der Mann Anton über den Tresen zuschob, das unscharfe Foto einer jungen Frau mit rotbraun gelockten Haaren, die zusammengesunken an einem Tisch saß.
Ist das Lydia? fragte Anton.
Der Mann ließ das Foto nicht los.
Sie heißt Stefanie, sagte der Mann. Seine Augen blickten mißtrauisch auf Anton.
Jetzt kommen Sie erstmal in mein Zimmer, sagte Anton.
Der Mann schaute weg und zog das Foto zu sich heran. Stefanie, sagte er noch einmal, in seiner Stimme zitterte etwas.
Ja ja, nun erklären Sie mal alles genau, beschwichtigte Anton und hielt ihm die Tür auf. Er wunderte sich, daß der Mann seiner Aufforderung folgte, und obwohl er fast zwei Köpfe größer war, fühlte er sich in die Enge getrieben.
Die kenne ich nämlich mit ihrem Kind, sagte der Mann und ging an ihm vorbei, er setzte sich nicht, sondern stellte sich dicht an den Schreibtisch.
Setzen Sie sich, bat Anton.
Nein, brauche ich nicht. Sie fassen die Frau nicht an, hören Sie!
Aber ich bin gar nicht sicher, daß wir dieselbe meinen! Anton spürte sein Herz klopfen. Ich kenne eine Frau, die rotbraune Haare hat, sie ist aber älter, sie heißt Lydia.
Sie heißt Stefanie und Lydia, sagte der Mann, er richtete sich auf. Und das Kind ist nicht von Ihnen, nur daß Sie das wissen!
Bevor Anton abends die Praxis verließ, rief er Nuray an, die längst nach Hause gegangen war. Nuray, heute nachmittag, was war das für eine Figur?
Meinst du den Mann? fragte Nuray.
Ja, was wollte er?
Aber du hast doch mit ihm geredet?
Er hat nur gesagt, daß er die Frau auf dem Foto kennt. Und ich bin nicht sicher, ob es wirklich Lydia war, sie sah so anders aus.
Wird sie schon gewesen sein, meinte Nuray. Du solltest sie jedenfalls fragen, wer das ist.
Er solle, war Lydias mageres Angebot gewesen, abends anrufen, sobald er die Praxis verlassen habe, sie könne dann entweder den Anruf entgegennehmen oder auch nicht, im Falle, daß sie mit ihrer dreijährigen Tochter Rachel beschäftigt sei oder Hausbesuche mache, und Anton war unklar, wann sie nach Hause ging, es mußte doch, mit einem so kleinen Kind, ihr Leben regelmäßig sein; er rief sie zu Hause an, konnte sie aber nicht erreichen. Vielleicht ging sie nicht ans Telefon. War er zu Hause, nahm er jeden Anruf entgegen: Es waren so wenige Anrufe, das Telefon klingelte selten, sein Herz klopfte jetzt, wenn es klingelte. Manchmal war es nur eine Umfrage.
Sie aber rief ihn nicht an.
Und obwohl er stolz darauf gewesen war, als einer der letzten kein Handy zu haben, kaufte er sich in einem Laden auf der Wiener Straße ein Nokia für zwanzig Euro und eine Karte, die er sofort auflud für fünfzig Euro. Er ließ sich von dem Ladenbesitzer, einem stämmigen, unfreundlichen Mann, eine SMS schreiben, in der er Lydia seine Telefonnummer mitteilte. Sie hatte ihn gebeten, möglichst nicht auf dem Handy anzurufen, das sie nur angestellt hatte, wenn ihre Tochter im Kindergarten war.
Er wartete vergeblich, daß sie ihn anriefe. Dann gab er Alix und Bernd die Nummer. Alix rief ihn als erste an, am nächsten Mittag.
Zwei Mal hatte er bisher Lydia eine Postkarte geschickt, in ihre Praxis.
Am Abend darauf summte sein Handy, es war kein Anruf, sondern die erste Mitteilung:
Neun Uhr, Möbel Olfe oder San Remo Upflamör?
Er wollte sie zu sich einladen. Warum mußten sie sich erst in einer Kneipe treffen?
Schließlich tippte er ungelenk: Defne?
Und er hatte Glück, sie kannte das türkische Restaurant am Kanal, wieder summte das Handy, er las Ok.
Ab viertel vor neun Uhr wartete er. Er lief das Planufer auf und ab. Die Böschung war voller Papier und leerer Dosen und Zigarettenstummeln, der Dreck deprimierte ihn, auf dem dunklen Wasser des Kanals schwammen zwei Schwäne, von der Admiralsbrücke hörte man Stimmen und auch Musik. In einem parkenden Auto saßen zwei und zankten sich. Er spähte nach den Gesichtern, die er hinter der Glasscheibe, auf der sich die Kastanienbäume spiegelten, nur undeutlich sehen konnte, gerade so viel sah er, daß auf dem Fahrersitz eine Frau mit dunklen, lockigen Haaren saß, die ihn an Alix erinnerte, aber ihre Stimme war brüchig und zornig, und der Mann, so viel konnte Anton erkennen, ähnelte in nichts seinem Freund Jan, er hatte eine dunkle Mähne und war kräftig, vermutlich auch nicht so hochgewachsen wie Jan.
Anton ging ein paar Schritte zurück zum Defne, drei der Tische auf der Terrasse waren besetzt, er überlegte, ob er einen Tisch reservieren sollte und verwarf den Gedanken, Lydia kam noch immer nicht die Straße entlanggelaufen, er kehrte um, die beiden im Auto waren lauter geworden, dann schrie die Frau auf, es war ein leerer, trauriger Schrei. Anton drehte sich alarmiert um. Von der anderen Seite des Kanals hörte er Kinder rufen. Er schaute hinüber. Zwei Polizisten, die vor der Synagoge patroullierten, unterhielten sich mit zwei Jungen, die auf Einrädern balancierten, sie schienen zu lachen.
Als er sich umdrehte, sah er, der Mann war ausgestiegen und entfernte sich eilig. Im Auto rührte sich nichts.
Er meinte, weiter entfernt die Haare Lydias aufleuchten zu sehen, sie kam aber immer noch nicht, er mußte zu dem Auto gehen und nachfragen, ob die Frau darin Hilfe brauche, er drehte sich um, es war schrecklich zu warten, und die Angst war schrecklich, daß etwas passieren konnte, nach all den Jahren, die er gewartet hatte, die Sehnsucht war wie ein Fremdkörper, und er fürchtete, daß die Fremdheit bleiben würde, selbst wenn er Lydia im Arm hielt, und es konnte ihr etwas zustoßen.
Das Auto war ein silbergrauer Ford Focus. Die Beifahrertür war angelehnt. Er beugte sich hinunter, zog sie auf, im ersten Moment sah er die Frau nicht, sie war hinuntergerutscht, sie hatte den Sitz zurückgeschoben so weit es ging, sie lag fast, ihr Gesicht war sehr ebenmäßig, sehr weiß, und Anton griff nach ihrem Handgelenk, er setzte sich auf den Beifahrersitz. Der Puls war kaum zu spüren, aber die Frau atmete ruhig, und dann schlug sie die Augen auf, ohne daß sich sonst etwas bewegte in ihrem Gesicht, sie schien Anton genau zu betrachten, er fürchtete, sie werde ihn sogleich beim Namen nennen, doch sagte sie kein Wort, und er begann zu reden, er fragte sie, wie sie heiße, er fragte, ob es ihr gut gehe, ob sie verletzt sei, sie sagte nichts, schaute nur stumm weiter in seine Augen, nicht zu verzweifeln war schwer, nicht zornig zu werden. Hör mal! rief er schließlich aus, ich bin verabredet! Er schaute aus dem Fenster. Dann drehte er sich wieder zu ihr.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: