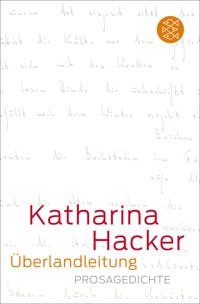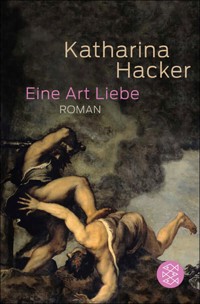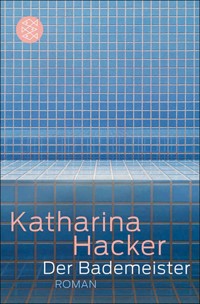9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Mitte seines Lebens macht der israelische Architekt Skip Landau eine Erfahrung, die er mit niemandem teilen kann: Eine innere Stimme ruft ihn an Orte, wo wenig später eine Katastrophe geschieht – ein Zugunglück in Paris, ein Flugzeugabsturz in Amsterdam. Offenbar soll er einzelne Sterbende auf ihrem schwierigen Weg in den Tod begleiten. Aber was soll, was kann er tun? Nicht viel mehr, als da zu sein und ihnen ein wenig Gesellschaft leisten, stellt er ernüchtert fest. Die Aufgabe, die er sich nicht ausgesucht hat, belastet seine Ehe und lässt die Familie in Tel Aviv fast auseinanderbrechen. Spät versteht er, dass er nicht nur die Sterbenden in den Tod, sondern auch seine Söhne ins Leben führen muss – und sich dazu. Katharina Hackers großer und seit langem erwarteter Roman steht nicht in Beziehung zum Figurenkosmos der vorausgegangenen Romane ›Alix, Anton und die anderen‹ und ›Die Erdbeeren von Antons Mutter‹, sondern erschafft eine eigene Welt. Seine Schauplätze sind Paris, Tel Aviv, Amsterdam und Berlin, sein Thema aber ist universal: Wo ist unser Ort auf der Welt, wo ist unser Ort im Leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Katharina Hacker
Skip
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Lösung des Problems, das Du im Leben siehst, ist eine Art zu leben, die das Problemhafte zum Verschwinden bringt.
Daß das Leben problematisch ist, heißt, daß Dein Leben nicht in die Form des Lebens paßt. Du mußt dann Dein Leben verändern, und paßt es in die Form, dann verschwindet das Problematische.
Aber haben wir nicht das Gefühl, daß der, welcher nicht darin ein Problem sieht, für etwas Wichtiges, ja das Wichtigste blind ist? Möchte ich nicht sagen, der lebe so dahin – eben blind, gleichsam wie ein Maulwurf, und wenn er bloß sehen könnte, so sähe er das Problem?
Oder soll ich nicht sagen: daß, wer richtig lebt, das Problem nicht als Traurigkeit, also doch nicht problematisch, empfindet, sondern vielmehr als eine Freude; also gleichsam als einen lichten Äther um sein Leben, nicht als einen fraglichen Hintergrund.
Ludwig Wittgenstein
Ich heiße Skip Landau, meine Mutter stammt aus England, mein Vater aus Paris, seine Eltern sind aus Ungarn nach Frankreich ausgewandert, weil sie als Juden in Ungarn nicht Medizin studieren durften. Den Krieg haben sie, so wie mein Vater auch, knapp überlebt, in irgendeinem Dorf in Südfrankreich.
Warum meine Mutter 1946 nach Paris gegangen ist, hat sie nie erklärt, vermutlich wollte sie weg von zu Hause, weit weg und schnell, und sie behauptete, Französisch lernen zu wollen und Malerin zu werden. Sie hat wirklich gemalt, nicht schlechter als andere, denke ich, und warum sie es am Ende aufgegeben hat, weiß ich nicht, oder vielleicht hat sie es auch nicht aufgegeben, sondern nur noch in kleine Hefte gezeichnet, sie hatte kleine Hefte, vielleicht finde ich sie in ihrem Nachlass, wenn ich mich endlich aufraffe, die letzte Kiste zu öffnen und zu sichten, was ich brauche, was ich behalte, eine Vorstellung, die ich nicht gut ertrage. Die Kiste steht mittlerweile in meiner Wohnung in Berlin.
Von ihren Gemälden habe ich nichts behalten, ich dachte, ich würde sie nie los, an die hundert, um genau zu sein siebenundachtzig, doch es tauchten immer mehr Freunde und Bekannte meiner Eltern auf, die danach fragten, und plötzlich stand ich da, hatte nichts außer einem kleinen, quadratischen Bild. Es hing immer in meinem Büro, in dem Zimmer mit Blick auf den Hof in Newe Zedek, das heißt Oase des Friedens. Ich habe lange in Israel gelebt, jetzt wohne ich in Berlin.
In Paris lernte meine Mutter in der zweiten Nacht meinen Vater kennen. So erzählte mein Vater. Meine Mutter erzählte, sie habe ihn in einem Café gesehen und sich verliebt, bevor sie nur ein Wort mit ihm gewechselt habe. Mein Vater sagte, sie sei mit ihm ins Bett gegangen, in dieser zweiten Nacht, in ihrer zweiten Nacht in Frankreich, und in der Nacht ihrer Begegnung. Er hatte eine eigene Wohnung, eine winzige Wohnung im jüdischen Viertel.
Seine Eltern wohnten damals etwas außerhalb, in Neuilly. Meine Großeltern waren fromm, auf ihre Weise, meine Großmutter sogar vermutlich ganz und gar gläubig, und vielleicht hätte sie besser einen Orthodoxen geheiratet. Alles hat sich verflüchtigt wie sie selbst, ihr Glaube, ihre Gewohnheiten, und ich bin nicht einmal Jude nach dem strengen Gesetz, denn meine Mutter war keine Jüdin, obwohl eine ihrer Tanten irgendwann schnaubte, etwas derart Albernes habe sie noch nie gehört, bei einer Familie, die Blomfield heiße, das war der Mädchenname meiner Mutter.
Was ist, was nicht ist, ich habe einigermaßen so gelebt, als wäre das klar, mich hat das Sichtbare interessiert. Immer das Sichtbare und was man anfassen kann, wie Menschen sich bewegen zwischen Wänden, umgeben von Möbeln.
Also bin ich Architekt geworden.
Ich wollte Häuser bauen. Wohnungen. Höfe auch, Höfe, in denen Kinder spielen, ihre Mütter könnten sie dann aus großen Küchenfenstern sehen, in den Höfen stünden Bänke, unter Bäumen, blühenden Bäumen. Alles würde belebt und klar sein, offen, jede Bewegung könnte einen Raum schaffen für das, was Menschen miteinander teilen. Und es würde abgelegene Zimmer geben, in die man sich zurückziehen könnte, um nachzudenken, zu lesen, Wände für Bücher, aber nicht so viele dunkle Bücher, wie ich es von meinen Großeltern kannte, die Regale bis zur Decke, die Einbände schwarz oder braun. Vielleicht haben sich mir nur die Bücher eingeprägt, die sie aus Budapest mitgebracht hatten.
Ein Mal habe ich ein Haus gebaut, mit einem Hof, ein Haus für drei Familien.
Es war eine der glücklichsten Zeiten in meinem Leben, ich arbeitete Tag und Nacht, nein, nachts war ich mit Shira zusammen, in ihrer kleinen Wohnung unweit des Meeres, man hörte die Wellen bis zu unserem Bett, und ich hielt sie in den Armen, wenn sie einschlief, hielt sie und hielt sie, mit der Zuversicht eines ganzen Lebens. Mit der Zuversicht unserer Kinder, die zwei und dreieinhalb Jahre später geboren wurden.
Lange Jahre war ich zu sehr mit mir, mit Shira, mit meiner Arbeit und mit den Söhnen, als sie endlich geboren waren, beschäftigt, als dass ich hätte darüber nachdenken können, was es heißt, wenn man plötzlich aus dem Leben gerissen wird, unvermutet und grausam, und was es heißt, wenn die Lebenszeit immer weniger wird, wenn man die Tage hinter sich bringt, schwerfällig, mühselig, manchmal sogar bitter, blind. Im Nachhinein habe ich einige der Tage noch einmal durchlebt. Stück für Stück. Verwundert, gerührt. Verängstigt.
Lange Zeit dachte ich, ich würde von Unglücken verfolgt. Ich wartete sehnsüchtig, dass Shira schwanger würde, aber sie wurde nicht schwanger, nicht von mir. Ich wartete darauf, wieder ein Haus bauen zu können, aber man übertrug mir nur alte Häuser zum Ausbau. Ich hoffte, Shira würde gesund werden, aber sie starb. Der Tod rückte immer näher, und doch habe ich nie darauf geachtet, wie die Tage vergehen, die Tage, an denen nichts Sonderliches geschieht, die glücklichen Tage. Manchmal war mir, als hätte ich das Sterben schon hinter mir.
Kein besonderes Erlebnis, keine einschneidende Erfahrung, keine Tiefe, wenn man so sagen will, hat mich ausgezeichnet. Ob es das nun gibt oder nicht, Menschen, die besonders empfindsam sind, besonders tief, besonders geeignet, auserwählt. Ich bin Halbjude, allenfalls halb auserwählt. Das passt. Jahre habe ich darunter gelitten, vielleicht bin ich deswegen als junger Mann nach Israel ausgewandert. Vor allem bin ich nicht: doch nicht Vater, denn meine Söhne habe ich nicht gezeugt, doch nicht Architekt, denn ich baue nicht selber Häuser, nicht mehr Shiras Mann, denn sie ist gestorben. Nicht einsam, denn hier in Berlin habe ich Zipora.
Skip. Einen anderen Namen hatte ich nie, ich weiß nicht, was sich meine Mutter dabei gedacht hat. Skip Jonathan Landau.
In Israel ist der Frühling nicht so spektakulär wie in Europa, ich habe ihn immer vermisst. Dafür habe ich in Tel Aviv jede Blume, jedes Grün, jede Veränderung des Lichts gesehen, die Flughunde, wenn sie auffliegen, und die milde Luft nachts habe ich geliebt. Liege ich jetzt in Berlin wach und denke an meine Söhne, bin ich glücklich, dass sie beide in England leben. Sie waren beim Militär, aber sie werden nicht eingezogen, sie müssen nicht zu Reserveübungen.
Ich habe in Israel auch meinen Wehrdienst gemacht, so wie jeder andere, kurz nach meiner Einwanderung. Nur wollte ich keinesfalls sterben, unter keinen Umständen. Ein Freund brachte mich auf die Idee – melden wir uns zur Leichenidentifizierung, dann passiert uns unter Garantie nichts. Entweder es ist nichts los, oder es ist der Teufel los und man braucht uns. Man hat uns gebraucht. Irgendwann dachte ich, man sollte die Erkennungsmarken in die Absätze der Schuhe tun, Schuhe tauscht man nicht so leicht wie eine Marke, die man sich um den Hals hängt, und immer wieder mussten wir feststellen, dass der Tote offenbar seine Marke mit jemandem aus der Etappe getauscht hatte.
Israel ist vielleicht nicht der beste Platz auf der Welt, aber es bleibt ein Zuhause. Avi und Naim werden nicht dahin zurückkehren, ebenso wenig, wie ich nach Paris zurückgekehrt bin. Das Haus in Newe Zedek habe ich behalten, noch gehört es mir und uns. Noch können wir zurückkehren, wenn wir wollen. Wer weiß.
Ich bin jetzt seit ein paar Jahren in Berlin. Seit sieben Jahren. Und ich spüre, dass ich bald wieder irgendwohin gerufen werde. Ich weiß, dass ich nichts Besonderes tun muss. Abwarten. Den Kopf offen halten, vielleicht, die Seele, wenn man so will, nefesh, wie es auf Hebräisch heißt. Auf Hebräisch ist es ein ganz normales Wort. Seele. Mich hat, als ich hierherkam, verwundert, dass ich so viel verstand, dass ich so rasch Deutsch sprechen konnte, obwohl ich nur das Jiddisch meiner Großeltern im Ohr hatte, und dann das bisschen Deutsch, das sie uns in der Schule eher widerwillig beibrachten. Zunächst waren meine Sätze holperig und voller Fehler, aber sie waren auch voller Luft, voller Atem, Luft und Wasser, das ist es, was die toten Konsonanten, schrieb ein berühmter Mystiker im zwölften Jahrhundert, ich glaube, er hieß Jitzchak von Akko, zum Leben erwecke, so, dass aus den Buchstaben, tote Knöchelchen und nichts weiter, Wörter werden könnten, Sätze, Sprache. Lebendige Sätze. Ob richtig oder falsch tut nicht so viel zur Sache.
Aber man braucht Vertrauen.
Man braucht Vertrauen, dass sich nicht alles über einem Unglück ändert, dass die Wörter bleiben. Der Atem, die Luft. Die Knöchelchen.
Natürlich hängt viel davon ab, wie man es beschreibt, wie man sich die Seele, oder was immer es sein soll, vorstellt. Ein Faden. Viele Fädchen. Stimmen. Vielleicht auch Bewegungen. Ich warte, dass ich gerufen werde, zu wem auch immer.
Wie stellst du sie dir vor?, fragte Naim einmal.
Wen stelle ich mir wie vor?
Die Toten! Er stand mit dem Rücken zu mir. Ich wusste, er dachte an seinen Freund Joni, der bei einem Attentat umgekommen war.
Langsam antwortete ich: Ich stelle sie mir gar nicht vor.
Sie sind einfach da, wollte ich sagen. Ich sehe sie, aber ich könnte sie nicht beschreiben, wollte ich sagen, aber ich sagte nichts weiter.
Naim sah enttäuscht aus, sein Rücken sah enttäuscht aus, die Schulterblätter, die sich durch das kurzärmelige Hemd abzeichneten.
Und Mama?, fragte er.
Um Shira hat sich, als sie starb, jemand anderes gekümmert, ich jedenfalls war es nicht, und vielleicht brauchte sie auch keine Hilfe, keine Gesellschaft in diesen ersten Stunden und Tagen nach dem Tod, sie hatte ja lange genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Am dreißigsten Todestag trifft man sich bei uns Juden – oder Halbjuden, wenn es mich betrifft – am Grab. Betet. Unterhält sich miteinander. Weint.
Shiras Nähe empfand ich nach ihrem Tod anders. Ich kannte sie ja, ihre Berührung, ihre Zärtlichkeit, die letzten Spuren der Lust, als sie schon krank war, vielleicht nicht wirklich Lust, eher das Wissen, es ist das letzte Mal, es ist das letzte Mal. Sie nahm meine Hand und führte sie über ihren Körper, mit dieser erschreckenden Aufmerksamkeit, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, als gelte es eine Entfernung zu überbrücken, die zu groß ist, jede Minute größer wird.
Bei den anderen Toten ist es anders. Da bin ich nicht ich. Oder ich bin ich: Skip. Der, der einen Schritt auslässt, hüpft. Der für die anderen den Namen trägt: Lass fahren dahin. Der, den man auslassen kann, nicht wichtig. Denn das ist der Tod: alles, was wir auslassen.
Während Shira im Sterben lag, hatte ich eine Freundin, Nina. Wir sahen einander im Café, mehrfach, kehrten beide anderntags zur gleichen Stunde zurück, eine Woche lang. Dann standen wir gleichzeitig auf, nahmen uns an der Hand und gingen. Wir gingen in mein Büro, in dem ein hübscher Diwan stand, auf dem ich schlief, mit einer Überdecke aus der Buchara, einem alten Stoff mit Blumen und Ornamenten in Rot, Blau, Grün, in leuchtenden, klaren Farben. Nina bewunderte den Stoff, dann zog sie sich aus, ich sehe sie vor mir, schlank, undenkbar schön. Ich wünschte mir im selben Moment, sie würde wieder gehen, nicht, weil ich das Gefühl hatte, Shira, die im Krankenhaus lag, zu verraten, sondern weil ich nicht mehr zu dieser Welt gehörte, zu dieser Schönheit, oder weil ich nur noch mit meinen Augen dazugehörte. Vielleicht hätte sie eingewilligt, dass ich ihr nur zusehe, vielleicht hätte es sie erregt, mehr als meine Hände, mein Geschlecht. Wir waren einander nahe, zugetan, obwohl wir uns nicht kannten. Wir schauten uns an, und ich sagte: Skip me! Der alte dumme Scherz, wie oft habe ich ihn gehört, wie oft ihn selber gemacht. Aber so war es, so sollte es sein. Nina sagte nichts. Irgendwann reiste sie ab, ich riss den Zettel mit ihrer Nummer in kleine Fetzen und löschte sie aus meinem Handy, eine Woche später fiel sie mir ein, die Telefonnummer. Sie ist kein Talisman, ich beschwöre sie nicht, wahrscheinlich führt sie längst zu einem anderen Menschen. Aber ich habe die Nummer im Kopf, unauslöschlich, scheint es, während ich mich an Ninas Gesicht nicht mehr genau erinnern kann.
Von meiner anderen Arbeit, wenn man es so nennen kann, habe ich Shira nie erzählt, und wenn ich etwas bereue, ist es nicht, dass ich eine Affäre hatte, während meine Frau im Sterben lag, sondern dass ich nicht die Worte oder nicht den Mut fand zu sagen, was ich erlebt hatte.
Sie war misstrauisch gewesen, wenn ich verreiste. Warum fährst du nach Paris, wohin fährst du? Ihr fiel kein Zusammenhang auf – ich reiste, und wo ich hinreiste, geschah ein Unglück. Ich musste nach Amsterdam. Wohin, nach Amsterdam? Was hast du in Amsterdam zu tun?
Das erste Mal war 1988. Um den 20. Juni herum erhielt ich die Nachricht, oder wie soll man es nennen? Es gab keine Botschaft, nichts Besonderes. Nachts hatte ich lebhaft geträumt, daran erinnere ich mich, ohne jedoch zu wissen, wovon ich geträumt hatte. Ein Gesicht war da gewesen, ein Gesicht, das ich nicht kannte, das eines jungen Mannes, Anfang zwanzig vielleicht, hübsch. Hübsch, wie ein junger Mensch mit dunklen Augen und langen Wimpern und roten Lippen eben aussieht, nichts Besonderes, noch zu jung vielleicht.
Und dann, am Mittag, ich war gerade im Café Tamar, um ein Beigel zu essen, schaute dabei der Besitzerin Sarah zu, die zwischen den Resopaltischen herumlief, mürrisch, weil morgens irgendein Schuft nicht bezahlt hatte, am Mittag dachte ich, dass ich nach Paris fliege.
An diesem Tag noch. Spätestens am nächsten. Der Gedanke war so stark, dass ich aufstand, um zum Reisebüro in der Allenby Street zu gehen.
He, willst du heute vielleicht auch abhauen, ohne zu zahlen?, schnarrte Sarah mich an.
Ich, das weiß ich noch genau, drehte mich zu ihr, verblüfft, verwirrt. Ich wolle zum Reisebüro, stammelte ich. Ich muss nach Paris.
Ihre blauen Haare standen nach oben, als wären sie elektrisch. Aber Sarah ist nicht der Mensch, in dessen Gegenwart man Gespenster sieht, jedes Gespenst würde einen Bogen um sie machen, sie hat gegen die Briten gekämpft, sie fürchtet nichts, allenfalls ihr Herz, an dem sie sterben wird. Damals war ich vierzig Jahre alt, und sie? Vielleicht sechzig? Irgendetwas muss in meinem Gesicht gewesen sein, während ich das Geld herauskramte und das Trinkgeld in das kleine Glas tat, das auf der Kasse steht. Was ist los?, fragte Sarah.
Ich muss nach Paris und weiß nicht warum, antwortete ich wahrheitsgemäß. Sie hielt meinen Blick.
Hat dir das jemand gesagt?
Ich zuckte die Achseln.
Sarah hat mir geholfen. Sie rief für mich im Reisebüro an. Sie sagte, ich werde das Flugticket abholen. Sie bürge für mich.
Als ich zurückkam, fragte sie nichts. Sie brachte mir einen frisch gepressten Orangensaft und ein Beigel mit Käse. Das war alles.
Shira und den Kindern erzählte ich von einer plötzlichen Schwäche meines Vaters. Sie glaubten mir kein Wort.
Als ich in Paris ankam, nach vier Jahren zum ersten Mal wieder, war ich müde und ratlos. Niemand erwartete mich, niemand rechnete mit meinem Besuch. Ich habe keine Geschwister. Meine Eltern lebten nicht mehr in Paris, sondern etwas außerhalb, in einem Haus in Jouy-en-Josas. Mein Vater hatte sich zur Ruhe gesetzt, das heißt, er arbeitete nicht mehr im Krankenhaus, behandelte aber noch zweimal in der Woche in einer Augenarztpraxis in der Nähe des Jardin du Luxembourg. Noch nie hatte ich mir in Paris ein Hotel gesucht.
Ich wollte erst eine Freundin, eine Schulfreundin anrufen, die einzige, mit der ich in Kontakt geblieben war. Ich malte mir aus, ihre Stimme zu hören, und dass es schön wäre, sie wiederzusehen, aber ich wusste, wir hatten uns wenig zu sagen, sie war Anwältin geworden, bei einem großen Stromkonzern, sie war verheiratet gewesen und wieder geschieden, sie hatte den schönsten Rücken und Po, und vermutlich hätte sie sich gefreut, mich bei sich aufzunehmen. Aber als ich ihre Nummer gewählt hatte, ihre Stimme hörte, legte ich wieder auf.
Ich nahm die Metro, fuhr zur Station Saint-Germain-des-Prés und lief zur Rue Jacob. Im Hotel Des Deux Continents nahm ich mir das kleinste Zimmer.
Es lag unterm Dach. Die Fenster standen offen, es waren zum Glück zwei, es gab ein Waschbecken, abgetrennt ein winziges Klo hinter einer braunen Lamellentür. Vom Dach gurrten Tauben.
Merkwürdigerweise fühlte ich mich nicht wie früher, nicht wie in meiner Kindheit, als mein Zimmer im vierten Stock lag, auf die Straße hinausging, im Marais, ich weiß nicht, warum mein Vater dort eine Wohnung nahm, vielleicht wollte er der Katastrophe – anders nannte er es nie – auf diese Weise nahe sein, denen, die aus den KZs zurückkamen. Wir wohnten in der Rue des Minimes, in einer großen Wohnung, vielleicht hatte meine Mutter sich geweigert, an den Stadtrand zu ziehen. In der Rue des Minimes hatte ich, als ich älter war, mein Zimmer unter dem Dach und meine Mutter ein Atelier im Hof.
Auf dem Bett im Hotel liegend, dachte ich daran, wie sie versucht hatte, das Atelier zu mieten, zwei Zimmer mit großen Fenstern, einer der Räume etwa vierzig Quadratmeter groß, wie lange es dauerte, bis mein Vater endlich einwilligte, und wie sie dann für Stunden, eigentlich für Tage verschwand, hungrig, glücklich und aufgeregt zurückkam in unsere Wohnung, in der eine Haushälterin, die meinem Vater auch als Sekretärin half, für Ordnung und Gleichmaß sorgte. Ich sah sie vor mir, mit leuchtenden Wangen, doch dann wurde das Gesicht meiner Mutter – obwohl ich an diesem Nachmittag vielleicht etwas begriff, das ich vorher nicht gewusst hatte – von dem des Jungen verdrängt. Mir war, als würden unsere Blicke sich treffen, die Empfindung war so deutlich, dass ich mich auf dem Bett, allein in dem kleinen Hotelzimmer, aufrichtete. He, rief ich ihm zu, wohin gehst du? Wieso?, antwortete er. Ich will zu meiner Freundin, sie wohnt in Maisons-Alfort, der Junge guckte frech zu mir. Was geht Sie das denn an?
Ja, was ging es mich an?
Ich habe dich nicht geholt, sagte ich ärgerlich zu ihm, ich sagte es laut. Er zog den Kopf ein, nachdenklich, nun sah er schon aus wie ein Schüler, mit einer heftigen Seitwärtsbewegung wollte er verschwinden, so, als müsste er sich ins Gebüsch schlagen, und wirklich, am Rand eines großen, kahlen Hofs, von Platanen umstanden, wuchs Gebüsch, und ein paar Kinder in dunkelblauen Jacken kamen angerannt, riefen etwas, das ihm, dem Jungen, galt, meinem Jungen, der das Gesicht verzog, nicht zum Weinen, nicht mehr zum Weinen, dachte ich, eher in einer Art Widerwillen. Was sie riefen, konnte ich nicht hören, aber ich hatte einen Verdacht.
Ich muss mich beeilen, sagte er, wieder älter geworden. Genau so: Ich muss mich beeilen. Er sagte nicht, warum, bewegte sich nur energischer voran, mir gab es einen Stich, würde er gehen? Ich lag ja immer noch da, allein, in dem Hotel, in meiner Heimatstadt, die mir so fremd war, angekommen in der Fremdheit von zwei Jahrzehnten.
Shira war nie gern in Paris, ich komme mir hier vor wie eine Bäuerin, hatte sie geklagt, und einmal sogar: Als wäre ich eine Deutsche! Spinnst du? Mir war nichts eingefallen, als sie anzufahren, die Idee war so absurd, Shira, eine Sabre, dritte Generation, dieser israelische Adel, aus Safed, die sich herabgelassen hatte, einen Halbjuden, mich, zu heiraten, einen, der konvertieren musste, um in Israel unter die Chuppa zu treten. Shira war blond und hatte blau-grüne Augen. Doch nicht deswegen fühlte sie sich wie eine Bäuerin, wie eine Deutsche, sondern weil sie sich unkultiviert vorkam. Meine Eltern besorgten Karten fürs Theater, obwohl Shiras Französisch miserabel war, sie besorgten Karten fürs Konzert, obwohl Shira keine klassische Musik mochte. Sie wollten mit uns in Museen gehen, damit wir auftanken könnten, aus unserer Wüstenei kommend, auftanken, sagte Shira einmal erbittert, nachdem wir im Musée de Cluny gewesen waren, auftanken zwischen lauter Gekreuzigten! Von meiner Kindheit wollte sie nichts wissen, ich konnte ihr nichts erzählen, dass sie die Straßen mit meinen Augen sah, von meinem Roller aus, meinem blauen Tretroller, den ich so geliebt hatte, oder von den kühnen Ausritten mit meinem Steckenpferd, das ich erst mit acht Jahren widerwillig hergegeben hatte, nachdem die Jungs im Viertel kreischend hinter mir hergerannt waren. Ich hatte mich auf die falsche Weise von der Stadt entfernt, war ausgerutscht, ausgeglitten, hinausgeglitten aus meinem Viertel, aus meiner Stadt, wie kann einem eine Stadt so fremd werden, derart gleichgültig. Doch stimmt es nicht ganz, die ganze Wahrheit war das nicht, und Shira bemerkte es. Du bewegst dich ganz anders hier! Du siehst ganz anders aus! Wie von selbst fand sich in meinem Elternhaus irgendetwas, eine Jacke, ein Hemd, eine Sonnenbrille, eine Mütze, das zu mir und hierher gehörte, nach Paris. Du sprichst anders! Der Akzent. Du riechst anders! Ich nehme dasselbe Rasierwasser wie immer. Das ist es nicht, sagte sie, es sind die Autos, die Steine, die Tauben, alles!
Komm mein Liebchen, wollte ich ihr sagen. Wie viel Zärtlichkeit wir vertan haben.
Ich lag auf dem Rücken und suchte nach dem Jungen, den ich nicht kannte und der mich nichts anging. Wo bist du? Er beeilte sich. Wohin? Ich wurde unruhig, gelähmt und unruhig, wie in den Zeiten der Depression, wie damals, als ich mich fragen musste, ob wir Kinder machen sollten, deren Vater ich nicht sein konnte. Ich war schuld, so viel war klar, und folglich musste ich eine Lösung finden, eine Lösung anbieten, und so groß das Problem war, eigentlich war es überall, es gab nichts, was davon nicht beschmutzt und beschädigt war, so unmöglich schien zu fassen, was eigentlich das Problem genau war, die Spermien, die Menge, ihre Beweglichkeit, denn impotent war ich nie, ich schlief mit Shira, sooft sie wollte, nur kam nichts dabei heraus. Und dann kam sie eines Tages nach Hause, verwirrt, verlegen, erzählte, sie habe im Café, in Sarahs Café, einen Mann kennengelernt, der mir ähnlich sah. Mehr sagte sie nicht, ich musste von allein darauf kommen. Sie bestellte mich am nächsten Tag hin, zeigte ihn mir und ging, ein Zahnarzt war es, ein Sabre, ich mochte ihn nicht besonders, auch wenn ich die Ähnlichkeit nicht leugnen konnte, und er amüsierte sich, er amüsierte sich einfach über mich und über Shira und vielleicht auch über sich selbst, und zwei Tage später, als ich in einer kleinen Bar in der King George Street mit meiner Frage, meiner Bitte herausrückte, sagte er einfach: Warum nicht?
Das war’s. Meine Depressionen wurden davon nicht besser.
Shira wurde also schwanger, bekam zwei Jungen, unsere Söhne, die nicht meine waren, und jetzt suchte ich, wie ein Idiot in mir gefangen, in meinem Gehirn, in meinen Eingeweiden nach diesem anderen Jungen, den ich nicht kannte, um den ich mich aber plötzlich so sehr ängstigte, dass ich es nicht aushielt und vom Bett aufsprang, um hinauszugehen.
Ruben, sagte er plötzlich. Ich heiße Ruben.
Er schaute sich um, ich sah, wie er eine Rolltreppe hinunterfuhr, Menschen, die sich an ihm vorbeidrängten. Es war längst später Nachmittag oder früher Abend, die Sonne neigte sich. Wo bist du?, murmelte ich, eine Passantin sah mich an, prüfend, dann lächelte sie, und ich lächelte zurück, sagte etwas über das schöne Wetter, dass ich gerade erst nach Hause gekommen sei, nach Hause, sagte ich tatsächlich, und sie blieb stehen bei mir. Ich wollte sie schon zu einem Kaffee einladen, da hörte ich plötzlich den Jungen, wie von fern, ein bisschen unruhig rief er nach mir, mit kleiner Stimme –.
He, was ist los?, sagte ich, als ich weitergegangen war.
Heiß hier, stickig, maulte er, wenn sie nicht gesagt hätte, ich dürfe über Nacht bei ihr bleiben, ginge ich lieber nach Hause.
Wo wohnst du denn?, fragte ich ihn und schaute auf die Häuser – ich war inzwischen in der Rue de Furstemberg, ging den Bogen, lief die Rue de l’Abbaye entlang, auf die Rue Saint-Benoît zu. Hier irgendwo?, sagte ich zu dem Jungengesicht, das blass geworden war, schwitzte, mir war auch heiß.
Ja, Scheiße, sagte der Junge. Dann hob er den Kopf irgendwie alarmiert. Was sagen die da? Was ist denn das für eine Ansage? Wie soll das denn jetzt gehen? Hier kommt doch keiner raus!
Ich stand in der Rue Saint-Benoît, vor der Nummer elf, und schaute hinauf zu den Dachgauben des hellgrauen Hauses. Ruben?, rief ich mit leiser Stimme. Im Restaurant gegenüber verschwanden ein paar Leute, ein Mann blieb stehen, guckte zu mir, fragend, als erinnerte er sich an mich, und als er seinen Begleitern etwas zurief, wusste ich, wir kannten uns wirklich, aus der Schule, aus dem Studium, wer weiß. Ich wandte mich ab und schaute an mir herunter, eine schäbige ausgeleierte Hose, ich hatte mich nicht fein gemacht für diese Reise.
Und allmählich bekam ich auch Hunger. Es war kurz nach sieben Uhr.
Etwas zu essen, dachte ich, oder ein Glas Wein.
Heute weiß ich mehr. Damals geriet ich bloß in einen komischen Zustand. In irgendeiner Brasserie trank ich ein Glas Wein, dann ging ich die Rue Bonaparte zur Seine hinunter. Trank ein weiteres Glas Weißwein. Es war die Stunde des Aperitifs, ein so friedlicher Sommerabend. In Berlin trinken wir heute wenig, ein Glas Wein vielleicht, allenfalls zwei. Früher in Tel Aviv haben Shira und ich gekifft, selten. Alkohol hat damals jedenfalls sofort gewirkt, aber natürlich war ich nicht betrunken. Der ganze Abend, sinnlos wie er war, kam mir ungeheuer anstrengend vor. Um halb acht etwa hörte man die ersten Krankenwagen. Inzwischen war ich an der Seine angelangt, am Quai Malaquais, dann stand ich auf dem Pont des Arts und schaute zum Pont Neuf hinüber.
Die Sirenen waren unüberhörbar.
Leute auf der Straße wurden unruhig und schauten sich um und suchten etwas. Hinter der Seine-Insel musste etwas geschehen sein, was immer es war, vielleicht ein Terroranschlag, so etwas. Terroristen.
Irgendwann rief ich zu Hause an und erzählte, dass hier dauernd die Sirenen heulten. Shira war kühl. Was machst du?, fragte sie.
Ich weiß nicht, antwortete ich. Das war die Wahrheit. Dass ich todmüde war und doch immer weiter herumlief, ohne etwas zu essen, ohne mich hinzusetzen. Irgendwo kaufte ich mir eine Flasche Mineralwasser.
Ich leerte die Flasche, kaufte eine zweite. Schaute zur Seine hinunter, am liebsten hätte ich mein Gesicht auf die Kaimauer gelegt, um einzuschlafen.
Hubschrauber flogen vorbei, verschwanden, kehrten zurück. Die Sirenen wurden irgendwann weniger. Es blieb warm, ich wollte nicht zurück ins Hotel.
Als ich gegen zwei Uhr aufgab, war die Hoteltür verschlossen, ich musste den Nachtportier wecken. Er wollte wissen, ob ich Kaffee bestellt habe. Auf acht Uhr, sagte ich und fragte mich, warum. Acht Uhr.
Ich wachte vorher auf. Ich wachte um kurz nach sieben auf, genau zwölf Stunden nachdem ein Zug in der Gare de Lyon in einen anderen gerast war, aber das wusste ich nicht. Vielleicht wachte ich auf, als irgendein Junge, ein junger Mann, der in dem Vorortzug gesessen hatte, starb, nachdem er bewusstlos oder auch wach darauf gewartet hatte, gerettet zu werden. Das wusste ich nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Wie von einem scharfen Messer getroffen, wachte ich um kurz nach sieben Uhr auf.
Es war hell. Ich erinnere mich, wie ich mich umschaute, nicht, weil ich nicht wusste, wo ich war, sondern weil ich jemanden suchte.
He, wo versteckst du dich?
Hier, sagte seine Stimme leise.
Wo ist hier?
Hier.
Irgendwann hörte ich es klopfen, das Tablett mit Kaffee und einem Croissant stand vor der Tür.
An dem Tag blieb es das Einzige, was ich zu mir nahm. Ich sagte, dass ich eine weitere Nacht bleiben müsse. Als ich mit dem Concierge sprach, fiel mein Blick auf die Zeitung: Zugunglück in der Gare de Lyon.
Das Foto zeigte zwei ineinander verkeilte Züge. Einen Sanitäter, der bei einem blutüberströmten Körper kniete. Im Hintergrund weitere Uniformen.
Der Concierge behielt mich im Auge, während ich die Zeitung anstarrte. Aber ich begriff nicht, noch nicht. Ich ging in mein Zimmer hinauf und schloss mich ein. Die beiden Fenster standen offen. Ich hatte mich nachts nicht ausgezogen, daran erinnere ich mich, und plötzlich merkte ich, dass mein Hemd nach Schweiß roch, nach meinem Schweiß und doch anders, wie von einem anderen Körper. Ich war unruhig deswegen, lief im Zimmer auf und ab, dann legte ich mich wieder auf das Bett, mit offenen Augen, müde und wach zugleich, auf dem Dach scharrten die Tauben, von unten klangen Stimmen herauf, Frauenstimmen, so dass es eine Weile dauerte, bis ich das andere hörte, ein Wimmern oder ganz leises Klagen, woher es genau kam, konnte ich nicht herausfinden, obwohl ich wieder aufstand und herumlief, sogar in den Treppenaufgang vor meinem Zimmer schaute, und aufs Dach schaute ich, als könne dort, auf dem First, bei den Schornsteinen und Tauben ein Kind hocken oder ein Junge, ein junger Mann.
Seine Stimme, und doch wieder nicht, nicht die Stimme eines jungen Mannes jedenfalls, auch nicht die eines Kindes – man hätte ihr keinen Körper zuordnen können, dieser Stimme, und sie war doch die eines Mannes.
Ruben?, flüsterte ich schließlich. Ruben, bist du das?
Ich blieb noch zwei Tage. Verließ schließlich das Zimmer, lief durch die Straßen, durch die Rue Saint-Benoît, zur Seine, sogar zur Gare de Lyon lief ich, der Bahnhof war nicht mehr abgesperrt, die Züge fuhren längst, ich stellte mir vor, von hier abzufahren, mit dem Nachtzug, irgendwohin, nicht zurückzukehren nach Israel, auch nicht nach England zu reisen, wo ich ein paar Onkel und Tanten mütterlicherseits hatte, auch nicht nach Deutschland, ein verbotener Ort für mich damals – ich wollte einfach abreisen und durch die Nacht fahren, ohne einen Grund zu haben. Ohne zu fragen, ohne gefragt zu werden.
So wie Ruben, denke ich jetzt, da ich das aufschreibe, so wie Ruben durch die Nacht reiste, wenn man so will. Irgendwohin. Ohne ein anderes Gepäck als Angst und Unsicherheit. Und vielleicht mit dem Gefühl, nicht anzukommen, aber doch etwas gefunden zu haben. Einen Modus. Etwas anderes. Ruben – oder genauer, seine Seele – musste sich daran gewöhnen, tot zu sein.
Bis dahin leistete ich ihm Gesellschaft.
Ich tat nichts. Ich blieb in einem Raum, der leer war. Stumm, voller Stimmen. Fremd.
Dies erste Mal wollte ich Beweise, wenigstens irgendeine Bestätigung, ich wollte etwas in der Hand haben, nicht, um es zu erzählen, um Shira zu erklären, was ich in Paris getan hatte, warum ich meine Eltern nicht besuchte, nicht einmal anrief. Ich brauchte es für mich. Ich musste herausfinden, was ich tat – oder nicht tat, schließlich war ich nur herumgelaufen, murmelnd, besorgt, tröstend, zornig, sprach einem Hirngespinst Mut zu oder einem Jungen, blieb ratlos mit ihm, einem Jungen, der meine Hilfe brauchte, weil er plötzlich aus dem Leben gerissen worden war, ohne Anzeichen, ohne Vorwarnung, ohne Schuld. Es war kein Schicksal, eines gewaltsamen, schrecklichen Todes zu sterben. Es war kein Schicksal, in einem zusammengestauchten, in sich verkeilten Zug zu verbluten, während die Helfer vergeblich versuchten, Metall wegzuschweißen, um zu den Sterbenden zu gelangen, und vermutlich schrie nach einer Stunde schon niemand mehr. Ich weiß nicht, ob Ruben bei Bewusstsein war, wie lange. Wie er leiden musste, wie er Angst leiden musste. Seine Seele litt und war voller Angst. Was soll ich jetzt tun, was muss ich jetzt tun? Ein hektisches, panisches Murmeln war das, dann stumpfes, mürrisches Schweigen. Nur ein Mal ein euphorischer Aufstieg, leuchtend, singend, die Wörter glitten hinauf, fingen sich in den Zweigen, tanzten weiter, er jubelte seiner Liebe zu, wie er bei ihr lag, sie umschlang, wie sie ihn aufnahm und sie einander mitrissen, verwirrt, schamhaft, zu ihr wollte er, war doch auf dem Weg zu ihr gewesen, die ganze Nacht sollte er bleiben, bei ihr, in ihrem Atem, der ihm noch einmal Sicherheit gab, bevor er anfing zu toben, zornig zu werden, und mir die Ungerechtigkeit vorhielt, warum bist du da, du, ausgerechnet, ich kenne dich gar nicht, du bist alt, hörst du, das spüre ich, alt, wärest du nicht gekommen, vielleicht würde ich noch leben, hörst du, vielleicht warst du es, der mir den Tod gebracht hat. Als wäre ich sein Todesengel gewesen, als trüge ich Schuld, nicht an dem Unglück, aber dass er dabei war. Warum musste er dabei sein, warum war er aus seinem Zug nicht ausgestiegen, er hätte seine Freundin anrufen können, hätte sie überreden können, zu ihm in die Stadt zu kommen, statt auf die Abfahrt zu warten, zu warten, eingezwängt, er hätte der Anweisung des Zugführers folgen können, den Zug sofort zu verlassen, hätte sich vorbeidrängen können, die anderen umrennen, vielleicht wäre er stark genug gewesen, er hörte die Stimme dieses Zugführers, dessen Angst, die letzten Sekunden, für ihn hatte es kein Entkommen gegeben. Und was hätte es bedeutet, wenn er die anderen zur Seite gestoßen hätte, vielleicht wäre er ein Krüppel geblieben, armlos, beinlos.
Scheiße, schrie ich ihn schließlich an, woher soll ich das denn wissen?
Du lebst doch! Du lebst doch, dann finde es heraus! Du hast doch alle Zeit der Welt, verdammte Scheiße, warum du und nicht ich? Finde es heraus!
Das Einzige, was ich herausfand, war, dass es ihn gab.
Ruben F., zwanzig Jahre alt. Wohnhaft in Paris, Rue Saint-Benoît. Student an der Sorbonne. Ich weiß nicht, was er studiert hat. Im Zug in der Gare de Lyon auf die Abfahrt wartend, um seine Freundin zu besuchen, die in Maisons-Alfort lebte.
Nichts, was einfacher wäre. In der Rue Saint-Benoît fand ich kein Zeichen, keinen Hinweis. Aber seine Eltern wohnten nicht so weit von unserer alten Wohnung, ein bisschen weiter nördlich, in der Rue de Turenne, das fand ich heraus. Denn in einer Zeitung stand sein Name: Ruben Fridland. Mir war, als hätten meine Eltern irgendwelche Fridlands gekannt.
Es war leicht, das Haus, die Wohnung zu finden: Sie saßen Schiv’a.
Ich tat, als wäre ich einer von diesen übergriffigen, religiösen Israelis, die denken, jeder jüdische Tote gehörte auch ein bisschen ihnen, und stieß die Wohnungstür auf, die nur angelehnt war. Rubens Eltern sahen mich verwirrt und müde an, wie man im Schmerz einen Fremden ansieht, einen Fremden, der etwas mit sich tragen könnte, eine Nachricht, eine Geschichte, eine letzte Botschaft vielleicht, der das Geschehene anders erzählen könnte, womöglich ungeschehen machen. Die Mutter stand auf und umarmte mich. Fester, als man je einen Unbekannten umarmen würde – sie war etwas älter als ich –, intimer, so, als würde sie den Jungen umarmen. Ihr Gesicht war fleckig und verstört, als sie sich endlich von mir löste, mied sie meinen Blick, alle schauten zu uns, und dann lief ich davon, als hätte ich Angst, sie würden mich verfolgen. Ich glaube auch, irgendjemand rief etwas, aber vielleicht war das Einbildung. Überall waren Geräusche, vorher hatte ich das nicht bemerkt, nicht die Stimmen von fern, vom Ende der Straße, oder aus einer Nachbarwohnung, Geräusche, die ich hörte, als spiele mein Gehör verrückt, und die Autos waren unerträglich laut und wie Leute husteten oder vor sich hinmurmelten, summten, wie die Tiere auch unablässig Geräusche machten, ich hörte es, ein paar Stunden lang, es war mehr, als ich hören wollte, aber ich hatte keine Wahl.
Es ist nicht so, dass ich den Glauben an irgendetwas gewonnen oder verloren hätte, an das Leben, an die Seele, an den Tod, irgendetwas dergleichen, es gibt keine Gedankengebäude, in denen ich mich geborgen fühle, auch keine Weisheit, die ich errungen hätte. Ich blieb, wer ich war. Und doch hatte sich etwas verändert, etwas, das in jeder Minute stattfindet, die ich über den Erdboden laufe, so, als wüssten meine Füße mehr als ich, als spürten sie die Haftung an der Erde. Und ich denke über den Tod nach, ich denke über den Tod nach, um über das Leben nachzudenken, weil es mir noch schwieriger scheint, über das Leben nachzudenken, über das wir doch angeblich viel leichter etwas in Erfahrung bringen können, aber ich grübele darüber, was es für ein Zusammenhang ist zwischen mir als Jungen in Paris und mir als Shiras Mann, zwischen dem, der das neugeborene Kind in den Armen hielt, und dem, der nach Hause kommt, müde, ein bisschen gereizt. Und wie unbemerkt gibt es ein kleines Gemurmel, etwas, das uns begleitet, die Kindheit, die Zärtlichkeit, das hilflose Altwerden, diese so schwer zu fassende Zusammenfassung, die unbegreifliche Tatsache, dass all das zusammengehört. Für mich fing es damit an, mit den Stimmen, mit dem Gemurmel. Rubens Stimme war es zuerst, seine Stimme, aber unhörbar, wollte ich lauschen, wurde sie zu leise, als dass ich etwas hätte verstehen können, sie begleitete mich, hartnäckig, manchmal zornig und manchmal zärtlich, es war kein Gesang, doch klang es zuweilen wie ein Lied, wie Verse, so wie ein Gedicht die Worte aneinanderreiht, eine Bedeutung findet und doch gleich wieder lässt, und nur der Klang der Buchstaben, der Silben bleibt, dann bildet sich wieder ein Wort, ein Satz, eine Stimme sagt etwas, ein Stimmchen, Laute, Seufzen, Atmen, etwas, das die eine mit der anderen Seite verbindet.
Darum ging es, auf die andere Seite zu kommen. Ohne zu wissen, wohin, ohne zu wissen, wie. Und ich, der ich nichts und noch weniger wusste als Ruben, sollte helfen, oder vielleicht nicht helfen, aber Gesellschaft leisten, bei ihm bleiben. In diesem Raum, der keiner ist, in diesem Zwischenraum, der mir Angst machte, der mein Herz sich zusammenkrampfen ließ vor Angst, vor Angst um mich, um meine Kinder. Ich wollte den Tod nicht anfassen.
Das, wo nichts war als diese Laute, Luft, Atem, kein Mund mehr, aber Atem, der schwächer wurde, und schließlich nur die Stimme oder der Schatten einer Stimme.
Im Hebräischen sind die Buchstaben karg. Nur das Gerüst, nur die Knochen, denn die Vokale fehlen ja, das Geschriebene ist nichts ohne den, der es ausspricht, ohne seine Spucke, seine Luft, ohne Lippen, Gaumen, Körper. Alles fehlt, ohne den Körper, und doch bleiben die Buchstaben, die Wörter, die Sprache.
Als ich wieder in Israel war, zu Hause, überfiel mich Shira mit einem Haufen Forderungen, sie wollte umziehen, sie wollte unser Leben ändern, sie wollte, dass ich mich änderte. Ein paarmal fragte sie, ob ich wirklich niemanden in Paris getroffen hätte, sie redete sogar mit meinen Eltern darüber, die natürlich gekränkt waren, dass ich sie nicht besucht hatte, aus lauter Ärger tat sie das, und dabei war ich gar nicht in der Lage, mit alldem zurechtzukommen, mit meiner Müdigkeit, einer Müdigkeit, wie ich sie vorher nicht gekannt hatte, mit Avi und Naim, die anfingen, aufmüpfig zu werden, obwohl sie erst knapp elf und neun Jahre alt waren, oder Shira hatte sie gegen mich aufgebracht, ich schleppte mich durch die Tage und ertrug ihre Frechheit, und am Wochenende ging ich mit ihnen ans Meer. Am Wochenende wollte Shira morgens ausschlafen. Wir gingen um acht, halb neun los, und manchmal dachte ich, dass sie den Vater der Jungs traf, dass er zu uns kam und mit ihr in unserem Bett schlief, ich fragte mich, ob ich es riechen würde, seinen Samen, ob er anders röche als mein Samen, der unfruchtbar war, ob es anders wäre, mit jemandem zu schlafen, der einen schwängern könnte. Dass Shira die Pille nahm, blieb mir nicht verborgen, sie behauptete, sonst zu sehr unter Stimmungsschwankungen zu leiden.
Wenn ich mich jetzt an diese Zeit zurückerinnere, als die Jungen klein waren, als Shira noch lebte und gesund war und wir uns liebten, es gab Nächte, die wir einer in den Armen des anderen verbrachten, wenn ich daran denke, wie ich mit Avi und Naim an den Strand hinunterlief und auf dem verlassenen Markt, in den schattigen Gassen ein Rudel wilder Hunde herumlief, wenn ich daran denke, wie wir ins Wasser rannten, uns nass spritzten und schrien, und ich schrie mit den Jungs mit, wenn die ersten kalten Spritzer meinen Bauch trafen, das Herz voller Fragen und Kummer, und während wir ins Wasser rannten und ich die Hände meiner Kinder spürte, rechts Avi, links Naim, meine Söhne, denen ich irgendwann sagen würde, dass sie nicht meine Söhne wären – wenn ich mich an all das erinnere, dann weiß ich, es stimmt: Der Messias verrückt alles nur um eine winzige Spur.
Irgendwann bekam ich einen Auftrag, der mich längere Zeit beschäftigen würde. Es war ein altes Haus hinter dem Hafen von Jaffo, in Ajami, damals, als Ajami noch vorwiegend von Palästinensern bewohnt wurde, als die Müllhalde gleich hinter dem Hafen begann, als Jaffo noch heruntergekommen und verschlafen war. Eine kleine Bäckerei gab es irgendwo auf dem Hügel, und es gab dieses alte Haus über dem Meer, das ich umbauen sollte, eigentlich standen nur noch die Mauern, eine Ruine war es, aber wir fanden die alten Kacheln, und in die Fenster sollten bunte Gläser eingesetzt werden, eine Bibliothek sollte es geben über zwei Stockwerke, es war ein großer Auftrag.
Morgens stand ich auf und schlüpfte ohne einen weiteren Gedanken an meinen Körper in eine Hose, ein T-Shirt, fuhr hinaus nach Ajami, ohne Angst, ohne Schmerzen, tauglich für das, was ich mir vorgenommen hatte, was mir aufgetragen war. Schlank war ich nie und auch nie hübsch, bestimmt nicht im Vergleich zu all den anderen jungen Männern, den Sabres, und Shiras Freunde aus der Kindheit waren größer als ich, athletisch, schön wie meine Söhne sind, das haben sie nicht von mir geerbt. Schaue ich jetzt Fotos an von damals, sehe ich, ich war gesund, und mein Gesicht, meine Gestalt gefallen mir. Im Spiegel habe ich mir damals nicht gefallen. Ich war nicht männlich, nicht kantig, ich konnte keine Kinder zeugen. War kein richtiger Mann, kein richtiger Jude, und nach Paris, nach Frankreich gehörte ich auch nicht mehr.
Dabei war ich unermüdlich, ich konnte vierzehn Stunden auf der Baustelle verbringen, die Arbeiter antreiben, planen, ihnen helfen, denn wir arbeiteten zusammen, das hatte ich geschafft, dass ich in Ajami Arbeiter gefunden hatte, Palästinenser, die das Jahr bei mir blieben, die mit mir lernten, was wir können mussten, um das Haus so umzubauen, wie ich es mir dachte, zu einem Ort, an dem die Menschen klar und leicht wurden, weil sie genug Platz hatten, weil sie in klaren, leichten Proportionen lebten. Die Bibliothek über zwei Stockwerke gelang, wir setzten die Galerie auf Stahlträger, verbanden den Boden des oberen Stocks mit der Wand durch einen Streifen Glas, so dass man hinunterschauen konnte in den unteren Teil des Zimmers, der Raum war voller Licht, ohne dass ich die alten Fenster vergrößern musste, die spitz zuliefen, wie in arabischen Häusern üblich, und sie schauten aufs Meer. Ich blieb dort abends manchmal allein zurück, saß in einer Fensterhöhlung und schaute in die Dämmerung, zu der Stunde, die im Hebräischen zwischen den Abenden heißt. Die Wahrheit ist, dass ich an Ruben nicht mehr dachte, überhaupt dachte ich nicht an die Tage in Paris zurück.
Ich kaufte mir eine Vespa. Eine rote, leuchtend rot, der Sitz aus hellem Leder.
Als ich damit nach Hause kam, behauptete Shira, ich hätte das nur gemacht, um mich bei den Jungs einzuschmeicheln.
Ich hatte niemandem davon erzählt, ich kam einfach angefahren, mit zwei Kinderhelmen, die erste Rate des Vorschusses hatte ich dafür ausgegeben. Dass ich die Vespa brauche, dass ich nicht jeden Tag mehr als eine Stunde im Stau stehen könne, weil ich irgendwo eine Kleinigkeit zu erledigen hatte. Dass ich wie verrückt arbeite, damit sie, Shira, weiter zu Hause bleiben könne und in irgendwelchen Galerien jobben, in denen sie nichts verdiene. Dass ich die Jungs mit der Vespa zum Musikunterricht bringen könne und dass sie, Shira, endlich endlich aufhören solle –
Mit was aufhören?, schrie sie mich an. Zu atmen? Zu leben?
Ich erinnere mich genau an die Gesichter der Jungen. Ich sehe sie vor mir, merkwürdig still, als ich Shira eine Ohrfeige gab. Was danach passierte, weiß ich nicht mehr, Shira lief weg oder ich, die Jungs gingen später am Abend noch raus, das weiß ich noch, trafen sich mit ein paar Freunden zum Fußball, ich holte sie in der Dunkelheit ab, aus dem kleinen Park zwischen Shenkin Street und Ba’alei Melacha, in den Bäumen hatten Flughunde ihre Schlafplätze, sie schossen durch die Dunkelheit, Naim träumte davon, einen zu zähmen, ich mochte sie nicht. Still war es, und ich hörte ihr Pfeifen, ich hörte oft die falschen Sachen seit Paris.
In dieser Nacht schliefen Shira und ich miteinander, ohne uns versöhnt zu haben.
Wir waren immer gut im Bett, sogar in miesen Zeiten blieb uns das, Shira sagte einmal, es wäre das Geschenk, das uns die Dibbukim zur Hochzeit gemacht hätten. Welche Dibbukim?, fragte ich. Sie zuckte die Achseln und sagte, dass ich deinen Körper mag, immer, dass ich deinen Schwanz mag, auch immer, dafür muss ein Dibbuk zuständig sein.
Daran dachte ich in dieser Nacht, als wir miteinander schliefen wie ein Liebespaar, obwohl wir nichts waren als alternde, müde Eheleute, die sich gestritten hatten und nicht wussten, ob sie sich versöhnen wollten. Shira hielt mich fest, so fest, dass es schmerzte, dann stieß sie mich weg und sagte: Wenn wenigstens du wüsstest, wo du steckst!
Wo soll ich schon stecken?, murrte ich und wandte mich ab, ich wollte nicht einschlafen, ich wollte aufstehen und gehen, am liebsten die Vespa nehmen und durch die Straßen fahren, bis es wieder hell wurde, bis ich zu meiner Baustelle konnte, wo mir Iunis etwas von seinem Frühstück abgeben würde, das tat er immer, ohne je darauf anzuspielen, dass meine Frau mir nichts mitgab, keine gekochten Eier, keinen Humus, keine Tomaten, nicht einmal das.
Wirklich stand ich etwas später auf, als ich dachte, Shira schlafe, schlich mich ins Bad und zur Wohnungstür. Da sah ich Naim im Flur stehen, im Schlafanzug, so ein hellblauer Jungs-Schlafanzug, und er stand gerade aufgerichtet wie eine Schildwache, träumend, er war gar nicht wach, er verzog nicht einmal das Gesicht, als er mich sah, falls er mich sah. Er stand da und bewegte sich nicht von der Tür weg. Und ich ging ins Wohnzimmer, legte mich aufs Sofa, versuchte gar nicht erst, ihn ins Bett zurückzubringen, wollte nicht wieder in unser Bett. Nach Avi schaute ich nicht. Ich schlief ein, schlief, bis die anderen weg waren, die Jungs in der Schule, und Shira war auch weg. Dann fuhr ich zur Arbeit.
Iunis stand vor der Mauer und wartete auf mich. Er strahlte, als er mich auf der Vespa kommen sah, und statt zu arbeiten, fuhr ich mit einem nach dem anderen eine Runde durch Ajami, über die Sandwege, bis zu den Klippen und wieder zurück, schlingernd, holpernd, die Möwen kreisten über der Müllhalde, die Männer schrien auf, wenn wir in ein Schlagloch fuhren, sie klammerten sich an mir fest, und auf den Hügeln tauchten Kinder auf, rannten auf uns zu, fuchtelten mit den Armen. Iunis’ Frau kam mittags und brachte uns allen Essen, sie hatte Salat gemacht und Labane, es gab frisches Brot mit Sa’ata, Humus, Zwiebeln, gekochte Eier, Borrekas mit Spinat. Die Vespa stand unweit unseres Sitzplatzes, alle wollten sie sehen beim Essen. Najib, der Jüngste von uns, wischte ihr den Staub ab, bevor er sich neben mich setzte, er strahlte mich an und sagte, jetzt werde er auch endlich den Führerschein machen, damit er einmal mit meiner Vespa durch Tel Aviv fahren könnte, von Jaffo bis zum Hafen im Norden, bis nach Reading, zu dem Kraftwerk, er werde über die Dünen reiten, und zum Dank werde er mich einmal mitnehmen, in den Gazastreifen, wo seine Familie lebe und Pferde habe, die schnellsten und kühnsten Araber, und dort werde er mit mir den Strand entlanggaloppieren.
Und ich war mit ihm im Gazastreifen, ich habe seine Familie besucht, und wir sind den Strand entlanggaloppiert.
Dass ich Shira geschlagen hatte, lastete auf mir, nicht so sehr die Ohrfeige selbst, sondern etwas anderes. Ich hatte sie schlagen wollen.
Es war nicht der blinde Moment irgendeines Zorns oder irgendeiner Enttäuschung gewesen, sondern Groll, ein tiefer Groll, auch Kummer meinetwegen, aber Kummer ist etwas anderes, Kummer ist immer der Anfang eines Satzes, Groll dagegen das Ende, nachdem man den Satz vergessen hat und nur die bittere Empfindung bleibt. Nicht, was sie war, brachte mich auf gegen Shira, sondern was ich nicht war, was wir gemeinsam waren. Dieses Paar. In diesem Land, in dieser Stadt, wer wir waren, auf eine so ausweglose Weise, wer wir waren, Shira, Skip. Vielleicht würden wir eine Wohnung kaufen wie die anderen, vielleicht würde ich Segeln lernen, wie andere Männer in meinem Alter, vielleicht würden wir Arabisch lernen, und die Kinder würden größer sein, bald schon, so dass wir abends wieder würden ausgehen können, vielleicht sogar tanzen. Vielleicht würden wir unser Leben ändern oder uns. Shiras Eltern waren im vergangenen Jahr gestorben, ihr Vater war alt gewesen, und ihre Mutter war kurze Zeit nach ihm an einer Entzündung gestorben, Shira und die Jungs vermissten sie manchmal, aber wir mussten wenigstens nicht mehr zu ihnen am Freitagabend, um ein langweiliges Shabbat-Essen mit ihnen und Shiras Bruder, dessen Frau und zwei Töchtern über uns ergehen zu lassen, ein Essen, das uns nicht schmeckte, wir waren frei. Vielleicht würden wir eines Morgens aufwachen, und alles würde von uns abgefallen sein, alles, was an uns klebte, und wir könnten noch einmal aufbrechen. Denn wo ich jetzt auch hinsah, sah ich eine Grenze. Und war es nicht so? Wir waren vom Meer, von den arabischen Ländern umgeben, die uns feindlich waren. Was mir fehlte, waren nicht Reisen, die wir uns nicht leisten konnten, nicht die Unbekümmertheit anderer Länder, wie wir sie uns, in Israel, vorstellten. Shira behauptete, mir fehle das echte Interesse am Leben, an unserem Leben, so wie es war, mir fehle das Bewusstsein, wie kostbar unser Alltag war, wie gefährdet. Wir müssten, sagte sie, dankbar sein, dankbar, dass wir überhaupt lebten. Und dass ich nichts begriff, weil ich kein Israeli war, kein echter Israeli, weil ich kein Vater war, kein echter Vater. Das sagte sie nicht, aber es war, was ich spürte, was ich argwöhnte. Ich war nicht einmal ein echter Architekt, ich baute ein Haus um und aus, und ich verdiente kaum genug Geld, uns alle zu ernähren, obwohl ich nach Paris flog, nur, weil ich einer inneren Stimme folgte. Und ich kaufte mir eine Vespa, nicht irgendetwas Japanisches für das halbe Geld.
So starrten wir uns an, Shira und ich, fragten einander voller Ressentiment, wo steckst du? In welchen elenden Winkel deines Lebens hast du dich eigentlich verkrochen? Denn Shira, die schön und begabt gewesen war, jobbte in Galerien, die auch Schmuck verkauften, weil die ausgestellten Künstler nicht gut genug waren. Angeblich war sie auf der Suche nach den wirklich guten jungen Künstlern, die es dann aber nicht gab, oder es gab sie, aber sie wechselten zu einer anderen Galerie, und Shira verschwendete ihre Zeit meistens mit irgendwelchen Idioten und stopfte ihren Kleiderschrank mit immer mehr Kleidern voll.
Über all das hätte ich vielleicht mit meiner Mutter sprechen können, sie, die nie ganz in Paris zu Hause war, die nie als Künstlerin ihren Platz fand, hätte mir vielleicht einen Hinweis geben können, der mir fehlte, um wieder Fuß zu fassen, auf einem Bein wenigstens, vielleicht auch mir zeigen können, dass ich ja doch stand, auf zwei Beinen sogar, mitten im Leben, wo auch sonst?
Bring das deiner Frau, sagte abends, als ich von der Baustelle aufbrach, Iunis und gab mir, in ein Tuch eingeschlagen, einige Borrekas mit, er sah zu, wie ich den Sitz hochklappte, die Borrekas darunter verstaute. Sie braucht auch einen Helm, sagte er.
Vielleicht hat uns das gerettet.
Man verschließt sich gegen einen Menschen in einem Streit, vielleicht öffnet man sich ihm einige Tage lang nicht, weil man grollt, weil man sich schämt, weil man müde ist – und plötzlich lässt sich das Herz nicht mehr öffnen, es scheint verklebt, der Blick ist träge, er sieht nicht mehr, was gefallen könnte, sondern nur Enttäuschung, Argwohn, der Groll dauert an, und dann ist es zu spät, der Weg scheint voller Barrieren oder einfach verschwunden, als hätte es nie einen Weg gegeben, als wäre jedes Lächeln, jeder gemeinsame Gedanke eine Illusion. So viel Zufall regiert uns, Zufall, der uns weismachen will, wir könnten nichts mehr entscheiden. Doch wir sind es, die entscheiden.
Eigentlich, so denke ich jetzt, da ich dies aufschreibe, eigentlich wollte ich damals nicht glauben, dass auch Shira eine Seele hatte. Wenn sie seelenlos war, so war ich frei.
Iunis stellte sich mir in den Weg, da war es ein Weg. Also kaufte ich Shira einen Helm.
Und ich sagte ihr: Komm.
Wir ließen die Jungs allein zu Hause. Sie taten, als würden sie uns nicht kennen. Sie schauten nicht auf, als wir ihnen sagten, in einer Stunde sind wir wieder da.
Ich fuhr langsam, sie hielt sich an meiner Taille, irgendwann schlang sie ihre Arme um mich, einmal legte sie ihren Kopf auf meine Schulter. Es wurde Abend, der Abend war still, im Westen zogen Wolken auf, doch war es warm, vom Meer wehte der Wind durch die Straßen, noch versperrte kein Hochhaus den südlichen Strand. So habe ich immer Tel Aviv geliebt, wenn die Hitze nachließ, der Lärm, wenn der Tag ohne Unglück vergangen war, wenn die Aufmerksamkeit nachließ und alles sanfter wurde, die Gesichtszüge der Menschen, das Antlitz der Stadt.
Ich fuhr Shira an der Baustelle vorbei, an meinem Haus – ich hätte es gerne für uns besessen. Wir fuhren weiter, Shira fragte, ob ich umkehren und bei Abulafia, dem Bäcker, etwas holen wolle, ich sagte, ich habe etwas zu essen dabei. An einem Kiosk hielt ich und kaufte zwei Flaschen Bier. Was willst du?, fragte Shira. Ich fuhr sie den Hügel hinauf, dahin, wo niemand mehr war, nur die Reste der Handwerker, Schreiner, Schuster und Schneider, die ihren Müll auskippten, es war schon verboten, die Müllhalde war geschlossen, aber wir fanden ein ausgestopftes Reh, wir fanden die hölzernen Schusterleisten, auf die früher Schuhe genäht worden waren, zerschlissene Kleider, eine Kommode ohne Beine, einen alten Sessel. In den Sessel setzte sich Shira. Sie schaute still übers Meer, man sah ein paar Schiffe weit draußen. Als Kind habe sie immer darauf gewartet, einen Walfisch zu sehen, denn wo sollten Walfische sein, wenn nicht bei Jaffo? Und in ihren Träumen tauche noch immer der Wal auf, sagte Shira, und manchmal denke sie, er sei ein Bote, ein Bote für irgendetwas, das sie nicht verstehe und das mit mir zu tun habe, sie warte, dass endlich geschehe, worauf sie warte, ohne zu wissen, was es sei.
Ich weiß nicht mehr, ob ich sie fragte, nach dem Traum, was er mit mir zu tun habe, und ob ich sie küsste, ich weiß auch nicht, ob wir miteinander schliefen, in der Dämmerung oder Dunkelheit, im Stehen oder auf dem alten Sessel. Ich frage mich, warum nichts geblieben ist, anders, als von unserer zweiten und letzten Fahrt, ein paar Jahre später, warum sich an diesen Abend keine Erinnerung einstellen will, keine Empfindung sich zurückrufen lässt. Damals muss ich doch bewegt oder sogar aufgewühlt gewesen sein, denn ich kehrte am nächsten Abend zur Misbele zurück, dem alten Müllplatz überm Meer, ich wollte einen der Schusterleisten holen, um ihn aufzubewahren, ich weiß nicht, warum. Zuerst fand ich nur den Sessel wieder, suchte weiter zwischen den kleinen gelben Blumen, zwischen dem harten Seegras, und da, in einer Mulde, sah ich ihn, einen Esel.
In einer Mulde fand ich ihn, grau, nicht sehr groß, nicht sehr dünn, er atmete, das sah ich sofort, auch, dass er starb. Einen Moment schaute ich gedankenlos, nichts dachte ich, nichts empfand ich, Unbehagen, Schrecken, Leere, nichts dachte ich, ich hatte Menschen sterben sehen, meine Großmutter, meinen Großvater, einen Freund sogar, der im Sechs-Tage-Krieg verwundet worden war, aber nie ein Tier, nie hatte ich ein Tier sterben sehen. Der Esel hob den Kopf, vielleicht fünf Zentimeter, er wollte wohl sehen, wer ich war, was ich tat. Ob ich eine Gefahr war. Warum stirbst du?, fragte ich ihn.
Ich schaute mich um, ob nicht jemand in der Nähe wäre, jemand, den ich herbeiwinken könnte, jemand, dem der Esel gehörte, der bei ihm bleiben müsste, damit ich gehen könnte.
Der Esel hatte den Kopf wieder sinken lassen, er atmete mühsam, es sah aus, als würde er schwitzen, das Fell war feucht, ich hockte mich neben ihn.
Und jetzt?, fragte ich. Er seufzte, öffnete die Augen. Seine Augen fanden mich und meine Augen, sonst war niemand da, so streckte ich die Hand aus und streichelte seinen Kopf, die Nüstern zitterten, ich fing an zu sprechen, erzählte von meinen Söhnen, die morgens den zweiten Tag stumm das Haus verlassen hatten, als wüssten sie nicht, was sie mit mir sprechen sollten, als gäbe es keine Wörter zwischen uns, meine Angst war das, meine größte Angst, ihr Verstummen. Schweigen. Schweigen um mich herum.
Manchmal dachte ich, wegen dieser Angst, wegen dieses Schweigens, vor dem ich mich fürchtete, sei ich nach Israel gegangen, in ein redseligeres Land, als es Frankreich gewesen war, nach Tel Aviv, in eine laute, unbekümmerte Stadt, und manchmal dachte ich, das sei beinahe eine Strafe, die Hiobs Strafen gleichkomme, hier auch ein Schweigen zu finden, es deutlich zu hören, hilflos zu bleiben, während etwas sich entfernte, zusehen zu müssen, ohne etwas beeinflussen zu können. Ich grollte Shira, aber ich hatte auch um sie Angst. Wenn sie sterben würde? Wenn sie mich allein ließe mit den Jungs, die ich so gerne gezeugt hätte, ich, mit meinem Samen, mit meinem Schwanz?
Dabei ahnte ich nicht, dass Shira krank werden würde. Ich hockte mich neben den Esel, streichelte ihn, sogar seine Nüstern, seine vielleicht todkranken, ansteckenden Nüstern, ich streichelte alles, Backen, Hals, mit dem Finger das Jochbein, und er entspannte sich allmählich, wurde ruhiger, er dachte ans Sterben. Daran, dass es sein musste, dass jetzt Zeit war.
Armer Kerl.
Dann starb er.
Die Wahrheit ist, er öffnete noch einmal das Auge, ich sah ja nur das eine, das rechte Auge. Er öffnete es und schaute mich an. Wie ein Mensch. Vielleicht nur trauriger, es war so ein großes Auge. Dann schloss er es wieder. Und ich blieb bei ihm, blieb, bis er längst aufgehört hatte zu atmen, bis ich spürte, dass mit der hereinbrechenden Nacht und Kühle auch sein Körper kühl wurde.
Ich blieb, als müsste ich jedes Grad Wärme, das seinen Körper verließ, bezeugen.
Sobald das Dach meines Hauses in Ajami fertig war, fuhren wir nach Paris, zu meinen Eltern, die längst ungeduldig geworden waren und schließlich jede Woche angerufen hatten, um zu fragen, wann wir kämen, seit sie von meiner Reise erfahren hatten, wollten sie wissen, ob wir sie nicht mehr besuchen mochten, sie waren doch gekränkt, und vielleicht hatten sie auch Sehnsucht, mich zu sehen.
Sie wollten auch, dass ich mit Shira und den Jungs käme, mit ihren Enkeln, wie sie dachten, und es waren ja auch ihre Enkel, sie wollten sicher sein, dass ich nicht fremdging, mit einer fremden Frau, ausgerechnet in Paris, unter ihren Augen gewissermaßen. Ob sie Shira mochten? Vielleicht. Es spielte keine große Rolle, und es hätte doch eine Rolle spielen sollen. Die Ehe musste respektiert werden, jede Ehe, die Familie, jede Familie, das Einzige, wie mein Vater sagte, wo wir heilig sind und auserwählt. Ich habe mich nie auserwählt gefühlt, auch nicht von Shira. Und meine Söhne? Meine Söhne, meine Söhne –
In diesen Tagen alterte meine Mutter, als hätte sie darauf gewartet, dass ich käme, als wollte sie mich zum Zeugen.