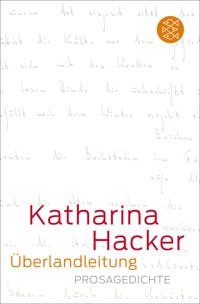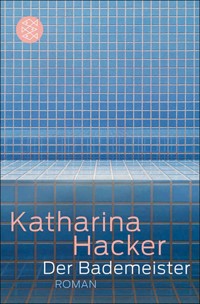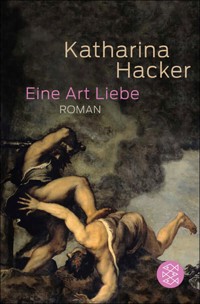
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von Freundschaft, Verrat und Schuld, die Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Eine deutsche Studentin, die im heutigen Israel ihren Weg zu finden sucht, erzählt die Geschichte dreier Personen: Sie erzählt von Jean, einem französischen Trappistenmönch, der unter seltsamen Umständen in Berlin umgekommen ist, von Moshe, seinem Schulfreund, der als Kind unter anderem Namen in Frankreich die Nazi-Herrschaft überlebt hat und nach Israel emigriert ist, und vom eigenen Entschluß, die dunkle Vergangenheit auszuleuchten. Das Rätsel um Jeans Tod ist Anlaß für die Recherche der Erzählerin und der Beginn aufkommender Fragen über Freundschaft und Verrat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Katharina Hacker
Eine Art Liebe
Roman
Fischer e-books
Für Saul Friedländer
»Daher ist das Nachvollziehen einer Geschichte ein schwieriger, mühseliger Prozeß, der unterbrochen oder blockiert werden kann. Eine Geschichte, so sagen wir weiter, muß letztlich annehmbar sein; man müßte eigentlich sagen: sie muß es trotz allem sein.«
Paul Ricœur
1. Kapitel
Drei Wochen nach Jeans Tod besuchte ich Moshe. Zum ersten Mal seit Jahren fuhr ich direkt vom Flughafen nach Jerusalem. Jean war in seinem Kloster Sept-Fons beerdigt worden, Moshe wenige Stunden vor mir in Israel eingetroffen.
Die Tür stand offen. Er saß in dem niedrigen, etwas schäbigen schwarzen Sessel, in dem er meistens sitzt. Obwohl Ende Januar, wärmte die Sonne, es waren mindestens vierzehn Grad, zwanzig Grad mehr als in Berlin. Moshe trug einen dunklen Anzug, er hatte abgenommen, als ich ihn umarmte, erschrak ich, er kam mir zerbrechlich vor. Er war 68 Jahre alt, sah jünger aus, das Gesicht schmal, auf Stirn und Kinn zeichneten sich blaß die beiden Narben ab, die er sich im Oktober bei einem Autounfall zugezogen hatte, sein dunkelblondes Haar war jetzt fast weiß. Ich bin einen halben Kopf größer als er, zum ersten Mal fiel mir das auf.
Der Fußboden glänzte, alles war aufgeräumt und sauber – das Verdienst von Tess, der philippinischen Haushaltshilfe –, das Sofa neu bezogen. Moshe winkte mir, ich solle mich setzen. Der lange Wohnzimmertisch verschwand fast unter Papieren und Stiften, unter Briefen, Rechnungen und den Notizzetteln, die mir Moshe manchmal schickt. Er las eine Aktennotiz, vermutlich von seinem Kollegen und Nachfolger in der Kanzlei, stand kurz auf, um mir ein Glas Wasser zu bringen – gleich gibt es Kaffee, sagte er –, und las schon weiter. In den letzten Monaten war so viel geschehen, daß ich nichts dagegen hatte, still dazusitzen und Moshe anzuschauen. Er ist ein gutaussehender Mann, etwa ein Meter fünfundsiebzig groß, vielleicht wirkt er durch seine lebhaften, abrupten Bewegungen kräftiger, als er ist, durch die Ungeduld und Entschiedenheit, mit der er reagiert, meist schneller als sein Gegenüber, meist unerwartet, und oft begreift man erst Stunden oder Wochen oder Jahre später, warum er gesagt oder getan hat, was er gesagt oder getan hat. Ähnlich ist es mit seinem Gesicht: erst nach einer gewissen Zeit bemerkt man, wie sich die dichten Brauen über den Augenhöhlen wölben, wie fein die Flügel der kräftigen Nase geschwungen sind, und plötzlich wirken die Gesichtszüge fragend und sogar traurig, die Entfernungen nicht überbrückbar. Wir kannten uns im Januar 1999 seit mehr als acht Jahren.
Als er aufstand, abrupter als nötig – er will mir zeigen, daß er sicher auf den Beinen ist, schoß es mir durch den Kopf –, sah ich, wie abgeschabt der Bezug des Sessels war. Vor dem Fenster pfiff ein Vogel Bulbul, ich glaube, ich begriff erst da, daß ich in Israel angekommen war. Moshe setzte Kaffee auf, schnitt Kuchen ab (sicher hatte Tess ihn gekauft), alles zu rasch, als daß ich ihm hätte helfen können. »Datteln mußt du dir morgen selber kaufen«, sagte er, auf eine Schale mit Obst zeigend. Von der Beerdigung erzählte er nichts.
Die Wohnung liegt im Souterrain, auf abschüssigem Gelände, so daß sich der hintere Teil zu einem kleinen Gartenstück, einer Wildnis aus ungeschnittenem Gras und Brombeerbüschen öffnet.
»Wenn du schon so lächerlich lang bist, solltest du wenigstens essen.« Moshe wirkte müde. Aber als er aufzählte, was in absurder Abfolge passiert war, sahen wir uns an und fingen an zu lachen: unberechenbare Schwindelanfälle, Verdacht auf einen Hirntumor, der Brief seines Freundes Jean, ein Autounfall, die erfolglose Suche nach Jean in Frankreich, die Todesnachricht. »Fehlt nur noch, daß die Wohnung abbrennt und Batsheva mich verläßt«, spottete Moshe.
Kurze Zeit später rief Batsheva an und fragte, ob ich noch bei Moshe sei. In einem Autobus der Linie, die ich in Tel Aviv immer benutze, war eine Bombe explodiert. Wir schalteten den Fernseher ein. Acht Tote, mehr als zwanzig Verletzte.
Moshe bat mich, bei ihm oder Batsheva zu übernachten, statt nach Tel Aviv hinunterzufahren. »Oder möchtest du, daß ich die ganze Nacht wach liege?« Aber ich wollte nach Tel Aviv, ich sehnte mich nach dem Meer und dem Zimmer, das ich dort immer miete, der Gedanke, in Jerusalem aufzuwachen, bedrückte mich. Ich fahre eigentlich nur noch nach Jerusalem, um Moshe zu besuchen.
Unwillig brachte Moshe mich zum Busbahnhof. Ob er überlegte, wie er mich zurückhalten könne? »Du schreibst doch«, sagte er. »Ich schenke dir Jeans Geschichte, schreibe sie auf.«
Ich war überrascht: Moshe hatte über meine Bücher bisher immer kritisch und oft spöttisch gesprochen. Wir hatten den Busbahnhof erreicht, ich sah, daß der 415er zur Abfahrt bereitstand. Hastig umarmte ich Moshe und versprach anzurufen, sobald ich angekommen sei.
Während der einstündigen Fahrt dachte ich über Moshes Geschenk nach. Die wenigen Fahrgäste waren still. Als wir die Ebene erreichten, schaltete der Fahrer das Radio ein, der Nachrichtensprecher und Augenzeugen berichteten Einzelheiten über das Attentat, da wurde mir klar, daß ich in Jerusalem hätte bleiben sollen.
Gleich nach meiner Ankunft rief ich Moshe an. »Und«, meldete er sich ungeduldig, »hast du über meinen Vorschlag nachgedacht?«
»Wenn du willst, versuche ich es.«
»Gut, und sei übermorgen um fünf Uhr bei mir, wir gehen spazieren.«
Ich konnte nicht schlafen und fing in der gleichen Nacht zu schreiben an. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Manuskript abgegeben, seither plagte ich mich mit der Übersetzung eines langen Romans. In den folgenden Tagen schrieb ich zwanzig Seiten, es ging mir leicht von der Hand. Den Tisch hatte ich ans Fenster gerückt, der dicke Vorhang ließ sich weder mit List noch mit Gewalt ganz zurückziehen. Ich stellte mir vor, daß Jean die letzten Wochen seines Lebens in einem ähnlichen Zimmer verbracht hatte. Moshe erwartete von mir keinen Tatsachenbericht. Mittags lief ich zum Meer hinunter, traf mich mit Freunden, und alle zwei Tage fuhr ich nach Jerusalem, zu Moshe. Wir gingen auf den Markt und kauften Datteln, er führte mich und Batsheva zum Essen aus. Das Wetter schlug um, Moshe gab mir seinen Regenschirm. Ein paarmal gingen Gewitter nieder, aber Schnee fiel nicht.
Nach Berlin zurückgekehrt, las ich, was ich geschrieben hatte. Es war schlecht, und ich ließ es liegen. Moshe hatte mich diesmal nicht drängen müssen, Sebastian zu besuchen, Sebastian, der vor Jahren mein Freund gewesen war, den ich verlassen hatte, als ich in Jerusalem studierte, meine große Liebe. Im Frühjahr fuhr ich mehrfach nach Freiburg, auch sonst reiste ich viel. Schließlich zog Sebastian nach Berlin. Wir lebten in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen, und ich versuchte zum zweiten Mal, Jeans Geschichte aufzuschreiben. Nach achtzig Seiten war auch dieser Versuch mißglückt. Mit jedem Ortswechsel kann eine Geschichte aus den Fugen geraten. Die Geschichte ähnelt einem Glas, das – in Zeitungen und schmutzige Wäsche verpackt – die Reise nicht überstanden hat.
In dem Jahr, das auf Jeans Tod folgte, dem Jahr, in dem Sebastian nach Berlin zog, fuhr ich dreimal nach Israel, einmal – im Herbst – begleitete mich Sebastian. Jedesmal blieb ich drei Wochen. Wir sahen uns oft, Moshe und ich; er war manchmal gesund und manchmal nicht, häufig spottete er über mich, ungeduldig wie im ersten Jahr unserer Freundschaft, über das wir oft sprachen. Als prüften wir uns und unsere Freundschaft unter veränderten Bedingungen.
»Mir fällt das Reisen schwer«, sagte ich zu Moshe. Er sah mich belustigt, beinahe empört an. »Von welchen Reisen sprichst du denn? Von deinem komfortablen Dahin, Dorthin, wie es uns beliebt?«
»Willst du«, verteidigte ich mich, »daß ich mit dem Schiff nach Palästina fahre und drei Wochen mit Malaria in einem verdreckten Krankenhaus in Haifa liege? Und dann darf ich auch übers Reisen reden?«
Aber ich wußte, was er meinte.
Im Frühsommer 1938 leerte sich die Charlottenburger Wohnung der Feins. Möbel wurden herausgetragen, um bei Freunden eingelagert zu werden, jedes Stück von seiner Mutter noch einmal sorgfältig poliert, in große, hölzerne Kisten wurde das Geschirr verpackt, in Holzwolle die Gläser, Gegenstände wurden unsichtbar, eine geschäftige Operation verbarg, was endgültig war. Mit seiner Kinderfrau schickte man Moses zu langen Spaziergängen. Eine große Reise würde es sein, sagte man ihm. Der Lehrer, der ihn seit seinem sechsten Geburtstag zu Hause unterrichtet hatte, blieb weg. Die Kinderfrau führte Moses in den Tiergarten; er wollte in den Zoo, das war nicht möglich. Um ihn zu trösten, weil er auch diesen Sommer nicht eingeschult wurde, versprach sein Vater, ihn bald selbst zu unterrichten.
Der Tag der Abreise (große Koffer, zwischen denen seine Mutter hin- und herlief, während der schmale Vater am Bahngleis stand, mit hängenden Armen und still wie ein Signalpfosten) war mild, das dicke, pelzgefütterte Mäntelchen viel zu warm, Moses weinte und wollte es ausziehen.
Er erinnert sich, daß ihm heiß gewesen war (es war Anfang Juni), wie er weinte, weil er den Mantel nicht ausziehen durfte. An die Zugfahrt und Ankunft in Paris erinnert er sich nicht, vage nur an das enge Hotelzimmer, an Nächte, in denen seine Eltern das Zimmer verließen, im Glauben, er schliefe. Fremde Stimmen drangen ins Dunkel, Schatten zogen einer hinter dem anderen aus den Ecken, sammelten sich um das leere Bett seiner Eltern, als suchten sie nach ihnen. Die Eltern hatten ihm gesagt, er müsse leise sein, schon während der Zugfahrt hatten sie es befohlen. Er schwieg, bis heute kann er in einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht laut sprechen.
Er wußte nicht, wohin seine Eltern nachts, wohin sie tags- über gingen, wenn sie ihn alleine ließen, um müde, mutlos zurückzukehren.
Seine Mutter trat rasch ins Zimmer, wo er auf ihrem Bett saß und wartete, zog die Tür hinter sich zu, bevor sie ihn fest an sich drückte. Sein Vater kam herein, sah ihn kaum an, stand am Fenster, stundenlang, ohne sich umzudrehen.
Er hörte sie sagen, daß sie Arbeit suchten und eine Wohnung. Er wollte nach Hause, wo seine Mutter den ganzen Tag über bei ihm blieb.
Sie hatten Mühe, sich mit ihrem schlechten Französisch durchzuschlagen, später war ihm das seltsam vorgekommen, später, als sie alle drei es längst fließend beherrschten und, wenn sie alleine waren, zuweilen die Sprachen mischten.
Sie baten Bekannte aus Berlin, die ebenfalls nach Paris geflohen waren, um Hilfe, es fiel ihnen schwer.
Schließlich fanden sie eine kleine Dachwohnung, seine Mutter fing an, ihm und sich selbst aus einem Lehrbuch Französisch beizubringen.
Er durfte sie begleiten, manchmal führte sie ihn in einen Park, wo andere Kinder spielten. Sie zeigte ihm den Eiffelturm, sie trug einen grünen Mantel und einen Hut, der schief auf ihrem Kopf saß. Er spürte, daß sie mit ihm über etwas reden wollte und nicht wußte wie, daß sie ihn überreden wollte zu etwas, das sich gegen seinen Vater richtete, der mager geworden war und sich oft räusperte. Moses wollte nicht hören, was seine Mutter über seinen Vater sagte, aber danach weigerte er sich, ihn zu umarmen. Eines Freitagabends brachte sein Vater eine Kerze mit und zündete sie an, wobei er mit einer Hand seinen Kopf bedeckt hielt, wie um sich zu verstecken.
Moses schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer. Seine Eltern hatten die Wohnung möbliert von einer jungen Frau gemietet, die ihn manchmal rief, wenn sie ihn im Treppenhaus herauf- oder herunterlaufen hörte, und ihm ein Glas warme Milch zu trinken gab.
Er erinnerte sich an dieses Glas Milch, an diese Geste wie an etwas, das unvermeidlich war: ein Klischee. Ein Glas warme Milch auf der Treppe, manchmal ein Löffel Honig darin, und wie sich die Tür öffnete, eine der Türen, die verschlossen blieben, als auf der Treppe ihre Schritte leiser wurden und schließlich unhörbar. Nur die Zeit blieb übrig, und sie fügte sich nicht mehr in das Maß irgendeiner Geste, weniger Minuten, bis der Topf aus dem Schrank gezogen war, die Milch gewärmt, ein paar Minuten, damit der Honig sich darin lösen konnte.
Moses wußte, daß es nicht gut war, zu fragen, wann sie nach Hause zurückkehren würden. Er fragte nicht. Er versuchte die Tage zu zählen, wollte sie abzählen, einen nach dem anderen, bis sie verschwunden waren. Die Zeit sollte verschwinden, die Tage und die Nächte, die Wochen, die vergingen und seinen Geburtstag näherrücken ließen, an dem er nicht in Berlin sein würde. Dann begriff er, daß es nicht mehr die Zeit war, die sie von Berlin trennte, sondern etwas anderes, das ihm angst machte. Der Sommer war vorbei, das Laub verfärbte sich, die Kastanien waren reif, er wollte sie nicht aufsammeln, um mit ihnen zu spielen. Er wollte nicht Französisch lernen. Seine Mutter führte ihn, wenn es schön war, in den Jardin du Luxembourg. An dem großen Becken spielten Kinder mit ihren Schiffchen, er saß neben seiner Mutter auf einem Eisenstuhl und weigerte sich, zu ihnen zu laufen.
»Ich erinnere mich nicht gerne an diese Zeit. Warum willst du das wissen?« »Weil du wolltest, daß ich Jeans Geschichte aufschreibe.«
»Das Glas Milch kannst du ebensogut erfinden. Was du erfinden könntest, unterscheidet sich nicht von dem, was ich erzähle. Und was hat das mit Jean zu tun?« Meine Erklärung schnitt er mit einer Handbewegung ab. Einmal fragte er: »Nennt man das Recherche?«
Seine Geschichte, Jeans Geschichte und meine eigene vermischen sich. Manchmal spricht Moshe von der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Es gibt Bruchstücke der Erinnerung, und es gibt die Erinnerung, an die man sich erinnert. Einer erzählt, und nur solange er spricht, fügen sich die Teile zusammen.
Neben seiner Mutter sitzt er im Jardin du Luxembourg, da sind Kinder, die auf Ponys reiten, bis zum Karussell ist es nicht weit. Seine Mutter trägt einen Mantel, den er aus Berlin nicht kennt. Was ist das für ein Mantel? Warum ist es so still? Später findet er heraus, daß sich dieses Karussell lautlos dreht, ohne Musik.
Juni 1938 bis Juni 1940. Sein achter, sein neunter Geburtstag.
Er erinnert sich an den achten Geburtstag, an den 17. November 1938, an die Mühe seiner Mutter, diesen Geburtstag zu feiern, mit einem Geschenk und einem festlichen Gesicht, zerbrechlich wie Glas. Er bekam einen hübsch gefertigten kleinen Zweispänner, dem ein Kutschpferd fehlte; sie hatte für die Sitze kleine Kissen aus blauem Samt genäht.
Sie schickten ihn in die Kammer, die als Schlafzimmer diente. Es war früh am Morgen, er fror ein bißchen und wickelte sich in die Decke seiner Eltern. Er hörte, wie sie hin und her liefen, sie richteten den Geburtstagstisch. Die Stimme seines Vaters, leise und heftig, redete auf seine Mutter ein, es roch nach heißer Schokolade, gleich würden sie ihn rufen, damit er die Geschenke auspackte. Aber vielleicht stritten sie auch.
Es dauerte lange, bis ihn seine Mutter rief, mit ihrer hellsten, allzu hellen Stimme, und Moses weinte, als er das Tischchen sah, auf dem nichts als die Kutsche und ein kleiner Kuchen standen.
In den letzten Pariser Wochen erlaubte man ihm, bei schönem Wetter nachmittags alleine aus dem Haus und auf die Straße zu gehen, die auf einen Platz führte. Er lief bis zu dem Platz, setzte sich auf eine Bank und hielt nach seiner Mutter Ausschau. Manchmal brachte sie von dort, wo sie arbeitete (putzte sie?), eine Brioche mit. Wenn er sie sah, sprang er nicht auf, um ihr entgegenzulaufen.
Die hölzerne Kutsche verlor er auf der Fahrt nach Néris-les-Bains. Er hatte nicht oft damit gespielt. Vielleicht war sie auch – unhandlich, wie sie war – in Paris geblieben.
»Ruth«, sagte Moshe, »hat mir immer vorgeworfen, daß ich nicht imstande bin, eines nach dem anderen zu tun und mich daran zu freuen. Woran zu freuen? Daran, daß man eines nach dem anderen in guter Ordnung tut und dabei eine gute Ordnung schafft. Was willst du noch? habe ich ihr gesagt, daß ich die Mondscheinsonate höre? Wenn ich mich an etwas erinnere, ist es ein albernes Detail oder eine kitschige Szene. Wenn ich mich an etwas erinnere, ist es ein Fitzelchen, und nehme ich es unter die Lupe, wird es ein Kitsch. Weißt du, was Kitsch ist? Kitsch ist, was jedermann gehört.«
Ich fragte nach der Pariser Zeit, denn Moshe hatte mir davon nicht erzählt. Er hatte mir von Néris-les-Bains, von Tournus erzählt, nicht von Berlin, nicht von Paris. Er spart diese Zeit aus. »Warum«, fragte er, »hast du mich nicht nach Berlin gefragt, als wir uns kennenlernten?«
Vielleicht hätte er auch damals nicht geantwortet, aber darum geht es nicht. Ich habe nicht gefragt.
Kurz vor ihrer Flucht aus Paris fand er eines Nachmittags im Bad (seine Eltern waren nicht da, aber wo war er gewesen, von wo war er gekommen?) einen hölzernen Kleiderbügel auf dem Fußboden liegen, wie hingeschleudert neben dem kleinen Tischchen, auf dem die Bürsten, Nagelscheren und Pinzetten seiner Mutter lagen. Ein Fläschchen lag auch auf dem Boden, der Deckel abgesprungen, der Hals gesplittert. Er starrte darauf und fing an zu heulen, als er merkte, daß er sich in die Hosen gemacht hatte.
Wir gingen oft spazieren. Moshe war unruhig, er lief im Zimmer auf und ab, dann schlug er einen Spaziergang vor. Die Alfasi Straße entlang bis zum Tal des Kreuzes oder bis zur Windmühle, Jabotinsky Straße hinunter. Wenn er wütend oder niedergeschlagen war, beachtete er weder die stechende Sonne noch regenkalte Wintertage. »Hast du Jerusalem vergessen?« fragte er, wenn er bemerkte, daß ich fror oder in der lähmenden Chamsin-Hitze blaß wurde.
In der Alfasi Straße habe ich von 1990 bis 1993 gewohnt, in der Nummer 13. Moshe wohnt in Nummer 21. »Warum mußtest du auch nach Berlin ziehen«, sagte er manchmal. Wenn wir am Grab des Seefahrers oder Kaufmanns Jason vorbeikamen, einem kleinen Kuppelbau aus hellenistischer Zeit, den man entdeckt hat, als man die Erde für einen Neubau aushob, sagte er: »Dort haben wir uns oft getroffen, weißt du noch?«, und er fügte vorwurfsvoll hinzu: »In Jean hättest du dich verliebt.«
»Bist du sicher, daß Sebastian zu dir paßt?« sagte Moshe, der mich oft gedrängt hatte, die abgerissene Verbindung wiederaufzunehmen und zu heiraten.
»Schau mich an«, sagte er. »Ich habe eine fünfzehn Jahre jüngere Freundin, die mich liebt. Meine Frau wollte sich von mir scheiden lassen, aber ein Auto hat sie überfahren. Juristisch betrachtet bin ich Witwer. Wie kommst du mit Jeans Geschichte voran?«
»Wie soll ich schreiben, wenn ich mit dir durch Jerusalem renne?«
Manchmal besuchte Moshe mich in Tel Aviv. Moshe meidet, wie die meisten Jerusalemer, Tel Aviv, aber er fuhr nach Tel Aviv und wartete in meinem Lieblingscafé, bis ich dort auftauchte.
»Da bist du ja.«
Es kann nicht still gewesen sein, aber das ist seine Erinnerung: eine Landschaft, die sich aus ruckhaften Bewegungen zusammensetzt, lautlos. Weder Motoren noch Stimmen. Ein Bauer steht auf einem Feld und hält ein Pferd am Zügel. Immer wieder stockt alles.
Auf der Rückbank neben ihm sitzt seine Mutter, er schmiegt sich an sie, die aufgerichtet aus dem Fenster schaut. Vielleicht sieht sie den Bauern ebenfalls, und das Pferd. Er will sie ärgern und fragt, ob sie nach Berlin fahren, er fragt es auf französisch. Die Zeit kippt und liegt still wie ein Kreisel, der aufgehört hat sich zu drehen.
Ich glaube, Moshe hat erst Ende 1998 damit angefangen, Notizzettel zu schreiben und dann achtlos liegenzulassen. Manchmal finde ich einen dieser Zettel in meiner Tasche, in meinem Koffer, manchmal in den Päckchen, die er mir nach Berlin schickt, Päckchen mit Datteln oder Trocken-Techina.
Oft knüllt er sie auch zusammen, wirft sie in den Papierkorb oder läßt sie auf dem Sofa liegen. Tess sammelt die Papierchen auf und tut sie in den Abfall, Moshe sieht ihr dabei zu.
Über Geheimnisse habe ich mir bisher wenig Gedanken gemacht. Aber neben all dem, was man sich erzählt, wird plötzlich spürbar, was man sich nicht erzählt – eher ein Raum als bestimmte Gedanken oder Begebenheiten, die man nicht preisgeben will. Es sind Verästelungen, beiläufige, verschlungene Gedanken- und Empfindungsfetzen, die nicht laut werden und deswegen anderen Gesetzen unterliegen als denen des Erzählens.
Moshe hat selten darüber gesprochen, was ihm Jean bedeutet. Ich hebe die Zettel auf, ich scheue mich, sie zu lesen, aber ich lese sie, manche schreibe ich ab.
In einem Karton im Bücherregal meiner Berliner Wohnung bewahre ich sie auf.
Theodor und Ruth Fein ergriffen 1938 die letzte Gelegenheit, aus Berlin nach Paris zu emigrieren. Das wenige, was sie mitnehmen konnten, wurde rasch weniger. Die beiden, er Rechtsanwalt, sie Sängerin, fanden in Paris zunächst keine Arbeit. Schließlich lernte Theodor Fein einen Geschäftsmann kennen, der mit den Nazis sympathisierte und Handelsbeziehungen nach Deutschland unterhielt. Fein erledigte für ihn den Schriftverkehr. Ruth Fein versuchte, als Näherin und Putzfrau etwas zu verdienen.
Dann mußten sie auch aus Paris fliehen.
Als sie ihren Sohn, auf den Namen Jean Marie getauft, in einem katholischen Internat sicher untergebracht wußten, versuchten sie, die Schweizer Grenze zu erreichen. Sie hatten sich verpflichtet, ihren Sohn Moses im katholischen Glauben zu erziehen, falls sie überleben würden. Theodor Fein, kein Zionist und assimiliert, aber ein Bewunderer der Aufklärung, hatte seinen Sohn nach Moses Mendelssohn benannt.
Sie wurden von schweizerischen Grenzbeamten abgefangen und an die Gestapo ausgeliefert, nach Gurs, von dort nach Theresienstadt deportiert und schließlich in Auschwitz vergast.
Von Moshes Eltern existiert kein Foto. Es gibt kein Foto von Jean.
Von Ruth, Moshes Frau, kenne ich zwei Fotografien. Sie sitzt in Prag auf einer Fensterbank und blickt, gemeinsam mit dem Betrachter des Fotos, zum Hradschin hinüber. Ihr dunkles, dickes Haar ist lose zurückgebunden. Das Jahr ist 1960, für eine Woche ist sie nach Prag gefahren, in die Stadt, in der sie geboren wurde. Sie hat darauf bestanden, alleine zu reisen, ohne Moshe, den sie zwei Jahre später heiraten wird. Die insgesamt drei Wochen ihrer Abwesenheit (Ruth reist über Berlin, wo sie eine Freundin ihrer Mutter besucht) sind für Moshe entsetzlich. Er fürchtet für Ruth, fürchtet um Ruth, nach ihrer Rückkehr will sie ihm sagen, ob sie ihn (sie kennen sich seit zwölf Jahren) heiraten wird. Ruth wirkt auf dem Foto weich, ein wenig rundlich, noch sehr jung (sie ist zwei Jahre älter als Moshe). Erst auf den zweiten oder dritten Blick entdeckt man in ihren Gesichtszügen etwas Schwermütiges, Besorgtes, die Augenlider sind geschwollen, ihre Hand (die rechte) scheint das Knie zu umklammern, als müßte sie Dinge festhalten, die man nicht festhalten kann. Ihre Mutter, ihr Vater, ihre jüngere Schwester sind aus Prag in einem Viehwaggon abtransportiert worden. Theresienstadt, dann Auschwitz.
Die zweite Fotografie zeigt Ruth in Jerusalem, Rechavia, sie sitzt auf einem Steinmäuerchen, nicht weit von der Alfasi Straße. Hinter ihr balanciert eine dünne weiße Katze. In der Hand hält sie ein Buch, das aufgeschlagen ist, der Fotograf hat sie aus ihrer Lektüre gerissen. (Wir hatten, sagt Moshe, keinen Garten, und Ruth saß gerne draußen, im Schatten, um zu lesen, wenn sie die Klassenarbeiten und Hausaufgaben ihrer Schüler endlich korrigiert hatte.) Ihr Blick ist energisch, der volle Mund zeichnet sich deutlich von der blassen Haut ab, das Gesicht ist stolz. Jetzt ist sie fünfundvierzig Jahre alt und schöner als mit zweiunddreißig.
Moshe hat sie kurz nach seiner Ankunft in Israel, im Kibbuz kennengelernt. Sie liebte ihn. Es dauerte fast vierzehn Jahre, bis er sie überreden konnte, ihn zu heiraten.
Er wollte sie mit Jean bekannt machen, er lud ihn zur Hochzeit ein, Jean kam nicht. Sie sind sich nie begegnet. Wieder war etwas vereitelt, nicht die Idee irgendeiner Vollständigkeit, die er längst aufgegeben hatte, sondern etwas anderes, an dem sein Herz hing, als wäre es, wie man im Hebräischen sagt, sein Seelenvogel: zippor nefesch.
Er machte ihr, Ruth sagte es, das Leben schwer. Er schien darauf zu warten, daß zerfiel, was sie geschaffen hatte. Du bist kein Zionist, sagte sie manchmal, und sein Herz krampfte sich zusammen, wenn er in diesem Satz ihre Hilflosigkeit und ihre Hoffnung hörte. Er wollte Zionist sein, er dachte manchmal, daß ihm fehlte, was er in Frankreich zurückgelassen hatte durch seine Entscheidung, nicht Mönch zu werden. Als Ruth davon sprach, ihn zu verlassen, hoffte Moshe, Jean würde sie überzeugen, bei ihm zu bleiben. Nur Jean konnte Ruth erklären, wie sehr Moshe sie liebte. Mit Jean, wenn er nur da wäre, würde alles gut werden.
Aber Jean war in Frankreich, er lebte für Gott oder für sich selbst, er erkannte nicht an, was den Schatten eines Zweifels auf seine Entscheidung hätte werfen können. Es gab für Jean keine Zweifel, dachte Moshe und hielt sich daran, als würde damit auch seine eigene Unrast schließlich zur Ruhe kommen.
Als Ruth ging, nahm sie nur eine Tasche mit ihrer Wäsche und ihren Kleidern mit. Sie hatte Blumen auf den Tisch gestellt. Monatelang wechselte er das Wasser in der Vase; die Blumen waren längst verwelkt. Sie war überfahren worden, als sie nach einem Autobus gerannt war, mit dem sie von ihrer neuen Wohnung zur Schule fuhr.
Er schrieb Jean. Seit er alleine war, ging er nicht vor zwei oder drei Uhr, die Zeit, da die Mönche im Kloster zum ersten Gebet aufstanden, zu Bett. Sie lösten sich ab.
Seit dem Tag, an dem er Jeans letzten Brief erhalten hat, geht er früh schlafen, um ein Uhr oder schon um Mitternacht.
»Es lohnt nicht, wach zu bleiben. Morgens weckt mich die Müllabfuhr, und dann die Radios, hörst du, jede Stunde Nachrichten, ab sieben Uhr früh.« Moshe reißt das Fenster auf. Rechavia ist das stillste Stadtviertel Jerusalems. Der Vogel Bulbul ruft, in den schweren Wedeln einer Palme hört man den Wind. Von fern Sirenen.
Zuweilen schreibt er aus Versehen einen Brief, Lieber Jean, und erst wenn er ihn unterschreiben will, begreift er, daß Jean tot ist.
Ich habe Moshe Fein 1990 kennengelernt, in dem Jahr, in dem ich nach Jerusalem kam, um an der Hebräischen Universität zu studieren. Es war Anfang August. Die Hitze und das Licht betäubten mich, hin und her lief ich durch die Stadt, fuhr Stunden mit dem Autobus, ich konnte kein Hebräisch, kannte niemanden. Wenn ich aus dem Sprachkurs kam, lief ich am Antiquariat Stein vorbei. Im Schaufenster lagen auch deutsche Bücher aus, hinter einem kleinen Tisch saß im Halbdunkel Herr Stein, er sprach Deutsch. Er war in Frankfurt am Main geboren. Ich besuchte ihn oft. Er rauchte Zigarillos mit einem langen Mundstück aus weißem Plastik, ein wenig gelber Speichel rann ihm übers unrasierte Kinn, er trug zerknitterte Hemden und ein Jackett, von dem man nicht wissen wollte, woher er es hatte. Eines Mittags kam er mir entgegen, schloß die Ladentür vor meiner Nase ab. »Wir gehen Hemden kaufen«, sagte er und führte mich zu dem großen Kaufhaus, nicht viel weiter oben auf der King George Straße. »Ist das dein Großvater?« fragte mich gereizt die Verkäuferin, als ein ganzer Haufen anprobierter Hemden vor uns lag. Ich, Anfang zwanzig, war noch rot, als wir den Buchladen wieder erreicht hatten, errötete erneut, als jemand auf Herrn Stein zutrat, mit blitzschnellen Fragen und Bemerkungen, die ich nicht verstand, Fragen, die sich wohl auf mich bezogen, Herr Stein nahm mich energisch bei der Hand, der Fremde musterte mich neugierig.
Tags darauf ging ich zur Post. Ich reihte mich in die Schlange ein, in der Hand den grünen Reisepaß. »Sie sind gestern rot geworden«, sagte eine Stimme hinter mir, es war der Bekannte des Herrn Stein, der mich auf deutsch ansprach. »Ihnen würde ich ein Päckchen auch ohne Paß aushändigen.« Ich hatte wirklich ein Päckchen bekommen. Den Karton habe ich aufgehoben, Alfasi Straße 13, Jerusalem, es war von Sebastian, meinem Freund.
»Moshe Fein«, stellte er sich vor. »Sie müssen über ein Meter achtzig groß sein«, sagte er. Einige der Wartenden drehten sich nach mir um. Fein lachte mich an. »Wenn man in Jerusalem aus dem Haus geht, kommt man mit einer Geschichte zurück.«
Seither trafen wir uns immer wieder auf der Straße, Fein überprüfte meine Fortschritte im Hebräischen, er fragte, von wem ich an jenem Tag ein Päckchen bekommen hätte, er sagte, ich hätte es im Arm getragen wie etwas Liebes. Im Hebräischen gibt es kein »Sie«, wir nannten uns bald beim Vornamen, Moshe, Sophie, und wenn wir Deutsch sprachen, duzten wir uns. Sobald Moshe sicher war, daß an meinem Fleiß und Fortschritt nichts auszusetzen war, sprach er mit mir Deutsch.
Im Oktober forderte er mich zum ersten Mal auf, am Freitagmittag ins Café Atara auf der Ben Yehuda Straße zu kommen.
Im Januar, während des Golfkriegs, lud Moshe mich zu sich nach Hause ein. Seine Freundin Batsheva hatte Tscholent gekocht, ein Gericht aus Fleisch und Bohnen und gekochten Eiern, das eine ganze Nacht im Ofen bleiben muß. Batsheva öffnete mir die Tür und erzählte, wie sie während des Alarms ratlos überlegt hatte, was mit Topf und Ofen zu tun sei. Spätestens um zwei oder drei Uhr müsse sie das Haus verlassen. Ich schaute sie verständnislos an, in ihrer Stimme mischten sich Gewohnheit und ein Lachen, auch eine Warnung schwang darin, die mir galt. »Um drei Uhr gehe ich, wie jeder weiß, schlafen«, fügte Moshe dem Rätselhaften seinen Teil hinzu, die anderen Gäste, die inzwischen eingetreten waren, unterbrachen besorgt den anscheinend sattsam bekannten Wortwechsel. Martha und David Weltfreund, beide Psychoanalytiker, Kollegen von Batsheva. Sie erzählten mir von dem weißen Pfau, der manchmal im Garten hinter dem Psychoanalytischen Institut, manchmal im Haus der Leprakranken auftauchte, sie sprachen Hebräisch und Deutsch durcheinander, wir saßen um einen niedrigen Wohnzimmertisch, einen Eßtisch schien es nicht zu geben. Die Fenster waren nicht verklebt, ängstlich fragte ich mich, was wir während des Alarms tun sollten. Als die Sirenen losheulten, bestanden – mit einem Blick auf mich – Weltfreunds darauf, daß wir mit unseren Gasmasken ins Schlafzimmer gingen, dessen Fenster schlampig mit Plastikfolie verklebt waren.
Eine halbe Stunde saßen wir um das Bett, einander die Rükken zugewandt, die Gesichter mit den schwarzen Rüsseln gegen die weiße Wand gekehrt. Auf dem Nachttisch neben mir bemerkte ich das Foto einer jungen Frau, ein älteres Foto, Batsheva war es nicht. Daneben lagen ein Kreuz und die Bekenntnisse des Augustinus.
Als die Entwarnung kam, sprang Moshe auf und zog mich, ich konnte kaum die Gasmaske absetzen, in die Küche, damit ich ihm beim Aufwärmen des Essens behilflich sei. Der Fernseher lief, ich erinnere mich an Bilder von Tel Aviv, helle Punkte, Raketen oder Abwehrraketen, in Ramat Gan waren Raketen eingeschlagen, in den Besetzten Gebieten auch. Über den niedrigen Tisch gebeugt, aßen wir, der Unterhaltung konnte ich nicht folgen, ich erinnere mich, daß Batsheva mir wieder und wieder auftat, ich schlief in dieser Nacht fest wie ein Stein, das erste Mal, seit der Golfkrieg ausgebrochen war. Später begriff ich, daß dieser Abend meinetwegen stattgefunden hatte: weil ich in Israel geblieben war.
Die Universität war geschlossen. Wenn man in die Stadt ging, mußte man seine Gasmaske, die Atropinspritze, ein Pulver gegen Senfgas bei sich tragen. Gestorben wurde anderswo. Weltfreunds luden mich ins Konzert ein, liehen mir Bücher und zwei Töpfe, Batsheva zeigte mir einmal den weißen Pfau, der auf einem Ast saß, weiß und wundersam.
Moshe sah ich ein paar Tage nicht, ich war enttäuscht darüber. Von Sebastian hatte ich mich entfernt, von Deutschland, ich wollte mit Moshe sprechen, wollte wissen, wer die Frau war, deren Foto auf seinem Nachttisch stand, warum ein Kreuz dort lag, warum er erst um zwei oder drei Uhr morgens schlafen ging.
Wenn ich nicht wußte, was ich tun sollte (mein Studium war mir in all den Aufregungen gleichgültig geworden), lag ich in meinem Zimmer auf dem Bett und dachte über ihn nach. Das Zimmer hatte nur ein winziges Fenster in zwei Meter Höhe, auf einem Tisch stand mein Computer, ich versuchte Sein und Zeit zu lesen.
Als der Golfkrieg vorbei war, trafen wir uns freitags wieder im Café Atara. Über Jean, seinen Freund, der Mönch war, Trappist, sprach Moshe nur ein einziges Mal. Wenn Jean in seinem Kloster in Frankreich aufstünde, ginge er schlafen, sagte er, das war alles. Ich war nicht sicher, ob es Jean tatsächlich gab. Daß Moshe in Berlin geboren war, wußte ich, nach seinen Eltern fragte ich nicht. Er trug in jenem Winter beige oder blaue Cordhosen, ein dickes Jackett, sein dunkelblondes Haar wurde allmählich grau, er sprach rasch und konzentriert. Er schaute einen aufmerksam an und schien doch an etwas anderes zu denken. Alle kannten ihn, und er kannte alle, sie begrüßten ihn, er grüßte zurück, an seinen Tisch setzte sich nur, wer dazu aufgefordert war, und seine Einladung galt viel. Ich hatte aus Deutschland meinen Dufflecoat mitgebracht, dunkelblau und mit einer Kapuze, sehr lang, so wie ich lang und dünn war, ich rauchte Pfeife, aber auch ohne Pfeife sahen mich alle an, lang und dünn, mit kurzen Locken, knabenhaft und ungeschickt betrat ich das Café, in dem alle wußten, daß ich zu Moshe gehörte, und vielleicht dachten sie, ich sei seine Geliebte. Er bestellte mir ein Stück Kuchen, denn er fand, ich sei zu dünn, Schokoladenkuchen, und es gab keine Widerrede.
Ich habe Fotos von ihm als junger Mann gesehen, Schwarz weißaufnahmen aus den sechziger Jahren. In einer Gruppe von Männern und Frauen steht er in der Ben Yehuda Straße, der Fußgängerzone, oben vor dem mehrstöckigen Haus, in dem seine Kanzlei ist, oder weiter unten vor dem Café Atara. Als einziger wendet er sich dem Fotografen zu, er sieht gut aus, er scheint zufällig dazugekommen, schon wieder auf dem Sprung, aber er ist der Mittelpunkt, die anderen schauen zu ihm hin.
Im Café Atara, wo jeden Freitagmittag dieselben Leute an denselben Tischen saßen, machte mir an Moshes Tisch immer jemand Platz oder holte mir einen Stuhl. Inzwischen ist das Café Atara umgebaut worden. Damals war es noch, wie es früher, in den vierziger, den dreißiger Jahren gewesen ist. Es gibt dieses Jerusalem nicht mehr.
Zweimal begleitete Batsheva mich, zweimal holte sie mich mit dem Auto aus der Alfasi Straße ab; ich nehme an, Moshe hatte sie darum gebeten. Er wollte nicht, daß ich Mißverständnissen ausgesetzt würde.
Das Wort führte er selten. Seine Begabung war es, Prozesse zu vermeiden, Parteien zur Einigung, zum Kompromiß zu zwingen. Er galt als einer der besten Rechtsanwälte Jerusalems. Man sagte von ihm, er sei imstande, einen Mandanten stundenlang zu beschimpfen, was ihm einfiele, wegen einer Lappalie vors Gericht zu ziehen, wegen eines Hauses, eines Grundstücks, nicht mehr wert als die drei Disteln, die dort wüchsen, wegen einer angeblichen Beleidigung, die geradezu ein Kompliment sei.
»Soundso hat mir Unrecht getan, Soundso hat mich übervorteilt. Da reden sie von Freiheit und Gerechtigkeit und sagen nicht geradezu, das und jenes will ich, ich will wissen, wie ich es bekommen kann. Fast immer stellt sich heraus, daß von Unrecht keine Rede ist, nur Geldgier, alle glauben sich zu kurz gekommen, und von wem einer nimmt, ist ihm egal. Sind wir dafür ins Land Israel gekommen?« – Einmal habe ich erlebt, wie er empört jemanden beschimpfte, vor allen, im Café Atara. Der Mandant, denn es war ein Mandant Moshes, stand auf, einen Augenblick wollte er den Mund gegen Moshe öffnen, dann setzte er sich wieder. Moshe, so kam es mir vor, lebte in einem Israel, das nicht mehr existierte. Wenn er damals schon pessimistisch war, zeigte er es nicht, jedenfalls nicht mir. Er gibt es nicht preis, dachte ich, wenn ich sah, wie sein Gesicht müde und ernst war, als nähme es an der ihm eigenen Lebhaftigkeit nicht länger teil. Ich vermutete irgendein Geheimnis. Von allen Lösungen ist ein Geheimnis die leichteste. Selbst wenn Moshe ungeduldig etwas beschleunigte, ungeduldig unterbrach, war es, als hätte er gleichzeitig eine andere Verabredung, als führte er gleichzeitig ein anderes Gespräch: ein Spiegelbild, aber vor dem Spiegel steht keiner, und der dort stehen müßte, wartet anderswo. Seine Hände, kräftig, mit sehr geraden, langen Fingern, spielten mit den Tassen, Untertassen, Kaffeelöffeln im Café Atara, als wäre es ein anderes Geschirr, das ihnen vertrauter war.
Ich wußte inzwischen, daß er verheiratet gewesen war, das Foto auf dem Nachttisch zeigte seine Frau, die ihn verlassen hatte und bei einem Unfall umgekommen war. Doch all das erklärte nichts, es war eine Vergangenheit aus Fakten, das konnte es nicht sein, was Moshe beschäftigte wie eine Frage, die entschieden werden muß, so oder so.
Dann wurde es Frühjahr, der Chamsin, der heiße Ostwind, trieb die Hitze in die Stadt. Was ich bisher gekannt hatte, war langweilig und fremd, in Deutschland fiel noch Schnee, in Jerusalem war schon Sommer. Mein Hebräisch machte unerwartet Fortschritte. Eines Tages, als ich den Campus verließ, folgte mir Jaron und fragte höflich, ob er mich begleiten dürfe. Er begleitete mich, vom Mount Scopus bis in die Stadt, an der Buchhandlung Stein vorbei und bis in die Alfasi Straße. Nachts lag ich wach, und als das Telefon um Mitternacht klingelte, Sebastians Zeit, antwortete ich nicht. Tags darauf war ich um Mitternacht nicht alleine.
Wir hatten uns in Freiburg am Philosophischen Seminar kennengelernt, jeden Samstag waren wir auf den Münster-Markt gegangen, wo im Spätherbst und Winter über großen Blechtonnen, in denen Feuer brannte, die Marktfrauen sich die Hände wärmten, ich hatte ihn lange geliebt, ohne daß er es bemerkt hatte.
Moshe wich ich aus, als sei er Sebastian. Freitags kam ich nicht ins Café Atara. Ich saß in meinem kargen Zimmer, vier Wände und über Augenhöhe das Fenster mit den Klebestreifen aus dem Golfkrieg, aber eng schien es mir nur in Freiburg. Die Küche teilte ich mit einer anderen Studentin, vor der Küchentür rannten Eidechsen, eine rostige Feuerleiter stand da und endete in der Luft, zersprungene Fliesen führten dahin, wo ein Garten hätte sein können, wo eingewachsen von Brombeerhecken ein Ölbaum wuchs und wo verwildert Katzen streunten. Nicht weit entfernt lag die Altstadt, der Schuk, dort tranken wir Mokka, aßen Humus. Der Tempelberg war nicht weit, und hinter der Stadt gab es die Wüste, man sah die blauen Berge Moabs. In Jerusalem ging man auf die Straße und kam mit einer Geschichte zurück nach Hause.
Jaron nahm mich mit ans Tote Meer. Auf der Rückfahrt schlief ich ein, erschöpft von der Festung Massada, den kahlen Bergen, von Jericho und Jaron, der schön war, von den jungen Männern, die mich spöttisch und begehrlich musterten, von Hitze, in der sich alles auflöste. Wenn ich alleine schlief, träumte ich von Sebastian, der jetzt nicht mehr anrief.
Jaron war übermütig, leichtsinnig, er machte unklare Geschäfte in den Besetzten Gebieten und in Rußland, er verreiste und kam zurück, studierte Jüdische Geschichte, hatte zuviel oder auch gar kein Geld, wohnte zuweilen bei einem alten Onkel und dann bei mir, mit einer Tasche war er gekommen und verstand nicht, worüber ich weinte.
Ich wußte nicht, was ich ihm bedeuten sollte: eine blonde Schickse, eine Herausforderung vielleicht oder eine Genugtuung, denn ich war auf ihn, den Israeli und Kibbuznik, angewiesen, ich, die aus Europa, aus Deutschland kam. Aber er war es, der über die Höhen sprang und die geheimen Gärten kannte. Er liebte an mir, was ihm unzugänglich war, Herkunft und Erziehung, die ich abzustreifen hoffte, lachte, wenn ich durch die Wohnung huschte, anklopfte, hinter mir alle Türen schloß, er öffnete die Türen wieder, ich liebte ihn dafür und weinte, weil ich Sebastian verloren hatte.
Seit Moshe mich mit Jaron gesehen hatte, begrüßte er mich, als käme ich geradewegs aus dem Bett meines Geliebten, er spottete, wie gut mit einem Mal mein Hebräisch sei, sprach mit mir eine Weile nur noch Hebräisch, fragte nicht mehr, was ich las und lernte und ob ich ins Café Atara käme. Das Vertraute wurde fremd, das Fremde war vertraut geworden, ich zerrissen zwischen beidem.
Die Zeit verging, du siehst aus wie eine Sabre, spottete Moshe, ich war sehr braungebrannt. Als ich ihm sagte, mein Stipendium sei verlängert, freute er sich. Batsheva hatte mir geholfen, den Antrag zu schreiben. Wochen und Monate sahen wir uns kaum, es war längst Sommer und schon wieder Herbst, ein Jahr war vergangen. Jaron war zu mir gezogen, wir mieteten das zweite Zimmer, er schnitt die Brombeerranken, ersetzte die Fliesen, die lose waren, abends aßen wir auf der kleinen Veranda unter der zerbrochenen Feuerleiter.
Schräg gegenüber lag Jasons Grab. Durchs trockene Gras huschten Eidechsen, die Straßenkatzen suchten unter der steinernen Kuppel Schatten, ein Eisengitter schützte den inneren Bereich vor Zudringlichen, im kleinen Vorhof stand zwischen Rosmarinsträuchern und Lavendel eine Bank. Niemand kam dorthin, die hellen Kalksteine leuchteten, eine Akazie spendete Schatten. Oft ging ich zu Jasons Grab wie zu einem Nachbarn, dem man höflich einen kurzen Besuch abstattet, manchmal ging ich dorthin, um meinen Kummer zu verbergen. Sebastian schickte mir Briefe, die ich ihm schrieb, ungeöffnet zurück. Ich sehnte mich nach ihm, ich durfte ihn nicht anrufen.
Einmal überraschte ich dort Moshe, er saß sehr still in sich versunken, als ob er betete, ich dachte an das Holzkreuz auf seinem Nachttisch. Verlegen wollte ich mich entfernen, aber eine Katze, die ich erschreckte, sprang auf und fauchte, Moshe hob den Kopf.
Es war sein Gesicht, aber ich kannte es nicht, ein Gesicht, das nichts preisgab, keine Empfindung darin. Er sah mich an, als wäre es undenkbar, irgend jemanden, irgend etwas wiederzuerkennen.
Am Abend, da es kühle ward, ward Gottes Wirken offenbar. Selbst an den heißesten Tagen wird es in Jerusalem abends kühl, das Licht – so stark tagsüber, daß Häuser und Straßen durchscheinend, wie haltlos scheinen – wird mild, um aus sich selbst leuchten zu lassen, was es übertrumpft hat. Der Jerusalemer Stein, heller Kalkstein, beinahe weiß in der Sonne, die dunklen Bäume mit ihren dichten Schatten, die Ausblicke allerorten, zu den Jerusalemer Bergen im Westen, in die Judäische Wüste östlich, selbst die gereizt hupende Betriebsamkeit, das Hasten der Passanten und die Orthodoxen in ihren Hüten, Kaftanen, die ewigen Bekanntmachungen, Aufrufe, selbst Ungerechtigkeit, Gewalt und Angst treten zurück, als gälte es, etwas Verborgenes sichtbar werden zu lassen. Zum Äußersten getrieben, hält die Stadt inne, um, was tagsüber tausendfach hin- und hergewendet wurde, erscheinen zu lassen wie einst am Tag des Gerichts, in einem Augenblick, in dem der Urteilsspruch ausgesetzt ist und Gott wartet. Der Himmel leuchtet, und die Zeit steht still. Die Katzen waren lautlos im Gesträuch verschwunden, es duftete nach Rosmarin, die Hitze hatte nur ihre Gerüche zurückgelassen, Moshe sah mich noch immer an und streckte die Hand aus, um mich zu sich zu rufen.
Es war Ruths Todestag, von Jean war ein Brief eingetroffen. Jean hatte 1977 nicht geantwortet, als Moshe ihm schrieb, Ruth sei umgekommen. Zweimal schrieb Moshe, daß Ruth tot war, im Glauben, der erste Brief sei verlorengegangen. Dann glaubte er, Jean sei in einem anderen Kloster. Dann glaubte er, auch Jean sei tot. Dann rief er im Kloster an. Dann wußte er nicht weiter. 1991 erhielt er an Ruths Todestag einen Brief von Jean.
Ich wußte davon nicht. Wir saßen nebeneinander auf der Bank, Moshe hielt meine Hand, streichelte sanft mit dem Finger den Handrücken. Als ich aufstand, um zu gehen, schien er es kaum zu bemerken.
Mittags hatte Jaron von unterwegs angerufen und mich gebeten, um acht Uhr in Nachalat Schiva zu sein. Er war ein paar Tage in Tel Aviv gewesen, so hatte er gesagt. Nachalat Schiva ist eine kleine Straße im Stadtzentrum, die damals gerade zum Leben (zwei oder drei Läden, eine Bar) erwachte. Heute reiht sich dort ein Restaurant ans andere, ein Souvenir- oder sogenannter Kunstladen an den nächsten. »The Mad Headhunter« hieß die Bar, drei kleine Holztische in einem winzigen Raum. Es war sieben Uhr, als ich aufbrach, die dämmrigen Straßen waren voller Menschen, Schatten vermischte sich mit Dunkelheit, Fledermäuse flogen zwischen den Bäumen, das letzte Licht des Tages und das erste Lampenlicht fingen sich in den Gesichtern. Alte Leute und Liebespaare teilten sich die Bänke in den Alleen, aus den Gebetshäusern kamen vom Abendgebet Männer, in einem Park lagerte eine Gruppe arabischer Frauen, auf einem Esel ritt ein kleiner Junge, rief mit hoher Stimme. Ich war zu früh, näherte mich der Altstadt, Arm in Arm liefen junge Palästinenser zu zweit oder zu dritt, die Stadtmauer schimmerte noch hell, Pferdewagen klapperten vorbei, ein armenischer Mönch folgte mir, flüsterte etwas, folgte mir weiter. Ehe ich mich versah, war ich umringt von einer Gruppe griechischer Pilger, schwarz gekleidet, mit müden, verwunderten Gesichtern schwatzten sie leise und unaufhörlich miteinander. Am Damaskustor packten Händler die letzten Waren ein, die Pilger verschwanden wie ein Vogelschwarm in langgestreckter Formation, es war Zeit, umzukehren. Durch die Straße der Propheten lief ich Richtung Zionsplatz, Richtung Nachalat Schiva. Jungen und Mädchen in Uniform standen in kleinen Grüppchen, tranken Cola, rauchten, wie eine Schulklasse wirkten sie, ihre Waffe trugen sie bei sich. Und da stand auch Jaron, inmitten junger Frauen, überragte sie um Kopfeslänge. Als er mich sah, löste er sich von ihnen und kam zu mir. Er trug ein weißes Hemd und eine helle weite Hose, er lachte, schüttelte die Locken, alle schauten zu uns her, ich trug ein weißes Hemd, trug eine helle Hose, war fast so groß wie er, er küßte mich.
Ich dachte an Moshe, der vielleicht immer noch bei Jason saß, als ob er wartete oder lauschte, wer weiß, auf was. Mir kam es vor, als hätte ich den allerersten, den gültigen Abdruck seines Gesichts gesehen, in dem seine Geschichte sich zusammenfaßte. Er hatte meine Hand gehalten. Ich lief an Jarons Seite, über der Altstadt war der Mond aufgegangen, und die Zikaden schrillten, Wind strich über den Rosmarin und trug den Duft zu uns, Jaron war groß und schön, ich dachte an Moshe, dachte an Sebastian, der nicht mehr mit mir sprach, wir liefen oberhalb des Hinnom-Tals, die Blätter der Olivenbäume schimmerten matt im Mondlicht, darüber die großen Steinquader der Stadtmauer. Hinter der Cinemathek sah man die Berge Moab, Jaron wollte mir einen alten Lieblingsfilm zeigen, wir saßen auf der Terrasse vor dem Kino und tranken, er küßte mich, und ich dachte, daß wir uns bald trennen würden.
Freitags ging ich jetzt wieder ins Café Atara. Inzwischen sprach ich Hebräisch fast ohne Akzent. Es wurde Winter, der Winter 91/92. Jaron reiste in unklarer Angelegenheit nach Rußland, rief alle Tage an und bat mich, seine Frau zu werden. Moshe besorgte mir einen Petroleumofen, »Perfection«, brachte mir alle paar Tage Öl, durch den Glaszylinder sah man das Feuer brennen. Ein zur Unzeit geborenes Kätzchen folgte mir eines Mittags so hartnäckig, daß ich es mit nach Hause nahm und fütterte. Moshe nannte es »Fennek«, weil es zu große Ohren hatte. Batsheva war in die USA gereist, Moshe fühlte sich so einsam wie ich. Er kam mit dem Ölkanister, er brachte dem Kater Fisch und auch für uns etwas zu essen. Er kam, um seine Tasche irgendwo abzustellen und zu erzählen, was sich tagsüber ereignet hat. Ich kochte Tee, deckte den Tisch, unter dem hohen Glaszylinder brannte gleichmäßig die Flamme, Fennek spielte mit einer toten Eidechse. »Im Sommer warst du traurig«, sagte Moshe, »und jetzt bist du es immer noch.« Geduldig hörte er sich an, was ich erzählte, von meiner Liebe dort und meiner Liebe hier, vom Zerrissensein zwischen zwei Orten, von der Angst, beide Orte zu verlieren. »Es ist ein Zwischenspiel«, sagte er mir, »irgendwann kehrst du zurück nach Deutschland.«
Ich weiß noch, wie ungern ich das hörte und wie gekränkt ich war. Schließlich lebte ich wie jeder andere in Israel und hatte längst beschlossen, daß hier mein Zuhause war. Und ich erinnere mich, daß Moshe aufstand, in meinem kleinen Zimmer auf und ab lief und sich am Ofen stieß, und Fennek rannte hinter seinen Füßen her.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: