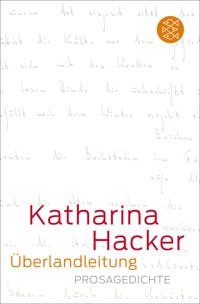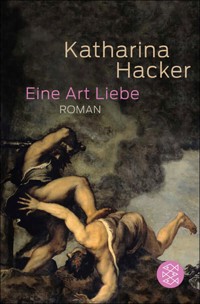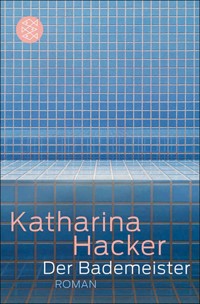7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau aus Deutschland in Tel Aviv, einer Stadt, wo Menschen unterschiedlichster Herkunft um eine neue Heimat und neue Lebensentwürfe ringen. Aber die Erzählerin belässt es nicht bei feiner Beobachtung und kluger Analyse oder beiläufigen Momentaufnahmen des Alltags. Ihre Phantasie, ihre surrealen Ausflüge machen die Stadt Tel Aviv zu einem magischen, zu einem poetischen Ort – fragil, flüchtig, schwebend –, der einzig gangbare Weg, um wirklich dort anzukommen. Katharina Hackers erstes Buch ist »eine Geschichte, die unbedingt zu erzählen ist und nicht für sich selbst, sondern um der Stadt willen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Katharina Hacker
Tel Aviv
Eine Stadterzählung
Fischer e-books
Tel Aviv
Eine Stadterzählung
Will man von einer Stadt sprechen, so kann man ihr Sätze anprobieren. Es gibt zappelige Städte, die immer schon woanders zu sein scheinen, während man doch den Satz noch gar nicht beendet hat. Vielleicht auch Städte, die immer größer werden, während man spricht, ausufern und mit einem Sprung vom Satz noch nie gehört haben.
Ebenso indignierte Städte, denen man es nicht recht machen kann.
Und wenn es all diese nicht gibt, so muss man doch ausprobieren, wie es wäre, wenn es sie gäbe, um vielleicht einen richtigen Satz zu finden.
Von einem richtigen Satz hängt alles ab. Das ist eine Überzeugung, der man unbedingt anhängen muss.
Da geht einer durch die Stadt und hält Leute an.
Manchmal kommt es mir so vor, als gäbe es zu jeder Gegebenheit eine imaginierte, die am genauesten ausdrückt, was es mit dieser ersten auf sich hat.
Er geht durch die Stadt, hält Leute an und erzählt ihnen eine ihrer imaginierten Gegebenheiten. Er kann das, obwohl er sie nicht kennt. Er sieht es, wie andere sehen, dass einer hinkt oder Ringe unter den Augen hat oder Blumen in der Hand.
Wer das nicht kann, muss sich damit abfinden. Also sage ich: einige Ereignisse haben sich zugetragen. Und ich sage, es geht wirklich nicht darum, ob sie sich so oder anders zugetragen haben.
Ähnlichkeiten dagegen sind unbedingt beabsichtigt.
Ähnlichkeiten sind hübsch.
Aber die Ähnlichkeiten sind viel erfundener als alles andere. Gerade dann, wenn sie nicht zufällig sind.
Die Personen von Anfang an und einzeln vorstellen vermag ich nicht. Es ist manchmal schwer zu wissen, wer ist wer. Wie erst bei denen, die erfunden sind! Jederzeit können sie sich auf dem Absatz umdrehen und weggehen. Ich würde ihnen das keineswegs übelnehmen, aber entsprechend gering ist meine eigene Verpflichtung ihnen gegenüber. Ein Vorteil ist, dass diese Regel auch auf mich selbst zutrifft.
Viel von dem, was über Tel Aviv zu wissen ist, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Arten, etwas nicht zu wissen über die Stadt, in der man lebt. Wenn ich an all das denke, was ich nicht weiß über Tel Aviv, ruft es Trauer hervor. So viel verloren, denke ich, als sei man Zuschauer. Die utopischen Schichten blättern ab, wie das Meer sich in jedem Moment in die äußeren Schichten der Hauswände frisst, das Haus zerfrisst, ehe man es sich versieht.
Vieles hat so kurz existiert, ist schon vorbei. Man sieht es, dieses: Ist-schon-Vorbei. Dann kann man erleichtert aufatmen, oder man möchte, was gerade jetzt ist, berühren und etwas Belangloses, Beschwichtigendes murmeln, jaja, da bist du. Trost? Die Stadt braucht ihn nicht.
Dass ich gerade in Tel Aviv lebe, ist Zufall. Es gab eine Zeit, da hätte ich nicht eingewilligt, hier zu leben.
Die wechselnden Behausungen, in denen ich wohne, sind ebenfalls willkürlich. Mit der Zeit lernt man, worauf es bei einer neuen Wohnung ankommt. Die Stadt ist mir nicht fremd.
Gibt es warmes Wasser? Regnet es hinein? Kann man gleichzeitig einen Kühlschrank, den Boiler und den Heizofen einschalten? Gibt es Kakerlaken? Welcher Art und wie viele?
Ich lerne auch, dass es auf diese Fragen nicht ankommt. Die Antworten sind vielfältig und werden häufig auf die rücksichtsloseste Weise widerlegt. Man muss umziehen. Schon bin ich geübt, trage einen kleinen Zettel bei mir, auf dem ich die jeweilige Hausnummer, die Telefonnummer, die Postleitzahl notiere. Fragt mich einer, so weiß ich, wo ich wohne. Das Taxi vom Flughafen fährt mich, wohin ich will. Dort packe ich meine Taschen aus, laufe auf die Straße hinunter und durch die Nachbarschaft. Diejenigen, die ich nicht treffe, stelle ich mir vor: Wladimir. Idith. Den Bäcker Chaim. David und Ilana. Ruth und Avner und Schirah. Ich gehe ins Café Tamar. Sarah ist da. Ich frage mich, wo Hannah ist, die mich vom Flughafen hätte abholen sollen. Sie hat mich nicht abgeholt. Sarah gibt mir ein Rogalach. Und wenn nicht Hannah, dann Jaron.
Sarah hat sie heute noch nicht gesehen. Sie kommen nicht mehr zusammen, sagt sie. Sie haben sich getrennt. Ich schaue Sarah an. Sie gibt mir noch ein Rogalach und schaut mich nicht an.
Sie hat keine Zeit. Die Schokolade verklebt mir die Hände. Aber sie waren doch glücklich. Ich war nur fünf Wochen fort, gehe hinaus und zum Shuk, kaufe Apfelsinen und Datteln und laufe weiter zum Meer.
Alles kann sich schon geändert haben.
Tomaten sind teuer.
Aber hier ist das Meer.
Der Wind ist lau, nach Mitternacht. Streichelt unterschiedslos Haut, Gesicht, Sätze. Fische steigen an die Meeresoberfläche. Umarmte Paare, die sich küssen.
All dies fehlt jetzt. Tel Aviv, Winter.
Wie eine Schafherde setzen sich meine Gedanken in Bewegung. Dann erschreckt ein Schaf links außen und eines ganz hinten, sie machen sich auf und davon, stecken alle anderen Schafe an und laufen hierhin und dorthin. Manche aus purer Freude. Einige aus Bosheit. Plötzlich ist alles in Bewegung und stiftet Unordnung. Ich muss mich noch einmal genau umsehen.
Ich stelle mir vor, wie die Alte, die in der Unterführung zum Shuk sitzt, sehr große Büstenhalter verkauft, einschläft, und als sie aufwacht, fehlt ihr ein Schuh. Aber es waren Schuhe mit Schnürsenkel – wie kann ihr jemand einen Schuh ausgezogen haben im Schlaf? Hat keiner der Vorübergehenden etwas gesagt? Sie sitzt eine lange Weile stumm und schaut auf ihren Fuß in einem schwarzen Strumpf.
Mit Abschieden tauchen andere Gesetze auf. Dinge zeigen die Unterseiten ihrer Panzer. Alles birgt einen Schrecken oder scheint etwas zu rufen. Alles Mögliche ist möglich, und wenn es sich schon nicht mehr ändern lässt, dann wird vieles komisch und traurig. Man muss etwas beiseitestehen und entdeckt, wie es sich mit Gegebenheiten verhält, wenn man sie aus diesen oder jenen Gründen nicht benutzt und nichts mit ihnen anzufangen weiß: kein Anfang, ein Ende. Unbeaufsichtigt, vorweg schon unbeachtet, setzt sich alles in Bewegung und versteint zu dünnen Bildtafeln. Als ich in Hannahs und Jarons Wohnung komme, stehen sie nebeneinander vor den Bücherregalen, die aus der Wand geschraubt sind, und vor den wie zerschlagen aussehenden Büchern. Also haben sie sich doch nicht getrennt? Schau, sagt Hannah und zeigt auf die Bücher, als wäre damit alles gesagt.
Es betrübt mich, ihre Hände so zu sehen. Ihre Hände liegen auf Gegenständen, und man merkt ihnen an, sie bemühen sich, unauffällig zu bleiben. Die Gegenstände sind schwer, weil es heiß ist, und selbst das, was sich nicht von alleine bewegen kann, zeigt, es will sich nicht bewegen. Wüsste Hannah, dass ihr etwas entzogen wird, dann könnte sie vielleicht zeitweilig Verzicht leisten. Jetzt sind die Gegenstände schwerer, als es gut sein kann.
Weil es warm ist wie im Sommer, zu warm für den Monat Oktober, hat das Meer noch zwanzig Grad. Aber da es schon einmal geregnet hat, muss Winter sein, auf der Straße ist es viel ruhiger als sonst, viel weniger Menschen gehen vorbei, der Strand liegt beinahe verlassen.
Die fliegenden Kakerlaken sieht man schon von weitem. Sie fliegen kleinere Entfernungen, von einer Hauswand auf einen Ast und weiter zu einem Abwasserrohr, kleine Strecken, aber nichtsdestotrotz kommen sie immer näher, unbeirrt und zähe, und ein Spalt zwischen Fenster und Fensterrahmen reizt sie zu ungeahnten Anstrengungen – mach dir nichts vor, sie werden hereinkommen. Du kannst einstweilen im Zimmer stehen, einen festen Schuh hast du schon zur Hand; jetzt musst du nur warten, bis die Kakerlake mit einem harten, knappen Geräusch auf den Kacheln landet, dann hebst du den Arm und lässt ihn niedersausen, nicht zu laut, um das Knacken des Panzers zu hören, nicht zu fest, um noch ein letztes Zappeln zu sehen, und wenn du nicht schon die nächste Kakerlake im Anflug sähest, könntest du dir erlauben, glücklich zu sein.
Wenn sie sich getrennt haben, ist das ihre Angelegenheit, sagt Sarah. Viele trennen sich. Aber man weiß nicht genau, wozu, fügt sie hinzu.
Die Zeit bewegt sich manchmal unsinnig schnell, und manchmal ist sie so groß und träge, dass man ganz sicher sein kann: fett und bewegungslos sitzt sie in irgendeinem schmierigen Sessel auf der Straße, wahrscheinlich bei den Vetteln im Cerem ha-Teimanim, und rührt sich nicht. Sowieso steckt sie uns alle in die kleinste ihrer Taschen, dort purzeln wir aufeinander, schlagen uns gegenseitig die Köpfe an und holen uns blaue Flecken. Viel zu eng. Missgelaunt. Ständig aufgeregt.
Hannah übernachtet bei mir, und wie sie schläft, hat sie etwas von einem sehr leisen Tierchen, richtet sich schlafend auf, greift nach dem Kopfkissen und zieht es von allen Seiten über den Kopf. Dabei macht sie ein ernstes Gesicht. Rutscht das Kissen weg, versucht sie, den Kopf zur Wand zu drehen, als könne sie mit dem Zwischenraum das Licht vermindern. Lange wird sie so nicht mehr schlafen, der Lärm zerrt an ihrem Schlaf, klingt ab, kehrt zurück, ein kleines Flugzeug, der Straßenfeger, dann wieder ein schweres Motorrad oder ein Lastwagen, das Rufen des Alte-Sachen-Händlers. Es sieht so aus, als versuche sie, ihre Lautlosigkeit dem Lärmen der Straße entgegenzusetzen.
Ein paar Tage später ist es mit einem Mal ganz still. Für Minuten hört man nur die Radios. Die Stadt verstummt, sie hört nichts mehr und will nichts mehr hören, wischt sich das Blut ab. Später sitzen und stehen Leute vor den Fernsehern in den Cafés. In jedem Gespräch immer wieder Brocken. Die Toten. Die Verletzten. Die Palästinenser. Die Verletzten. Die Toten. Fallen in Gespräche und Tätigkeiten wie fremde Stimmen. Ohne Namen. Sich selbst ist die Stadt fremd, will sich nicht kennen und nicht amüsieren. In das Verstummen und die Interviews fallen Tote ohne Namen und ihre Angst. Sieben Stunden später räumen Müllautos die Straße. Überreste des Autobusses. Glassplitter. Der zweite Autobus. Der Abfall der Ersten Hilfe. Blutflecken. Orthodoxe sammeln Fleischstücke, Hautreste von der Straße, den Hauswänden.
Dann die ersten Namen.
Immer mehr Namen.
Nachts, es ist schon nach Mitternacht, krächzt eine Krähe. Wie merkwürdig zu denken, dass ein Vogel plötzlich aufwachen kann oder vielleicht nicht einschlafen.
Bei uns ist alles gut, sagen sie. Falls sie sich sorgen, dann lieber heimlich. Und Avner war schon immer mager. Manchmal träumt er von Abrechnungen und Bestellungen und Ladenkosten, und sie von einer Vase und einem Krug und springenden Glasuren und klirrenden Öfen.
Ruth war auf der Kunsthochschule. Avner verkauft Geschenke.
Ruth würde nie die kleinen, blumigen Keramiken nehmen und vom Dach ihrer Wohnung in Richtung Meer schleudern, unten springt eine dicke weiße Katze entsetzt auf.
Stattdessen fahren sie ans Meer, und sie bemerkt, wie komisch Avner aussieht, blass und dünn stakt er in seinen roten Badeshorts. Sie vermeiden, einander anzusehen. Schirah läuft zum Wasser, sie läuft zurück und spielt Stunden im Sand. Die Sonne steht hoch. Also ist es heiß. Wenn jetzt ein Schiff mit violetten Segeln vorbeikäme, dann würde sie streiten und sich sofort, standrechtlich, trennen. Die ganze Wahrheit kann von einer lächerlichen Begebenheit abhängen. Von der Hitze. Dem scharfen Licht. Ohne Begehren sehen sie die nackten, versehrten Flächen des anderen Körpers.
Unter dem Laden haben sie einen Keller gemietet, in dem sie ihre Waren lagern, sortieren, hin und wieder abstauben. Ihre Kunden sind zufrieden. Wenn er die Listen durchsieht, Keramiken, getrocknete Blumen, Geschenkkarten zusammenstellt und verschickt, wenn er kontrolliert hat, dass im Laden alles vor sich geht, wie es vor sich gehen soll, sitzt er im Keller. Er muss nur seine Computer anschalten, um dort so lange zu sitzen, wie er mag. Keiner wird ihn stören: sie haben sich selbständig gemacht.
Die Katastrophe wird eingetreten sein, denkt er, wenn er im Lager erstickt zwischen unverkäuflichen Keramiken, Kerzenleuchtern mit wandernden Kamelen, getrockneten Blumen, Holzkistchen, den Mandeln in bitterer Schokolade. Treten Sie ein, und sehen Sie sich ganz genau um. Er sieht sich genau um.
Er sieht Schirah.
Schirah lernt beizeiten, dass sie sich vorsichtig bewegen muss, wenn sie willkommen sein will – Keramiken sind zerbrechlich. Sie bewegt sich vorsichtig und darf bleiben.
Ein kleiner dicker Mann mit einer knubbeligen Nase, schwere Hände in die Hosentaschen gebohrt, steht vor einer der zahllosen Schreinereien in Florentin und debattiert aufgeregt mit einem großen Mann, der einen fetten Bauch in ein blaues T-Shirt gezwängt hat, mürrisch aussieht und einen Hammer in der Hand schwingt. Man sieht ihnen an, dass sie es gleich wissen werden. Was? Darauf kommt es nicht an. Auch wenn es dasselbe ist, was beide wissen werden, wird das keinesfalls zu einer Einigung führen.
Die Häuser hier, in Florentin, Neweh Zedek, in Jaffo, sind in der Mehrzahl klein und verwahrlost. Werden sie angestrichen, dann machen sie sich lächerlich mit ihrem Aufputz und ihren Farben. Davor verbleicht Wäsche.
Andererseits scheint ihnen das wenig anzuhaben. Sie sehen noch immer aus wie zuvor. Das liegt vielleicht daran, dass Häuser hier einiges gewöhnt sind. Sie zerfallen vor dem Meer, und wenn es regnet, dann regnet es womöglich hinein. Meist kümmert man sich kaum um sie. Sollen sie zurechtkommen, die Häuser, und deswegen sehen sie erschreckt aus, wenn man sie Reparaturen und Renovationen unterzieht. Täuscht man sie nicht? Sie haben allen Grund, misstrauisch zu sein. Man kann sie nämlich auch abreißen. Mit der größtmöglichen Leichtigkeit.
In dem Eukalyptusbaum vor dem Fenster habe ich eine Schallplatte gesehen. Im Wind rutschte sie einen Zweig tiefer, so wurde ich auf sie aufmerksam. Da ich gerne wissen wollte, um was für eine Schallplatte es sich handelt, habe ich mir von den Nachbarn ein Fernglas geliehen, um das Etikett zu lesen. Es ist das Streichquartett op. 135 von Beethoven. Soweit ich das beurteilen kann, ist sie in gutem Zustand, doch außerhalb meiner Reichweite. Den ganzen Vormittag habe ich mich gemüht und war sehr enttäuscht, dass ich nichts auszurichten vermochte.
Plötzlich scheinen mir alle Dinge außerhalb meiner Reichweite miteinander verbunden. Es ist eine lange Kette. Die Schallplatte ist dabei bloßes Zwischenspiel.
Wladimir kann verschwinden, bis man überlegt: gibt es Wladimir? Sein Haus bleibt dunkel. Die Rollläden sind geschlossen. Auf jedem Balkon steht jemand, oder es lehnt sich einer aus dem Fenster. Nur Wladimirs Haus ist abgeschieden. Es verweigert jede Aufmerksamkeit.
Aber das stimmt nicht. Das Schlimme ist nicht, dass Einsamkeit maßlos ist, sondern dass sie ihr sehr genaues, kleinliches Maß hat. Er tritt hinaus auf den Balkon, schaut auf die Straße hinunter und sieht, die Menschen gehen von einem Ort zum anderen, als wäre das nichts. Oder: einer geht die Straße entlang, ein anderer kommt ihm entgegen, und sie kennen sich. Sie bleiben stehen, reden einer mit dem anderen und verschwinden zusammen in einem Café. Er denkt sich, dass er das auch einmal versuchen muss, geht hinunter und läuft die Straße entlang und zurück, bis ihm einer begegnet. Aber der schaut ja gar nicht auf, der kennt ihn nicht und bleibt nicht stehen, ganz einfach und achtlos geht er weiter.
Manchmal wirft Wladimir Olivenkerne oder Zigarettenstummel hinunter auf den Gehweg – soll einer stolpern.
Hufe klappern auf dem Asphalt. Ein Geräusch, auch eine Farbe oder ein Geruch, kann einen glücklich machen wegen des Satzes, der es beschreibt. Hufe klappern auf dem Asphalt. Jeden Morgen höre ich den Altwarenhändler, seinen Wagen, sein Pferd. Auf dem Asphalt klappern Hufe. Der Altwarenhändler ruft: Alte Sachen! Alte Sachen!
Zum Beispiel alte Kühlschränke. Am aufgelassenen zentralen Busbahnhof werden sie verkauft. Garantie: zehn Jahre.
Das Pferd des Altwarenhändlers wird dann längst tot sein. In zehn Jahren. Schon jetzt sieht es nicht recht gesund aus.
Man kann die Stadt lieben, in der man lebt. Man kann in einer Stadt leben, die man liebt. Und das ist etwas ganz anderes, als gut zurechtkommen in einer Stadt. Wenn man eine Stadt liebt, dann ist sie ständig im Hintergrund dessen, was man tut in gerade dieser Stadt. Das kann stören. Eifersüchtig verlangt sie ihr Maß Aufmerksamkeit. Aber es kann einen auch glücklich machen. Jede Begegnung, jedes Ereignis und jede Tätigkeit hat ein besonderes Gewicht, eine Geschichte, die unbedingt zu erzählen ist, nicht für sich selbst, sondern um der Stadt willen. Man fällt nicht leicht von der Erdkruste. Die Blicke verhaken sich. Sie werfen Anker.
Er sitzt im hintersten Raum des langen und unübersichtlichen Ladens, in dem Galanteriewaren verkauft werden. Sie zählt Knöpfe. Sie ist fünfzig Jahre alt und hat ein dickes und ein dünnes Bein. Und sie liebt ihn. Seit dreißig Jahren arbeitet sie hier. Und seit dreiundzwanzig Jahren liebt sie ihn. Kommt einer und sucht einen Knopf, dann schüttet sie eine große Anzahl auf ein Tablett und reicht es dem Kunden. Vielleicht ist sein Knopf dabei.
Später gehen sie. Er geht, und sie geht, jeder in seiner Richtung, aber den Laden (›Rachamim‹, ›Erbarmen‹, heißt der Laden, so wie er und so wie sein Vater: ihr Vorname) verlassen sie gemeinsam. Sie wartet, bis er die Türe aufschließt. Währenddessen lehnt sie an der Tür. Das Licht brennt noch. Neonlicht. Das Glas in der Tür ist trübe, so dass man sie nur undeutlich sieht. Aber man sieht sie. Mehr braucht es nicht. Hebt wer einen Stein auf, schlägt durch die Türe.
Rachamim, im hintersten Raum des langen Ladens, hört nur den Schlag; vielleicht denkt er, sie hat etwas heruntergeworfen, zum Teufel, denkt er, hoffentlich sammelt sie es selbst wieder auf. Es fällt ihr schwer, sich zu bücken. Sie bückt sich nicht. Sie hat ein schwaches Herz. Aber wozu das Ganze? War es ein Scherz? Die unförmige Silhouette in einer Galanteriewarenhandlung? Er wird sie nicht gekannt haben, der mit dem Stein.
Rachamim vermisst sie oft.
Erst jetzt verstehe ich, was die Katzen dort gegenüber auf der Fensterbank zu sitzen, der Straße den Rücken zuzukehren und starr ins Zimmer zu schauen haben. Aufmerksam und vermutlich lüstern belauern sie die Vogelvoliere. Morgens jedoch sind sie verunsichert. Die Vögel in der Voliere zwitschern, und die Vögel im Baum unter dem Fenster zwitschern auch. Die Katzen schauen von diesen Vögeln zu jenen Vögeln und verrenken sich den Hals.
Dann hat sie eine große Wohnung, und abends rückt sie manchmal Möbel hin und her, um zu sehen, ob sie noch Geräusche machen, noch dieselben Geräusche.