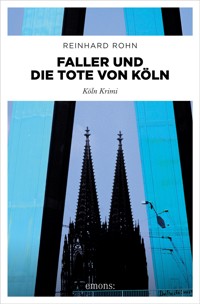10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die einzigartige Geschichte einer schicksalhaften Liebe und die alles entscheidenden Momente im Leben. Friedrich Dohle stellt sich auf freudlose Ferien ein: Seine Frau ist allein verreist, während er in Osnabrück bleibt. Doch dann steht auf einmal Susan vor seiner Tür, seine ehemalige Lehrerin, in die er sich vor fast vierzig Jahren haltlos verliebte. Gezwungen, ihre Beziehung geheim zu halten, schworen sie sich ewige Treue. Bis ein tragisches Unglück Susan aus der Stadt trieb. Nun ist sie zurückgekehrt, damit Friedrich sein Versprechen einlöst: sie für alle Zeit zu lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Reinhard Rohn, 1959 in Osnabrück geboren, lebt seit über dreißig Jahren in Köln und arbeitet als Verlagsleiter in einem Berliner Verlag. Er hat zahlreiche Kriminalromane ins Deutsche übersetzt und mehrere Spannungsromane geschrieben.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung der Motive von shutterstock.com/Daniela H, shutterstock.com/Doris Oberfrank-List
Lektorat: Dr.Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-092-1
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Norbert, Susanne, Barbara, Burkhard, Elle, Heinz-Rudolph, Wolfgang und all die verlorenen und auch längst vergessenen Osnabrücker Helden – und ganz besonders für Christian
Teil 1
1
Die Hitze war über Nacht schier unerträglich geworden. Eine Hitze, als würde die Luft in Flammen stehen, als würde man mit jedem Schritt eine Mauer aus heißem, flirrendem Dunst durchdringen müssen. Eigentlich war die Stadt aus Regen gemacht; jede Jahreszeit brachte ihren Regen mit sich, doch nun brannte die Sonne schon am Morgen sengend herab und schien alles mit ihrem grellen Licht einebnen zu wollen.
Die Gestalt, die am Gartenzaun stand, nahm er zunächst gar nicht wahr; sie war auch nicht viel mehr als ein Flimmern; sie war ganz in Weiß gekleidet, mit einem ebenfalls weißen Hut, der ihr Gesicht verdeckte.
Ein Vogel schrie, ein lautes, unwirkliches Geräusch, und erst meinte er, der Schrei dringe von der weißen Gestalt zu ihm herüber. Wenn man als Lehrer Dohle hieß, dann enthielt der Name eine Einladung für fade Scherze wie das Nachahmen von Vogelrufen. Doch die Gestalt rührte sich nicht. Sie wirkte auch nicht jung, sondern stand ein wenig gebeugt da, die Hände, die in weißen Handschuhen steckten, auf den Zaun gelegt.
Als er eine Bewegung mit seiner rechten Hand vollführte, verschwand die Gestalt dann auch, als hätte er sie weggezaubert.
Nora hatte sich entschieden, mit ihrer BMW nach Gibraltar zu fahren, einmal die Meerenge sehen und dann zurück. Er hatte sie nicht aufgehalten. »Du bist ein Feigling, Friedrich«, hatte sie gesagt, und es stimmte auch. Niemals würde er auf ein Motorrad steigen und sich schutzlos mit über hundert Stundenkilometern auf einer Straße bewegen.
Sechs Wochen lagen vor ihm – allein im Haus, in dem anscheinend heißesten Sommer seit Menschengedenken.
Nora hatte ihn nicht gefragt, was er vorhatte, das tat sie schon lange nicht mehr, und wenn, hätte er sie gewiss belogen. Aufräumen, hätte er gesagt, Papiere sichten … Dabei wusste er genau, was er tun wollte. Er wollte eine Geschichte schreiben, eine erotische Erzählung. Nora wusste nicht, dass er seit fünf Monaten zu einer Prostituierten ging. Er hatte sie beim Einkaufen getroffen, eine schmale, magere Frau mit künstlichen Locken und kleinen Brüsten, die nicht einmal besonders hübsch war. Weil sie einen Arm in Gips hatte, hatte er angeboten, ihr eine Kiste Mineralwasser in ihre Wohnung zu tragen. Eine Dachwohnung, die im Wesentlichen aus einem Zimmer bestand, mit einem großen roten Samtbett als Mittelpunkt. Beim ersten Mal hatten sie ohne Kondom Sex gehabt, was ihn im Nachhinein erschreckt hatte. Nie zuvor war er bei einer Prostituierten gewesen. Sie nannte sich Dela, aber er war beinahe sicher, dass es nicht ihr richtiger Name war.
Plötzlich klingelte es im Haus, das Telefon – der Festnetzanschluss, den Nora und er kaum mehr benutzten. Niemand meldete sich, dann, als er schon auflegen wollte, hörte er ein Summen, ein heißes weißes Summen; ja, so kam es ihm vor, als würde die weiße Gestalt vom Gartenzaun nun ein Lied summen, das ihm vage bekannt vorkam.
»Hören Sie«, sagte er mit heiserer Stimme. »Was soll das? Wer sind Sie?«
Statt zu antworten, legte der Anrufer auf.
Die Hitze schlich so schnell ins Haus, dass er atemlos schwitzend vor seinem Laptop saß. Ein weißer Bildschirm. Der erste Satz … Er musste die Worte für den Anfang finden. Als Kind hatte er jeden Abend ein Wort aufgeschrieben, ein Wort, das es nicht gab und das ganz allein ihm gehörte, ein Wort gegen den Rest der Welt. Totensonnenschein, Himmelslügenbild … Oder er hatte besondere Wörter gesammelt, deren Klang ihm gefiel: holterdiepolter, Abrakadabra.
Am Nachmittag, als er gelangweilt hineinschaute, in der Erwartung, nichts zu finden, entdeckte er eine Visitenkarte im Briefkasten, sie lag in einem weißen, feuchten Umschlag, auf dem keine Briefmarke klebte. »Bei Luigi, Bramstraße 17«, die vierstellige Postleitzahl war längst ungültig, genauso wie die Telefonnummer. Die Karte war über vierzig Jahre alt.
Dann, auf einmal, hatte er eine Ahnung, wer da an seinem Gartenzaun gestanden hatte. Jemand war aus dem Himmel gefallen, geradewegs auf sein schmales Stück Erde.
Nein, dachte er dann am Abend, als er unter einem dünnen Laken in dem Doppelbett lag, das er sonst mit Nora teilte, und auf die Geräusche der Nacht lauschte, nein, es konnte nicht sein. Warum hätte sie zurückkommen und an seinem Gartenzaun stehen und ihm eine alte Visitenkarte in den Briefkasten werfen sollen? Sie – die große wunderbare und zugleich furchtbare erste Liebe seines Lebens?
Er konnte lange nicht einschlafen. Die Hitze hatte sich in der Dunkelheit eingerichtet. Sie würde bleiben, hieß es im Wetterbericht, den ganzen Sommer lang, mindestens die nächsten sechs Wochen.
2
Ein Bild prägte seine Kindheit: ein kleines Kind, dreijährig, in einem schwarzen Anzug, einem Hemd mit einem harten weißen Kragen, der am Hals scheuerte, mit Lackschuhen und feinen weißen Handschuhen. Es saß auf einem Holzkasten. Wenn man nicht genau hinschaute, hätte man das hölzerne Ungetüm für ein zu groß geratenes Pferd halten können, ein unförmiges Spielzeug. Dass es ein Sarg war, wäre keinem Betrachter in den Sinn gekommen. Sein Vater hatte das Foto mit einer Leica geschossen. Der erste Sohn im Bestattungshaus Dohle. Mehrere Särge aus unterschiedlichem Holz – Eiche, Lärche, Kirsche – und verschieden große Urnen schmückten den Ausstellungsraum, dazwischen stand ein schwarzes edles Ledersofa, flankiert von zwei mächtigen Vasen mit teuren Orchideen. Auf Wunsch konnten von einer Musiktruhe auch klassische Klänge eingespielt werden. Bach, am liebsten etwas von Bach, auch wenn sein Vater von klassischer Musik eigentlich nichts verstand, sondern lieber bayerische Blasmusik hörte und seine Mutter Schlager liebte. Wenn er die Augen schloss, hatte er die Szenerie immer noch vor Augen.
Im Mai 1959, vier Wochen nach seiner Geburt, hatten seine Eltern sich mit ihrem Bestattungshaus selbstständig gemacht. Vorher hatte sein Vater als Tischler gearbeitet, aber dessen Rückenleiden war immer heftiger geworden, sodass er zuletzt mehr beim Arzt gesessen als an der Werkbank gestanden hatte.
Seine Mutter hatte ihre Bürotätigkeit bei einem Steuerberater aufgegeben, und er, der kleine Friedrich, kroch mit acht, neun Monaten zwischen den Särgen herum und wurde nur eingefangen, wenn Kundschaft ins Haus kam. Seinen ersten Toten hatte er gesehen, als er vier war – einen mageren nackten Mann, den er in seiner Erinnerung nur den Dirigenten nannte, weil er mit seinen grauen lockigen Haaren dem mittelalten Herbert von Karajan geähnelt hatte. Sein Vater hatte den Toten gewaschen und ihm dann ein weißes Rüschenhemd angezogen.
Später, mit acht oder neun, musste er seinem Vater zur Hand gehen, wenn er nicht auf Henry, seinen zwei Jahre jüngeren Bruder, aufpassen musste. »Reich mir mal den Kamm, Friedrich.« – »Wo ist das Totenhemd?« – »Na, sieht Frau Soundso nicht schön aus mit ihren gefalteten Händen?«
Manchmal hatte Friedrich schon damals das Gefühl gehabt, dass sein Vater sich am liebsten unter Toten aufhielt; er redete mit ihnen, sie widersprachen ihm nicht, und er hatte keine Angst vor ihnen. Er erzählte ihnen auch, wer er eigentlich war – der arme Flüchtling, den man aus Ostpreußen vertrieben, dem man alles genommen hatte, zuerst den Hof, dann die Eltern, auf der Flucht die kleine Schwester, die an der Ruhr gestorben war. Als Tischler habe er sich durchschlagen müssen – ganz unter seinem Stand, obschon sein Vater das erste Auto im Dorf besessen habe, die schönsten Pferde und einen Hofladen obendrein. Die Toten hörten aufmerksam zu. Selbst wenn der Vater sich permanent wiederholte, wenn aus dem Opel ein Mercedes wurde und all die Dinge aufgezählt wurden, die man im Hofladen verkauft hatte – Brot, selbst gemachte Wurst und so weiter –, wurden die Toten nie ungeduldig.
Wie ängstlich sein Vater war, konnte man erst begreifen, wenn er sein angestammtes Revier – das Bestattungshaus und die Friedhöfe der Stadt – verließ. Er fuhr nie in Urlaub, wollte nie ein anderes Land sehen; seit einem Sturz von einem Motorroller warnte er schon das kleine Kind, nicht zu schnell auf dem Fahrrad zu sein. Sein Refugium war ein Garten am Rande der Stadt, fünfhundert Quadratmeter mit viel Rasen und wenig Unkraut und einer Hütte, in der man zu viert ein Wochenende verbringen konnte. Eine Heizung gab es in der Hütte nicht, aber das erste Telefon der Gartensiedlung, weil ein erstklassiger Bestatter immer erreichbar sein musste.
An der ersten Bestattung nahm Friedrich mit elf Jahren teil, als einer von vier Sargträgern. Er ging ganz hinten links, mit ernstem, ruhigem Gesicht. »Guck dir die Soldaten vor dem Buckingham-Palast an«, hatte sein Vater gesagt. »So muss auch ein guter Sargträger aussehen, gelassen, ohne eine Miene zu verziehen, seelenruhig.« Der Sarg war schwer, der Griff schnitt tief in seine linke Hand, er atmete in kurzen Stößen durch den Mund, seine Augen waren auf ein fernes Nirgendwo gerichtet. Der Tote hatte eine gewisse Berühmtheit, ein Schauspieler vom Stadttheater, deshalb standen etliche Leute am ausgehobenen Grab. Friedrich schwitzte, und einmal, während sie mit dem Sarg auf das Grab zusteuerten, musste er sich einen besonders großen, lästigen Schweißtropfen von der Lippe lecken.
Am nächsten Tag war ein Foto der Bestattung mit ihm in der Zeitung – ausgerechnet dieser Moment war eingefangen worden, wie er mit offenem Mund den Sarg trug. Er war in der sechsten Klasse am Graf-Stauffenberg-Gymnasium, ein schlechter Schüler, doch nun bekam er obendrein einen neuen Namen. Er hieß bis zum Abitur: der Bestatter.
Wer hat heute Kartendienst? Der Bestatter!
Wo ist das Klassenbuch? Beim Bestatter!
Für die Klassenfahrt sammeln? Das kann doch der Bestatter erledigen.
Es half nichts, sich dagegen zu wehren, und Friedrich gab es auch rasch auf.
Nur seine Mutter verstand, wie unglücklich er war. Eines Abends hörte er, wie sie zu seinem Vater sagte: »Hermann, der Junge mag das nicht. Er will dir nicht bei der Arbeit helfen; es ist auch nicht gut für ihn.«
Sein Vater schnaubte, wie er es immer tat, wenn ihm etwas nicht gefiel. »Er hilft mir nicht oft, nur ausnahmsweise, wenn jemand ausfällt. Ich habe meinem Vater immer gerne geholfen, und unser Beruf ist ehrenwert. Wir sind für Menschen da, Trauernde, die in höchster Not sind. Wir …«
»Für Friedrich ist das nichts«, unterbrach seine Mutter ihn ungewohnt energisch.
Das nächste väterliche Schnauben fiel lauter und unwirscher aus. »Er soll einmal das Geschäft übernehmen. So lernt er es von klein an, und die schlimmen Fälle, die Unfallopfer, kriegt er gar nicht zu Gesicht. Ich weiß doch, was ich tue, Marianne.«
Mit diesem Satz beendete sein Vater die unliebsamen Gespräche. Ich weiß doch, was ich tue.
Am nächsten Tag sah er seinen Vater auf einmal mit ganz anderem Blick. Die kleine, untersetzte Gestalt, die schwarzen Härchen auf seinen Händen, die Augen, die tief in den Höhlen lagen, den schmalen, beinahe lippenlosen Mund, die Haare, die er sich morgens pedantisch über die große kahle Stelle am Hinterkopf kämmte. Er will, dass ich so werde wie er! Dieser Gedanke stach ihn immer wieder. Ich soll sein kleines, ängstliches Leben verlängern.
Als hätte der Einwand seiner Mutter gefruchtet, musste Friedrich in den nächsten Monaten bei keiner Beerdigung mehr aushelfen, nur dann und wann hatte er Botengänge zu erledigen, oder er wurde beauftragt, Blumen zu besorgen oder Fotografien rahmen zu lassen.
Doch dann – er war mittlerweile vierzehn Jahre alt – musste er an einem regnerischen Dezembertag wieder die weißen Handschuhe überstreifen. Ein Bauunternehmer war gestorben. Ein hohes Tier, wie sein Vater meinte. Eine große Trauerfeier – »wir dürfen da nichts falsch machen, da werden gut und gerne zweihundert Leute zusammenkommen«.
Der Sarg war pechschwarz, ein schwarz lackierter Kasten. Das Foto des Toten hatte verraten, dass er groß und fett gewesen war. Kurz vor der letzten Kurve geriet Friedrich ins Stolpern, nicht aus Schwäche, wie er sich eingestehen musste, sondern aus Widerwillen, Verdruss und Ekel. Für eine lange Sekunde geriet der Sarg in Schieflage, er drohte sogar umzuschlagen, doch die anderen Männer, alle drei routinierte Träger jenseits der sechzig, denen die graue Teilnahmslosigkeit ins Gesicht gemeißelt war, waren geschickt genug, um die Katastrophe zu verhindern, und stellten das Gleichgewicht wieder her, bevor Friedrich sich gefangen hatte. Nur sein Vater hatte diesen einen Moment der Disbalance bemerkt, wie an seiner mürrischen Miene abzulesen war.
Doch Friedrich selbst empfand kein Schuldgefühl, im Gegenteil, später, als er im Bett lag, das strafende Schweigen seines Vaters ertragen hatte, kam es ihm wie ein Akt des Widerstandes vor. Noch ein-, zweimal straucheln und er wäre von diesen Gängen befreit.
Wenn seine Mutter nicht an Migräne litt, was mit den Jahren immer häufiger vorkam, ging sie sonntags tapfer ins Hochamt; sein Vater jedoch ließ sich nur selten in der Kirche blicken, er schützte andere Tätigkeiten vor, dabei war es ihm wichtig, den Kontakt mit dem glatzköpfigen Pfarrer mit den rosigen Wangen zu halten. Von Sankt Joseph kam schließlich häufig Kundschaft, und im Gemeindeblättchen inserierte er auf der ersten Seite. »Seriös und kompetent – das Trauerhaus Dohle. Vierundzwanzig Stunden für Sie im Dienst.«
Ihn und seinen Bruder Henry schickten sie jeden Sonntag zur Zehn-Uhr-Messe. »Bete für mich mit«, rief ihm sein Vater manchmal lachend zu. Friedrich hatte schon damals nicht begriffen, ob sein Vater religiös war; er kannte Gebete, konnte lauthals ein paar Kirchenlieder singen, was er besonders in der Weihnachtszeit auch tat, aber ob es ihm etwas bedeutete, wusste wahrscheinlich nicht einmal die Mutter. Später, als Friedrich kaum noch aushalf, war er sicher, dass der Vater nur an den Tod glaubte; der Tod war sicher, mit dem Tod kannte er sich aus, und ob danach noch etwas kam, ob die Leichen, die er wusch und anzog, in irgendeiner Sphäre weiterlebten, interessierte ihn nicht. Eher war von Belang, dass die Rechnung, die nach einer gebotenen Zeit folgte, pünktlich beglichen wurde.
Als Friedrich fünfzehn war und bei einer Bestattung einen Niesanfall erlitten hatte, nahm sein Vater ihn hinterher beiseite. Er sprach mit scheinbar freundlicher, salbungsvoller Stimme, in einem Tonfall, der eigentlich zahlungskräftigen Kunden vorbehalten war. »Friedrich, ich weiß ja, dass du im Grunde gerne hilfst, aber ich glaube, nun ist Henry dran. Dein Bruder … er bewegt sich besser, er ist noch jung, aber schon sehr reif. Er hat mich gebeten, demnächst einmal helfen zu dürfen.«
Friedrich nickte nur; sein Herz war in Aufruhr. In der Schule würde er immer der Bestatter bleiben, aber nun würde Henry, der sich gern die Haare mit Pomade einschmierte und in einem schwarzen Anzug vor dem Spiegel auf und ab ging, seinen Part übernehmen.
»Gut«, sagte er nur. »Ich verstehe.« Und sein Vater nickte verständnisvoll und tätschelte ihm den Kopf, was er hasste wie nichts auf der Welt.
Wenn man ihn zur Kirche geschickt hatte und seine Mutter nicht dabei war, hatte er meistens nur kurz ins Gotteshaus geschaut und nachgeguckt, welcher der drei Priester der Gemeinde sich hinter dem Altar aufbaute, um hinterher davon berichten zu können, dann war er weitergezogen, um drei Straßenecken zu einem Sportplatz, auf dem sonntagmorgens irgendwelche sechstklassigen Fußballmannschaften gegeneinander spielten. Dickbäuchige Männer rannten hinter dem Ball her, schrien und fluchten, doch es interessierte ihn mehr als eine lange Predigt, in der es nur hieß, die Menschen seien verdammt und könnten allein durch Demut und Gebete erlöst werden. Das hatte er schon früh nicht begriffen, warum Menschen sich um eine Figur versammelten, die blutend und leidend an einem Kreuz hing.
In den Sommerferien schickten die Eltern Henry und ihn in das Zeltlager der katholischen Gemeinde. Meistens ging es mit einem alten Reisebus mit fünfzig Kindern irgendwo in ein Kaff im Emsland, wo sie selbst ein Plumpsklo ausheben mussten und frühmorgens zu einem See gingen, um sich zu waschen. Es gefiel ihm nicht sonderlich, war aber immer noch besser, als mit den Eltern im Gartenhaus zu sitzen und dem Gerede seines Vaters zuzuhören, der, wenn er betrunken wurde, von Ostpreußen sprach, von langen Schneewintern, von Kutschfahrten über zugefrorene Seen und dass der Iwan alles kaputt gemacht habe.
Die Kirchengemeinde wurde für Friedrich aber erst interessant, als er vierzehn Jahre alt geworden war und dort bei einem sogenannten Disco-Abend Udo traf – Udo Kayser, Kayser mit Ypsilon.
Udo war ein Jahr älter, er ging auch aufs Stauffenberg, anfangs eine, später zwei Klassen höher. Er trug die schwarzen Haare lang, hatte bereits einen Oberlippenbart und rauchte auf dem Schulhof ganz offen in der Raucherecke. Friedrich war ihm schon häufiger begegnet, aber noch nie hatten sie miteinander gesprochen. Udo wirkte auch immer ein wenig abwesend; seine Lider leicht gesenkt, wandelte er über den Schulhof und schien niemanden wirklich wahrzunehmen.
Die Disco-Abende fanden immer freitags statt; Ralf Merkmann, einer der älteren Ministranten, legte dann von sieben bis um neun Uhr im Partykeller des Pfarrheims Platten auf. Da das Stauffenberg ein reines Jungengymnasium war, bot sich hier die beste Gelegenheit, die Mädchen vom Kollwitz-Gymnasium kennenzulernen.
Friedrich war nicht wirklich erstaunt, dass er auch im Pfarrheim der Bestatter war, doch bei manchen Mädchen klang es eher ein wenig ehrfürchtig als spöttisch. Er galt als sympathisch und war durchaus beliebt, aber er spürte selbst, dass er zu schüchtern und wenig redegewandt war.
Das schönste Mädchen wagte er daher auch nicht anzusprechen; sie tat es jedoch zu seinem Erstaunen. Beate, lange blonde Haare, ein sinnlicher Mund, der meistens damit beschäftigt war, Kaugummi zu kauen, und hellblaue Augen, kam auf ihn zu und ergriff seine Arme.
»Tanzen wir?«
Nein, wollte er zuerst sagen, ich bin ein schlechter Tänzer, aber da hatte sie ihn schon auf die Tanzfläche gezogen, die von einer Lichtorgel, die Bernhard Fellinger, der Sohn des Küsters, gebaut hatte, erleuchtet wurde. Sie tanzten den ganzen Abend miteinander, ohne mehr als fünf Sätze zu wechseln, und als Ralf Merkmann einmal »Angie« von den Stones spielte, schloss er die Augen, während er die schöne Beate in seinen Armen wiegte.
Als er sie wieder öffnete, sah er, wie Udo Kayser, der sich selten bei diesen Abenden sehen ließ, mit einem spöttischen Grinsen an ihm vorbeistreifte und ihm zuflüsterte: »Na, Bestatterchen, gefällt dir der Klammerblues?«
Später, als Beate sich auf ihr Fahrrad geschwungen hatte und er sich zu Fuß auf den Heimweg machen wollte, hörte er aus einem offenen Fenster des Pfarrheims Klaviermusik. Neugierig schaute er hinein, und da saß Udo Kayser in einem recht großen leeren Raum und hämmerte wild auf einen Flügel ein. Als hätte er seinen Blick gespürt, brach er unvermittelt ab und wandte sich um. Er schob sich die schwarzen Haare aus der Stirn. »Komm rein«, sagte er dann. »Ich spiele dir meinen neuesten Song vor.« Er sagte schon »Song«, was damals noch gar nicht üblich war.
Obwohl es eigentlich schon viel zu spät war und bis auf Ralf alle den Partykeller verlassen hatten, machte Friedrich kehrt und suchte den Raum, in dem Udo Kayser am Klavier saß. Er lag ein Stockwerk höher als der Partykeller, neben dem Saal, in dem die Kommunionkinder unterrichtet wurden.
Kaum hatte er den Raum betreten, legte Udo los; er wiegte den Kopf hin und her – mit geschlossenen Augen –, seine Hände glitten schlafwandlerisch über die Tasten, und die Melodie, die sich ausbreitete, klang nicht nur wie Musik; sie war irgendwie mehr – wie eine Landschaft, die vor ihm entstand: ein Baum im Wind, ein Fluss, auf dem ein Boot dahintrieb, zwei Spaziergänger, Hand in Hand, irgend so etwas.
»Genial«, sagte Friedrich, nachdem der letzte Ton verklungen war.
»Ich müsste noch einen Text dazu machen«, sagte Udo Kayser und lächelte. »Könnte dann ein Hit werden.« Er breitete die Arme aus. »Hier übt der olle Bäumler immer. Ich darf hier spielen, wenn ich ihn dann und wann in der Kirche an der Orgel vertrete.«
Heinrich Bäumler war weit über sechzig, ein grauhaariges Monstrum, das ungefähr zwei Tonnen wog. Er war der Organist der Kirchengemeinde.
»Das Teil ist ein echter Bösendorfer«, redete Udo weiter. »Zu Hause habe ich nur ein Yamaha-Keyboard – keinen Flügel, und meine Mutter lauert mir immer auf.«
Als Friedrich noch etwas erwidern wollte, stand Ralf Merkmann in der Tür. »Zapfenstreich«, sagte der ältere Ministrant grinsend. »Was macht ihr eigentlich hier? Habt ihr wieder keine Weiber abgekriegt?«
»Was sollen wir mit Weibern?«, sagte Udo verächtlich. »Wir haben hier Kunst gemacht, nicht wahr, Friedrich?«
Er nickte; erst hinterher fiel ihm auf, dass Udo Kayser ihn mit seinem Vornamen angesprochen hatte.
Richtige Freunde wurden sie erst ein Jahr später. Friedrich hatte Beate zweimal geküsst, und einmal hatte er ihr unter die Bluse gegriffen, eher aus Versehen, aber da hatte sie ihn rüde abgewiesen. Er hatte keine Ahnung, ob sie richtig zusammen waren. Eigentlich sahen sie sich nur im Pfarrheim; ansonsten war Beate beschäftigt; sie ging auf ein altehrwürdiges Gymnasium in der Stadt, an dem auch ihr Vater unterrichtete, spielte Cello und war im Ruderverein.
Aber an einem Abend im Frühsommer nahm er sich vor, endlich offen und ehrlich mit ihr zu reden. Er wollte mit ihr zusammen sein, richtig mit ihr gehen, wie sie es nannten.
Doch wieder kam Beate ihm zuvor. Sie werde für ein Jahr nach Amerika fliegen, nach Atlanta zu Pflegeeltern, schon übermorgen; es sei also ihr letzter Abend. Vorher hatte er sich ein paar Tipps von Udo geholt, die nun komplett verwehten. Er konnte zu Beates Worten nur nicken, dann küsste sie ihn auf die Wange, als wäre er ihr kleiner Bruder, den sie trösten müsste. Weil irgendjemand seinen Geburtstag feierte, gab es außer Bier auch noch ein paar härtere Sachen – unter anderem Cola mit Rum –, die er in sich hineinschüttete.
Als Ralf Merkmann den Partyraum abschloss, war Friedrich so betrunken, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Alles um ihn versank in einem wabernden Nebel; Gesichter, Stimmen, Geräusche. Er versuchte, auf sein Fahrrad zu steigen, rutschte aber immer wieder ab, und als er endlich zu Hause angekommen war, den knappen Kilometer irgendwie hinter sich gebracht hatte, stürzte er förmlich ins Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen, damit seine Eltern nichts von seiner Trunkenheit mitbekamen. Eine sinnlose Aktion, die sein Bruder Henry ihm noch Jahre später voller Spott vorhielt. Zum Glück aber war sein Vater zu einem Trauerfall gerufen worden, und seine Mutter machte Büroarbeit und hockte in ihrer winzigen Kammer, in die sie sich immer häufiger zurückzog.
Als er am Montag – noch immer leicht lädiert – über den Schulhof lief, fragte Udo ihn, ob er schon das Pink-Floyd-Album gehört habe, das er ihm am Freitag geliehen habe.
Plötzlich fiel es ihm ein. Klar, als er das Pfarrheim verlassen hatte, hatte er in einem Stoffbeutel noch die LP »The Dark Side of the Moon« dabeigehabt, aber zu Hause war er ohne die Platte angekommen.
Udo bemerkte seine zerknirschte Miene. »Du hast sie nicht mehr, stimmt’s? Hast sie verloren.«
»Sorry, ich kaufe sie dir neu, gleich morgen«, erwiderte er, doch mit einer heftigen Bewegung umarmte Udo ihn. »He, jetzt hast du endlich einmal richtig Scheiße gebaut. Jetzt bist du nicht mehr Friedrich der Bestatter, sondern Friedrich der Plattenverlierer.«
3
Im Sommer 1977, als das Unglück begann, war Udo in der Stadt zu einem kleinen Star geworden. Zu seinem ersten Konzert in der Teestube der »Lagerhalle« waren fast fünfzig Leute gekommen, von denen auch dreißig Eintritt bezahlt hatten; im Mai, zwei Monate später im »Grünen Jäger«, war der Saal mit zweihundert Plätzen ausverkauft, und in der Zeitung stand ein großer Bericht, in dem Udo allerdings Liedermacher genannt wurde, was ihn kolossal ärgerte.
Seine Songs spielte Udo ihm weiterhin erst im Pfarrheim vor; er wechselte zwischen Klavier und Gitarre; für die melodischeren langsameren Lieder setzte er sich ans Klavier; für die rockigeren bevorzugte er die Gitarre. Er hatte sich für seine Auftritte von Fellinger einen Verstärker bauen lassen, an den er seine Gitarre anschließen konnte.
»Mensch, Friedrich«, hatte er nach dem ersten Konzert beinahe glückselig gesagt, »willst du mich nicht begleiten? Ich gebe dir eine alte Gitarre von mir, und du übst ein wenig. Du bist bestimmt supermusikalisch.«
Für einen Moment fühlte Friedrich sich geehrt, aber dann stellte er sich vor, wie er neben dem genialen Udo auf der Bühne stehen würde, und sah das Gesicht seines Vaters vor sich. Henry war von den Eltern gezwungen worden, Akkordeon zu lernen – Schifferklavier, wie es sein Vater nannte; sein Bruder hasste dieses Instrument, hatte sich aber nicht genug gewehrt und ging nun jede Woche eine Stunde zu einem unfreundlichen, wortkargen Musiklehrer. Seine Fortschritte bescheiden zu nennen war schon eine Übertreibung.
Statt also Gitarre zu lernen, half er Udo bei dessen Texten, die alle irgendwie von der Liebe handelten, obwohl sie beide da so gut wie keine Erfahrung hatten. Udo behauptete, einmal in dem sagenumwobenen Bordell an der Rehmstraße gewesen zu sein, aber das hielt Friedrich für pure Angabe. Viele Details zur Beschreibung waren ihm jedenfalls nicht eingefallen. Udo ging mit Barbara, einer wunderschönen schweigsamen Elfe vom Kollwitz, die ihm selbst jedoch ein wenig zu langweilig war, sodass sie sich meistens nur einmal in der Woche sahen. Friedrich hatte sich mit Monika – ebenfalls vom Kollwitz – angefreundet, die ihn ein-, zweimal in der Woche zu sich zum Teetrinken einlud und ihm erzählte, was sie alles bei Amnesty International so machte. Meistens musste er dann die ganze Zeit Cat Stevens hören, was ihm aber spätestens nach drei Liedern – Songs – gehörig auf die Nerven ging.
»Cat Stevens ist Kinderkacke«, sagte Udo, wenn keines der beiden Mädchen in der Nähe war. Er ging nun in die Dreizehn, er lernte allerdings kaum für die Schule, alles schien ihm zuzufallen. Seine Mutter war Lehrerin an einer Realschule und sein Vater Architekt, der anscheinend immer die gleichen Häuser baute – kastenförmig mit rotem Klinker – und erwartete, dass sein einziger Sohn in seine Fußstapfen trat, aber Udo war sicher, dass er Musiker werden würde; mit einem alten Rekorder hatte er mindestens zwanzig Songs aufgenommen, die er nun an Plattenfirmen und verschiedene Musiker schicken wollte.
Weil er die zehnte Klasse wiederholt hatte, kam Friedrich nach den Ferien erst in die Oberstufe. Klassen gab es nun auf einmal nicht mehr, und das Stauffenberg nahm zum ersten Mal auch Mädchen auf. Gerüchte darüber hatte es vorher zuhauf gegeben. Wer würde sich trauen, vom Kollwitz zu wechseln? Jemand, der behauptete, gute Kontakte zum Schulbüro zu haben, meinte, es hätten sich nur drei Mädchen angemeldet, alle von der Realschule.
Am ersten Schultag nach den Ferien standen ungefähr zwanzig Mädchen unsicher auf dem Schulhof; beäugt von zweihundert Jungen. Friedrich tat so, als würde es ihn nicht interessieren, aber ein Mädchen stach absolut heraus, und ausgerechnet sie schob sich eine Stunde später im Leistungskurs Deutsch neben ihn. Sie hatte lange Haare, die so schwarz aussahen, als wären sie gefärbt; auch ihre Kleidung war schwarz – Jeans, Stiefel –, nur die Bluse, die an den Ärmeln in Rüschen auslief, war weiß.
Sie sagte erst nichts, dann flüsterte sie ihm heiser zu: »Ich heiße Luna.«
Ihr wahrer Name lautete Friedegunde, aber wenn jemand sie so ansprach – gleichgültig, ob Lehrer oder Schüler –, reagierte sie nicht. Ihr Großvater war ein mittelmäßig erfolgreicher Landschaftsmaler gewesen, der irgendwann in den sechziger Jahren aus Worpswede nach Osnabrück gezogen und zehn Jahre später gestorben war, und ihm eiferte Luna nach. Sie wollte ebenfalls Malerin werden. Nur im Kunstunterricht zeigte sie einen gewissen Ehrgeiz, ansonsten glänzte sie durch absolutes Schweigen, und in den drei Kursen, die er mit ihr zusammen hatte, setzte sie sich zwar immer neben ihn, sprach aber auch mit ihm selten ein Wort.
Am vierten Tag hatte sich die erste Aufregung, dass nun genau achtzehn Mädchen den Weg ans Stauffenberg gefunden hatten, ein wenig gelegt, als etwas anderes geschah. Es war an einem Donnerstag in der fünften Stunde. Philosophie. Der Kurs bestand nur aus sechzehn mäßig interessierten Schülern. Zu seiner Überraschung war auch Luna darunter, die nun davon auszugehen schien, dass sie immer neben ihm saß.
Als die Tür aufging, glaubte Friedrich zunächst, eine neue Schülerin betrete das Klassenzimmer: eine große junge Frau mit langen blonden Haaren, die irgendwie wild, gleichzeitig auch geschickt geföhnt wirkten, wie sie ihr über die Schultern fielen. Ihr Gesicht war makellos, ein harmonisches Gesicht mit wasserblauen Augen und einer perfekt geformten Nase und Lippen, auf denen ein leichter rötlicher Schimmer lag.
Er spürte eine Reaktion, die er noch nie gespürt hatte. Sein Herzschlag beschleunigte sich; er atmete schneller, und er staunte; ja, er staunte über so viel Schönheit. Er bemerkte, dass Luna ihm hinter dem Schleier ihrer langen schwarzen Haare einen überraschten Blick zuwarf, dem er jedoch keine Bedeutung zumessen konnte, denn er vermochte seine Augen nicht von diesem Wesen zu nehmen, das sich auf das Pult zubewegte und eine schwarze Segeltuchtasche ablegte.
Nein, diese junge Frau war keine Schülerin; sie betrachtete wortlos die Klasse vor ihr; wie zwei grelle Suchscheinwerfer glitten ihre Augen umher, dann drehte sie sich um, nahm ein Stück Kreide und schrieb an die Tafel: »Susan Sorge«.
Mit einer eleganten Bewegung legte sie die Kreide wieder ab; sie wandte sich um, lächelte, auch ihre Zähne waren perfekt. »Bevor wir anfangen«, erklärte sie mit einer überraschend dunklen Stimme, »ich bin hier zwar nur die Referendarin, aber ich sage euch eins: Ich habe schon jeden Witz über meinen Namen gehört – Susi Sorglos. Oder Susanne Ohnesorg. Oder: Wer kann es Susan besorgen? Auch dass meine Initialen nicht besonders hübsch ausschauen, ist mir bekannt. Also versucht gar nicht erst, neue Witze zu erfinden, sondern verlegt eure sicherlich im Übermaß vorhandene Kreativität auf etwas Konstruktives. Verstehen wir uns?«
Sie lächelte erneut, und Friedrich wäre am liebsten aufgestanden und hätte laut »Ja!« gerufen.
Erst am Nachmittag begriff er, dass ihm etwas eigentlich sehr Peinliches widerfahren war: Er hatte sich in seine Lehrerin verliebt.
Zwei Nächte später träumte er von ihr; er zitterte, als sie sich als Traumwesen vorbeugte und den Arm um ihn legte, und er erinnerte sich später daran, als sie ihn wirklich berührte und er ihren Duft einatmete – ein Parfümhauch von Zitrone und Lavendel –, dass er genauso zitterte wie zuvor im Traum.
Obwohl er mit seinen Liedern beschäftigt war, bemerkte Udo die Veränderung, die in dem neuen Schuljahr mit Friedrich vor sich ging. »Was ist los mit dir?«, fragte er, als sie im Pfarrheim zusammensaßen. »Liebeskummer? Ist es diese kleine Schwarzhaarige, die immer an deiner Seite ist?«
Friedrich schüttelte den Kopf. »Ich mag Luna, aber mehr ist da nicht. Manchmal denke ich, sie hat Angst vor allem, nur nicht vor mir, und ist deshalb so anhänglich.«
Udo nickte. »Kann sein«, sagte er, »aber vielleicht ist es auch nur eine Masche. Jemand hat mir erzählt, dass auf dem Mädchenklo plötzlich ein Bild von Pohl hängt – mit einem Filzstift innen an die Tür gemalt. Pohl als Witzfigur mit Glupschaugen. Man hat Luna in Verdacht.«
Raimund Pohl war der Schuldirektor; er lief immer nur in einem grauen Anzug mit Krawatte herum, eine ehrfurchtgebietende Figur; nebenbei war er der Bürgermeister der Stadt und daher nicht oft in der Schule.
»Aber wenn Luna es nicht ist – wer ist es dann?«, fragte Udo weiter.
»Stress mit Monika«, log Friedrich. »Nichts weiter.«
Udo schaute ihn an, seine Augen funkelten. Er glaubte ihm nicht. Dann sagte er einen Namen, der Friedrich sofort erschreckte und ihn glauben ließ, sein Freund könne Gedanken lesen. »Diese Susan«, sagte er, »diese neue Lehrerin – kennst du sie? Sie hat nun den Musikunterricht übernommen, weil der alte Großhoff krank ist, obwohl sie gar keine richtige Musiklehrerin ist. Daher haben wir uns in der letzten Stunde nur Musik angehört. ›Die Moldau‹ – eine Sinfonie über einen Fluss. Meinst du, ich sollte ihr mal einen meiner Songs vorspielen?«
»Ja«, sagte Friedrich matt, »spiel ihr doch etwas vor.« Er stellte sich vor, wie Susan Sorge in das Pfarrheim schritt, an Ralf Merkmann, dem älteren Ministranten, vorbei und dann mit leicht gesenktem Kopf auf einem Stuhl saß und zuhörte. Aber das hatte Udo gar nicht gemeint.
»Vielleicht«, sagte er, »frage ich sie nach der nächsten Stunde, ob wir noch ein paar Minuten dableiben können. Dann setze ich mich ans Klavier und singe etwas.«
Friedrich erkannte, was es bedeutete, wenn etwas von einem Besitz ergriff. Zum ersten Mal in seinem Leben schien ihm etwas eine Bedeutung zu haben. Er wollte wissen, wer diese Susan Sorge war. Er hielt in der Schule nach ihr Ausschau, er schlug im Telefonbuch nach, um herauszufinden, wo sie wohnte, er überlegte sogar, sie zu verfolgen – zu stalken, obschon es das Wort noch gar nicht gab. Sie beherrschte seine Gedanken. Gelegentlich, wenn ihre Eltern unterwegs waren, hatte er mit Monika geschlafen, recht phantasielos, wie er sich eingestand, doch das tat er nun nicht mehr. Monika rutschte in ein graues Zwischenreich zwischen Bedeutung und Bedeutungslosigkeit.
An einem Freitag nach der Schule – es war fast schon halb drei – sah er Susan Sorge in einem weißen VW Käfer; die Fahrertür war geöffnet, und sie saß da und weinte; ja, sie tupfte sich mit einem Papiertaschentuch die Tränen aus den Augen. Er war so gerührt, dass er stehen blieb und sie anstarrte. Sie bemerkte ihn, ihre blauen, tränenfeuchten Augen tasteten ihn ab, dann nickte sie ihm zu und lächelte ihn an.
»Alles in Ordnung, Friedrich?«, fragte sie, als sei er es, um den sie sich Sorgen machen musste.
Er senkte den Kopf. »Ja«, sagte er mit schwankender Stimme. »Bei mir ist alles in Ordnung.«
Dann zog sie die Tür zu und fuhr an ihm vorbei davon.
4
Alle machten in diesem Jahr den Führerschein, nur Friedrich wollte darauf verzichten, denn er wusste, was das für ihn bedeutet hätte; sobald er aus der Schule gekommen war und frei gehabt hätte, wäre er mit dem Leichenwagen durch die Gegend gefahren. »Trauerhaus Dohle – immer für Sie da.« Henry hatte ihn nun endgültig bei den Trauerfeiern als Sargträger abgelöst, aber es würde noch knapp zwei Jahre dauern, bis er auch den Führerschein machen durfte.
Wann immer sein Vater ihm vorschlug, sich bei der Fahrschule anzumelden, schützte er irgendwelche faden Gründe vor – die Schule, den Fußballverein, bei dem er neuerdings wieder spielte. Zum Glück sprang seine Mutter ihm zur Seite, und als er dann endlich doch die ersten Fahrstunden nahm, war sein Lehrer völlig verzweifelt über seine Ungeschicklichkeit. Er brauchte dreißig Stunden bis zur Fahrprüfung, die er dann auch nicht beim ersten Mal bestand.
Udo hatte bereits den Führerschein, aber er ließ sich neuerdings fahren. Er hatte seinen ersten Fan – Christian Ellwangen, genannt Elle, der, weil er zweimal sitzen geblieben war, auch in die Elf ging, aber seit einem Jahr schon einen kleinen grünen Fiat fuhr. Von ihm ließ Udo sich nach Hause kutschieren, wenn ihm danach war, oder auch zu den Konzerten, die er nun im Umkreis dann und wann veranstaltete. Was Elle genau an Udos Musik mochte, kapierte Friedrich nicht, irgendwas schien ihn jedoch in Bann zu ziehen. Elles Markenzeichen war sein Grinsen. Gleichgültig, was man ihm sagte, ob man ihn beschimpfte, ihm Vorwürfe machte, ihn einen Schwachkopf nannte: Elle beantwortete alles mit einem breiten Grübchengrinsen.
An einem Tag im Oktober sagte Udo, der sonst in der Schule kaum mit ihm sprach, in der Pause zu Friedrich: »Hast du heute Abend Zeit? Da passiert etwas. Elle holt dich um sieben Uhr ab.«