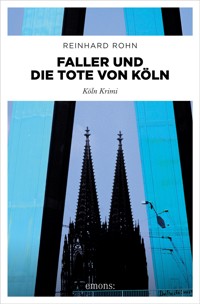9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jan Schiller ermittelt
- Sprache: Deutsch
Jan Schiller, Kölner Hauptkommissar, hat ein paar Probleme zu viel: Er fühlt sich krank, eine neue, äußerst wortkarge Kollegin macht ihm das Leben schwer, und er muss einen Mörder finden, der bei seinen Opfern ein rotes Herz hinterlässt. Der Täter scheint Schiller zu kennen: Er schreibt ihm E-Mails und lässt in der ganzen Stadt rote Plastikherzen aufhängen, als seien sie ein geheimes Zeichen. Dann geschieht ein dritter Mord - doch diesmal hat der Mörder einen Fehler gemacht: Es gibt einen Zeugen ..
Auftakt der großen Köln - Krimi Reihe mit Hauptkommissar Jan Schiller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Jan Schiller, Kölner Hauptkommissar, hat ein paar Probleme zu viel: Er fühlt sich krank, eine neue, äußerst wortkarge Kollegin macht ihm das Leben schwer, und er muss einen Mörder finden, der bei seinen Opfern ein rotes Herz hinterlässt. Der Täter scheint Schiller zu kennen: Er schreibt ihm E-Mails und lässt in der ganzen Stadt rote Plastikherzen aufhängen, als seien sie ein geheimes Zeichen. Dann geschieht ein dritter Mord - doch diesmal hat der Mörder einen Fehler gemacht: Es gibt einen Zeugen ..
Auftakt der großen Köln - Krimi Reihe mit Hauptkommissar Jan Schiller.
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman "Rote Frauen", der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über "Matthias Brasch". Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Falsche Herzen
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Epilog
Danksagung
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
»Schrecklich ist das, dass die
Schönheit nicht nur etwas Furchtbares,
sondern auch etwas Geheimnisvolles ist.
Hier ringen Gott und Teufel, und der
Kampfplatz ist – des Menschen Herz.«
Fjodor M. Dostojewski,
»Die Brüder Karamasow«
1.
Er hasste die Stadt, er hasste den schmutzigen Regen, die engen Straßen, er hasste sogar die Leutseligkeit der Menschen in dieser Stadt, aber nirgendwo hatte er in letzter Zeit bessere Geschäfte gemacht. Vielleicht lag es auch nur am neuen Haus. Außer einer nagelneuen Küche, die er nicht brauchte, weil er überhaupt nicht kochen konnte, besaß er gerade mal ein großes französisches Bett mit eingebautem Radio, einen Glastisch, einen Laptop und ein Aquarium. Leider hatte Emma seine beiden Kois verhungern lassen, ein paar hundert Euro zum Teufel, aber das Aquarium war ohnehin zu klein für die beiden kostbaren Fische gewesen. Bei nächster Gelegenheit würde er sich neue Fische besorgen, für den Anfang würden ein paar Guppys reichen. Er musste nicht sofort wieder den Neureichen spielen. Dabei kannte er sich mit Fischen aus. Gab es etwas Beruhigenderes als ein Aquarium? Besonders bei Regenwetter konnte er stundenlang vor einem beleuchteten Aquarium sitzen. Allerdings brauchte er Musik dazu und Zigaretten und etwas zu trinken.
Er brauchte auch eine Putzfrau. Elke musste ihm gleich morgen, wenn er ins Büro kam, eine Putzfrau besorgen. Auch wenn er kaum Möbel hatte, war es wichtig, dass nirgendwo Staub lag, und er mochte es, wenn es im Bad nach Desinfektionsmittel roch. In Utrecht hatte er mit seinen Eltern in einem Mietshaus direkt an einem Kanal gewohnt. Da hatte es besonders im Sommer immer fürchterlich gestunken, und die Ratten waren sogar am helllichten Tag über die Straße gelaufen. Er wollte nie wieder arm sein.
Dass es mit Emma auseinandergegangen war, bedauerte er nicht wirklich. Achtzehn Monate waren eine verdammt lange Zeit. Außerdem hatte sie angefangen, von Kindern zu reden und auf sein Alter anzuspielen. Gut, er wurde nächstes Jahr fünfzig, aber was bewies das schon? Er hatte die Figur eines Dreißigjährigen, kein Gramm zu viel, und geraucht hatte er schon mit vierzehn. Trotzdem hätte er sie nicht schlagen müssen. Na, eigentlich war ihm nur kurz die Hand ausgerutscht. Nicht die feine Art, aber verzeihlich bei all dem Stress, den er hatte. Sie hatten sich immer schon ziemlich handfest gestritten, selbst wenn sie in Hotels abgestiegen waren. In Berlin, als er für einen Fernsehpreis nominiert gewesen war, hatte Emma im Adlon einen ganzen Spiegelschrank zerlegt, weil sie eifersüchtig auf eine holländische Schauspielerin gewesen war, die er von früher gekannt hatte und mit der er nur einmal im Bett gewesen war. Zum Glück hatte der Sender den Schaden übernommen, damit das Ganze nicht an die große Glocke gehängt wurde.
Der neue Exklusivvertrag als Produzent brachte ihm sechs Millionen für vier Jahre. Nicht schlecht, und Ersatz für Emma würde sich auch bald finden.
Für zwei Show-Reihen hatte er schon das Konzept fertig, bei der dritten würde er richtig über die Stränge schlagen. »Torture« würde alles in den Schatten stellen, was man bisher im deutschen Fernsehen gesehen hatte. Das würde einen Aufschrei bis in höchste politische Kreise geben. Die Kandidaten dieser Show würden weit über ihre Grenzen gehen und sich und andere quälen müssen. Der Gedanke allein gefiel ihm. Er war immer ein Provokateur gewesen. Schon am Anfang, als er noch bei einem kleinen holländischen Sender nachts am Mikrofon gesessen und sich mit Leuten unterhalten hatte. Da hatten meistens Gestörte angerufen, denen er die Hölle heißgemacht hatte. Trost hatten sie jedenfalls nicht von ihm bekommen. Einem, der gedroht hatte, sich nach dem Telefonat aus dem Fenster zu stürzen, hatte er viel Spaß und einen guten Flug gewünscht.
Man musste sich das nehmen, was das Leben einem gab – das war immer sein Wahlspruch gewesen. Irgendwann lag man in einer Holzkiste, und dann war Ende, finis, aus, vorbei. Danach kam nichts mehr. Davon war er überzeugt. Aber bis dahin würde er alles mitnehmen, was sich ihm bot. Und diese Energie, mit der er an die Dinge ging, wirkte ansteckend und attraktiv, besonders auf Frauen – wie oft hatte er das schon bemerkt!
Der Regen war noch heftiger geworden, als Roger van Gaal von der Aachener Straße abbog. Der Porsche beschleunigte kurz, dann fuhr er in seine ruhige, vornehme Straße ein. Es war kurz nach dreiundzwanzig Uhr. Niemand war zu sehen. In der Garage hatten die Klempner noch ihr Werkzeug stehen, deshalb musste er ein Stück die Straße hinunter einen Parkplatz suchen. Er steckte sich eine Zigarette an. Nun hätte er Emma doch gebraucht. Er war kein bisschen müde, und jetzt so ganz allein in seinem leeren Haus in sein viel zu großes Bett zu kriechen … Gab es in dieser verdammten Stadt keinen Begleitservice, der einem ein wenig Gesellschaft schicken konnte? Ritchie Moll hätte Bescheid gewusst, aber der lag wahrscheinlich schon neben seiner holden Iris, der er vor zwölf Jahren einen Ehering übergestreift hatte, und schlummerte selig. Moll, das Genie, konnte selbst im Schlaf Geld zählen. Nur dass seine brave Iris nicht immer so brav war, davon hatte er keine Ahnung. War allerdings auch besser so.
Roger van Gaal achtete nicht auf den Fahrradfahrer, der ohne Licht an ihm vorbeifuhr. Er öffnete die Pforte zu seinem Haus. Kaum hatte er sie geschlossen, sprang das Licht über der Tür an. Sonst war alles dunkel. Auf den nassen Steinen wäre er beinahe ausgerutscht, als er die vier Stufen zur Haustür hinaufging.
Er kramte in seiner Lederjacke nach dem Schlüssel. Ihm war kalt, und verdammt, er war einsam. Er hätte dieses Haus nicht kaufen dürfen. Er hatte es für Emma gekauft, damit sie beschäftigt war und ihn nicht nervte. Einkaufen und Räume einrichten machten ihr am meisten Spaß. Da dachte sie auch nicht mehr ans Kinderkriegen.
Als er den Schlüssel endlich gefunden und seine Zigarette in das Beet neben dem Eingang geschnippt hatte, hörte er, wie ihn jemand ansprach, merkwürdigerweise auf Englisch.
»Mister van Gaal?«
»Si«, antwortete er und fand sich plötzlich ausgesprochen witzig.
Es war der Radfahrer, eine schmächtige Gestalt. Er war herangekommen und hielt sich mit einer Hand an der Pforte fest. Mit der anderen machte er eine weit ausholende Bewegung.
Für einen Moment hielt Roger van Gaal es für einen Scherz, dass der Radfahrer eine Waffe in der Hand hatte. He, wollte man ihn auf den Arm nehmen, nachdem er heute Abend den fetten Vertrag unterzeichnet hatte? War das die Rache seines Senders, ihn dabei zu filmen, wie er sich vor Angst beinahe in die Hose machte? Die »Versteckte Kamera« einmal auf die etwas brutalere Art? Auch keine schlechte Idee, könnte man vielleicht ein Konzept daraus machen. …
Doch eine Sekunde später zerriss ihm ein furchtbarer Schmerz die Brust. Er spürte noch, wie er gegen die Haustür geschleudert wurde, dann dachte er einen flüchtigen Augenblick an Emma. Er hatte ihr unrecht getan. Er hätte sie lieben müssen, einfach lieben …
Dann dachte er gar nichts mehr und bekam auch nicht mehr mit, wie der Radfahrer sich näherte, ihn vor der Haustür in eine sitzende Position brachte, ihm ein rotes, blinkendes Plastikherz in den toten Schoß legte und ihn dann noch mit seiner Handy-Kamera fotografierte.
2.
Jan Schiller fühlte sich fiebrig. Der Kopf schmerzte, der Rücken tat ihm weh. Schon in den letzten Tagen hatte er sich schlecht gefühlt. In der Nacht hatte er kaum geschlafen und war, leise und ohne Carla zu wecken, aufgestanden, um sich einen heißen Tee zu machen, obwohl er Tee eigentlich verabscheute. Es hatte leider nicht viel geholfen. Zu allem Überfluss musste er um spätestens zehn Uhr im Präsidium sein. Trump, der alte Kriminaltechniker, sein liebster Kollege von der Spurensicherung, wurde verabschiedet. Außerdem kam eine Neue in sein Kommissariat – Birte Jessen aus Hamburg. Er hatte sie einmal kurz gesehen, eine hübsche Blonde mit einer Vorliebe für seltsame Kleidung. Sie hatte eine Art schwarze Pluderhose und einen langen roten Pullover getragen und den typischen norddeutschen Dialekt gesprochen – wenn sie einmal ein Wort gesagt hatte.
Aber es gab noch einen dritten, ziemlich gewichtigen Grund, warum Schiller trotz Fieber ins Präsidium musste: Seit knapp einer Woche ermittelten sie in einem Mordfall und tappten, wenn sie ehrlich waren, vollkommen im Dunkeln: Harald Mundt, den alle nur »Harry« genannt hatten, ein Lehrer, war hinter einem kleinen Buchladen, bei dem er Teilhaber gewesen war, erschossen worden. Ein platzierter Schuss mitten ins Herz, und dann hatte der Täter ihn seelenruhig, als hätte er alle Zeit der Welt, an eine Hauswand gelehnt und ihm ein rotes, blinkendes Herz in den Schoß gelegt.
Gab es schlimmere Mordopfer als Lehrer? Ein Lehrer hatte am Tag alle möglichen Kontakte – Schüler, Kollegen, Eltern und möglicherweise ehemalige Schüler, die glaubten, sie wären nur deshalb Verlierer geworden, weil man ihnen in der Schule übel mitgespielt hatte. Sie waren noch dabei, Mundts Hintergrund auszuleuchten und ein Motiv zu finden. Er war ein ziemlich bunter Vogel gewesen, als Student erst bei den Kommunisten, dann bei den Grünen, dann hatte er die Buchhandlung aufgemacht, um revolutionäre Schriften unters Volk zu bringen, was ihn beinahe in die Pleite getrieben hatte. Erst später war er Lehrer geworden, nicht sonderlich beliebt und anscheinend auch sehr streng. Er hinterließ eine Frau, ebenfalls Lehrerin, und eine neunjährige Tochter.
Sie hatten nichts, keine Anhaltspunkte – nur das billige Plastikherz, das eine Firma in Holland herstellte und das auf jedem Jahrmarkt verkauft wurde, und den Bericht der Ballistiker, die als Tatwaffe eine Walther P38, 9 mm Parabellum, vermuteten, wie sie im Zweiten Weltkrieg verwendet worden war. Aber solche Waffen waren heute immer noch leicht zu bekommen.
Die Feier für Trump fand im großen Konferenzraum des Präsidiums statt. Man hatte sogar den Saal geschmückt, an den Wänden hingen Bilder von Trump, farbige Computerausdrucke von alten Fotos, die man eingescannt hatte. Auf den meisten saß er über ein Schachbrett gebeugt da, oder er trug den klassischen weißen Overall der Kriminaltechniker. Groß und dünn war Trump im Lauf der Jahre geworden. Mittlerweile, als Dreiundsechzigjähriger, hatte er die Figur eines Marathonläufers.
Bert Cremer, sein engster Kollege, kam Schiller am Eingang entgegen. Er fingerte nervös an einer Schachtel Zigaretten, der letzte hoffnungslose Raucher des Kommissariats.
»Du bist zu spät«, raunte er ihm zu. »Neuendorf ist schon weg, hat wieder eine jämmerliche Rede gehalten.« Neuendorf war der neue Polizeipräsident und für seine Versprecher und Räusperer gefürchtet. Bei ihm konnte es mitten in einem Vortrag fünf Sekunden Sendepause geben, aber er hatte anscheinend Fürsprecher im Innenministerium. Keiner wusste, warum.
Dann klingelte Cremers Mobiltelefon, und Schiller hörte noch, wie er verärgert den Namen seiner Frau ausstieß. Die beiden konnte sich nach drei Jahren permanenter Ehekrise immer noch nicht entscheiden, ob sie sich trennen sollten oder nicht.
Fast fünfzig Personen füllten den Saal. Die meisten standen in Gruppen zusammen, unterhielten sich und hatten einen Pappbecher mit Sekt oder Mineralwasser in der Hand. Schiller drückte sich in eine Ecke und ließ sich von einem jungen Mädchen, das sonst in der Kantine arbeitete, ein Glas Wasser geben. Dann schluckte er noch eine Kopfschmerztablette. Trump stand ein paar Meter entfernt mit einem großen Blumenstrauß im Arm und schaute ihn lächelnd an.
Sie mochten sich, auch wenn sie nie viel miteinander geredet hatten.
»Nun ist es zu Ende«, sagte Trump, während er sich neben Schiller stellte. Seine Blumen legte er wie ein lästiges Bündel auf dem Tisch neben sich ab. »Hat immerhin etwas Gutes. Ich werde nie wieder einen weißen Overall anziehen müssen.«
»Was wirst du jetzt machen?« Schiller spülte den Rest der Tablette hinunter. Er glaubte zu spüren, wie das Fieber allmählich nachließ.
»Ich werde jeden Tag ins Café gehen und Schach spielen, mich auf ein paar wichtige Turniere vorbereiten. Außerdem habe ich noch das Haus in der Eifel, das ich für Brigitte ausbauen wollte. Habe drei Jahre nichts dran gemacht.«
»Vielleicht besuche ich dich mal«, sagte Schiller, obwohl er schon wusste, dass er niemals kommen würde. Die Eifel war nichts für ihn, zu viel Landschaft, zu viele Bäume. Er hielt nicht mal den Stadtrand von Köln lange aus. Alles, was über den äußeren Ring hinausführte, war für ihn schon beinahe Ausland. Nicht mal zum Laufen verließ er die Stadt.
Trump nickte, dann ging er, ohne seine Blumen mitzunehmen.
»Wir waren verabredet. Ich habe um acht auf Sie gewartet.« Die Stimme, die ihn ansprach, klang eindeutig gereizt. Als Schiller sich umwandte, sah er Birte Jessen neben sich, die Neue. Blond, wie es sich für eine Norddeutsche gehörte, mit leicht vorstehenden Schneidezähnen und gefährlich blauen Augen.
»Ich bin krank«, entgegnete Schiller. »Grippe.«
»Man hat mir gesagt, Sie seien Gesundheitsapostel. Läufer, Marathon sogar.« Birte Jessen legte die Stirn in Falten, dann nahm sie sich einen Plastikbecher mit Orangensaft. Sie trug keinen Ring, nur eine große Männeruhr am rechten Arm, und hatte eine schwarze, viel zu weite Hose an.
»Marathon laufe ich nur einmal im Jahr hier in Köln, und zwar in drei Wochen, wenn ich noch mal Zeit zum Trainieren finden sollte. Bestzeit: drei Stunden und dreiundvierzig Minuten, falls es Sie interessiert.«
»Dann haben Sie sich vielleicht beim Training übernommen.«
»Das glaube ich kaum.« Schiller stellte sein Glas beiseite. Der Raum begann sich bereits zu leeren. Wer war nur auf die Idee gekommen, Trumps Verabschiedung auf zehn Uhr morgens zu legen?
»Wir können in mein Büro gehen«, sagte Schiller schließlich, als er den erwartungsvollen Blick seiner Kollegin bemerkte.
Birte Jessen nickte. »Aber nun ist es auch mein Büro. Ich habe mich schon ein wenig eingerichtet.«
Sie verließen den Saal und gingen zu den Fahrstühlen. Von Trump war nichts mehr zu sehen. Cremer stand noch immer in der Halle und telefonierte wild gestikulierend. Birte Jessen bedachte ihn mit einem spöttischen Blick.
»Er scheint auch Wichtigeres zu tun zu haben, als an unserem Mordfall zu arbeiten.«
»Hören Sie«, sagte Schiller. »Ich weiß nicht, was Sie so in Hamburg gemacht haben und warum es Sie ausgerechnet zu uns nach Köln verschlagen hat, aber wir tun hier unsere Arbeit. Da können Sie ganz sicher sein.«
Wortlos fuhren sie in die vierte Etage hinauf.
Birte Jessen hatte sich in der Tat schon eingerichtet. Frische Blumen standen da, orange und gelb. Die hatte sie sich wohl selbst geschenkt. Neuendorf oder Fitschen, als Kriminaldirektor ihr unmittelbarer Vorgesetzter, wäre so etwas nicht eingefallen. Außerdem hatte sie eine supermoderne Kaffeemaschine auf der Fensterbank platziert. Zum Glück hatte sie das große, gerahmte Foto nicht angerührt, das an der Wand hing: die Meistermannschaft vom 1. FC Köln aus dem Jahr 1978. War leider der letzte große Triumph seines Vereins gewesen. Noch immer kannte er den Namen jedes Spielers.
»Ich dachte, Fischköpfe trinken nur Tee«, sagte Schiller mit Blick auf die Maschine. Dann setzte er sich hinter seinen Schreibtisch. Das fing nicht gut an. Er sollte die ganze Sache leichter nehmen, sie war eben eine neue Kollegin aus einer anderen Stadt, aber der Schmerz hämmerte in seinem Kopf, und er mochte ihre wortkarge und zugleich ständig herausfordernde Art nicht. Sie hatte sich bereits dienstbeflissen die Akten zum Fall Harry Mundt von seinem Schreibtisch genommen. Er wollte schon wütend werden, aber sie gehörte nun dazu, war die Verstärkung, die man ihnen seit Monaten versprochen hatte.
Birte Jessen zog eine Schachtel Zigaretten aus ihrer Hosentasche und hielt sie unschlüssig in der Hand.
»Hier raucht niemand«, sagte Schiller. »Allgemeine Abmachung.«
Sie schaute ihn abschätzend an. Er war sicher, dass sie sich nun erst recht eine anstecken würde, dann jedoch sagte sie: »Ist ja auch vernünftiger. Ich habe es eigentlich längst aufgegeben.«
Für einen Moment sah sie irgendwie verletzlich aus, aber dann straffte sie sich wieder.
»Können wir mit der Arbeit anfangen – auch wenn Sie krank sind?« Ihre Augen schienen die Farbe wechseln zu können und wirkten nun beinahe grün.
Schiller wischte sich über das Gesicht. Vielleicht steckte ihm das Training für den Marathonlauf wirklich noch in den Knochen, außerdem der Stress mit Carla und dieser Fall, der nicht in Gang kam.
Als er sie anschaute, saß sie ihm gegenüber. Die Kaffeemaschine hinter ihm zischte. Er hatte gar nicht bemerkt, dass sie das Ding angeschaltet hatte. Ein MP3-Player lag neben den Akten auf ihrem Schreibtisch. Das erste Utensil, das sie ihm ein wenig sympathisch machte.
»Verraten Sie mir eins«, sagte er und legte einen deutlichen Hauch von Spott in seine Stimme, »was hören Sie für Musik? Oder haben Sie sich das Ding besorgt, um einen Sprachkurs in Kölsch zu machen?«
An der Musik erkannte man die Leute. Wahrscheinlich würde sie ihm sagen, dass sie Robbie Williams hörte oder allgemein, was so im Radio lief.
»Neil Young«, sagte sie. »Oder Händel und Wagner. Die Ouvertüre zu ›Tannhäuser‹ könnte ich dreimal am Tag hören. Tue ich auch manchmal.« Sie lächelte, und dann blickte sie an ihm vorbei, als würde sie sich voller Wehmut an etwas erinnern.
Schiller ahnte, dass sie ein Geheimnis umgab. Eine Affäre mit einem Musiker oder einem Opernsänger? War sie deshalb als Fischkopf in Köln aufgetaucht? Nein, Polizisten hatten mit berühmten Sängern und Künstlern meistens nichts zu tun – oder nur, wenn einer sie umgebracht hatte.
Sie stellte ihm keine Gegenfrage, sondern erhob sich und schob ihm einen Moment später einen dampfenden Milchkaffee hin. Sie hatte sogar eigene Gläser mitgebracht, die teuer und nagelneu aussahen, aber er kannte sich mit solchen Sachen nicht richtig aus.
Schiller trank einen Schluck und nickte anerkennend. Kaffee gehörte zu seinen Schwächen. Bei besonders intensiven Ermittlungen trank er drei Kannen am Tag, meistens schwarz und ohne Zucker, aber er konnte sich auch an Milchkaffee gewöhnen. Diese Maschine war ein echter Pluspunkt auf ihrem Konto.
»Ich könnte Sie ein wenig herumführen«, sagte er. »Die Kollegen vorstellen, die hier auf dem Gang sitzen, Einbruch, Drogen, Erkennungsdienst, dann könnten wir in die Kantine …«
»Vielen Dank, aber die Leute, die ich kennenlernen wollte, habe ich bereits getroffen«, entgegnete sie. »Ist Mundt schon beerdigt worden?« Sie zog eine Akte zu sich heran.
Schiller nickte. Der Kaffee tat ihm gut. »Vorgestern.«
»Und? Irgendetwas Auffälliges? Wo ist das Motiv?« Sie deutete auf die Akte vor sich. Dabei fiel ihm auf, dass ihr rechter kleiner Finger rot lackiert war.
»Fast tausend Leute waren da, die halbe Schule, ein paar Leute aus dem Stadtrat, weil Mundt bei den Grünen eine große Nummer war, dazu Verwandtschaft, Freunde, ein unübersichtlicher Haufen. Cremer hat einige Bilder gemacht, die wir uns aber noch nicht genau angesehen haben. Sind auf seinem Rechner.«
Birte Jessen zog die Fotos vom Tatort heraus. »Da hat jemand eine alte Rechnung beglichen, ohne Zweifel. Wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass Mundt hinter der Buchhandlung erschossen worden ist. Und warum hat der Mörder ihm das Herz in den Schoß gelegt? Das Herz ist der Schlüssel.« Sie schaute ihn an, als erwartete sie eine Bestätigung ihres Verdachts.
»Oder ein gutes Ablenkungsmanöver«, sagte Schiller. »Mundt hat zwar vor zwölf Jahren eine hässliche Scheidung hinter sich gebracht, aber seine Exfrau hat ein Alibi.« Als er das billige Plastikherz gesehen hatte, war ihm sofort klar gewesen, dass sie bei diesem Fall nicht einfach die Ehefrau oder eine Geliebte verhören mussten, um ihren Täter zu finden.
»Sie war mit einer Freundin auf einer Vernissage?« Birte Jessen hatte sich bereits kundig gemacht.
»Ja, mit zweihundert anderen Leuten. Wir haben fünf Zeugenaussagen schriftlich.« Schiller trank seinen Kaffee aus und schluckte noch eine Tablette. Die Kopfschmerzen waren beinahe verschwunden, nun kam die Müdigkeit. Er hatte das Gefühl, seit Tagen nicht mehr geschlafen zu haben. Carla hatte ihn gefragt, ob er mit ihr eine Woche in den Süden fliegen würde, Teneriffa, Gran Canaria, gleichgültig, eine Art Friedensangebot, aber nun hatte auch sie wieder einen akuten Fall, der ihren ganzen Einsatz forderte. Ein autistisches Mädchen, das bei ihr seit drei Jahren in Behandlung war, hatte begonnen, sich selbst zu verletzen. Mit einer Rasierklinge hatte sie sich drei tiefe Schnitte im Bauch beigebracht. Der Urlaub würde warten müssen; er hätte ja auch nicht fahren können, solange der Fall Mundt nicht aufgeklärt war.
»Wir brauchen eine lückenlose Biografie Mundts«, sagte Birte Jessen, und es klang fast, als würde sie Schiller einen Auftrag erteilen.
Schiller verzog das Gesicht. »Der Typ war einundfünfzig Jahre alt und hat wohl nichts ausgelassen. Wir haben noch nicht einmal herausgefunden, wo seine uneheliche Tochter wohnt. Sie hatte eine Schmuckwerkstatt in Kronenberg in der Eifel, aber da ist sie schon seit Monaten nicht mehr gewesen. Ihre Miete hat sie auch nicht mehr bezahlt.«
»Was ist mit persönlichen Unterlagen, Briefen, Fotos?«
»Cremer hat sich zwei Tage lang in seinem Arbeitszimmer umgesehen. Es ist immer noch versiegelt. Wenn Sie wollen, können wir der Witwe gerne noch einen Besuch abstatten.«
Er hatte diesen Vorschlag nicht wirklich ernst gemeint, doch Birte Jessen nickte entschlossen.
»Oder sind Sie zu krank?« Sie lächelte ihn scheinbar mitfühlend an, während sie sich erhob.
Bevor Schiller etwas erwidern konnte, stand Bert Cremer in der Tür. Er sah abgehetzt aus. Bei ihm wusste man nicht, was ihn mehr mitnahm: der Ärger mit seiner Frau oder die erfolglose Arbeit der letzten Woche.
»Schön, dass ihr hier gemütlich Kaffee trinkt«, sagte er ein wenig atemlos, »aber ich muss euch leider stören. Eben ist der Notruf eines Postboten eingegangen. Der Kerl mit dem Plastikherzen war wieder unterwegs. Ein zweiter Toter – diesmal in Müngersdorf.«
3.
Sie glaubte die kleine Narbe in ihrem Rücken zu spüren. Es war Unsinn, dennoch zuckte sie zusammen, als sie zu Schiller in den Wagen stieg. Sie dachte an Martin. Sie hatte vergessen, seine Mutter anzurufen. Martha würde sich ängstigen und wissen wollen, wie ihr erster Tag in Köln verlaufen war. In der Nacht hatte sie kaum geschlafen, weil sie wieder Martins Stimme im Kopf gehabt hatte. Außerdem hatten vor ihrem Fenster ein paar Jugendliche randaliert. Die Polizei war nicht aufgetaucht, obwohl die Randalierer sich erst nach einer Stunde beruhigt hatten. Etliche Flaschen waren zu Bruch gegangen, aber es schien niemanden zu stören. Immerhin konnte sie von ihrem kleinen Hotelzimmer direkt auf den Rhein sehen. Erstaunlich, wie viele Schiffe da vorbeifuhren. Sie hatte schon jetzt Heimweh nach Hamburg.
Schiller fuhr ohne Hast in die Stadt hinein. Einmal, als er die Spur wechselte, warf er ihr einen kurzen Blick zu, ohne jedoch etwas zu sagen. Höflichkeit schien nicht seine Sache zu sein, keine Frage, ob sie schon eine Unterkunft gefunden habe oder wie ihr die Stadt gefalle. Nun, dann musste sie auch nicht lügen. Köln war ein Schock für sie gewesen, eng und schmutzig, keine Bäume, keine Parks, nur der graue, gleichmütige Rhein, über dem die Möwen ihre Kreise zogen.
Warum bin ich nicht woandershin gegangen, dachte Birte Jessen, nach Bremen oder Rostock, dorthin, wo es zumindest ein wenig nach Heimat riecht? Aber so ging es ihr ja mit allem, seit Martin tot war. An allem zweifelte sie. Warum waren die Dinge nur so, wie sie waren?
Nein, nahm sie sich vor, sie würde sich von Schillers Schweigen nicht einschüchtern lassen, aber sie hatte Angst davor, die Leiche zu sehen. Der erste Arbeitstag in Köln, und gleich fiel ihr ein Toter vor die Füße.
Der letzte Tote, den sie gesehen hatte, war Martin gewesen, klein und aschfahl, vom Krebs gebissen. Sie spürte, dass ihr Tränen in die Augen traten. Es war viel zu früh, um wieder einen Toten zu sehen, auch wenn sie ihn nicht kennen würde.
»Ich bin sonst nicht so«, sagte Schiller plötzlich. »Es ist die Grippe. Stecken Sie sich bloß nicht an!« Er lächelte vor sich hin, als hätte er einen Witz gemacht.
»Alles klar«, sagte sie und versuchte die Tränen wegzublinzeln. Schiller würde sie für eine Psychotante halten, wenn sie schon auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz Tränen in den Augen hätte. Plötzlich fragte sie sich, wie alt er war. Ende dreißig – Anfang vierzig? Er war ziemlich athletisch, aber am Hinterkopf wurde sein Haar bereits schütter. Seine Hände waren groß und klobig, kein Hobbykoch, eher ein Handwerker.
Über Funk hörten sie, dass mittlerweile drei Polizeiwagen am Tatort eingetroffen waren.
»Fehlt uns noch, dass hier ein Irrer herumläuft, Leute erschießt und ihnen ein Plastikherz in den Schoß legt«, sagte Schiller vor sich hin.
Birte Jessen sah ihn an und wusste, woran er dachte. Zwei Morde in knapp einer Woche mit einem untrüglichen Erkennungszeichen – in Amerika würde man da schon von einem Serienkiller reden. Sie würde ihm den Vortritt lassen, sollte er sich die Leiche anschauen.
»Wenn wir Glück haben, finden wir so schneller das Motiv«, sagte sie. »Vielleicht hat der Tote eine Verbindung zu Mundt.«
»Ja, vielleicht.« Schiller starrte vor sich hin.
Er bog in eine schmale Wohnstraße ein, und da sahen sie die Streifenwagen mit laufendem Blinklicht. Zwei Polizisten sperrten den Tatort ab. Schiller ließ sein Fenster herunter und winkte ihnen lässig zu.
Birte Jessen zog sich Latexhandschuhe über und sprang aus dem Wagen, noch bevor er zum Stillstand gekommen war. Nun musste sie sich wieder in die Rolle der Ermittlerin einfinden, und vor allem durfte sie keine Schwäche zeigen. Sie hielt dem ersten Polizisten ihre Marke hin und ging durch die Pforte auf das Haus zu. Ein weißes Einfamilienhaus, keine Villa, aber dennoch strahlte es einen gewissen Prunk aus. Ein gepflegter Kiesweg, teure Marmorstufen, keine Gardinen vor den Fenstern.
Schiller tauchte hastig neben ihr auf. Er keuchte angestrengt. Anscheinend wollte er hier doch den Platzhirsch spielen.
Zwei Sekunden später bemerkte sie, dass sie viel zu forsch gewesen war. Da lag der Tote – ein Mann mittleren Alters mit dunklen lockigen Haaren. In Brusthöhe hatte es ihm seine teure Lederjacke zerrissen. Er saß gegen seine schmucke weiße Eingangstür gelehnt da, die Beine überkreuzt, wie bei einem Indianer, der am Lagerfeuer hockte. Deshalb hatte man ihn von der Straße nicht entdecken können. Der Mörder hatte ihn zurechtdrapiert. Das Plastikherz in seinem Schoß blinkte, aber die Batterie schien schon recht schwach zu sein. Wäre die hässliche Wunde nicht gewesen, hätte der Mann ein Betrunkener vom Schützenfest sein können.
Martin hatte anders ausgesehen, nach monatelanger Krankheit, nach Martyrium und letzten geflüsterten Worten.
Obwohl er keinen Overall trug, beugte Schiller sich über den Toten. »Sauberer Einschuss«, sagte er, »wie bei Mundt. Unser Täter muss ein echter Kunstschütze sein.«
Viel Blut war nicht zu sehen.
Birte Jessen wandte sich ab und blickte auf das Türschild. »Roger van Gaal, Genie« stand da.
Sie hatte nach Martins Tod die Wahl gehabt, eine lange Segeltour zu machen, hinauf nach Norwegen, zwei Wochen auf See, keine Menschen sehen, nur die anderen vier an Bord, Freunde von Martin, die sie trösten wollten – oder aber einen neuen Job in einer neuen Stadt anzunehmen. Sie glaubte ihren Erinnerungen nur zu entkommen, wenn sie ging. Sie würde nie wieder einem Menschen wie Martin begegnen, einem verrückten Geigenbauer. Sie hatte ihn ausgelacht. Gab es so etwas wirklich, dass jemand Geigen baute – mitten auf St. Pauli? Wo die Huren herumliefen und wo es jeden Tag mindestens zehn Schlägereien gab? Er war ganz ernst geblieben und hatte sie nur angeschaut. Später hatte sie Martha, seine Mutter, kennengelernt und begriffen, dass es solche Menschen noch gab, die nicht Auto fuhren, allenfalls Radio hörten und die nach einer ganz anderen Zeit ihr Leben führten. Ihre Uhr schien immer eine gewisse Gelassenheit anzuzeigen. Bis in den Tod.
Schiller führte ganz routiniert Regie. Ohne sie zu beachten, überwachte er die Sicherung des Tatorts. Dann stellte er ihr einen bärtigen Mann mit Namen Roland Grauer vor, der zum Erkennungsdienst gehörte und die Tatortfotos machte, und wies ihn ein. Grauer streifte sich einen Papieranzug über und machte sich wortlos und ohne eine Miene zu verziehen an die Arbeit. Offenbar hatte Schiller seine Grippe in den Griff bekommen. Jedenfalls war ihm nichts mehr anzumerken. Der Tote schien tatsächlich der Bewohner des Hauses zu sein. Über Funk ließ Schiller sich die Daten geben. Es hatte einen Prominenten aus der zweiten Reihe erwischt. Einen holländischen Fernsehproduzenten, der seit einigen Jahren in Köln wohnte und gelegentlich in den Klatschspalten auftauchte, wenn er sich mal wieder irgendwo betrunken hatte. Schiller meinte, sein Foto auch schon in der Zeitung gesehen zu haben.
Birte Jessen ging um das Haus herum, weg von der Leiche, die im Blitzlicht schon seltsam wächsern aussah. Alles wirkte unbewohnt und unfertig. Auf der Terrasse standen keine Möbel, einen richtigen Garten gab es nicht, nur einen ungepflegten Rasen und ein paar alte verkrüppelte Bäume. Als sie durch ein großes Fenster blickte, entdeckte sie kein einziges Möbelstück, nur einen blanken Holzboden. Roger van Gaal besaß nicht einmal einen Fernseher. War er gerade erst eingezogen? Was wollte ein einzelner Mann mit so einem Haus? Und was hatte ein großprotziger Produzent aus Holland mit einem linken Lehrer gemeinsam?
Als Birte Jessen zur Straße zurückkehrte, sah sie einen Möbelwagen, der auf der Straße hielt. Hupend versuchte er einen Streifenwagen aus dem Weg zu scheuchen.
»He«, rief einer der Möbelpacker auf Kölsch, sodass sie ihn beinahe gar nicht verstehen konnte, »wir machen hier einen Umzug.«
Einer der Polizisten, die an der Pforte zum Grundstück standen, ruderte mit den Armen, doch der Möbelwagen blieb mitten auf der Straße stehen. Zwei Männer, ein junger mit Pudelmütze und ein älterer mit einem langen grauen Zopf, sprangen ab und machten sich an der hinteren Klappe zu schaffen. Den Polizisten ignorierten sie hartnäckig.
»Sie können hier nichts abladen«, sagte Birte Jessen mit fester Stimme und taxierte den Älteren mit dem Zopf.
Er schaute nur kurz auf. »Dauert nicht lange, Liebchen, ein paar Kisten für Herrn van Gaal. Eilauftrag. Kam heute Morgen.«
»Wann kam der Auftrag?« Schiller stand plötzlich neben ihr, was sie irgendwie ärgerte. Entweder wollte er sich immer in den Vordergrund schieben, oder er meinte, dass sie nicht einmal mit ein paar Möbelpackern fertig wurde.
»Seid ihr taub?«, fragte der graue Zopf. Er hatte die hintere Klappe nun geöffnet und machte Anstalten, auf die Ladefläche zu klettern. Ein riesiger Fernseher stand da, etliche braune Kartons, Stühle und ein paar zerlegte Möbel, ein Bett vielleicht. Kein großer Umzug.
Schiller packte den Mann am Arm, genau da, wo eine große, schon recht verblichene Tätowierung zu sehen war. Eine Schlange, die irgendwie aus einer blühenden Rose zu steigen schien. »Hör mal zu, mein Freund«, sagte er. »Du scheinst hier taub zu sein. Wer hat dir den Auftrag gegeben?«
Birte Jessen verzog das Gesicht. Offenbar war Schiller auch so einer, der jeden duzte. Sie nahm sich vor, bei ihm konsequent beim Sie zu bleiben.
Der Möbelpacker entschloss sich zu einem Lächeln. »Nun mal langsam. Die Braut vom Meister hat uns angerufen. Wir sollten das Zeug bei ihr abholen. Sofort. Vielleicht war es auch die Exbraut. Keine Ahnung.«
Schiller ließ den Mann los und hielt seinen Ausweis hoch. »Wie heißt die Frau? Und wo wohnt sie?«
Der Möbelpacker lächelte verkniffen. »Ist was passiert, dass ihr hier so einen Aufmarsch macht? Aber am besten fragt ihr die Frau selbst.« Dann deutete er vor sich.
Birte Jessen wandte sich um. Eine gut frisierte, dunkelhaarige Frau mit Sonnenbrille, hochgeschoben ins Haar, stieg aus einem kleinen blauen Sportwagen. Ja, dachte sie, so sehen die Frauen von solchen Fernsehmenschen tatsächlich aus. Kurzes pinkfarbenes Plüschjäckchen, enge teure Jeans und braune Lederstiefel mit hohen Absätzen. Neben sich hörte sie Schiller auf- stöhnen. Dann stieß er sie ganz vertraut mit dem Ellbogen an und sagte lächelnd: »Da kommt ja unsere Mörderin!«
Sie hieß Emma Sahler, und sie brauchte ein paar Momente, um zu begreifen, was passiert war. Kein Einbruch, kein Streit mit Nachbarn, weil van Gaal doch manchmal sehr cholerisch sein konnte, sondern Mord.
Dann suchten ihre runden braunen Augen den Himmel ab, und die Beine knickten ihr ein, dass sie übel gestürzt wäre, wenn Schiller sie nicht aufgefangen hätte. Emma Sahler schnappte nach Luft, als hätte man ihr irgendwie die Kehle zugeschnürt. Sie führten sie zu einem Streifenwagen und betteten sie förmlich auf den Rücksitz.
»Ich habe ihn verflucht«, stammelte sie dann, »neulich abends.« Sie klang, als wäre sie überzeugt, ihm tatsächlich den Tod an den Hals gehext zu haben.
»Beruhigen Sie sich!«, sagte Birte Jessen sanft. »Soll ich Ihnen ein Glas Wasser besorgen?«
Emma Sahler sah sie an, als hätte sie in einer ganz anderen Sprache mit ihr gesprochen. Einen Moment später begann sie zu würgen. Schiller war nicht mehr da. Birte Jessen bemerkte aus den Augenwinkeln, dass ein Zinksarg auf die Straße getragen wurde. Da hatte man aber schnell gearbeitet. War der Rechtsmediziner schon da gewesen? Sie versuchte sich ein wenig vorzubeugen, aber Emma Sahler hatte die grau gekleideten Männer mit dem Sarg bereits registriert. Ihr Würgen ging in ein abgehacktes Husten über.
Schiller stand plötzlich mit einem Kaffeebecher in der Hand wieder da, aus dem zarte Dampfwölkchen aufstiegen. »Ich kann auch mitten in der Wüste Kaffee besorgen«, sagte er, als er Birtes erstaunten Blick bemerkte. Dann drückte er Emma Sahler den Becher in die Hand. »Trinken Sie das! Wir können nun auch ins Haus gehen«, fügte er ungerührt hinzu.
Wie ein kleines Kind, das eine bittere Medizin schlucken muss, nippte sie an dem Kaffee und ließ sich wenig später zum Haus führen. Schiller warf Birte Jessen einen triumphierenden Blick zu. Sie bemerkte, dass er im Vorbeigehen dem jüngeren Möbelpacker mit einem knappen Nicken den Kaffeebecher gab. Daher war also der Kaffee gekommen. Er hatte die Arbeiter angepumpt oder einen Becher konfisziert.
Auf der Treppe war kein Blut zu sehen. Der Schlüssel steckte. Wahrscheinlich hatte einer der Forensiker ihn dem Toten abgenommen. Schiller war da anscheinend nicht zimperlich. Vorsichtig drehte er ihn herum.
Es war ein leeres, trostloses Haus. Birte Jessen begriff gleich, dass sie einen Fehler gemacht hatten, mit der Freundin oder – wie es schien – Exfreundin des Toten einzutreten, aber Schiller schritt munter voran, fast wie ein forscher Makler, der glaubte, einen guten Kunden an der Angel zu haben.
Emma Sahler folgte ihm gehorsam und wirkte ein wenig gefasster, doch schon in der geräumigen Diele presste sie sich ein Papiertaschentuch vor das Gesicht und schluchzte wieder.
Schiller drehte sich nach ihr um. »Riecht noch ziemlich nach Farbe«, sagte er, als hätte sie nur deshalb das Taschentuch hervorgenommen. »Waren Sie schon mal hier?«
Emma Sahler nickte. »Natürlich«, flüsterte sie so leise, dass Birte Jessen, die neben ihr ging, sie kaum verstehen konnte. »Er hat das Haus ja für mich gekauft. Wir wollten hier zusammen einziehen.«
Es gab tatsächlich keine Möbel. Das riesige Wohnzimmer war leer, ebenso ein Nebenraum, der Büro oder Kinderzimmer sein konnte. Nicht einmal Lampen hingen von der Decke.
Schiller steuerte einen anderen Raum an – die Küche. Hier hatte sich ein teurer Innenarchitekt ausgetobt. Mitten im Raum befand sich eine Art Kochinsel mit einem riesigen Herd unter einer überdimensionalen silberfarbenen Abzugshaube, die noch in Zellophan eingepackt war. An den Wänden Metall- und Glasschränke und ein mannshoher runder Kühlschrank. Nur einen Tisch gab es noch nicht, aber vier Designerstühle, die aussahen, als würde man sich unweigerlich den Rücken verrenken, wenn man sich auf sie setzte.
Schiller schob Emma Sahler einen Stuhl hin. Sie schluchzte immer noch und nahm dann umständlich Platz. Ihre enge Jeans war für solche Stühle nicht gemacht. Birte Jessen zog es vor, stehen zu bleiben.
»Warum ist aus dem gemeinsamen Einzug nichts geworden?«, fragte Schiller.
Emma Sahler sah ihn an. Ihre Augen wirkten plötzlich viel größer. Ratlosigkeit und Unglaube spiegelten sich in ihnen. »Roger war ein Scheißkerl«, sagte sie mit einer Entrüstung, die gar nicht zu der Trauer passte, die sie eben noch an den Tag gelegt hatte. »Er war der Meinung, dass er alles tun und lassen könnte, was er wollte, aber das kann man nicht mehr, wenn man jemanden liebt.« Sie nickte ihren eigenen Worten nach, und Birte Jessen hatte plötzlich Mitleid mit ihr. Emma Sahler schien eine kleine Tragödie durchlebt zu haben, die aber wohl nichts mit dem Mord zu tun hatte.
»Er hat Sie also betrogen, und dann haben Sie ihn hinausgeworfen«, sagte Schiller ein wenig zu routiniert, wie Birte Jessen fand. »Wann haben Sie ihn denn zum letzen Mal gesehen?«
»Vor drei Tagen«, sagte Emma, und es klang, als wäre es schon eine Ewigkeit her. »Er hat mich geschlagen.« Sie zog ihr Jäckchen hoch, sodass man ihren Unterarm sehen konnte, und hielt ihn Schiller vorwurfsvoll hin. Birte Jessen musste die Augen zusammenkneifen, um etwas zu erkennen, aber wenn man genau hinsah, waren da zwei Fingerabdrücke zu erahnen, als hätte jemand ein wenig zu kräftig zugepackt.
»Ist das häufiger vorgekommen, dass Ihr Freund so rüde mit Ihnen umgesprungen ist?«, fragte Schiller. Er hatte ein schmales schwarzes Büchlein hervorgezogen.
Sie nickte und starrte nun mit Rehaugen wie ein verängstigtes kleines Mädchen vor sich hin. »Gestritten haben wir uns aber wegen dem Kind. Ich habe ihm gesagt, dass ich schwanger bin. Da ist er vollkommen ausgerastet.«
»Aber Sie sind nicht schwanger, nicht wahr?«, fragte Birte Jessen. Irgendwie waren solche Frauen so leicht zu durchschauen.
Emma Sahler schüttelte den Kopf, was sie noch kleinmädchenhafter aussehen ließ. »Ich wollte ihn auf die Probe stellen, ob er mich wirklich liebt. Da ist Roger noch wütender geworden. Er hat einen Aschenbecher nach mir geworfen.« Sie tupfte mit dem Taschentuch an ihren Augen herum, obwohl bisher gar keine Tränen zu sehen waren. »Eigentlich hatte ich gehofft, dass sich alles wieder einrenkt, aber er hat sich zwei Tage nicht gemeldet. Deshalb habe ich ihm jetzt den Möbelwagen geschickt. Sollte ein Zeichen sein.«
»Haben Sie eine Ahnung, wo er die zwei Tage gewesen ist? Hat er vielleicht eine Freundin gehabt?«, fragte Schiller, und als er merkte, dass diese Frage eine Spur zu hart ausgefallen war, fügte er milder hinzu: »Ich meine, irgendeine gute Bekannte, wo er unterschlüpfen konnte?« Er rieb sich über die Augen. Nun war ihm doch anzusehen, dass er nicht in Form war.
»Keine Ahnung«, sagte Emma Sahler. »Da müssen Sie in seinem Büro nachfragen. Elke, seine Managerin, weiß alles über ihn. Vielleicht war er bei ihr. Sie würde sogar seine Unterhosen bügeln, wenn es sein müsste.« Sie lachte, aber dann hob sie ihre Hand, als wollte sie dieses unpassende Lachen wieder einfangen. Ihre Fingernägel waren weiß und sahen unecht aus. Kann man mit solchen Händen jemanden töten?, dachte Birte Jessen. Nein, das konnte man nicht. Schiller machte sich ein paar Notizen in sein Büchlein, aber für sie war schon klar, dass sie aus Roger van Gaals Exfreundin nicht viel herausbringen würden.
Als Schiller ihre Personalien aufnahm, klingelte ein Handy, eine schrille, nervtötende Fanfare, die irgendwie nach »Final Countdown« klang.
Schiller schaute Birte Jessen verärgert an, doch sie zuckte nur mit den Schultern.
»Es ist sein Handy«, sagte Emma Sahler. »Seine Fanfare, die bläst er sogar nachts auf einem Kamm, wenn er …« Sie brach ab.
Überrascht blickte Schiller auf, dann griff er in seine Jackentasche und zog eine kleine Plastiktüte hervor. Ein winziges silberfarbenes Mobiltelefon schwebte da und trompetete vor sich hin. Tatsächlich, »The Final Countdown«.
Schiller hielt Birte Jessen die Plastiktüte hin, was sie für einen Moment irritierte. Aber ja, er hatte keine Handschuhe an, der große Experte.
»Vermutlich irgendein vorlauter Journalist«, sagte Schiller verächtlich. »Aasgeier! Will wahrscheinlich von van Gaal wissen, ob er wirklich tot ist.«
Birte Jessen brauchte einen Moment, um sich an dem Gerät zurechtzufinden. Nokia – sah neu und ziemlich teuer aus.
»Ja?«, sagte sie dann und bemühte sich, möglichst tief zu klingen.
Schiller war herangekommen und beugte sich zum Apparat. Sie bemerkte zum ersten Mal, dass er nach Kölnisch Wasser roch. Gab es das noch – Männer in seinem Alter, die Kölnisch Wasser benutzten?
»Verdammt, Roger«, sagte eine Stimme, die eindeutig einer Frau gehörte. »Warum hast du mir diese SMS geschickt? Nur weil du Stress mit Emma hast? Du sentimentaler Idiot! Ritchie hat sie zufällig gesehen und dreht nun völlig durch! Am liebsten würde er dich erschießen.«
4.
Er fuhr mit dem Fahrrad nach Norden. Das war immer die Frage, nach Süden Richtung Rodenkirchen den Rhein hinauf oder nach Norden, am Dom vorbei bis nach Niehl zum Hafen. Es tat ihm gut, den Regen zu spüren, der ihm vom Rhein ins Gesicht wehte. Er trug eine Fahrradbrille und fuhr ziemlich schnell. Geschickt wich er den wenigen Touristen aus, die auf der Promenade entlangliefen, meistens Japaner, die wirklich alle drei Schritte ein Foto machten. Wahrscheinlich fand wieder irgendeine Messe statt. Nicht dass sich die Stadt dann herausputzte, Köln war und blieb schmutzig, aber dann wehten Fahnen auf den Brücken, als würde die Stadt mit ein paar Wimpeln im Wind internationaler aussehen. Es war so lächerlich.
Er liebte die Stadt und hasste sie gleichzeitig. Er hatte es nie geschafft, wegzukommen, aber nun hatte er seine Balance gefunden. Die ersten beiden Morde waren perfekt abgelaufen. Keine Zeugen, keine Spuren, außer der einen tödlichen Kugel und dem roten Plastikherzen. An dem Plastikherzen würden sie sich die Zähne ausbeißen. Im Advent gab es auf jedem Weihnachtsmarkt mindestens zwanzig Stände, die diesen billigen Plunder verkauften, und das allein in Köln.
Es tat ihm gut, zu fahren, schnell und gleichmäßig, als hätte er ein Ziel. Niemand kannte ihn, keiner wusste, wer er war. Gut, er hatte nach wie vor seine Arbeit erledigt, er war ein Kollege, ein Nachbar, aber niemand kannte ihn wirklich.
Seht her, hätte er schreien können, ich sorge für Gerechtigkeit, ich kämpfe gegen den Dreck, aber ich bin noch nicht am Ziel.
Er hatte lange gedacht, dass er es nicht mehr ertragen konnte, das Leben, den Tod. Wie sollte er nur weiterleben, funktionieren, arbeiten, essen, atmen? Mehr als einmal hatte er an Selbstmord gedacht, wenn er dalag, in dem Raum, den er nur die »Herzkammer« nannte, ihr Zimmer, in das sie sich zurückgezogen hatte und in dem sie gestorben war. Er hatte mit ihr geredet, nüchtern und betrunken, morgens und in der Nacht. Sie sollte ihm irgendetwas sagen, ein Zeichen geben. Sein Leben war so nutzlos. In den düsteren Tagen nach der Beerdigung saß er nur da und starrte ihr Bild an. Dann begann er mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ein hohles, dumpfes Geräusch entstand, von dem er glaubte, dass es durch das ganze Haus, durch die ganze Stadt klingen musste. Ein dumpfer Laut des Schmerzes, doch einen echten Schmerz spürte er gar nicht, nur Leere und Verlorenheit. Dann, als er drei Tage ununterbrochen in der Herzkammer gewesen war und sich den Kopf fast blutig geschlagen hatte, klingelte es an der Tür. Die alte Krall, die eine Etage über ihm wohnte, stand da. »Hören Sie das auch?«, fragte sie ihn verschwörerisch. »Diese merkwürdigen Geräusche? Sind das diese Computerleute im Hof? Machen die solche Geräusche? Sollte man die Polizei rufen?« Er schüttelte den Kopf, stammelte etwas von Klempnerarbeiten im Keller und hörte auf, den Kopf gegen die Wand zu schlagen.
Stattdessen zog er die Rasierklingen hervor, wenn er alles nicht mehr ertragen konnte, wenn die Erinnerungen ihn durchschüttelten und er Weinkrämpfe bekam. Zuerst ritzte er sich nur ganz leicht, ein Schnitt in den Finger, sodass ein paar Tropfen Blut hervorquollen. Irgendwie erleichterte es ihn, zu sehen, wie das Leben aus ihm herauslief. So wurde alles leichter – so konnte er sich vorstellen, auch bald tot zu sein.
Doch nach ein paar Wochen reichte ein kleiner Schnitt nicht mehr. Er schnitt sich in den Oberschenkel, brachte sich eine klaffende Wunde bei. Der Schmerz war köstlich, tief und echt, und irgendwie glaubte er tatsächlich, etwas ströme aus ihm heraus, ein Ventil werde geöffnet. Seine Verzweiflung verging. Ein, zwei Wochen hielt die Erleichterung an, eine lange Woche ohne Alpträume und fast ohne Selbstgespräche.
Dann musste er den nächsten Schnitt tun, obschon die Wunde noch gar nicht verheilt war. Die Erleichterung kam, aber sie war nicht mehr ganz so groß, und als er am nächsten Tag auf sein Fahrrad steigen wollte, konnte er sich kaum noch bewegen. Er wusste, dass er krank war. Nur kleine pubertierende Mädchen taten so etwas – mit Rasierklingen an sich herumschnippeln und sich selbst verletzen. Fast wäre er aufgeflogen. Als er während einer Besprechung an sich hinuntersah, bemerkte er Blut auf seinem Oberschenkel. Die Wunde war aufgebrochen und hatte seine Hose durchtränkt. Ein langer dunkelroter Streifen war zu sehen, der sich ausbreitete und durch den Jeansstoff fraß. Eilig war er hinausgestürzt und hatte eine unvermittelte Übelkeit vorgetäuscht.
Wenn die Verzweiflung ihn überwältigte, nahm er sich danach seine Waden vor, brachte sich nur hier und da kleine, unauffällige Schnitte bei, nichts Großes und Ernsthaftes, und daher währte die Erleichterung auch nie lange, ein paar Stunden Schlaf, ein ruhiger Fernsehabend ohne Gedanken und Erinnerungen.
Er hatte keine Ahnung, wie er ohne Funny weiterleben sollte. Funny – so hatte er sie genannt, weil sie das Leben und den Spaß zurückgebracht hatte. Ihr hatte der Name gefallen. Und dann war die Krankheit ausgebrochen – sie hatten erst drei unbeschwerte Monate miteinander gehabt. Es war so ungerecht gewesen. Zu Beginn hätte er am liebsten jeden alten grauhaarigen Kerl auf der Straße umgefahren, hätte jeder Rentnerin, die nutzlos herumkrauchte, einen Tritt versetzt. Warum lebten sie, wurden neunzig und hundert und schämten sich ihres Alters nicht, während Funny schwächer und schwächer wurde?
Ja, er hätte sich umbringen müssen, direkt nach der Beerdigung. Die Pistole in den Mund und abdrücken, aber er konnte es nicht, irgendetwas hielt ihn zurück. War es, weil Funny so gerne gelebt hatte? Er wusste es nicht.
Bis er eines Tages, fast neun Monate nach ihrem Tod, all seinen Mut aufgebracht hatte.
Er saß in der Herzkammer und hörte Musik, Mozart, laut und wild. Das war nicht ihre Musik gewesen, sondern seine; sie hatte sanfte Lieder bevorzugt, Leonard Cohen, Cat Stevens, James Taylor, solche Sachen, aber ohne Mozart wäre er nicht stark genug gewesen, sich ihre Tagebücher vorzunehmen. Er wollte sie gar nicht lesen, aber er begriff, dass Funny ihm viele Dinge nicht erzählt hatte. Ihre Niederlagen, wie oft sie betrogen, ausgenutzt und sogar geschlagen worden war. Krebs war eine Krankheit der Psyche, das war erwiesen. Bei manchen Menschen, die zu viel aushalten mussten, reagierte der Körper auf die Niederlagen, indem er krank wurde. So war es auch bei Funny gewesen – nach außen lebensfroh und lustig, doch jede Enttäuschung fraß sie in sich hinein. Daher der Darmkrebs, die schrecklichen Metastasen.
In ihren Tagebüchern fand er die kleine Liste und begriff sofort, dass er nun eine Aufgabe hatte. Deshalb war er noch am Leben. Er musste noch etwas für Funny erledigen. Sie hatte eine Liste der Männer gemacht, die sie betrogen und dafür gesorgt hatten, dass sie krank geworden war.
Harry Mundt lautete einer der Namen auf der Liste. Der große Revolutionär und Angeber. Zehntausend Mark hatte er ihr abgeschwatzt, damit er seinen Buchladen aufmachen konnte. Kaum hatte sie ihm das Geld gegeben, hatte er sie fallen lassen und auch noch dreist behauptet, sie hätte ihm keine einzige Mark geliehen. Auf zwanzig Seiten hatte Funny alles haargenau berichtet – den Beginn der Liebe, die Illusionen, die Verletzungen, den Betrug.
Es war nicht schwer gewesen, Mundt zu finden. Zwei Wochen genaue Observation hatten ausgereicht, um alles vorzubereiten.
Nach achtzehn Jahren hatte er ihm dann die Rechung präsentiert für all die Schmerzen, die er Funny bereitet hatte. Hinter seinem schmutzigen kleinen Buchladen hatte er ihm aufgelauert, wo Mundt immer noch den Chef mimte, obwohl er sich nun längst auf eine Beamtenstelle an einem Gymnasium gerettet hatte. Ein widerlicher Lügner und Heuchler, um den es nicht schade war.
Am liebsten hätte er ihm noch eine kurze Erklärung zugerufen, einen besonderen Gruß von Funny, bevor er schoss, aber er war kein Amateur. So viel Zeit hatte man nicht, wenn man jemanden umbringen wollte. Außerdem hatte er das rote Plastikherz dabei – das Herz war ihr Zeichen gewesen.
Zuerst schaute Mundt ihn wütend und aggressiv an, weil er glaubte, einen Penner vor sich zu haben, der sich in seinen Hinterhof gestohlen hatte, dann, als er die Pistole sah, bekam er Angst, die ihm die Knie weich werden ließ. »Was soll das?«, rief er mit echtem Zittern in der Stimme, aber da war die Kugel schon auf dem Weg zu ihm und zerriss ihm einen Wimpernschlag später das Herz.
Es war ein Kinderspiel gewesen. Irgendwo in einer Seitenstraße fand mit lauter Musik ein Fest statt, und er konnte es sich sogar erlauben, Mundt noch das blinkende Plastikherz anzuheften. Als er wieder auf sein Fahrrad stieg, wusste er, dass Funny zufrieden mit ihm sein würde.
Danach legte er sich schlafen, schlief lange, wunderbare acht Stunden auf ihrem Bett in der Herzkammer, tief und voller Glück, genau wie vorher, als Funny noch neben ihm gelegen hatte.
Der Regen hatte aufgehört, als er den Niehler Hafen erreichte. Er fühlte sich gut, nicht erschöpft, aber er hatte sich einigermaßen gefordert. Er war gut in Form. Zwanzig Kilometer am Rhein waren eine Kleinigkeit für ihn. Außerdem hatte er noch einiges vor. Zwei Namen hatte er von der Liste streichen können, ohne dass es ein größeres Problem gegeben hatte, aber noch war er nicht am Ziel. Und der letzte Name würde ihm Kopfzerbrechen bereiten – so viel war sicher. Er hatte gar nicht gewusst, dass Funny auch einen Mann gekannt hatte, der später Polizist geworden und in der Stadt so etwas wie eine Berühmtheit war. Von ihm hatte sie nie gesprochen.
Aber zuerst würde er sich den anderen vornehmen: diesen verdammten Arzt, der an ihr herumgepfuscht und ihre Krankheit nicht erkannt hatte. Er musste endlich mit seinen Vorbereitungen beginnen, musste ihm auflauern, seinen Tagesablauf recherchieren, Tatort und Tatzeit festlegen und für ein Alibi sorgen. Mittlerweile hatte er ja beinahe Routine darin.
5.
Schiller hatte das Gefühl, dass mit ihr etwas nicht stimmte, dass sie auch krank war, aber nicht so wie er, bei ihm war es nur eine lästige Grippe, aber bei ihr ging die Krankheit tiefer, eine Krankheit, die sich vor allem in einem düsteren Schweigen ausdrückte. Liebeskummer, dachte er, sie hat Liebeskummer, eine gescheiterte Ehe, irgendetwas in der Art. Deshalb ist sie in Köln aufgetaucht.
Er hatte heimlich noch zwei Kopfschmerztabletten nachgeworfen und hatte nun das Gefühl, dass die Pillen sich zusammen mit einer Menge Kaffee daranmachten, seinen Magen anzugreifen. Ihm war übel.
»Ich muss etwas essen«, sagte er mit Blick auf Birte Jessen. »Was dagegen?«