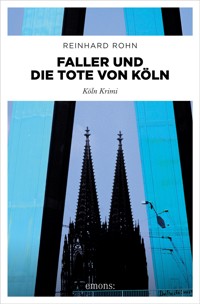9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Et hätt nit emmer joot jejange Kommissar Jan Schiller und seine Kollegin Birte Jessen sind im Dauereinsatz: In der Tiefgarage am Dom wird ein Obdachloser erschossen, am nächsten Tag treibt ein bekannter Boxer tot im Decksteiner Weiher, und ein Journalist, der als Experte für Doping gilt, wird ermordet in einer Lagerhalle gefunden. Die Spuren lassen vermuten, dass alle Taten zusammenhängen – aber wo liegt das Motiv? Schiller und Jessen tappen im Dunkeln, bis ein Brief auftaucht, der alles verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Ähnliche
Über das Buch
Et hätt nit emmer joot jejange Kommissar Jan Schiller und seine Kollegin Birte Jessen sind im Dauereinsatz: In der Tiefgarage am Dom wird ein Obdachloser erschossen, am nächsten Tag treibt ein bekannter Boxer tot im Decksteiner Weiher, und ein Journalist, der als Experte für Doping gilt, wird ermordet in einer Lagerhalle gefunden. Die Spuren lassen vermuten, dass alle Taten zusammenhängen – aber wo liegt das Motiv? Schiller und Jessen tappen im Dunkeln, bis ein Brief auftaucht, der alles verändert.
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman "Rote Frauen", der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über "Matthias Brasch". Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Die drei Toten von Köln
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Zitat
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Epilog 1
Epilog 2 — Der Abschiedsbrief
Dank
Impressum
Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!
Das Leben verlieren
ist keine große Sache; aber zusehen,
wie der Sinn des Lebens aufgelöst wird,
das ist unerträglich.
Albert Camus
Prolog
Es ist Nacht in mir – die ganze Tiefe der Nacht, in der alles vergeht, in der alles im absoluten, unendlichen Schwarz herabsinkt. Diese Nacht wird nie ein Ende haben. Ich kann nicht mehr gehen, nicht mehr denken, keine Pläne mehr schmieden, kaum noch Atem holen. Selbst das kleine gelbe Schneidemesser, mit dem ich mir dann und wann in den Unterarm geschnitten habe, um die Verzweiflung abfließen zu lassen, hole ich nicht mehr hervor. Kein Haus mehr bauen, keine Tochter, keinen Sohn bekommen, keinen Baum mehr pflanzen, keinen Schritt mehr vor den anderen setzen. Ich weiß, aus diesem Labyrinth der Nacht werde ich nie mehr herausfinden.
Für eine kurze Zeit war die Hoffnung eine andere. Da war der große Jemand in meinem Leben, der ein wenig Licht herangetragen hat. Er konnte das ganz leicht, ein Lichtbringer – mit einem Fingerschnipsen. Er verscheuchte die Dunkelheit, das tote Kind mit den toten Augen, das mir immer folgte, Schritt um Schritt. Er lächelte sanft und herzeinnehmend, er gab den Dingen neue Namen, er wusste, wie man das Blau vom Himmel einfing, er konnte Wörter buchstabieren, die ich noch nie gehört hatte.
Es hätte immer so weitergehen können, am Tag und in der Nacht. Ich war bereit dazu, doch dann verriet er mich, stieß mich in die Grube, wurde auch zu dem Monster, das ich nun verfluche und das mich am Weiterleben hindert.
Ich werde töten – ihn oder mich selbst.
1
Siebenhundertfünfzig Millionen Tiere – so viele wurden in einem Jahr in diesem verfluchten Land geschlachtet. Es war eine Schande. Er hätte kotzen können. Wo hatte er diese Zahl aufgeschnappt? Ach egal, er hatte ja immer gewusst, dass er von Verbrechern, Ignoranten, Heuchlern und Besserwissern umgeben war. Seine nächste Aktion würde den gequälten Tieren gelten. Daran hatte er schon einmal gedacht: seine Mauer, die er jeden Tag, wenn man ihn nicht verjagte, vor dem Dom aufbaute, mit Fotos von Tieren zu versehen, die für widerwärtige Versuche gequält wurden.
Der Mensch – die Krone der Schöpfung! Da konnte er nur lachen und ausspucken.
Aber erst musste er seine Aktion gegen die Folgen des Klimawandels durchziehen. Er hatte Fotos aus der Arktis, aus Afrika und Australien, die so erschreckend waren, dass man sie in den Zeitungen natürlich nicht veröffentlichte. Gletscher, die abbrachen, Eisbären, die auf einer grünen Wiese elendig krepierten, dann Sandsteppen mit abgemagerten Rindern und rote Wüsten, die immer mehr um sich griffen. Am schlimmsten waren die Fotos von toten Kindern, die man in Äthiopien in dünne weiße Tücher gehüllt hatte. Kontrastiert hatte er diese Fotos mit Aufnahmen von Touristen auf Kreuzfahrtschiffen. Feist hockten sie am Pool, ließen ihre fetten Körper in der Sonne braten, oder sie saßen an der Bar, einen Cocktail in der Hand, und grinsten dümmlich in die Kamera ihrer eigenen Smartphones. Selfies – noch so eine Pest, die über die Menschheit gekommen war.
Klar, er wusste selbst, dass er mit seiner Mauer aus Pappe, auf die er die Fotos klebte, die Welt nicht aus den Angeln heben würde, aber wenn er nur ein paar der Leute, die vorbeihasteten oder aus dem Dom kamen, ein wenig zum Nachdenken bringen würde, wäre vielleicht schon etwas gewonnen.
Vor drei Tagen hatte ihm ein alter Mann mit grauem Schnauzbart, der einen FC-Schal trug, Prügel angedroht, und dann waren diese drei Jugendlichen aufgetaucht, hatten ihn erst angerempelt und dann gegen seine Mauer getreten. Er hatte sich verteidigt, so gut er konnte.
»Alter – hau ab mit deinem Scheiß!«, hatten sie gepöbelt.
»He, es ist eure Welt, die vor die Hunde geht!«, hatte er sie angeschrien, doch sie hatten nur gelacht – dumme, stumpfsinnige Kinder, die sie waren, nichts anderes als Facebook, YouTube und billige Vergnügen im Kopf. Dann hatte der Größte von ihnen, ein hässliches Pickelgesicht, ihn mit der Faust gegen die Schulter geschlagen, und er war förmlich ausgeflippt. Er hatte dem Pickligen den Ellbogen in den Bauch gerammt, und während der Bursche zusammenklappte wie ein Taschenmesser, hatte er zugetreten und ihn zu Boden gebracht. Die anderen waren sofort über ihn hergefallen. Einer hatte ihn an den Haaren gezogen, und der andere, ein kleiner, schmächtiger Schwarzhaariger, hatte ihm einen Hieb auf die Lippe verpasst.
Die Polizei war fünf Minuten später gekommen; da waren die drei Burschen schon längst abgehauen.
»Mensch, Jakob«, hatte der eine Polizist gesagt – er hieß Markus und war ein ehemaliger Schüler, was die Angelegenheit besonders peinlich machte, »was ist denn nun schon wieder los? Warum tust du dir das an – jeden Tag mit dieser Pappmauer hier zu stehen? Geh doch nach Hause!«
Geh doch nach Hause! Dabei wusste dieser Markus genau, dass er kein Zuhause mehr hatte.
Es war alles weg. Das Haus, die Frau, der Job – er hatte doch nur noch diese Pappmauer und seinen Zorn.
Die Menschen müssen sich ändern – wir alle müssen uns ändern, wenn wir diese Welt retten wollen. Um etwas anderes ging es nicht mehr. Warum sahen das die Menschen nicht, die auf ihre Smartphones glotzten, jeden Tag an ihm vorbeiliefen, die in Kaufhäuser rannten, zu ihren Terminen oder in den Dom, um … ja, um was zu tun? Richtig gebetet wurde in der Kathedrale doch schon lange nicht mehr. Ein Hotspot für Touristen – etwas anderes war dieses ehrwürdige Gemäuer nicht. Einmal hatte er versucht, über Nacht dort zu bleiben, sich in einer geheimen Ecke auszuruhen und ein wenig zu schlafen, aber die Domschweizer, diese alten Männer in ihren roten Gewändern, kannten jeden Trick. Ihnen ging keiner durch die Lappen, bevor sie die Kirche absperrten.
Der Polizist hatte ihm dann die Adresse des Obdachlosenheims in der Annostraße gegeben, allerdings nur um sein Gewissen zu beruhigen. Die Adresse kannte er außerdem längst, doch in dem Heim wimmelte es nur so von Bulgaren und Rumänen, die keinerlei Skrupel hatten, einem das letzte Hemd zu klauen. Da würde er nie einen Fuß hineinsetzen.
Markus, hätte er dem Polizisten am liebsten hinterhergerufen, in Deutsch warst du damals eine ziemliche Niete. Ich hoffe, deine Rechtschreibschwäche fällt nicht mehr so auf.
Damals – wann war damals?
Das war die Zeit, als er noch handgearbeitete Lederschuhe getragen hatte – eine Marotte, über die sie im Lehrerzimmer alle heimlich gelächelt hatten. Und dann der dunkelgrüne Jaguar, gebraucht, aber super erhalten. Maron hatte es gefallen, in solch einem Auto zu fahren.
Es wurde dunkel, als er seine Pappmauer zusammenlegte. März – endlich wurde es wärmer. Bald würde man gut im Freien übernachten können.
Er spürte seine aufgeplatzte Lippe. Eine Frau mit langen roten Haaren, eine echte Schönheit, hatte ihm heute zehn Euro zugesteckt. »Für die Weltrevolution!«, hatte sie gesagt. Irgendwie hatte es ironisch geklungen, aber egal, zehn Euro bedeuteten zwei warme Mahlzeiten.
Jakob Ruben klemmte sich seine Pappwand unter den Arm. Vielleicht würde er sich auch ein Glas Rotwein gönnen. Worauf sollte er trinken? Auf den Frühling, ja, darauf, dass die Tage heller wurden.
Schlafen würde er heute Nacht nicht in seinem Bauwagen, sondern in der Tiefgarage, hinter seiner Pappwand – und morgen … Ach nein, er wollte nicht an morgen denken.
In der Tiefgarage überfiel ihn schon wieder unbändiger Zorn. Er ging zur untersten Ebene hinab. Der alte Schlüssel seines Bauwagens begann in seiner Hosentasche zu glühen – so kam es ihm zumindest vor. Warum fuhren diese Ignoranten alle so dicke Autos, die kaum noch in die Parkbuchten passten? SUVs, wohin man blickte. Und er stand oben und demonstrierte gegen das Elend der Welt.
Als er an einem schwarzen Porsche Cayenne vorbeiging, zog er den Schlüssel unauffällig hervor. Das Kratzen, als der Schlüssel über den glänzenden Lack fuhr, war wie Musik. Ein schöner langer Cratch-Laut. Gleich noch einmal … So geschah es diesem Porschefahrer recht. Ein Kratzer für die Eisbären am Nordpol, der nächste für die hungernden Kinder in der Sahelzone …
Die Stimme, die er plötzlich hörte, ließ ihn zusammenzucken. Fast wäre ihm seine Pappmauer entglitten. Doch nein, die Stimme galt nicht ihm, er war nicht entdeckt worden.
Hastig ging er weiter. Diese Garage am Dom war ihm deshalb so lieb, weil sie verwinkelt war. Außerdem gab es in der hintersten Ecke, dort, wo noch Reste einer römischen Mauer standen, eine Nische, wo er seine Pappmauer deponieren und sich gelegentlich zusammenrollen konnte, wenn der Mann an der Pforte nicht genau hinsah. Da konnte er davon träumen, dass eine Welt außerhalb dieser Mauern gar nicht existierte.
Das Aufheulen eines Motors war zu hören, dann wieder eine Stimme, diesmal eine andere.
Da, genau vor ihm, standen zwei Gestalten, die sich offenbar stritten, aber was sie genau sagten, konnte er nicht verstehen. Es war ihm auch gleichgültig. Sollten sich diese SUV-Fahrer doch die Schädel einschlagen! War nicht schade um sie.
Er bog zu der alten römischen Mauer ab, die man in der Tiefgarage gelassen hatte. Hier war angeblich 1074 ein Bischof durch einen Geheimgang aus der Stadt geflohen. Ein Stück weiter lag die Ecke, wo er seine Pappwand verstecken konnte.
Die beiden Streithähne waren leiser geworden, jedenfalls hörte er nichts mehr, doch vor ihm, auf dem Sims zu der Römermauer, stand eine schwarze Tasche aus Segeltuch.
Für einen Moment verharrte er. Konnte sie jemand vergessen haben? Oder war nun Köln dran? Ein Bombenanschlag in der Tiefgarage am Dom? Da würde einiges in die Luft fliegen, und in der ganzen Welt würde es für Aufsehen sorgen.
Doch das waren auch schon Gedanken, die einem von den Zeitungen eingeimpft wurden. Die Terrorangst wurde regelrecht produziert, um von den anderen, viel wichtigeren Problemen dieser Welt abzulenken.
Jakob Ruben stellte seine Pappwand beiseite und hob die Tasche an. Sie war nicht besonders schwer, das Ticken eines Zeitzünders konnte er nicht wahrnehmen.
Als er sie öffnete, spürte er ein ungewöhnliches Gefühl der Freude, das ihn selbst verblüffte. Er sah Geld – ziemlich viel Geld. Hundert-Euro-Scheine, sehr ordentlich gebündelt.
Schnell zog er den Reißverschluss wieder zu und nahm die Tasche an sich.
Das waren etliche tausend Euro. Damit wäre er seine Sorgen für eine Weile los. Er könnte sich eine Wohnung nehmen, vielleicht könnte er auch einen zweiten Prozess anstrengen, einen richtigen Freispruch erwirken.
Er hätte wieder eine Zukunft. Mit einem neuen Anzug, frisch gewaschenen Haaren könnte er zu Maron gehen. Er würde nicht um eine zweite Chance bitten, sondern nur reden.
Er war kein Mädchenanfasser, er hatte sich niemals gegen ihren Willen an einer Schülerin vergriffen.
Die schwarze Tasche warf er sich über die Schulter, dann packte er die unhandliche Pappwand. Die würde er verstecken und dann abhauen.
Er hörte nun von irgendwo ein Reifenquietschen, dann Schritte und eine Stimme.
Nein, dachte er, die Stimme gilt nicht mir. Ich bin nicht zu langsam gewesen, um ein neues Leben anzufangen.
2
Es gab ein paar gute Nachrichten, dachte Jan Schiller, Hauptkommissar der Kölner Polizei und neuerdings wieder Single. Matthias Brasch, sein ehemaliger Kollege, der Weihnachten angeschossen worden war, lernte wieder zu laufen. Die Kugel in seinem Kopf hatte ihn nicht zum Invaliden gemacht. Den IKEA-Schrank in seinem neuen Schlafzimmer hatte Schiller in nur zwei Stunden allein aufgebaut, ohne einen Tobsuchtsanfall zu bekommen. Außerdem war er nicht eifersüchtig. Dass sich bei Carla, in ihrer gemeinsamen Wohnung, in der sie nun seit zwei Monaten allein lebte, eine Männerstimme gemeldet hatte, hatte ihn überhaupt nicht gestört, kein bisschen. Wahrscheinlich war es dieser Stefan gewesen, der Sozialarbeiter, mit dem sie vor etlichen Monaten einmal geschlafen hatte.
Im Präsidium hatte er sich eine neue Kaffeemaschine gegönnt, nein, »Kaffeemaschine« war untertrieben. Mit diesem silbernen Ungetüm hätte er auch ein Café betreiben können. Espresso, besten Milchschaum, heißes Wasser für Tee – diese Maschine konnte einfach alles, und diese furchtbaren Kaffeepads, die fast jeder im Präsidium benutzte, konnte man in den Müll werfen.
Es gab allerdings auch eine schlechte Nachricht. Almut Schwäbe, die Rechtsmedizinerin, mit der er eine kurze Affäre gehabt hatte, glaubte immer noch, bei ihm sei die große Liebe ausgebrochen, er brauche jedoch noch ein wenig Zeit, um seiner alten Liebe nachzutrauern.
Sie rief fast jeden Tag an oder schickte eine SMS, und dummerweise hatte er ihr einmal die Adresse seiner neuen Wohnung in Braunsfeld genannt, und dann war sie mit Salz und Brot vorbeigekommen. »Für den Einzug«, hatte sie gesagt. »Macht man so. Es bringt Glück.« Dabei hatte sie ihn verliebt angesehen.
Verdammt, er konnte beinahe nachempfinden, was seine Kollegin Birte Jessen hatte aushalten müssen, als Hinrichs, der ehemalige Pressesprecher der Kölner Polizei, sie gestalkt hatte, nachdem sie von Hamburg nach Köln gewechselt war.
Eine Stalkerin war Almut Schwäbe nicht. Noch nicht, dachte er, aber er würde um ein klärendes Gespräch nicht herumkommen.
Er wollte sich jedoch nicht eingestehen, dass er ihretwegen nicht in seine neue Wohnung ging. Christian-Gau-Straße, Braunsfeld, dritte Etage. Almut wohnte etwa achthundert Meter entfernt in Lindenthal am Kanal. Daran hatte er nicht gedacht, als er den Mietvertrag unterschrieben hatte, er war einfach nur froh gewesen, Carlas Schweigen nicht mehr ertragen zu müssen. Die letzten Wochen hatte er bei Therese gewohnt, der alten Hebamme, die sich um ihn kümmerte, seit seine Eltern bei einem Brand gestorben waren. Da war er vierzehn gewesen. Aber Therese war ein Messie, ihr Bungalow in Seeberg war eine bessere Müllhalde, da hortete sie alles, was ihr in die Finger kam, Zeitungen, Babywäsche, Stofftiere, Handtücher, Bücher. Auf ihrem Küchentisch lagen alle Rechnungen herum, die sie in den letzten dreißig Jahren bezahlt hatte – oder auch nicht.
Schiller hatte beschlossen, vom Präsidium zu Fuß ins Belgische Viertel zu gehen. Mittlerweile lief er wieder jeden zweiten Tag zehn bis zwölf Kilometer durch den Stadtwald. Morgen würde er sein Pensum auf vierzehn steigern, da könnte er sich zum Feierabend noch einen Kaffee und zwei, drei Gläser Rotwein gönnen.
Über der Deutzer Brücke wehte ein kalter Wind, doch von hier aus hatte man den besten Blick auf den Dom und die Stadt. Wenn man hier stand, konnte man tatsächlich für ein paar Momente glauben, Köln sei eine schöne Stadt, bewohnt von glücklichen Menschen.
Schiller gestand sich ein, dass er sich einsam fühlte. Die Trennung von Carla hatte ihn zwar befreit, zu lange waren sie zu sprachlos miteinander umgegangen, doch irgendetwas fehlte, nein, nicht irgendetwas, jemand an seiner Seite. Insgeheim beneidete er Birte um ihre Liebe zu Max. Ihr Freund war ein Fahrradkurier, der an einem Roman schrieb und der so gut kochte, dass sie ständig Angst hatte, dick zu werden. »Du wirst aus einem ganz anderen Grund dick werden«, hatte Schiller zu ihr gesagt, doch sie hatte es nicht lustig gefunden.
Den Neumarkt passierte er im Laufschritt. Köln zeigte hier eine besonders hässliche Seite. Die Drogenszene hatte sich in den letzten Jahren hierhin verlagert. Manchmal konnte man Junkies sehen, die sich ausgerechnet in einem Nebeneingang zum Gesundheitsamt einen Schuss setzten. Aber so war Köln, mal herzlich, dann wieder gleichgültig und zu bequem, um etwas gegen Missstände zu unternehmen.
Nach zehn Minuten war er am Café am Bauturmtheater angekommen.
Am Fenster gab es noch einen letzten freien Tisch, den Vera, eine der Kellnerinnen, ihm mit einem Nicken zuwies. Vera war fünfundzwanzig und hatte ein halbes Semester Kunstgeschichte studiert. Ihre Eltern im Westerwald hielten sie immer noch für eine brave Studentin, dabei arbeitete sie nun bereits zwei Jahre im Café. Gelegentlich übernahm sie auch kleinere Rollen im Theater. Beim letzten Besuch hatte Schiller sich vorgestellt, sie einmal einzuladen, irgendwo mit ihr einen Cocktail zu trinken. Er war zweiundvierzig und gewissermaßen wieder ledig. Siebzehn Jahre Unterschied, da war doch nichts dabei.
Nachdem er sich gesetzt hatte, brachte sie ihm gleich einen schwarzen Kaffee.
»Heute schon Verbrecher gefangen?«, fragte sie lächelnd. Sie war hübsch, wenn sie lächelte; sie hatte blonde, glatte Haare und sah ein wenig wie die Kronprinzessin von Norwegen aus, deren Namen er vergessen hatte.
»Mehrere«, erwiderte er. Dabei hatte er nur einen Fall bearbeitet; jemand hatte angegeben, in der Nacht in der U-Bahn-Station Poststraße überfallen worden zu sein, doch die Wunde, die er vorzeigen konnte, eine leichte Stichverletzung am Arm, hatte wie selbst beigebracht ausgesehen.
Der Kaffee tat ihm gut. Er musste Pläne machen, sagte er sich, neue Dinge in Angriff nehmen. Nächsten Monat würde er einen Halbmarathon laufen; außerdem hatte er, als er seine Sachen gepackt hatte, im Keller seine alte Bassgitarre wiedergefunden. Er könnte einen alten Bekannten, Hanno, den Saxophonspieler, anrufen und sich nach einer Band erkundigen, die einen ziemlich schlechten, aber hoch motivierten Bassisten suchte.
Eine Frau mit langen roten Haaren saß allein zwei Tische von ihm entfernt; sie streifte sich immer wieder gedankenversunken eine Locke zurück, während sie etwas auf ihrem Smartphone las. Sie war nicht mehr ganz jung, Anfang vierzig vielleicht. Dunkle Augen, ein sehr sinnlicher Mund … Schiller versuchte, ihren Blick aufzufangen, doch von dem, was sie da las, schien die Frau ganz gebannt zu sein. Vielleicht eine Schauspielerin – oder eine Schriftstellerin. Es kam nicht selten vor, dass berühmte oder zumindest halbberühmte Menschen sich im Bauturmcafé einfanden.
»Sitzt du hier, um Damen anzuflirten?« Birte Jessen trat an seinen Tisch.
»Ich trinke einen Kaffee«, sagte er missmutig. Er hatte sie nicht bemerkt; offenbar hatte sie ihn schon seit einiger Zeit beobachtet.
Birte lächelte. »Ich habe alles gesehen«, sagte sie und nickte in Richtung der rothaarigen Frau. »Schade, dass sie so gar nicht interessiert ist. Aber du hast ohnehin keine Zeit. Es gibt einen Toten in der Tiefgarage am Dom. Ich habe dreimal versucht, dich zu erreichen, aber der Herr Hauptkommissar weilt offenbar im Flugmodus.«
Schiller zog sein Smartphone hervor. Ja, er hatte auf »nicht stören« gestellt.
Drei Anrufe von Birte, keiner von Carla oder Almut, und Therese hatte ihm eine SMS geschickt. »Hast du deine Wohnung endlich eingerichtet? Wann kann ich sie besichtigen?« Der vorwurfsvolle Unterton, der sich seit seiner Trennung von Carla bei ihr eingeschlichen hatte, war noch nicht gewichen. Für Therese stand fest, dass er daran schuld war, dass seine Beziehung zu Carla nach fast zehn Jahren zu Ende gegangen war.
Als Schiller aufstand, sah sie tatsächlich auf: die rothaarige Frau, und sie lächelte ihn sogar an, als hätte sie die ganze Zeit bemerkt, dass sein Blick auf ihr geruht hatte.
Birte hatte das Lächeln auch registriert. »Na«, sagte sie, »vielleicht wäre ja doch etwas gelaufen, aber du kannst ja morgen Abend wiederkommen.«
»Wissen wir genau, dass ein Tötungsdelikt vorliegt?«, fragte Schiller ganz geschäftsmäßig, während er eine Zehn-Euro-Note auf den Tresen legte, hinter dem Vera hantierte.
Birte hielt ihm die Tür auf. »Bei dem Toten handelt es sich um einen etwa fünfzigjährigen Mann. Jemand hat ihm aus nächster Nähe in die Brust geschossen.«
3
Max hatte sie in ein Nobelrestaurant im Rheinauhafen bestellt. »Achtzehn Uhr – sei pünktlich«, hatte er in seiner SMS geschrieben. Die letzten Wochen waren vielleicht die glücklichsten in ihrem Leben gewesen – nicht weil sie so verliebt war, dass sie ständig Schmetterlinge im Bauch hatte, sondern weil das Zusammensein mit ihm auf eine so wunderbare Weise normal war. Er kochte für sie, er küsste sie, sie tranken Wein zusammen, sie liebten sich, und manchmal liefen sie am Decksteiner Weiher entlang. Obschon man ihm den Unterschenkel hatte amputieren müssen, war er immer noch schneller als sie. Nun, er war auch einmal ein erfolgreicher Triathlet gewesen – bevor ihn ein Lastwagen beim Training auf dem Rennrad angefahren hatte.
Trotzdem – als sie das griechische Lokal betrat, hatte sie ein mulmiges Gefühl.
Was würde sie sagen, falls er ihr einen Heiratsantrag machte? Schon zu Weihnachten hatte er Anstalten in diese Richtung gemacht.
Sie kannten sich erst seit ein paar Monaten. Er hatte sie mit dem Fahrrad buchstäblich über den Haufen gefahren – und sie hatte ihn belogen, hatte einen falschen Namen angegeben und so getan, als wäre sie eine Geigenbauerin. Aber er hatte herausgefunden, dass sie Polizistin war.
Max sprang auf, als er sie sah. Er hatte seine langen Haare nach hinten gekämmt und sich ein weißes Hemd angezogen. Sie küssten sich, und während des Kusses suchte sie den Tisch ab. Befand sich da etwas? Ein kleines Etui für zwei Ringe? Nein, nichts, aber wahrscheinlich hatte er das Etui auch in der Hosentasche.
»Ich möchte einen Aperitif trinken«, sagte Max, »und kannst du dein Telefon ausschalten?«
Birte lächelte ihn an. Diese Diskussionen hatten sie häufig. »Ich schalte auf stumm – in Ordnung?«
»Demnächst suche ich ein Restaurant aus, in dem man keinen Handyempfang hat«, erwiderte er.
An seinem Lächeln erkannte sie, dass er längst wusste, was sie dachte. Aber er begann von einem Film zu erzählen, von einem Theaterstück.
Einmal nur hatten sie eine kurze Krise erlebt. Kate, seine ehemalige Lebensgefährtin, die auch seine Trainerin gewesen war, war aus den USA zurückgekehrt – eine wunderschöne, braun gebrannte Frau. Birte hatte sich seltsamerweise sofort unterlegen gefühlt, doch Max hatte sich nur einmal mit Kate getroffen. Nach zwei Stunden in einem veganen Restaurant war er wieder zurück gewesen.
»Ein paar Dinge«, hatte er gesagt, »gehören nun wirklich in die Vergangenheit.« Mehr nicht.
Sie bestellte sich einen Weißwein und als Hauptgang einen Fisch.
»Ich möchte etwas feiern«, sagte Max. Dann beugte er sich zu seinem Rucksack hinab, der unter dem Tisch stand. Doch er holte kein kleines Etui hervor, sondern einen weißen DIN-A4-Umschlag. Mit funkelnden Augen hielt er ihr das Kuvert hin.
»Für mich?«
»Für uns«, erwiderte er. »Irgendwie.«
Sie nahm den Umschlag und zog ein Papier heraus – fünf Seiten. Ein paar Momente brauchte sie, um zu erfassen, was sie da in der Hand hielt. Es war ein Buchvertrag. Max hatte seinen Roman verkauft, den er über den 3. März 2009 geschrieben hatte, den Tag, an dem das Stadtarchiv eingestürzt war. »Ein Tag, eine Stadt«, hieß das Buch.
»Du hast einen Buchvertrag?«
Er lächelte. »Ja, stell dir vor. Fünfundzwanzigtausend Euro Vorschuss und ein guter Verlag in Köln.«
»Aber ich dachte, du bist noch gar nicht fertig?« Er hatte ihr bisher lediglich die ersten hundert Seiten zum Lesen gegeben.
»Die erste Fassung ist fertig. Einen Monat habe ich noch, um alles zu überarbeiten, aber der Verlag war so begeistert, dass sie gleich einen Vertrag machen wollten.« Er nahm sein Glas und prostete ihr zu. »Und das mit dem Heiratsantrag«, sagte er, »kommt vielleicht später.«
Im nächsten Moment spürte sie, wie ihr Smartphone vibrierte. Das Präsidium – noch bevor sie verstohlen auf das Display geschaut hatte, wusste sie, dass sie einen Einsatz hatte.
Jan kannte den Toten. Insofern unterschied sich die Routine von anderen Einsätzen.
»Der Mann heißt Jakob Ruben. Er steht mit einer Pappwand vor dem Dom und demonstriert gegen alles Mögliche – gegen den Krieg, den Hunger, gegen die Religion. Wir haben uns vor ein paar Jahren fast einmal geprügelt.« Jans Stimme klang völlig teilnahmslos.
Schultke und sein Team von der Spurensicherung waren schon bei der Arbeit. Der Tote hatte in einem versteckten Winkel der Tiefgarage am Dom hinter einem schwarzen Kombi gelegen. Eine Frau hatte ihn entdeckt, als sie in ihr Mazda-Cabriolet hatte steigen wollen und ihr der Autoschlüssel heruntergefallen war. Da hatte sie die Schuhe des Toten gesehen.
Der Anblick eines Toten machte Birte immer noch betroffen. Eine tiefe Traurigkeit ging von einem Toten aus, besonders, wenn er gewaltsam ums Leben gekommen war. Es war, als würde er sagen: Sieh her – es war alles vergeblich.
Der Ermordete trug einen grauen verfilzten Pullover, sein Gesicht war wächsern und verzerrt, die grauen Haare klebten ihm am Kopf. In seiner Brust war ein blutiges Loch. Vermutlich war er sofort tot gewesen.
»Wieso hast du dich mit ihm fast geprügelt?«, fragte Birte.
Jan stand neben ihr. Er blickte auf sein Smartphone und begann dann, Fotos zu machen. »Ruben hat Carla aufgelauert. Er hat sie bedroht. Er war Lehrer an der Gesamtschule in Rodenkirchen. Zwei Mädchen hatten ihn beschuldigt, sich ihnen eindeutig genähert zu haben. Das eine Mädchen war bei Carla in Behandlung. Sie war eine Borderlinerin, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich geritzt. Ihr Arm war voller Narben.«
Schultke hatte einen Scheinwerfer aufgebaut, der den Toten nun in ein grelles, gespenstisches Licht tauchte. Ein Kollege machte mit einer Spezialkamera Fotos.
Birte wandte sich ab. War der Tote in der Tiefgarage erschossen worden? Blutspuren waren auf dem Betonboden nicht zu sehen. Von der Zufahrt hörten sie aufgeregte Stimmen. Sie hatten die untere Ebene der Garage absperren müssen, was offenbar für reichlich Unmut sorgte.
»Wo ist die Frau, die den Toten gefunden hat?«, fragte sie einen uniformierten Polizisten.
Er deutete mit dem Daumen hinter sich. »Sie hat aber nichts gesehen, sagt sie.«
Eine Frau, die ein rotes Kopftuch trug, stand bei einem anderen Uniformierten, dann kam die Rechtsmedizinerin, Dr. Almut Schwäbe, mit einem Metallkoffer heran. Birte sah sich nach Jan um. Er würde nicht sonderlich begeistert sein, sie zu sehen. Wenn Birte nicht alles täuschte, war da ein One-Night-Stand vor einiger Zeit ziemlich schiefgegangen.
Als ihr Smartphone summte, war sie sicher, dass Max sich meldete. Sie hatte ihn mit der Hauptspeise sitzen lassen, und zum ersten Mal hatte er sich verärgert gezeigt. »Gibt es nur eine Polizistin in Köln, die Mordfälle lösen kann?«, hatte er so laut seufzend ausgerufen, dass sich das halbe Restaurant nach ihnen umgeblickt hatte.
Es war jedoch Nele Krach, ihre Assistentin, die sich aus dem Präsidium meldete.
»Es gibt eine Art Bekennerschreiben im Netz«, sagte sie. »Sie nennen sich ›Rebels of Cologne‹ und erklären, dass sie Jakob Ruben liquidiert haben, weil er das Symbol des verlogenen Gutmenschen sei.«
Birte hörte wieder aufgeregte Stimmen von der Zufahrt her. »Das Symbol des verlogenen Gutmenschen?«, wiederholte sie. »Kennen wir diese Rebels of Cologne?«
»Bisher nicht«, erwiderte Nele. »Ich habe das schon gecheckt. Wir versuchen auch, herauszufinden, woher die E-Mail stammt. Könnte von einem russischen Server abgeschickt worden sein.«
4
Der Anblick des Toten brachte ein paar unliebsame Erinnerungen ans Tageslicht. Schiller hatte Jakob Ruben sofort erkannt, obschon der ehemalige Lehrer sich sehr verändert hatte. Sein Haar war schütter und grau geworden, die Haut in seinem Gesicht wirkte ungesund ledrig, und das hatte nichts mit seinem gewaltsamen Tod zu tun.
Es musste etwa fünf oder sechs Jahre her sein, als Ruben vor ihrer Praxis in der Palanterstraße auf Carla gewartet hatte. Mit dem lauten Ruf »Verdammte Psycho-Schlampe« hatte er sich auf sie stürzen wollen, doch da war Schiller neben sie getreten und hatte ihm die Faust vor die Brust geschlagen. Ruben war sofort zu Boden gegangen. Laut zeternd hatte er sich dann entfernt. Carla hatte eine Anzeige aufgeben wollen, doch Schiller hatte es ihr ausgeredet.
Wenig später war Ruben vom Unterricht suspendiert worden, nicht wegen der Aussagen der zwei Schülerinnen, die ihn bezichtigten, sie nach einer Theateraufführung, die er geleitet hatte, unzüchtig berührt zu haben, sondern weil er seinem Schulleiter einen Hieb ins Gesicht verpasst und ihm die Nase gebrochen hatte. Danach war es mit Ruben schnell bergab gegangen – er war aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden, seine Frau hatte sich von ihm getrennt, und irgendwann war er als Mahner und Warner vor dem Dom aufgetaucht. Eine stadtbekannte Person, die aber niemandem sympathisch war. Ob die Anschuldigungen der Mädchen stimmten, war niemals geklärt worden. Marissa, das Mädchen, das bei Carla in Behandlung gewesen war und von dem die Beschuldigungen ausgegangen waren, war ein Jahr später mit ihren Eltern nach Süddeutschland gezogen, wenn Schiller sich recht erinnerte.
Und nun hatte jemand Ruben in die Brust geschossen. Er war vermutlich sofort tot gewesen.
Dass Almut Schwäbe am Tatort auftauchte, überraschte Schiller nicht. Sie hatte sich eine neue Frisur machen lassen: einen Kurzhaarschnitt, blond gefärbt. Ihm wurde bewusst, dass sie sich seit über zwei Wochen nicht gesehen hatten. Ihre letzten Kurznachrichten hatte er nicht beantwortet.
Schiller nickte ihr zu. Sie musterte ihn mit dunklem, gleichzeitig erwartungsvollem Blick. »Ich kenne den Toten«, sagte er. »Hat hier immer vor dem Dom demonstriert. Es wäre wichtig, zu wissen, wann genau er getötet worden ist.«
Almut Schwäbe schaute ihn an. »Werde mir Mühe geben«, sagte sie tonlos, dann glitt sie an ihm vorbei.
Zweimal hatten sie miteinander geschlafen. Beim ersten Mal war er betrunken gewesen, beim zweiten Mal so nüchtern, dass ihm klar geworden war, dass es nicht passen würde. Sie war eine intelligente Frau, aber ihr Blick war zu suchend, zu sehr darauf aus, zu gefallen und irgendjemanden an ihrer Seite zu wissen.
Schiller entfernte sich von dem Toten. Zwei von Schultkes Leuten suchten den Boden nach Spuren ab. Das Projektil hatten sie noch nicht gefunden.
An der Zufahrt zur Tiefgarage hingen zwei Kameras, die offenbar auch funktionierten. Also würden sie sich jedes Auto ansehen können, das in die Garage gefahren war. Jemand von der Betreibergesellschaft des Parkhauses war auch schon aufgetaucht. Ein Mann in einem grauen Anzug mit Krawatte.
»Was hat dieser Obdachlose hier zu suchen gehabt?«, herrschte der Mann Schiller an. »Wir haben alle unsere Mitarbeiter angewiesen, solche Subjekte zu entfernen.« Er betonte das Wort »Subjekte«, als bezeichnete es eine Krankheit. »Gab es einen Streit unter Pennern? Ist der Mann deshalb ermordet worden?«
»Wir haben eben erst mit den Ermittlungen begonnen«, erwiderte Schiller missmutig. »Aber Sie werden uns sicherlich gerne unterstützen. Wir benötigen das Videoband des heutigen Tages. Wir müssen sehen, wer alles herein- und herausgefahren ist.«
Der Mann nickte, nun etwas versöhnlicher. »Das gefällt uns gar nicht«, sagte er. »Wir tun alles, damit man sich in unseren Parkhäusern sicher fühlt, und dann kommt so ein Penner und lässt sich hier erschießen.«
Es blieb die ganze Zeit ein merkwürdiges Gefühl: Almut Schwäbes dunklen Blick zu spüren und gleichzeitig den Impuls zu haben, Carla anzurufen. Hatte sie mit Jakob Ruben nicht auch später noch Kontakt gehabt und nicht auch dessen Ex-Frau kennengelernt?
Erst im Präsidium, während er mit Nele Krach und Bert Cremer, dem dritten Hauptkommissar in ihrem Team, das Videoband durchsah und Fotos der geparkten Autos aus der Tiefgarage sichtete, fühlte Schiller sich entspannter. Über sechshundert Fahrzeuge, die von morgens elf Uhr bis gegen zwanzig Uhr dreißig, als der Tote gefunden worden war, in die Tiefgarage gefahren waren, mussten sie überprüfen. Zudem etwa dreihundert geparkte Autos in der unteren Ebene. Eine Arbeit, die mehrere Tage in Anspruch nehmen würde. Nele hatte bereits Verstärkung angefordert. Auf den ersten Augenschein hin hatten sie auf dem Videoband nichts Auffälliges entdecken können. Jakob Ruben war auf den Aufnahmen nicht zu sehen gewesen. Er war vermutlich durch den Seiteneingang am Dom in die Garage gelangt.
Schiller unterließ es, Carla anzurufen. Die Ex-Frau von Ruben, die als Kunstlehrerin am Museum Ludwig arbeitete, hatte sich bereit erklärt, ihren Mann am nächsten Morgen zu identifizieren. Sonderlich bekümmert über den Tod Rubens schien sie nicht zu sein. Die Rebels of Cologne hatten noch eine E-Mail verfasst – fünf Zeilen voller Unsinn über Identität, Flüchtlinge und die Strafaktion zu Jakob Ruben. Aber woher hatten diese Rebels von der Ermordung gewusst, bevor sie offen im Netz gestanden hatte? Die beiden E-Mails waren von einem Server in der Ukraine verschickt worden – eine Rückverfolgung würde nahezu unmöglich sein.
Als Schiller gegen zwei Uhr nachts seine Wohnung betrat, fiel ihm auf, wie leblos sie aussah. Wenn man die drei Räume als Tatort angesehen hätte, wäre es schwergefallen, irgendetwas über den Bewohner zu sagen. Keine Fotos oder Bilder an den Wänden – außer dem großen bunten Druck eines Gemäldes von Gerhard Richter, das Carla ihm zum vierzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Keine Bücher, nur ein paar CDs, und die Küche sah nicht aus, als hätte da jemand in den letzten Wochen gekocht.
Einzig die Bassgitarre – ein Fender-Bass mit einem Hals aus Ahorn und einem Korpus aus Esche – deutete auf die Persönlichkeit des Bewohners hin.
Schiller nahm den Bass in die Hand und zupfte ein paarmal. Außer Variationen eines tiefen Dum-Dum-Dum hatte er früher in seiner Band nicht viel hervorgebracht. Nun probierte er ein paar Akkorde. Wieder das bekannte Dum-Dum-Dum, das ihm durch Mark und Bein ging. Dazu schlug er mit dem rechten Bein einen Takt und schloss die Augen. Er konnte sich vorstellen, auf einer Bühne zu stehen, ganz im Hintergrund, vor ihm ein Gitarrist und rechts von ihm der Leadsänger, und dann setzte das Schlagzeug ein, gab einen harten Rhythmus vor, in den er mit einstieg, Sekunden später kreischte die Gitarre auf. Sie spielten harten, groben Rock. Ja, wie wäre das, wenn er auf seine alten Tage noch richtig Musik machen würde?
Mit Hanno, einem stadtbekannten Saxophonisten, der nun auf die siebzig zuging, hatte er vor Ewigkeiten einige Auftritte gehabt. Milde hatte Hanno über seine Fehler und sein sehr eingeschränktes Repertoire hinweggesehen. »Sei du der Teppich, über den wir laufen«, hatte er gesagt.
Plötzlich klang ein lautes Schrillen in sein Gezupfe hinein, das er überhaupt nicht einordnen konnte. Schiller öffnete die Augen. Das Schrillen ertönte ein zweites Mal, nun noch drängender. Es war zwei Uhr zwölf, wie er auf der Anzeige seines Radioweckers sehen konnte. Jemand stand vor seiner Tür. Zum ersten Mal hörte er die Türklingel. Als Almut gekommen war, hatte sie ihn vor der Tür abgepasst, aber sie würde sich nach ihrer letzten Begegnung kaum trauen, um diese Zeit bei ihm aufzutauchen.
Carla, fiel ihm ein, nein, sie konnte es nicht sein, aber vielleicht machte Therese einen nächtlichen Hausbesuch. Bei ihr konnte man nie wissen, wann sie in ihrem babyblauen Mantel auf der Matte stand. Oder Birte hatte eine Idee zu ihrem neuesten Fall, die sie unbedingt sofort loswerden musste.
Als er die Tür öffnete, stand eine blonde Frau da – sie trug eine schwarz umrandete Brille, hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und lächelte ihn schief an.
»Cool«, sagte sie in einem leicht ironischen Tonfall, »wir haben jetzt einen Musiker im Haus, aber, verdammt, musst du um zwei Uhr nachts noch üben? Ich bin vor einer Stunde aus dem Theater gekommen und bin hundemüde.«
»Tut mir leid«, erwiderte Schiller entschuldigend. »Ich habe nicht auf die Uhrzeit geachtet. Ich bin kein Musiker, sondern …«
»Polizist … ich weiß«, sagte die blonde Frau. Ihre blauen Augen schienen ihn zu erforschen. »Hat mir ein Nachbar aus dem Erdgeschoss erzählt. Na, nun kann ich mich ja absolut sicher in meinen vier Wänden fühlen.« Sie stellte sich als Nadine Linder vor und war Dramaturgin am Kölner Schauspiel.
Als sie sich wieder umdrehte, um in ihre Wohnung hinunterzugehen, sah Schiller ein Tattoo auf ihrem linken Oberarm. Eine Schlange mit einem offenen Maul, die sich an einem Rosenstock hinaufwand.
Könnte es sein, dachte er ein paar Minuten später, als er in seinem Bett lag, dass ich soeben der schönsten Frau begegnet bin, die ich jemals gesehen habe?
5
Birte hatte gewusst, dass Jan sie hängen lassen würde. Sie hasste es, bei Obduktionen dabei zu sein; Jan hatte versprochen, auch zu kommen – trotz seiner unglückseligen Affäre mit Almut Schwäbe, aber um neun Uhr war vor dem Gebäude der Rechtsmedizin nichts von ihm zu sehen.
Maron Kirschner, die Ex-Frau von Ruben, trug einen eleganten grauen Ledermantel. Sie hatte langes rotblondes Haar und sah aus wie ein in Ehren gealtertes Fotomodell.
»Es tut mir leid, was mit Jakob passiert ist«, sagte sie nach ihrer knappen Begrüßung, »aber richtig trauern kann ich nicht um ihn. Wir hatten ein paar gute Jahre, als unser Sohn geboren wurde, doch die waren schon lange vorbei, als diese Mädchen ihn anzeigten.«
Birte bemerkte, dass die Rechtsmedizinerin sich verstohlen nach Jan umschaute. Sie wirkte auch leicht enttäuscht, dass er nicht auftauchte.
»Jakob Ruben hatte Alkohol im Blut, knapp zwei Promille. Seine Leber war schwer geschädigt. Da hätte er bald Probleme bekommen. Insgesamt war sein körperlicher Zustand jedoch nicht schlecht«, erklärte die Rechtsmedizinerin.
Die Identifizierung dauerte dann nicht mehr als drei Minuten.
Maron Kirschner vergoss schließlich doch ein paar Tränen. »Jakob war kein sehr guter Mensch, er war jähzornig und rechthaberisch. Trotzdem hat er dieses Schicksal nicht verdient. Ich bin auch sicher, dass die Mädchen damals gelogen haben.«
»Wissen Sie, wo Ihr Ex-Mann zuletzt gewohnt hat?«, fragte Birte. Im Melderegister hatte Nele eine Adresse ausfindig gemacht, wo er vor einem Jahr ausgezogen war.
»Ich glaube, er hatte keine feste Wohnung mehr«, erwiderte Maron Kirschner. »Dabei war er kein armer Mann. Er bekam seine Pension, nicht viel, aber er hätte nicht auf der Straße leben müssen. Außerdem hatte er sogar noch ein Bankkonto.«
Birte machte sich eine Notiz, dass sie die Vermögensverhältnisse von Ruben überprüfen mussten.
»Sagen Ihnen die Rebels of Cologne etwas?«, fragte sie.
Maron Kirschner schüttelte den Kopf. »Ich habe Jakob schon über ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Die Domplatte habe ich zuletzt gemieden. Ich wollte ihn da nicht so stehen sehen – in seinem verfilzten Pullover, mit fettigen Jahren –, wie er glaubte, gegen alles und jeden protestieren zu müssen.«
»Hatte Ihr Ex-Mann Feinde?« Birte begleitete Maron Kirschner zu ihrem Wagen, einem schwarzen Audi. Hinter einem Fenster der Rechtsmedizin glaubte sie Almut Schwäbe auszumachen, die ihnen nachblickte.
»Feinde? Ich weiß nicht. Bevor das mit den Mädchen passiert ist, war er Schöffe – eine Sache, die er sehr ernst genommen hat. Da haben ihn schon mal Leute bedroht, aber danach …« Sie zuckte die Achseln. »Hat ein Mann Feinde, der auf der Domplatte steht und jedem Passanten stumm ins Gesicht schreit, er sei am furchtbaren Zustand dieser Welt mitschuldig?«
Maron Kirschner öffnete die Fahrertür. Tränen waren in ihrem Gesicht keine mehr zu erkennen.
»Was ist mit Ihrem Sohn?«, fragte Birte. »Welchen Kontakt hatte er noch mit seinem Vater?«
»Das habe ich Jakob besonders übel genommen: Justus hat seinen Vater geliebt, er hat dessen Abstieg am wenigsten verkraftet, und deshalb ist er vor fünf Jahren abgehauen, gleich nach dem Abitur. Er lebt nun in Brisbane und studiert Meeresbiologie. Ich habe ihn in all der Zeit nur viermal gesehen.«
Als sie zurück ins Präsidium fuhr, traf eine SMS von Max ein. »Meine Haut ist taub ohne dich. M.« Gestern Nacht war er in einer seltsam düsteren und sogar abweisenden Stimmung gewesen. So kannte sie ihn nicht, dabei hatte er doch allen Grund gehabt, zu feiern. Zum ersten Mal seit Langem hatte er wieder von seinem Unfall gesprochen, von dem Moment, als ihn der Lastwagen gestreift hatte. Mit dem Rennrad war er unterwegs gewesen; eine Trainingsfahrt von zweihundert Kilometern, kurz vor Köln hatte ihn der Kühlergrill eines Trucks gestreift; er war zu Boden gegangen, und ein Reifen hatte sein rechtes Bein erwischt. »Ich habe einen furchtbaren Schmerz gefühlt, einen glühenden Schmerz, als würde ich meinen eigenen Feuertod erleben, und ich habe gewusst, dass mein Leben zu Ende ist. Mit dieser glasklaren Erkenntnis bin ich in Ohnmacht gefallen und erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Da hatte man mir schon den Unterschenkel amputiert. Kate, die per GPS immer wusste, wo ich war, hatte ihre Zustimmung gegeben.«
Vielleicht, hatte Birte da zum ersten Mal gedacht, nahm Max ihr diese Zustimmung immer noch übel; als hätte Kate, seine Lebensgefährtin, Hüterin und Trainerin, ihn aus seinem alten Leben hinausgeworfen.
Was antwortete man auf so eine Kurznachricht? Großer Gott, sie war Polizistin, keine Dichterin! Statt eines »Ich liebe dich«, das ihr profan und wie eine leere Beruhigung vorkam, schrieb sie: »Wir lieben uns, sind Herzverwandte. Bis heute Abend. B.«