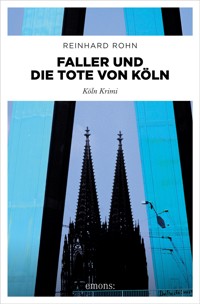
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Köln-Krimi
- Sprache: Deutsch
Reinhard Rohns neue Köln-Krimi-Reihe geht in die zweite Runde! Faller arbeitet wieder als Journalist – nur für eine kleine Kölner Internetzeitung, aber immerhin. Auch in seinem Privatleben scheinen sich die Dinge zu fügen, bis sein Vater ihn unerwartet um Hilfe bittet. Der Literaturprofessor hat eine berühmte Sängerin tot in seinem Gartenhaus gefunden und gilt als Hauptverdächtiger. Faller stürzt sich in die Suche nach dem wahren Täter, doch bald kommt es zu einem zweiten Mord – bei dem er selbst in den Fokus der Ermittlungen gerät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhard Rohn, 1959 in Osnabrück geboren, lebt seit über dreißig Jahren in Köln und arbeitet als Verlagsleiter in einem Berliner Verlag. Neben seinen Kriminalromanen erschien bei Emons sein Roman »Die ersten Tage der Liebe«.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig. Bei der Schilderung real existierender Schauplätze hat sich der Autor einige kleinere Freiheiten gestattet. Die hier beschriebenen Internetplattformen existieren nicht.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/MERVYN REES/Alamy/Alamy Stock Photos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-98707-144-7
Köln Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
1
Beim ersten flüchtigen Hinsehen hielt er das Tier, das vor seinem Küchenfenster saß, für eine Katze – klein, schwarz-weiß gescheckt hockte das Tierchen da und starrte ihn an. Katzen waren in seiner Straße nicht selten, ein kleiner Park, eher eine Ansammlung von Gebüsch, lag ein paar Meter weiter, und er hatte sich schon häufiger gewundert, warum er auf der viel befahrenen Venloer Straße, die sich dreihundert Meter entfernt befand, noch nie eine tote Katze gesehen hatte. Vielleicht waren sie einfach zu klug oder doch zu schnell, um sich überfahren zu lassen.
Dann gab das Tier einen jaulenden Ton von sich und sprang von dem Fensterbrett. Es war ein winziges Hündchen, erkannte er, ein Pudel, schwarz-weiß gelockt. Braune Augen schauten zu ihm auf, und als er die Tür zu Helens Atelier öffnete, folgte ihm der Hund, huschte hinter ihm hinein, als wäre er hier zu Hause.
Kauf dir einen Hund, ein Hund ist immer ein treuer Begleiter – an diesen Satz musste er denken. Helen hatte ihn gesagt, zumindest in seinen Gedanken. Das war kurz nach ihrem Tod gewesen. Sie war in seiner Straße von einem Van überfahren worden. Ihr Tod hatte ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, und zugleich war er wieder zu dem geworden, der er einmal gewesen war: ein engagierter Journalist. Ausgerechnet Valentin Graf, mit dem Helen vor der Zeit mit ihm liiert gewesen war und den alle Welt nur den Malerfürsten nannte, weil seine Bilder Millionen wert waren, hatte ihn mit der Journalistin Julia Blum zusammengebracht, und nun gaben sie eine Internetzeitung heraus – den Rhein-Pegel –, und einmal in der Woche zeichneten sie im Hinterhofsalon an der Aachener Straße eine Diskussionssendung auf – den Rhein-Talk –, die sie über YouTube und andere Plattformen verbreiteten. Die Klickzahlen waren in jeder Woche gestiegen; in der ersten Woche hatten sie kaum fünfhundert Zugriffe gehabt; nun – in der achten Woche – waren sie bei über dreitausend, und er hatte endlich wieder das tun können, was er liebte, recherchieren, schreiben und nun auch auf einer offenen Bühne diskutieren.
Und doch hatte er die Trauer immer noch nicht überwunden.
Mit Julia war er zweimal in der Südstadt essen gewesen, aber Helens Bilder hatte er ihr noch nicht gezeigt.
Das Hündchen schien förmlich an seinem Bein zu kleben.
Faller schaute hinab. »Was willst du hier? Bist du irgendwo abgehauen?«
Der Hund hielt kurz inne, und dann tat er etwas, das Faller nicht erwartet hatte, er machte einen gewaltigen Satz und sprang an ihm hoch.
Fang mich auf!, bedeutete dies eindeutig. Nimm mich in den Arm!
Mit einer fahrigen Bewegung wehrte Faller den ersten Versuch ab und durchquerte Helens Atelier, um in die Küche zu gelangen.
Was tat man mit einem Hund, der einem nachlief? Gab es eine Stelle, wo Leute ihre Hunde als vermisst meldeten? Oder musste man in einem Tierheim anrufen, und dann kam jemand vorbei und nahm den Hund mit?
In der Küche kochte er sich einen Kaffee, es war später Nachmittag. Mit Julia hatte er die nächste Sendung vorbereitet, die am Donnerstag aufgezeichnet werden sollte. Diesmal würde Julia moderieren – sie taten das im Wechsel. Faller war für die politischen Themen zuständig – die Politik in Köln, Wohnung, Verkehr, Verwaltung. Sie redeten über all das, was in dieser Stadt so schieflief. Julia hingegen bearbeitete die softeren Themen – wie kann ein Leben gelingen, wie finden wir Entspannung, warum sind die Kirchen so leer. In der nächsten Sendung sollte es um Musik gehen – warum lieben Menschen es, zu singen, was passiert, wenn sie Musik hören.
Der Hund hatte sich an der Tür postiert und beobachtete jede seiner Bewegungen ganz aufmerksam.
»Wo kommst du her?«, fragte Faller ihn mit lauter Stimme. »Und was willst du hier bei mir?«
Für einen Moment kam ihm sogar der Gedanke, dass Valentin Graf ihm das Hündchen vor die Tür gesetzt hatte. Sie waren in den letzten Monaten keine Freunde geworden, dafür waren sie zu unterschiedlich, aber seit den Ereignissen um Helens Tod – der Fahrerflucht und den Ermittlungen danach – hatten sie sich oft gesprochen, und Faller wusste, dass ohne Grafs Geld Julia niemals ihr Unternehmen hätte starten können. Aber ein Hündchen als Geschenk vor die Tür setzen? Nein, das war ein wenig zu weit hergeholt.
Als Faller sich mit seinem Kaffee an den Küchentisch setzte, jaulte das Hündchen kurz auf, dann nahm es Anlauf und sprang ihm auf den Schoß.
Für einen Moment war er verblüfft. Taten solche Hund das – wildfremden Menschen auf den Schoß springen? Dann strich er dem Hund über das schwarz gelockte Köpfchen. Dankbar schaute das Tier zu ihm auf. Es trug ein rotes Halsband, erkannte Faller, aber keine Marke, nichts, mit dem man es identifizieren konnte. Allerdings – hatten Hunde nicht neuerdings einen Chip am Ohr, den man beim Tierarzt auslesen lassen konnte? Er versuchte, etwas zu ertasten, konnte jedoch nichts erfühlen. Die Berührungen schienen dem Hund zu gefallen, er schmiegte sich an Faller, als sei ihm kalt und als wolle er sich ein wenig Körperwärme holen. Das Tier war mager, man konnte leicht die Rippen ertasten, trotzdem sah es nicht abgemagert oder verwahrlost aus.
Er überlegte, Julia anzurufen oder seinen Freund Matthias Brasch, den Privatdetektiv, um sich einen Rat geben zu lassen, was er mit dem Hund anfangen sollte. Es war gleich siebzehn Uhr. Wahrscheinlich würde er da bei einem Tierheim niemanden mehr erreichen. Oder war es besser, den Hund für eine Nacht zu behalten, ihn zu fotografieren und Zettel an Laternenpfähle in der Straße zu kleben? Namenloser Hund zugelaufen …
Aber wahrscheinlich war es wohl am besten, dem Hund erst etwas zu trinken und zu fressen zu geben. Vorsichtig schob er den Hund von seinem Schoß. Er füllte eine kleine Plastikschale mit Wasser, immer aufmerksam von braunen Hundeaugen beobachtet, dann öffnete er den Kühlschrank. Wurst war keine mehr da, aber noch ein Stück geräucherte Forelle, die er neben die Schale legte. Der Hund zögerte ein paar Sekunden, dann hob er den Kopf, als müsse er gewisse Düfte erschnüffeln.
Im selben Augenblick, als er sich über den Fisch hermachte, summte Fallers Smartphone.
Er erkannte die Nummer, die nichts Gutes verhieß. Sein Vater rief ihn an, was eigentlich niemals vorkam. Der alte Literaturprofessor aus dem noblen Kölner Stadtteil Marienburg, der seinen Sohn nicht einmal respektiert hatte, als er eine Zeit lang der Starjournalist beim »Magazin« in Hamburg gewesen war.
Faller überlegte, den Anruf zu ignorieren, doch vielleicht handelte es sich um einen Notfall. Sein Vater war achtundsiebzig Jahre alt, und auch wenn er bei seinem letzten Besuch vor ein paar Wochen kerngesund gewirkt hatte, konnte sich so etwas schnell ändern.
»Was gibt es, Herbert?«, fragte er statt einer Begrüßung, auch weil er wusste, dass sein Vater es gar nicht schätzte, mit seinem altertümlichen Vornamen angesprochen zu werden.
»Robert …« Die Stimme seines Vaters klang ältlich und zitterte. »Könntest du vorbeikommen? Sofort? Es ist was passiert … bei mir … Ein Mord, aber ich … ich bin nicht der Mörder …« Dann brach die Verbindung ab.
2
Ein Mord, aber ich bin nicht der Mörder? Faller musste die Worte seines Vaters noch einmal laut nachsprechen, doch auch dann verstand er sie nicht. Betrunken hatte sein Vater nicht geklungen, verwirrt allerdings schon, verwirrt und sehr aufgeregt.
Er rief seinen Vater zurück, zuerst auf dessen Mobilnummer. Ein altes Nokia-Telefon würde nun summen, stellte er sich vor, weil sein Vater sich weigerte, sich ein Smartphone zuzulegen, obschon er ansonsten mit Computer und Tablet gut ausgestattet war. Sein Vater hob nicht ab; auch auf der Festnetznummer meldete sich niemand.
Das Hündchen sah interessiert zu ihm auf. Es hatte mittlerweile den Fisch aufgefressen.
»Monday«, sagte Faller zu dem Tier, das daraufhin den kleinen Kopf schräg legte. »Ich nenne dich Monday, weil ich dich an einem Montag gefunden habe, oder nein, du hast ja mich gefunden, und morgen mache ich ein Foto von dir und hänge es an ein paar Laternenpfähle. Bestimmt sucht dich jemand, und bei mir kannst du auf keinen Fall bleiben.«
Als Faller zur Tür ging, trippelte Monday ihm nach und jaulte dann enttäuscht auf, als er vor ihm durch die Tür ins Atelier schritt.
Hier hatte sich seit Helens Tod nichts verändert, obschon ihn Lorenz Münter, ihr Galerist, fast jede Woche anrief, um Interessenten vorbeizuführen. Für »Sonnenkuppe«, Fallers Lieblingsbild, eine Komposition aus Sand und grellen gelben Farben, hatte Münter bereits mehrfach hundertfünfzigtausend Euro geboten. Ein Irrsinn, trotzdem war Faller nicht schwach geworden. Einen Verkauf hätte er wie Verrat an Helen empfunden.
Sein alter Volvo stand am Ende der Straße und sprang zum Glück sofort an. Wann hatte er seinen Vater zuletzt gesehen? Er wusste es nicht mehr – es musste etliche Wochen her sein, nein, es war dessen achtundsiebzigster Geburtstag Anfang April gewesen, also vor zwei Monaten. Der Professor hatte ihn zu einem Kaffee auf das Schiff »Alte Liebe« eingeladen, das ein paar hundert Meter von seinem Haus entfernt am Rhein lag. Schon nach einer halben Stunde hatten sie sich nichts mehr zu sagen gehabt. Herbert Faller passte das alles nicht mehr – so drückte er sich aus. »Es passt mir nicht mehr.« Die Verhältnisse an seiner alten Universität, die Artikel in den Zeitungen – dass man heutzutage keine alten Sprachen mehr lernen müsse, dass alle so geschichtsvergessen geworden seien.
In dem Haus in Marienburg war Faller schon länger nicht mehr gewesen. Als er sechzehn war, war seine Mutter an Darmkrebs gestorben – sie hatte er wirklich geliebt, doch sein Vater war stets der unnahbare kühle Dozent geblieben, der von seinem Sohn vollkommen enttäuscht war, weil der sich nicht für Literatur interessierte, sondern mit achtzehn auszog, um Journalist zu werden.
Das Haus lag in einer ruhigen Seitenstraße, aber eigentlich gab es in so einem noblen Vorort wie Marienburg nur ruhige Seitenstraßen. Er fand einen Parkplatz direkt vor dem Haus. Alles war ruhig, nichts deutete darauf hin, dass etwas passiert sein könnte. Auch einen zweiten Anruf hatte sein Vater nicht angenommen. Das Haus war ein weißer Backsteinbau aus den dreißiger Jahren, der schon zu groß für sie gewesen war, als seine Mutter und er noch dort gewohnt hatten.
Faller überlegte zu klingeln, obwohl er noch einen Schlüssel für die alte hölzerne Haustür besaß. Er tat das auch, hörte, wie der dunkle Gong, den er als Jugendlicher so gehasst hatte, durch das Innere des Hauses wogte. Wie erwartet kam niemand an die Tür.
Er schloss auf und rief nach seinem Vater. Die Diele war dunkel. Garderobe, Spiegel, auf der anderen Seite ein Foto von Rilke, dem Säulenheiligen seines Vaters.
Keine Antwort.
Die Tür zum Wohnzimmer stand offen. Hier gab es tatsächlich eine Neuerung – ein großer Flachbildschirm hing an einer Wand, die Ledermöbel waren ein wenig nach hinten gerückt, und eine riesige Regalwand, in der früher die klassischen Schallplatten gestanden hatten, war verschwunden.
Wieder rief er ein lautes »Herbert!«. Er begann sich unwohl zu fühlen. Etwas schien absolut nicht zu stimmen. Auf dem Tisch im seitlichen Bereich des Wohnzimmers, wo sie früher gesessen hatten, um zu essen, stapelten sich Zeitungen, Schallplatten und alte Fotos. Dass sie alt sein mussten, erkannte Faller daran, dass sie schwarz-weiß waren und sich bereits wellten. Hatte sein Vater sein Fotoarchiv gesichtet? Aber eigentlich erledigte er solche Dinge in seinem Arbeitszimmer unter dem Dach.
Faller wollte schon zurück in die Diele und dann in die Küche gehen, als sein Blick in den Garten fiel.
Der Garten war weitläufig, fast achthundert Quadratmeter mit einem steinernen Gartenhaus am Ende.
Da saß sein Vater, vor dem Gartenhaus auf einem Baumstumpf, und sah zu ihm herüber.
Faller öffnete die Tür zur Terrasse, eilte über die Marmorplatten, vorbei an einem hölzernen Gartenstuhl über den Rasen, der schon länger nicht gemäht worden war.
Sein Vater kauerte da, hatte den Blick wieder gesenkt. Er trug ein weißes Hemd, das voller Blut war, und auch seine dunkelbraune Cordhose war blutig. In der Hand hielt er ein Messer, ebenfalls voller Blut, das er kurz hochhielt, eine müde, irgendwie resigniert wirkende Begrüßung.
»Vater …« Jetzt kam Faller dieses fremde Wort doch über die Lippen. »Was ist passiert?«
Sein Vater hob kurz den Blick, seine Augen waren dunkel, wie erloschen. Er deutete hinter sich, in das Gartenhaus, dessen Tür offen stand.
Faller schob sich an ihm vorbei, legte ihm dabei kurz die Hand auf die knochige Schulter und betrat dann das Gartenhaus. Es war vollkommen anders möbliert als noch vor drei, vier Jahren, als er zuletzt einen Blick hineingeworfen hatte. Das Häuschen hatte zwei kleine Zimmer, Strom und sogar einen Wasseranschluss gab es. In den dreißiger Jahren mochte eine Hausangestellte hier gewohnt haben.
Die Frau bemerkte er nicht sofort, er roch jedoch das Blut, bevor er sie sah. Vor der Spüle lag sie auf dem Boden, rabenschwarze Haare, eine weiße Leinenbluse, die voller Blut war, dazu ein roter, mittellanger Rock. Ihre Beine waren von der Sonne gebräunt. Wie alt sie sein mochte, war nicht zu erkennen. Keine ganz junge Frau jedenfalls. Ihre Füße waren nackt.
Was machte eine tote Frau im Gartenhaus seines Vaters?
Unvermittelt war der Professor neben ihm. Sein Mund zitterte. Er atmete stoßweise, wie nach einer viel zu großen Anstrengung.
»Sie hat am Boden gelegen …« Er brachte die Worte nur stockend hervor. »Ich habe das Blut gesehen, habe mich über sie gebeugt, und da … Ich habe gedacht, sie ist tot, aber sie hat plötzlich die Augen aufgeschlagen und dann … Sie muss gedacht haben, dass ich sie angegriffen habe, dass ich … Mit letzter Kraft hat sie nach dem Messer gefasst und hat versucht … Ich musste ihren Arm umfassen, musste ihr das Messer aus der Hand nehmen …« Sein Vater schluchzte plötzlich auf. »Ich habe ihr nichts getan. Wird man mir das glauben?«
Der Professor schaute ihn mit seinen wasserblauen Augen an, die nun ganz trüb und dunkel waren.
Wie dünn sein graues Haar geworden ist. Dieser absurde Gedanke überfiel Faller.
»Es hört sich unglaublich an, nicht wahr?« Das Kinn seines Vaters bebte wieder.
Ja, hätte Faller ihm beinahe recht gegeben. Das hörte sich unglaublich an. Stattdessen fragte er: »Wer ist diese Frau überhaupt? Und wie kommt sie hierher?«
»Das ist Blanche, die Sängerin. Kennst du sie nicht? Sie war früher einmal meine Studentin – Maria Derkum heißt sie in Wahrheit.« Die Stimme seines Vaters klang ein wenig gefasster.
»Und warum war sie hier?« Faller schob seinen Vater zurück. Der metallische Geruch von Blut, der sich ausbreitete, setzte ihm zu.
»Sie ist krank und wollte in Köln noch eine Platte aufnehmen«, sagte sein Vater, als wäre das eine ausreichende Erklärung.
Warum hast du nicht sofort die Polizei gerufen? Diese Frage ging Faller durch den Kopf. Früher hatte sein Vater ihm solch inquisitorische Fragen zu allen möglichen Dingen gestellt, aber natürlich wusste er, warum Herbert Faller ihn, seinen im Grunde nichtsnutzigen Sohn, angerufen hatte. Sein Vater hatte das Messer angefasst, er war voller Blut …
»Was sollen wir jetzt tun?« Unsicherheit und Angst schwangen in der Stimme eines Vaters.
Gleich sinkt er zusammen, dachte Faller ohne Mitleid.
Mittlerweile war die Sonne herausgekommen – ein schöner Juniabend brach an. Warmes Licht fiel durch die hohen Bäume, die das Grundstück begrenzten und vor Blicken schützten.
Was sollte diese Frage? Hatte sein Vater etwa überlegt, die Leiche verschwinden zu lassen? Sollte er ihm dabei helfen, einen Mord zu verheimlichen, indem sie eine tote Frau irgendwo vergruben? Ein Gedanke, den er gar nicht zu Ende denken wollte …
»Wie lange ist diese Frau hier bei dir?«, fragte Faller, während er sein Smartphone hervorzog.
»Seit fünf Wochen und sechs Tagen.«
Faller schaute den Professor beinahe vorwurfsvoll an. Aber nein, wieso sollte er ihm vorwerfen, dass er nichts davon gewusst hatte?
»Wir machen Folgendes«, sagte Faller. »Wir rufen die Polizei an. Ich frage meinen Freund Brasch, der war früher Polizist, an wen wir uns am besten wenden. Und dann ziehen wir einen Anwalt hinzu. Hast du einen guten Anwalt?«
Sein Vater nickte, und fast hätte er ihn umarmt, doch dann bemerkte er im letzten Moment, wie blutig sein Hemd und seine Hände waren.
3
Sein Vater war der Grund gewesen, warum er sich niemals hatte vorstellen können, zu studieren, nicht in Köln, aber auch nicht an einem anderen Ort, wo man den Literaturprofessor Dr. Herbert Faller nicht kannte. Schon in der Schule hatten die Lehrer ihm Vorhaltungen gemacht: »Bist du nicht der Sohn vom Uni-Faller?« – »Weiß dein Vater davon, was du hier für einen Unsinn erzählst?« – »Ihr müsst doch das Haus voller Bücher haben – warum interessierst du dich dann nicht für Literatur?«
Nur eine Lehrerin – die blonde, kurzhaarige Frau Dombrowski, die einige für eine Lesbe hielten – hatte begriffen, warum er sich lieber auf Sport und Biologie konzentrierte. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte er nicht einmal das Abitur geschafft. Sein Vater hatte damals schon aufgegeben, ihn für eine Karriere an der Universität zu begeistern. »Wenn du so weitermachst, kannst du noch Pferdewirt in der Eifel werden« – so hatte einer seiner ständig wiederkehrenden Sprüche gelautet.
Trotzdem war er dann Journalist geworden – und er hatte sogar Kurzgeschichten geschrieben, die er Frau Dombrowski gezeigt hatte, aber niemals seinem Vater. Frau Dombrowski hatte ihm dann auch das Praktikum beim Stadt-Anzeiger vermittelt.
Und nun hatte er, als er kurz wieder das Haus betreten hatte, durch das Küchenfenster gesehen, wie sein stolzer, stets aufrecht gehender Vater geduckt in einem Polizeivan saß und verhört wurde.
Zuerst hatte er Brasch angerufen, der ihm geraten hatte, einen ganz gewöhnlichen Notruf abzusetzen und keinesfalls länger damit zu warten. Keine acht Minuten später war mit Blaulicht und Sirene der erste Streifenwagen vorgefahren. Vier Polizisten waren durch den Seitengang neben dem Haus in den Garten gestürmt. Nach weiteren dreißig Minuten war auch die gesamte Kavallerie der Polizei eingetroffen – so war es ihm erschienen. Zwei weitere Streifenwagen, zwei Vans und dann zwei Fahrzeuge in Zivil.
Eine gut aussehende Polizistin mit kurzen blonden Haaren hatte sich beiläufig vorgestellt. Sie hatte sich dann mit seinem Vater, dem man zwei durchsichtige Plastiktüten über die Hände geschoben hatte, vor das Haus zu einem Van begeben, der genau in der Garageneinfahrt parkte. Sie hieß Birte Jessen. Zu ihr hatte sich wenig später ein älterer Mann gesellt, ebenfalls ein Hauptkommissar. Sein Name lautete Rüdiger Köster. Seinem Akzent nach stammte er aus Köln. Er kümmerte sich um die Spurensicherung, beobachtete Faller von der Terrasse aus, wohin man ihn verbannt hatte, nachdem er sich als Sohn des Hauses ausgewiesen hatte.
Köster kam wieder vom Gartenhaus auf ihn zu. Er mochte Anfang fünfzig sein, trug ein abgewetztes blaues Jackett und eine grobe Hornbrille. Sein Haarschnitt wirkte so, als hätte ihm ein gänzlich untalentierter Friseur die strohblonden Haare genau einen Zentimeter unterhalb der Ohrmuschel abgesäbelt.
Köster bedachte ihn mit einem auffordernden Nicken und klappte ein schwarzes Notizbuch auf. »So«, sagte er. »Wir müssen den Ablauf einmal kurz durchgehen. Sie haben uns alarmiert, nicht wahr? Aber vorher hat Ihr Vater Sie angerufen?«
»Korrekt«, sagte Faller. Eine Bewegung hinter ihm im Haus irritierte ihn. Die blonde Polizistin kam heraus.
»Herr Faller«, sagte sie zu ihm. »Wir müssen Ihren Vater zur kriminaltechnischen Untersuchung mit auf das Präsidium nehmen. Es wäre hilfreich, wenn Sie sich dort auch in etwa einer Stunde einfinden könnten.«
Bevor Faller etwas erwidern konnte, hatte die Kommissarin wieder abgedreht.
Hauptkommissar Köster sah ihn an, dazu musste er sich immer wieder eine Haarsträhne aus der Stirn wischen. »Haben Sie eine Erklärung für das alles?« Er machte eine Bewegung, die sowohl die Terrasse als auch den Garten und das Gartenhaus umfasste.
Faller schüttelte den Kopf. »Nein«, erwiderte er.
Die ersten Spurensicherer, die in ihren weißen Anzügen wie verirrte Astronauten aussahen, zogen an zwei postierten Uniformierten vorbei und betraten das Gartenhaus. Zwei Scheinwerfer warfen ein grelles Licht hinein, als würde da ein Film gedreht werden.
»Ich habe keine Erklärung – ich kenne diese … Frau nicht, und mein Vater …« Er brach ab. Was wusste er überhaupt von seinem Vater? War diese Frau seine Geliebte gewesen? Hatte er schon früher Frauen in seinem Gartenhaus wohnen lassen?
»Ihr Vater war Professor, nicht wahr?« Kösters Augen hinter der Hornbrille funkelten ihn an. »Ein honoriger Mann – trauen Sie ihm einen Mord zu?«
Faller zögerte, obschon ihm eine innere Stimme sagte, dass er keineswegs zögern sollte. »Nein«, sagte er dann, »eigentlich nicht.«
Köster zog eine Augenbraue in die Höhe und wischte sich dann wieder eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Eigentlich nicht?«
»Nein«, sagte Faller dann, »ich traue meinem Vater keinen Mord zu. Er ist kein wirklich warmherziger Mensch, aber dass er mit einem Messer eine Frau …«
Er zuckte mit den Achseln. Die äußerste Gewalt, die er von seinem Vater erlebt hatte, war, wenn er mit zusammengekniffenen Augen und schneidender Stimme gesprochen hatte. Und einmal, als ihr Krebs schon weit fortgeschritten war, hatte Faller gesehen, wie sein Vater seiner Mutter eine Zigarette aus dem Mund gerissen und mit einer heftigen Bewegung in einem Aschenbecher ausgedrückt hatte. Aber an der Universität war er gefürchtet gewesen, wie sich sogar bis in die Redaktion des Stadt-Anzeigers herumgesprochen hatte. Eugen Pohl, der Feuilletonchef, hatte bei ihm studiert und wäre in der mündlichen Prüfung beinahe durchgefallen, weil ihm nichts zu Brechts Theater eingefallen war – oder zumindest nicht das Richtige.
»Was ist mit Ihrer Mutter?«, fragte Köster. Wieder legte sich eine Haarsträhne vor seine Augen. Er klang nun gleichmütig, gar nicht sonderlich interessiert. Im nächsten Moment grüßte er eine Frau mit dunkelrot gefärbten Haaren, die durch den Seiteneingang in den Garten kam und sich kurz orientieren musste, um dann auf die Tür des Gartenhauses zuzuhalten. In ihrem Schlepptau trugen zwei Männer einen Zinksarg heran. Vermutlich die Rechtsmedizinerin, schätzte Faller.
»Meine Mutter starb vor über dreißig Jahren«, sagte Faller.
»Und seitdem lebt Ihr Vater hier allein?« Köster machte sich eine Notiz. Ein Hauch Erstaunen schwang in seiner Stimme mit.
Faller nickte. »Zwei Jahre war mein Vater an einer Uni in den USA und ein Jahr in Berlin an einem Kolleg, aber sonst war er immer hier – allein mit seinen Büchern.«
Er registrierte, dass sein Smartphone summte. Julia, dachte er, konnte sie schon gehört haben, was passiert war? Aber als er auf das Display blickte, leuchtete Braschs Nummer auf.
Im nächsten Moment erklangen laute Stimmen von der Garageneinfahrt.
»Lasst mich durch!«, rief eine jüngere Männerstimme. »Was ist hier los? Ist sie tot, die Hexe?«
Dann stürmte ein schwarzhaariger Mann in einer schwarzen Lederjacke an dem Haus vorbei in den Garten. Zwei Polizisten folgten ihm und warfen ihn zu Boden, bevor er das Gartenhaus erreichen konnte.
»Ich will sie sehen.« Die Stimme des Mannes klang gedämpft, weil ihn der größere der beiden uniformierten Polizisten zu Boden drückte.
Köster hatte sich von Faller gelöst und lief über den Rasen auf den Mann zu, der dann auf die Beine gezerrt wurde. Der jüngere Uniformierte hatte sogar seine Waffe gezogen.
Der Eindringling blickte Köster wütend an. Er mochte Mitte dreißig sein, er trug einen Dreitagebart, eine goldene Kette baumelte um seinen Hals.
»Wer sind Sie?«, fragte Köster. Mit einer Kopfbewegung forderte er den jüngeren Polizisten auf, seine Waffe wieder einzustecken.
Der Mann blickte zum Haus hinüber. »Sie ist tot?«, sagte er. »Nicht wahr? Hat der alte Professor sie umgebracht? Oder hat sie sich selbst getötet?«
Köster packte den Mann am Kragen seiner Lederjacke. So viel Energie hatte Faller, der alles gebannt beobachtete, ihm gar nicht zugetraut.
»Wer sind Sie?«, fragte er erneut.
Der Blick des Mannes irrte nun durch den Garten, als suche er etwas. »Für Schönheit hat sie immer einen Sinn gehabt«, sagte er, nun viel leiser. »Sie konnte nicht nur auf eine ganz besondere Art singen, sondern sie hat sich wie eine Königin angezogen. Alle Männer haben sich in sie verliebt. Aber eigentlich hat sie sich nur für sich selbst interessiert …« Plötzlich lachte der Mann auf. »Ich wette, sie hat sich umgebracht – aber ganz auf die melodramatische Weise. Deshalb sind Sie alle hier, nicht wahr? Der große inszenierte Abgang von Blanche.« Wieder ein Lachen, diesmal hohl und unecht. Der Blick des Mannes glitt zu Köster zurück. »Sie wollen wissen, wer ich bin? Ich bin ein Niemand, ein Nichts – und außerdem der Sohn der wunderbaren Blanche.«
4
Sie hatte eigentlich ein paar Tage Urlaub nehmen wollen, um nach Hamburg zu fahren, ihre Lieblingsstadt, wo sie lange gelebt hatte, danach weiter an die Nordsee auf eine Insel. Keine Autos, kein Stress, kein Nachdenken über ihre Beziehung zu Max.
»Wie alt bist du eigentlich?«, hatte er sie kürzlich gefragt, und sie hatte genau gewusst, worauf er hinauswollte. Trotzdem hatte sie sich offenbar dumm gestellt.
»Ich werde siebenunddreißig«, hatte sie geantwortet, kein Wort mehr.
Max hatte auch nichts gesagt – nicht: Mit siebenunddreißig sollte frau wissen, ob sie ein Kind will oder nicht.
Vor zwei Tagen hatte er sich mit seinem Fahrrad aufgemacht, um nach Santiago de Compostela zu fahren. Gehen konnte er die Strecke von Köln leider nicht – er war ein vielversprechender Triathlet gewesen, bis ihn vor Jahren, als sie sich noch nicht gekannt hatten, bei einer Trainingsfahrt ein Lastwagen angefahren hatte und ihm der rechte Unterschenkel hatte amputiert werden müssen.
Mit dem Fahrrad jedoch würde Max es schaffen. Schließlich war er eine Zeit lang Fahrradkurier gewesen, ehe er einen Roman veröffentlicht hatte, der aber dann furchtbar gefloppt war. Zuletzt hatte ihn ein anderer Verlag in Köln beschäftigt, für den er Lesungen organisierte und den Instagram-Account betreute.
Am ersten Tag war Max bis nach Trier gekommen – über hundertsechzig Kilometer und trotz etlicher Steigungen ohne große Mühe, wie es schien.
Aber ihre Urlaubspläne hatte sie über den Haufen werfen müssen – als genau um achtzehn Uhr vierzehn der Anruf kam, dass in Marienburg eine Leiche gefunden worden war. Obendrein hatte Rolf Dauner, der Oberstaatsanwalt, den Fall an sich gezogen, nachdem bekannt geworden war, dass ein namhafter, allerdings bereits emeritierter Literaturprofessor der erste Tatverdächtige war.
»Geben Sie mir genau Bericht, Frau Hauptkommissarin Jessen«, hatte Dauner sie am Telefon aufgefordert. Sie mochte ihn nicht sonderlich, er galt als der George Clooney der Staatsanwaltschaft, stets ein wenig zu elegant gekleidet, eitel, pseudocharmant und, zugegeben, gut aussehend, obwohl er schon über sechzig war, und angeblich hatte er auch politische Ambitionen, für den Fall, dass die Oberbürgermeisterin amtsmüde geworden war und nicht noch einmal antreten wollte.
»Dauner wird sich nicht groß kümmern«, hatte ihr Kollege Köster gesagt, der sie in dem Fall unterstützen sollte. »Nur bei der Pressekonferenz möchte er unbedingt direkt vor dem Mikrofon sitzen. Darauf musst du achten.«
»Alles klar.« Birte Jessen hatte abgewinkt.
Die Tote war eine einundsechzigjährige Frau – Maria Derkum; sie war Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre unter dem Namen Blanche als Sängerin bekannt gewesen. Mit einem Partner, der sich seltsamerweise »Rubikon« genannt hatte, hatte sie eine Band mit dem Namen »Klangbreite« gehabt. Zwei, drei Songs waren auch in den Charts gelandet. Konnte man alles auf Wikipedia lesen und auf YouTube nachhören, wenn man wollte.
Über den ersten Tatverdächtigen stand ebenfalls einiges im Netz. Professor Dr. Herbert Faller, Experte für expressionistische Literatur, dazu Rilke-Biograf, Berater der Landesregierung in Schul- und Kulturfragen, Jurymitglied für den Heinrich-Böll-Preis und so weiter.
Nach einer kurzen Vernehmung hatte Birte Jessen ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium bringen lassen. Herbert Fallers Hände waren voller Blut gewesen; angeblich hatte Maria Derkum sich schwer verletzt noch einmal aufgerichtet, weil sie ihn für ihren Angreifer gehalten hatte, als er in das Gartenhaus gekommen war, das ihm gehörte.
Konnte man glauben oder auch nicht. Hoffentlich würde Dr. Grams, die Rechtsmedizinerin, ihnen dazu etwas sagen können.
Keine Stunde hatte Birte sich am Tatort aufgehalten. Nach all den Jahren machte es ihr immer noch Schwierigkeiten, sich Leichen anzuschauen und sich dieser besonderen, düsteren Atmosphäre eines Ortes auszusetzen, an dem etwas ganz und gar Grausliches geschehen war. Denn es stimmte: Diese Orte veränderten sich durch eine Bluttat; es war, als würde das Licht hier anders scheinen, als würden sich Geräusche verändern, Stimmen, selbst geflüsterte, anders klingen. Zum Glück gab es Fotos, farbig, schwarz-weiß, auch Infrarotaufnahmen, auf denen man einiges erkennen konnte.
Die Sonne ging irgendwo über dem Rhein unter, konnte Birte von ihrem Fenster im Polizeipräsidium sehen. Kurz überlegte sie, Max eine Kurznachricht zu schreiben. Wie geht es dir – wie kommst du voran? Etwas eher Freundlich-Belangloses, doch da trat Köster ein und ging gleich an die Kaffeemaschine.
»Wo ist der Professor?«, fragte er, ohne eine Begrüßung. Seine Laune war offenbar ziemlich im Keller.
»Er wird untersucht«, sagte Birte. »Er wird uns aber noch einmal vorgeführt. Hast du seinem Sohn ausgerichtet, dass er seinem Vater ein paar Anziehsachen mitbringen soll?«
Köster wischte sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Ein Tick von ihm, der aber durch seine schreckliche Frisur begünstigt wurde. Ständig musste er einen zerfransten Vorhang aus Haaren beiseiteschieben. Geh mal zum Friseur und lass dir einen anständigen Haarschnitt machen, hätte Birte ihm am liebsten am ersten Tag gesagt, als er in ihre Abteilung kam, doch dann war sie gewarnt worden. Irgendein unbekannter Rockstar, der vor etlichen Jahren gestorben war und den Köster verehrte, hatte eine ähnliche Frisur gehabt.
»Der Sohn sitzt draußen und wartet auf seinen Vater. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er eine Plastiktüte mit Kleidung dabei«, sagte Köster. »Der Anwalt vom Professor ist auch da – ein eleganter Typ in einem Ledermantel.« Er nahm mit einem Kaffeebecher, auf dem das FC-Köln-Logo prangte, an seinem Schreibtisch Platz. »Das beste Verhältnis scheinen Vater und Sohn nicht gehabt zu haben. Aber draußen sitzt noch ein anderer Verdächtiger, den habe ich uns mitgebracht. Daniel Derkum, der Sohn der Toten … Er ist plötzlich aufgetaucht und hat einen Beamten niedergeschlagen, um in den Garten zu gelangen. Hast du wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen.«
Sie hob die Augenbrauen, während Köster sich wieder über die Stirn wischte. Nein, irgendeinen Aufruhr im Garten des Verdächtigen hatte sie nicht mitbekommen. »Wieso ist er verdächtig?«
»Vielleicht ist er nicht direkt verdächtig, aber ich finde es ungewöhnlich, die eigene Mutter als Hexe zu bezeichnen, und große Trauer hat der junge Mann auch nicht gezeigt.«
Der Mann, den sie in den Vernehmungsraum hatten bringen lassen, sprang auf, als sie eintraten. Er mochte Ende dreißig sein, war unrasiert und sah irgendwie wie ein Schauspieler aus. Jedenfalls kam Birte dieser Gedanke. Mit dunkler Miene blickte er sie an und hob die Hände, als wolle er sich ergeben.
»War nicht besonders schlau von mir, an den Ort des Verbrechens zurückzukehren, nicht wahr?« Er lachte auf.
Birte bedeutete ihm mit einer schnellen Geste, sich zu setzen. »Sie sind Daniel Derkum, der Sohn der Toten?«
»Daniel Derkum stimmt – und Sohn …« Er nahm Platz und lachte wieder. »Was stellt man sich unter einem Sohn vor? Oder besser – was stellt man sich unter einer Mutter vor?«
Köster legte ein Smartphone auf den Tisch. »Haben Sie etwas dagegen, wenn wir unser Gespräch aufnehmen?«
Nachdem Daniel Derkum mit einem Wink seine Zustimmung signalisiert hatte, sprach Köster laut und deutlich das Datum, die Uhrzeit und die Namen der Anwesenden. Dann blickte er Birte Jessen fragend an. Sie war hier die Chefin im Ring, verhieß sein Blick.
Doch bevor Birte etwas sagen konnte, hatte Derkum sich vorgebeugt. Seine braunen Augen schienen förmlich zu glühen. »Damit Sie es gleich wissen, es gibt eine Akte über mich. Ziemlich dick. Da ist eine Menge dabei – Drogen, Diebstahl, Fahren ohne Führerschein. Ich habe nicht viel ausgelassen. Einmal, da war ich siebzehn, bin ich sogar wegen Prostitution am Bahnhof verhaftet worden, doch an der Sache war nichts dran. Ein Stricher war ich nämlich nie, aber ein kleiner Dealer war ich. Lore hat mich nie in den Griff gekriegt, obschon sie sich alle Mühe gegeben hat.«
Birte wartete ein paar Sekunden ab, nachdem sein Redefluss versiegt war. »Wer ist Lore?«, fragte sie dann.
»Lore war meine Großmutter. Bei ihr bin ich aufgewachsen, tiefstes Bayenthal, drei Zimmer. Weil meine Mutter … Sie hatte anderes zu tun, als sich um mich zu kümmern.«
»Aber jetzt war Ihre Mutter zurückgekehrt«, entgegnete Birte.
»Ja«, sagte Derkum. »Sie ist allerdings nicht gekommen, um mich zu sehen, sondern …«
»Sondern?« Birte fixierte ihr Gegenüber.
Derkum atmete tief ein. Er zog eine zerknitterte Schachtel Zigaretten aus seiner Hosentasche und schaute sich dann nach einem Aschenbecher um.
»Nichtraucherzone – tut mir leid«, sagte Köster.
»Ist mir egal, warum sie zurückgekehrt ist.« Derkum warf die Schachtel vor sich auf den Tisch. »Wegen Musik, weil sie ein paar alte Freunde sehen wollte … Ach, im Grunde habe ich keine Ahnung, wieso sie plötzlich da war.«
»Aber Sie haben sich gesprochen?«
»Der alte Mann, bei dem sie einzogen ist, hat mich angerufen, und dann bin ich zwei Tage später hin und habe ihr gesagt, was für eine beschissene Mutter sie war.« Blanke Wut zeichnete sich in seinem Gesicht ab, die kein bisschen gespielt war – so kam es Birte vor.
»Sie sind achtunddreißig Jahre alt, nicht wahr?«, sagte Birte. »Aber Sie haben Ihrer Mutter nicht verziehen, dass sie sich nicht um Sie gekümmert hat?«
Derkum lehnte sich zurück. »Sollte ich mir auch einen Anwalt nehmen? Rede ich mich um Kopf und Kragen, wenn ich hier die Wahrheit sage? Ja, ich habe ihr nicht verziehen. Selbst als sie mit ihren Liedern eine Menge Geld verdient hat, hat sie Lore nichts gegeben, und wenn sie einmal vorbeikam, hatte sie kein Geschenk für mich. Deine Mami kommt morgen, hat Lore mir gesagt, und dann kam eine Frau, die mir über die Wange gestrichen hat, aber danach war ich Luft für sie. Dann ist sie los, zu irgendwelchen Leuten. Deals machen, so hat sie das genannt.«
»Wann haben Sie Ihre Mutter zuletzt gesehen, bevor sie wieder hier aufgetaucht ist?«, fragte Birte.
Derkum zog eine Zigarette aus der Schachtel und steckte sie sich kalt in den Mund, bevor er sich zurücklehnte. »Vor sieben Jahren, nachdem Lore gestorben ist. Sie hat es nicht einmal zur Beerdigung geschafft. Ich habe sie drei Tage später auf Melaten am Grab getroffen. ›Ich hasse Beerdigungen‹, hat sie mir gesagt. ›Bei Beerdigungen gibt es nur negative Energien.‹ Ich hätte ihr ins Gesicht schlagen können.«
Eine Pause trat ein. Nur eine Polizeisirene war zu hören. Mittlerweile war es draußen dunkel geworden.
»Doch Sie haben Ihre Mutter nicht ins Gesicht geschlagen«, sagte Birte. »Oder? Aber haben Sie heute am späten Nachmittag mit einem Messer auf sie eingestochen? Haben Sie Ihre Mutter umgebracht?«
Daniel Derkum kniff den Mund zusammen. »Nein«, flüsterte er dann. »Nein, das habe ich nicht. Ich habe sie zwar manchmal gehasst, aber … ja, ich habe sie auch geliebt.«
Im nächsten Moment wurde die Tür zum Vernehmungsraum geöffnet. Gül Mutlu, ihre neue Kommissaranwärterin, die gerade frisch von der Polizeischule Münster gekommen war, stürmte herein. »Sorry für die Störung, aber bei den Technikern ist was schiefgelaufen – der alte Mann, dieser Professor, hatte einen Herzanfall. Er ist auf dem Weg in die Uniklinik. Sie hoffen, dass er durchkommt.«
5
Sein Vater würde sterben. Dieser Gedanke drehte in seinem Kopf Kreise. An dem Tag, an dem in seinem Garten eine Frau ermordet worden war und die Polizei ihn vermutlich für den Täter hielt, würde Professor Herbert Faller an einem Herzanfall sterben.
Faller hielt noch immer die Plastiktüte mit Kleidung für seinen Vater im Arm, die er unter Aufsicht eines Uniformierten eilig zusammengesucht hatte, während er vor der Intensivstation der Uniklinik saß und wartete, dass ihm jemand eine Nachricht überbrachte. Clemens Reitmaier, der Anwalt seines Vaters, der dann doch noch gekommen war, hatte sich im Präsidium mit einer matten Entschuldigung von ihm verabschiedet. Augenblicklich könne er ja nichts mehr tun. Faller hatte nur genickt. Anschließend hatte er sich einige Minuten sammeln müssen, bevor er in die Uniklinik hatte fahren können.
Als sich die Tür zur Intensivstation öffnete, erwartete er einen Arzt oder eine Pflegerin, doch zu seiner Überraschung trat die blonde Kommissarin heraus, die mit seinem Vater ins Präsidium gefahren war.
Birte Jessen reichte ihm die Hand. »Tut mir leid – das Ganze.« Ein schwaches Lächeln folgte diesen Worten. Ein sanfter Glanz lag auf ihren Lippen, bemerkte Faller. »Ihr Vater hatte einen Herzstillstand«, sprach sie weiter. »Die Kollegen im Präsidium haben zum Glück schnell reagiert. Die Ärzte …« Sie verstummte für einen Moment. »Sie sind optimistisch, dass sie Ihren Vater retten können.« Mit einer fließenden Bewegung setzte die Kommissarin sich neben ihn. »Sie werden verstehen … Wir müssen natürlich weiterermitteln … und Ihr Vater …« Sie brach ab, weil die Tür sich öffnete; aber nur ein junger Mann in einem weißen Kittel eilte heraus, ohne sie zu beachten.
»Sie halten meinen Vater für den Täter, nicht wahr?«, sagte Faller. »Dieser Herzanfall ist so etwas wie ein Beweis für Sie, dass er sich durch die Tat in eine Stresssituation gebracht hat.«
»Nein.« Die Kommissarin schaute ihn an. Die winzigen Falten unter ihren blaugrünen Augen kräuselten sich. Sie war eine wirklich schöne Frau. Ein Gedanke, den er sofort beiseiteschob. »Nein, dieser Herzanfall beweist gar nichts. Ihr Vater hat die Tote gefunden, das war möglicherweise Stress genug. Selbstverständlich können wir nicht ausschließen, dass er der Täter ist. Die Blutspuren … Er hatte auch eine leichte Verletzung an der Hand. Andererseits …« Ein Telefon summte. Es war das Smartphone der Polizistin, wie Faller erkannte, doch sie nahm das Gespräch nicht an, sondern blickte lediglich auf das Display. »Andererseits war Ihr Vater schwer herzkrank. Der Herzschrittmacher …«
»Mein Vater hatte einen Herzschrittmacher?«, warf Faller überrascht ein.
Die Kommissarin blickte ihm in die Augen. »Das wussten Sie nicht? Seit acht Jahren hat Ihr Vater einen Schrittmacher und …« Sie zog einen Notizblock, wie ihn auch ihr Kollege gehabt hatte, aus der Tasche ihrer rotbraunen Lederjacke. »Außerdem hatte er nach einer Coronaimpfung Herzbeschwerden und war deshalb Anfang Februar zwei Wochen in einer Klinik in der Eifel.«
Faller konnte nicht sofort antworten. Ich kenne meinen Vater überhaupt nicht, fiel ihm ein. Er war immer ein Fremder in meinem Leben. »Mein Vater war ein verschwiegener Mensch«, sagte er dann. »Und wir hatten nicht den besten Kontakt.«
Birte Jessen nickte, während sie eine Nachricht auf ihrem Smartphone las. »Können Sie morgen um zehn Uhr ins Präsidium kommen? Wir benötigen ein paar Informationen über Ihren Vater. Und auch über Sie selbst. Schließlich waren Sie ja auch am Tatort, vor der Polizei. Und Sie sind Journalist, wenn ich richtig informiert bin. Sie sollten uns aber die Kommunikation überlassen. Falls wir uns verstehen.«
Sie erhob sich und wandte sich um. Dann jedoch drehte sie sich noch einmal um. »Ihr Vater scheint wirklich ein interessanter Mensch und Gelehrter zu sein, aber wie ist es dazu gekommen, dass er Freimaurer ist? Ich dachte, so etwas hätte es nur im Mittelalter gegeben.«
Der Kaffee in der Cafeteria der Klinik schmeckte bitter. Von einem Fenster im Gang aus konnte man den Dom vor dem Nachthimmel sehen. Faller wartete noch zwei Stunden, in denen ihm niemand Genaueres über den Zustand seines Vaters sagen konnte. Dann fuhr er nach Hause.
Es war kurz nach Mitternacht. Er wurde von einem lauten schrillen Kläffen begrüßt. Monday – das Hündchen. Er hatte ganz vergessen, dass da ein Hund auf ihn wartete. Monday sprang jaulend an ihm hoch und rannte dann zur Tür. Klar, der Hund musste pinkeln, falls er nicht schon in der Küche seine Notdurft verrichtet hatte. Die Tür zum Atelier war zum Glück geschlossen gewesen.
Faller ging mit dem Hund in den winzigen Park um die Ecke. Der Hund hatte sich ein wenig beruhigt. Als Erstes pinkelte er einen schwarzen Porsche an, der ein Stück weiter in der Straße parkte.
Vor dem verwilderten Rasenstück setzte Faller sich auf eine Bank, während der Pudel die Gegend abschnüffelte. Er hatte Brasch und Julia eine kurze Nachricht geschrieben. Brasch hatte einen Auftrag, weswegen er in Bonn unterwegs gewesen war, und Julia hatte ein längeres Interview mit einem Musiker gehabt, der vielleicht bei ihnen in ihrer Diskussionssendung auftreten würde.
»Melde dich bitte«, hatte sie daher nur geschrieben. »Hoffe, dein Vater kommt durch.«
Mein Vater, der herzkranke Freimaurer …
Faller hatte das Bedürfnis, aufzuspringen und nach Marienburg zu fahren, um das Haus zu durchsuchen, Zimmer für Zimmer, Stockwerk für Stockwerk. Der Detektiv in eigener Sache, der nach der wahren Identität seines Vaters suchte. Er zog die Visitenkarte hervor, die ihm die Hauptkommissarin in die Hand gedrückt hatte.
Obschon es kurz vor ein Uhr war, meldete sie sich nach dem zweiten Klingeln.
»Wann kann ich in das Haus meines Vaters?«, fragte Faller ohne Begrüßung. »Kann ich da sofort hinfahren? Ich habe noch einen Schlüssel.«
Die Kommissarin atmete tief ein. Faller erwartete einen Vorwurf, warum er sie um diese Zeit noch störe, wo sie sich doch vor Kurzem noch gesehen hatten, doch Birte Jessen sagte: »Wir werden uns bei Ihrem Vater im Haus noch länger aufhalten müssen. Aber ich denke, morgen Nachmittag werden Sie in das Haus können. Sie wollen sich dort umsehen, wollen einiges über Ihren Vater erfahren, was Sie nicht gewusst haben?« Sie hielt kurz inne, als würde sie eine Antwort erwarten. Einen Atemzug später fuhr sie fort: »Dann können Sie uns unterstützen. Auch wenn Sie nicht wirklich über Ihren Vater Bescheid wissen, so kennen Sie ihn doch besser als wir. Also, schauen Sie sich ab morgen Nachmittag um und halten Sie mich auf dem Laufenden. Wichtige Gespräche nehme ich übrigens auch vor ein Uhr in der Nacht entgegen.« Dann legte sie auf.
Das Hündchen kam auf ihn zugelaufen. Mit einem Satz sprang es neben ihn und begann, ihm die Hand zu lecken, in der er sein Smartphone hielt.
»Monday.« Der Pudel schaute mit seinen braunen Augen zu ihm auf. »Was für ein besonderer Tag! Bist du deshalb zu mir gekommen? Weil es bei mir so aufregend ist?«
Der Hund leckte ihm weiter über die Hand, als sein Smartphone summte.
Rief ihn die Kommissarin zurück? Fast erwartete er, ihre Stimme zu hören, doch es war eine andere Frauenstimme, die sich meldete.
»Anna hier«, sagte die Stimme. »Du bist noch wach, Faller – wie schön! Wir haben uns länger nicht gesprochen. Wie du vielleicht weißt, arbeitete ich hin und wieder für den Stadt-Anzeiger, und da hat man mir zugetragen, was bei deinem Vater passiert ist und …«
Faller lächelte. In Anna war er vor vielen Jahren verliebt gewesen, als er noch ein ordentlicher Redakteur bei der ordentlichsten Zeitung Kölns gewesen war, und auch sonst hatten sie einiges miteinander zu tun gehabt. Sie hatten sogar zusammen ein Buch über den Verfassungsschutz geschrieben, das leider nirgendwo besprochen worden war, und bis vor Kurzem hatte es noch so ausgesehen, als wäre Annas Tochter von ihm.
»Anna, was weißt du genau? Und was willst du von mir wissen?«
»Wir wissen, dass bei deinem Vater ein Mord passiert ist … Wir wissen nicht genau, wer das Opfer ist. Es gibt Gerüchte, aber nicht mehr.«
»Ihr wisst also bescheiden wenig, daher hat Winterfeld, unser liebster Chefredakteur, dich reaktiviert?«
Faller konnte hören, wie Anna tief einatmete. »Du sagst es, Faller. Er hat gedacht, wir beide stehen wieder auf gutem Fuße und …«
»Ich kann dir nichts sagen, Anna. Nur das: Mein Vater hat keinen Mord begangen. Er hatte einen Herzstillstand und liegt in der Uniklinik. Ich hoffe, er überlebt die Nacht.«
Gegen halb fünf wurde er wach, weil er ein Kratzen und Schaben hörte, das er zuerst überhaupt nicht einordnen konnte. Dann hörte er ein leises Jaulen. Monday stand am Fuß der Treppe, die zu seinem Hochbett hinaufführte. Er begann noch lauter zu jaulen, als er bemerkte, dass Faller zu ihm hinunterschaute.





























