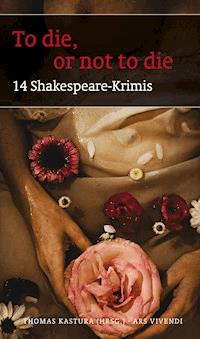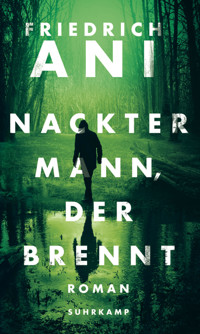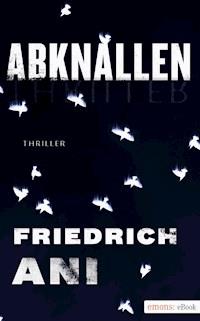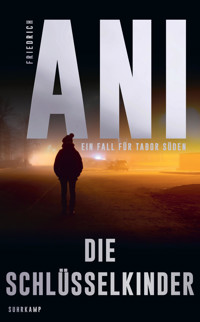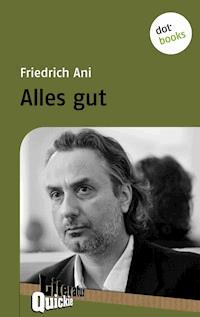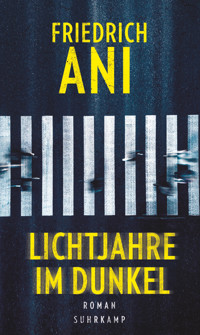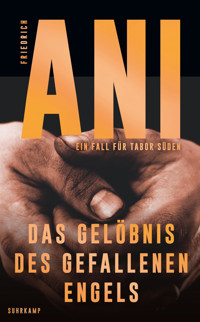11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
Johann Farak, 41, Sohn eines Ägypters, ist verschwunden. Doch außer seiner Schwester scheint ihn niemand zu vermissen. Er war ein Trinker, heißt es, er hat auf Holzbretter Bilder gemalt, die nichts taugen, sagen die Leute. Dann taucht eine geheimnisvolle junge Frau auf – und Kommissar Tabor Süden begreift plötzlich, was für ein trauriges Leben Johann Farak bisher geführt hat und dass er vielleicht gar keine Wahl hatte, als dieses Leben hinter sich zu lassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Friedrich Ani
Die Frau mit dem harten Kleid
Ein Fall für Tabor Süden
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5344.
Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln
Umschlagfoto: DEEPOL by plainpicture
eISBN 978-3-518-77577-6
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Informationen zum Buch
Die Frau mit dem harten Kleid
Ich arbeite auf der Vermisstenstelle der Kripo und kann meinen eigenen Vater nicht finden.
Tabor Süden
1
Dies ist die Geschichte von Johann Farak, deinem Vater, von dem du nichts wusstest. Auch ich weiß wenig von ihm, und was ich über ihn erfahren habe, beruht auf Aussagen von Leuten, die ihn zwar gekannt, aber selten ernst genommen haben, die meisten hielten ihn für einen Spinner, einige für einen Versager, andere für einen Alkoholiker. Ich halte ihn für einen Lebenskünstler, der gescheitert ist, und das ist in meinen Augen keine Schande.
In dem Bericht, den ich dir schicke, tauchen Menschen auf, die dir vollkommen unbekannt sein mögen, die aber dennoch Teil deines Lebens sind, auch wenn du sie nie bewusst wahrgenommen hast. Einigen von ihnen bist du begegnet, hast mit ihnen gesprochen, flüchtig, wie man mit jemandem spricht, den man nach dem Weg fragt oder im Gasthaus um die Speisekarte bittet und sich dabei nach dem Gericht erkundigt, das der andere gerade isst.
Ich kam mit ihnen als Sachbearbeiter im Fall der Vermissung deines Vaters in Kontakt, und manches von dem, was sie schilderten, verwendete ich für meine offiziellen Akten, vieles davon nicht. Dies steht nun auf den folgenden Seiten. Natürlich hätte ich, obwohl du mir das verboten hast, versuchen können, dich zu treffen und dir die Geschichte zu erzählen. Aber ich weiß nicht einmal, ob ich so lange hätte sprechen wollen. Ich bezweifele es. Zu schweigen fiel mir immer schon leichter, als zu sprechen, und das Briefeschreiben ist eine gute Möglichkeit, beides gleichzeitig zu tun.
Dieser Bericht enthält also die Geschichte deines Vaters aus der Sicht von Personen, die ihm nahestanden, ohne dass er selbst, so scheint mir heute, besonderen Wert auf ihre Nähe gelegt hätte. Vor allem schildere ich dir meine eigenen Beobachtungen und Vermutungen und Interpretationen. Der Grund, warum ich in den vergangenen zwei Wochen jede Nacht an dem Tisch in meinem Zimmer mit den gelben Wänden saß und schrieb, war: Ich wusste nicht, wohin mit diesen Erzählungen von Fremden, die um einen Mann kreisten, der mir nicht fremd ist, obwohl ich ihn so wenig kenne wie du. Vielleicht begreifen wir auf diesem Weg beide, worum es Johann Farak in diesem Leben ging, auch wenn es, glaube ich, nicht die geringste Rolle spielt, ob wir es begreifen oder nicht. Aber immerhin bist du seine Tochter und der einzige Mensch in eurer zerrissenen Familie, der die Tapetentür nicht nur bemerkt, sondern sogar geöffnet hat.
Die Polizeidienststelle in Münzing liegt in einer Seitenstraße gegenüber einer Bäckerei, was günstig war, da meine Kollegin Sonja Feyerabend vor der Fahrt aufs Land von nichts anderem gesprochen hatte als davon, dass ihr am Morgen nicht vergönnt gewesen war, in Ruhe ihren Kaffee auszutrinken. Sie hatte verschlafen und um acht Uhr einen Termin beim Zahnarzt, und bevor sie die Wohnung verließ, erhielt sie einen Anruf vom Leiter unseres Kommissariats, der ihr eine aktuelle Änderung im Dienstplan mitteilte. Anschließend musste sie beim Zahnarzt wegen eines Notfalls dreißig Minuten warten, umplärrt von zwei ihrer Meinung nach hyperneurotischen kleinen Kindern, die, wie Sonja vermutete, möglicherweise eine taube Mutter hatten. Diese habe ungerührt zwanzig Illustrierte gelesen, von denen sie jede Seite in atemberaubender Geschwindigkeit und mit einem Höchstmaß an Rascheln umblätterte. Und als Sonja wieder gehen wollte, erklärte ihr die Sprechstundenhelferin so laut, dass ihre Stimme in dem Vorraum widerhallte, einen neuen Termin könne sie allenfalls in drei Wochen bekommen.
Mit Sonja Feyerabend nach Münzing zu fahren war ein spezielles Vergnügen.
Nachdem wir am ersten Café im Dorf vorbeigefahren waren, wollte sie impulsiv wenden. Im letzten Moment bemerkte sie auf der Gegenfahrbahn einen Mopedfahrer.
Ich saß auf der Rückbank hinter dem Beifahrersitz und hielt Ausschau nach dem blauen Schild der Dienststelle. Wir fanden sie schnell. Und Sonja sah die Bäckerei und hinter den Fenstern die weißen Stehtische und klatschte wie ein glückliches Mädchen in die Hände.
»Und jetzt erzählen Sie«, sagte sie. Die erste Tasse hatte sie wortlos getrunken, dazu aß sie ein Croissant, danach noch ein zweites. Wir bestellten beide einen weiteren Kaffee. Auch auf der Fahrt hatte sie, abgesehen von einer Frage auf der Autobahn, den Mund nicht aufgebracht.
»Die nächste raus?«
»Die übernächste.«
Das Schweigen hatte mich nicht gestört, wie du dir denken kannst.
»Seine Schwester hat ihn als vermisst gemeldet«, sagte ich und sah hinüber zu dem flachen Gebäude, in dem die Polizei untergebracht war. Auf einem DIN-A4-Blatt hatte ich mir Notizen gemacht, außerdem hatte ich eine Kopie der VVA dabei, der vorläufigen Vermisstenanzeige, die die Kollegen in Münzing aufgenommen hatten. Da dein Vater seit ungefähr fünfzehn Jahren in der Landeshauptstadt lebte, gehörte der Fall zu unserem Dienstbezirk, andererseits war er in Münzing aufgewachsen und hatte hier nach wie vor offiziell seinen zweiten Wohnsitz. Wir hätten keinen Anlass gehabt, am selben Tag, an dem uns die Kollegen die Anzeige per Mail übermittelten, aufzubrechen, um eigene Recherchen anzustellen, wenn Polizeiobermeisterin Susanne Berkel nicht angerufen und uns eindringlich gebeten hätte zu kommen. Gemeinsam mit einem Kollegen hatte sie die aufgeregte und verweinte Frau an diesem Morgen vernommen. Und sie sei, erklärte Susanne Berkel am Telefon, überzeugt, dass die Frau, auch wenn sie angetrunken und verwirrt gewesen sei, die Wahrheit gesagt habe.
»Wie heißt die Frau?«, fragte Sonja Feyerabend.
»Mathilda Ross.«
»Wieso ist sie sich so sicher, dass ihr Bruder verschwunden ist?«
»Sie hat heute Geburtstag, angeblich ruft er jedes Jahr morgens um sieben bei ihr an, um zu gratulieren.«
»Ist das ein Witz?« Sonja warf einen Blick zur Theke, wo reihenweise frisches Gebäck lag.
Ich hatte nur Kaffee getrunken, doch je länger ich dorthin sah, desto hungriger wurde ich. »Das ist kein Witz.«
»Das ist doch kein Grund, jemanden als vermisst zu melden.« Sie wurde ungehalten und glaubte, wir seien nur wegen der Launen einer Frau, die morgens um acht betrunken war, und einer übereifrigen Kollegin vierzig Kilometer weit gefahren.
Zu allem Überfluss kamen in diesem Moment drei Schulkinder in die Bäckerei, die sich leidenschaftlich anschrien.
»Du hast überhaupt nix kapiert, du blöder Depp.«
»Du auch nicht.«
»Ich krieg aber von meiner Mama noch fünf Euros und dann kauf ich mir die Böller.«
Mit ihren Rucksäcken rempelten sie Sonja an und schrien ihre Bestellung über die Theke.
»Eine Breze.«
»Für mich auch!«
»Und für mich auch.«
Sonja setzte sich ihre schwarze Lederschirmmütze auf und verließ eilig den Laden.
»Wiedersehen«, sagte ich zu der Verkäuferin, nachdem ich bezahlt hatte.
Draußen war es kalt, ein schneeiger Wind wehte. Kein Funken Sonne.
Ich lief Sonja hinterher.
»Der Mann hat Selbstmordabsichten«, sagte ich.
»Ah ja?«
»Die Kollegin sagt, sie glaubt der Schwester.«
»Ich nicht.«
An diesem Freitag wären die Menschen, die Sonja Feyerabend über den Weg liefen, vermutlich besser zu Hause geblieben.
Bevor ich die Klingel an der Tür der Inspektion drückte, nahm ich Sonjas Hand und legte sie an meine Wange, kalt auf kalt.
»Sie sollten sich mal rasieren«, sagte sie.
Wie es in der Polizeidienstvorschrift heißt, gilt eine Person als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen hat und ihr Aufenthalt unbekannt ist. Handelt es sich um Kinder, Jugendliche, verwirrte oder kranke Menschen, leiten wir sofort eine Fahndung ein. Bei Volljährigen, die verschwunden, aber nicht hilflos oder psychisch labil sind, muss eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bestehen, sonst sind wir nicht zuständig. Unter »konkrete Gefahr« fällt die Möglichkeit einer Straftat, der ein Vermisster zum Opfer fallen könnte, ebenso wie der Verdacht auf Suizid. Nur unter diesen Umständen starten wir vom Kommissariat 114 aus eine INPOL-Fahndung, was bedeutet, wir geben Daten über die vermisste Person in unser Informationssystem ein, an das auch das Landeskriminalamt angeschlossen ist, wo die Kollegen unsere Angaben mit denen über unbekannte Tote vergleichen.
Ergeben sich nach einiger Zeit keine neuen Erkenntnisse und bleibt die Person verschwunden, füllen wir Formblätter mit weiteren, exakteren Details aus, die wir dann auch ans Bundeskriminalamt schicken. Über dessen zentrale Suchstelle »Sirene« werden sämtliche Länder informiert, die das Schengener Abkommen unterzeichnet haben. Außerdem arbeitet das BKA mit der »Vermi/Utot-Datei«, in der die Daten über Vermisste und unbekannte Tote aus allen sachbearbeitenden Dienststellen der Bundesrepublik gespeichert und für jeden zuständigen Kommissar abrufbar sind. Müssen wir die Fahndung über das BKA und »Sirene« ausweiten, schalten wir Interpol ein. Parallel dazu bitten wir die Presse und den ADAC um Mithilfe. Als erledigt gilt ein Fall – nach unseren »Richtlinien für die Führung polizeilicher personenbezogener Sammlungen« – frühestens dreißig Jahre nach der Vermisstenmeldung.
Als wir an jenem siebzehnten November, Sonjas schwarzem Freitag, das Polizeirevier am Falkenweg in Münzing betraten, waren wir von der Lösung des Falles deines Vaters unendlich weit entfernt. Und beim Verlassen des Dienstgebäudes nach einer Stunde kam es mir vor, als hätte sich die Entfernung vergrößert.
Lange saßen wir im Wagen, bevor wir uns auf den Weg zu dem Haus machten, in dem Mathilda Ross wohnte. Das Haus lag auf dem Grünerberg, einem Hügel am Rand des Dorfes mit einer schmucklosen Siedlung aus den sechziger Jahren, lang gezogene Blocks, gleichförmige Fassaden, leere Blumenkästen vor den Fenstern, Wäschestangen auf grauen Wiesenflächen.
Bist du je dort gewesen?
Ich dachte an Polizeiobermeisterin Susanne Berkel, die nahezu ununterbrochen geredet und erklärt hatte, sie sei vollkommen sicher, dass deine Tante die Wahrheit gesagt habe und wir deinen Vater unbedingt finden müssten, bevor er sich das Leben nehme.
»Warum sind Sie sich da so sicher?«, hatte Sonja gefragt.
Und Susanne Berkel hatte fast geschrien: »Weil ich das spüre!«
Hinter den beschlagenen Scheiben des Autos verschwand die Umgebung.
Sonja saß auf dem Fahrersitz, ich hinten, wie immer, und wir schwiegen.
Nach einigen Minuten sagte Sonja: »Sie weiß etwas, das wir nicht wissen.«
Ich sagte: »Vielleicht.«
Dann warf Sonja einen Blick auf die Aktenhülle auf dem Beifahrersitz. Ich hatte die drei Seiten der vorläufigen Vermisstenanzeige und meine Notizen darin zusammengeheftet.
»Sollen wir klären lassen, ob es Verbindungen zwischen der Kollegin und der Familie des Vermissten gibt?«
»Nein.«
Wieder war es still. Dann wandte Sonja den Kopf zu mir. »Warum nicht?«
»Zu viel Aufwand.«
Die Antwort brachte sie zum Lächeln. Kurz vor Mittag ihr erstes Lächeln. Und ich bildete mir ein, der Rest ihres Gesichts wunderte sich darüber, jedenfalls schien ihr Blick Irritation auszudrücken.
»Was denken Sie gerade?«, fragte sie.
»Ich rätsele über Ihre grünen Augen.«
»Was gibt’s da zu rätseln?«
»Das ist ein Geheimnis«, sagte ich und öffnete die hintere Wagentür.
Wir gingen zum Haus. Hinter den Wohnblocks stieg der Hügel weiter an, dicht bepflanzt mit Nadelbäumen, die im grauen Licht dunkel und abweisend wirkten. An einigen Fenstern sah ich ein Gesicht, ältere Frauen, die uns beobachteten. An der Wand neben der Tür, an der wir klingelten, lehnte ein Mountainbike; das Hinterrad fehlte.
»Wer ist da?«, hörten wir eine Stimme in der Sprechanlage.
»Kriminalpolizei, mein Name ist Sonja Feyerabend. Sind Sie Frau Ross?«
Sie empfing uns in Mantel und Stiefeln.
»Ich wollte grade gehen«, sagte sie.
Wir standen nicht direkt vor ihr, aber ihre Fahne war unüberriechbar.
»Wir würden gern mit Ihnen sprechen«, sagte Sonja. »Oder hat sich Ihr Bruder in der Zwischenzeit gemeldet?«
»Nein«, sagte sie sehr leise, blickte zu Boden und machte einen Schritt zurück in die Wohnung.
Wir folgten ihr. Sie schloss die Tür, und wir standen zu dritt im engen Flur.
Mathilda Ross war neununddreißig Jahre alt, sie hatte halblange blonde Haare und ein Gesicht, das vielleicht vom Trinken aufgedunsen war, vielleicht von der Einnahme starker Tabletten, vielleicht von Verzweiflung. Sie war nicht dick, aber als sie ihren Wollmantel auszog, der ihr bis zu den Knien reichte, kam ein unförmiger Körper zum Vorschein, wie der von jemandem, der vor langer Zeit aufgehört hatte, auf sich zu achten. Sie hängte den Mantel an den Haken einer Leiste, an der noch andere Mäntel und Jacken hingen, alle in Grau- und Brauntönen. Sie drehte sich wieder zu uns um und sah uns reglos an.
Mir gefiel, dass es nach Tannennadeln und Walderde roch. Wahrscheinlich strömten die Jacken und Bergschuhe, die neben anderen Schuhen auf Zeitungspapier unter den Kleidungsstücken standen, diesen Geruch aus.
»Dürfen wir uns setzen?«, fragte Sonja.
»Ja«, sagte Frau Ross sofort, ebenso leise wie zuvor.
Im Wohnzimmer schaltete sie das Licht an. Die Wohnung lag im Parterre und die Zimmerdecken waren niedrig und die Fenster schmal.
Meinen kleinen karierten Block in der Hand, wartete ich, bis Mathilda Ross sich uns gegenüber hingesetzt hatte, auf die braune Couch, genau in die Mitte.
Sonja legte ihren DIN-A4-Block auf den Tisch, dazu die VVA, meine Notizen und einen Standardfragebogen, den sie nur mitgenommen hatte, weil sie erst seit Kurzem auf der Vermisstenstelle arbeitete und keine wesentliche Frage vergessen, vor allem aber, weil sie sich nicht von mir korrigieren lassen wollte.
Sie saß derart konzentriert auf ihrem Stuhl, dass sie vergessen hatte, ihre Mütze abzunehmen. Ich musste an gewisse Damen in Cafés denken, die ihre Hüte, so grotesk es auch aussehen mochte, niemals abnahmen, und ich dachte, vielleicht übt Sonja schon fürs Alter.
»Frau Ross …«, begann Sonja.
»Entschuldigung«, unterbrach sie Frau Ross. »Wollen Sie was trinken? Ich hab Kaffee oder …«
»Nein«, sagte Sonja.
»Danke«, sagte ich.
»Stimmt es, dass Sie Ihren Bruder vor einem Jahr zum letzten Mal gesehen haben?«, fragte Sonja.
Mathilda Ross nickte.
»Heute vor einem Jahr.«
Sie nickte.
»An Ihrem Geburtstag.«
Sie nickte.
Wir hatten beide vergessen, ihr zu gratulieren.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Sonja jetzt.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte ich.
»Danke.«
»Und im letzten Jahr hat Ihr Bruder angekündigt, er wolle sich umbringen«, sagte Sonja.
So stand es in der Aussage, die uns die Münzinger Kollegen gemailt hatten.
Mathilda Ross nickte.
»Hat er einen Grund genannt?«
»Er ist …« Sie drehte den Kopf zur Seite. Dann sah sie zwischen uns hindurch. »Er hat keine Kraft mehr, er ist … er weiß nicht mehr, was er tun soll, er hat kein Geld, er arbeitet, aber … Mein Bruder ist Maler von Beruf …«
Auch das stand in dem Bericht.
Sie suchte nach Worten, vergrub eine Hand in ihren Haaren und hielt die andere waagrecht, wie um zu testen, ob sie zitterte. Die Hand zitterte leicht, und sie legte sie aufs Knie. Lauter ungelenke Bewegungen und ihr Blick fand im Zimmer keinen Halt. Immer wieder sah sie in die eine Richtung, dann in die andere, betrachtete die Möbel, die schlicht und alt waren, und stützte sich dann mit beiden Händen auf der Sitzfläche ab, als wolle sie jeden Moment aufstehen.
»In letzter Zeit … in den letzten Jahren hab ich ihm Geld geschickt, nicht viel, ich verdien ja auch nicht viel, ich arbeite in einer Gärtnerei … obwohl ich ausgebildete Floristin bin … Ich hab … Wenn ich was übrig hab, schick ich’s ihm, mal zwanzig, mal fünfzig Euro, ich schick’s mit der Post, das ist am unauffälligsten, ist noch nie was weggekommen …«
»Frau Ross«, sagte Sonja.
Ich ahnte, worauf sie hinauswollte. Geschichten, die einen Fall nicht voranbrachten, machten sie unruhig. Sie redete sich dann ein, jemand stehle ihr kostbare Zeit.
»Frau …«
»Ja?«, sagte Mathilda schnell.
»Außer Ihnen hat niemand Ihren Bruder als vermisst gemeldet, keiner seiner Bekannten und Freunde aus München, wo er lebt. Denen würde doch auch auffallen, wenn er plötzlich verschwunden wäre …«
»Nein«, sagte Mathilda mit der gleichen leisen Stimme wie bei unserer Begrüßung. »Das fällt niemand auf, wenn der Hanse – wenn der Johann weg ist, der ist doch oft weg, dann bleibt er tagelang in seinem Zimmer und schläft und will niemand sehen, kann ich gut verstehen …«
Sonja nahm die Blätter aus der Aktenhülle. »Ihr Bruder wohnt in der Bauerstraße, wir haben die Adresse überprüft, zwei Kollegen von uns waren dort, niemand hat ihnen aufgemacht. Möchten Sie, dass wir die Wohnung aufbrechen lassen?«
»Wozu denn?«
»Es ist doch möglich, dass Ihr Bruder einfach nur schläft, und Sie machen sich unnütz Sorgen.«
»Er schläft nicht«, sagte sie und sah Sonja in die Augen. »Heut ist mein Geburtstag, da schläft er nicht, er ist weggegangen, um sich … um sich umzubringen. Wieso glauben Sie mir nicht?«
Sie stand auf, ging zu einem niedrigen weißen, abgeschabten Bücherschrank, auf dem mehrere Flaschen Rotwein und Gläser standen. Sie schenkte sich ein Glas ein und trank.
»Ich darf das, ich hab heut Geburtstag«, sagte sie.
»Zum Wohl«, sagte ich.
Sonja warf mir einen Blick zu, den ich nicht beachtete.
Während Mathilda das Glas erneut an die Lippen setzte, stand Sonja ebenfalls auf. »Haben Sie eine Ahnung, wo sich Ihr Bruder aufhalten könnte?«
»Nein, das hab ich doch schon gesagt, nein, weiß ich nicht, weiß ich nicht, deswegen bin ich zur Polizei gegangen, sonst hätt ich ihn ja selber gesucht.«
Ich sagte: »Ihr Bruder ist einundvierzig, er kann tun, was er will, vielleicht ist er einfach verreist, vielleicht schläft er in seiner Wohnung, niemand kann ihn daran hindern. Er ist erwachsen, er ist frei in allen seinen Entscheidungen.«
»Ist er nicht«, sagte Mathilda und stellte das Glas hin.
»Bitte?«, fragte Sonja.
Weder sie noch ich hatten, seit wir in diesem Zimmer waren, auch nur ein Wort notiert.
»Frei in seinen Entscheidungen … Sind Sie das?« Mathilda sah mich an.
»Nein«, sagte ich.
»Na also«, sagte sie. »Ich auch nicht. Und er auch nicht. Er besonders nicht. Er war auf andere angewiesen, immer, zum Glück hatte er Andrea, die hat das Geld verdient und ihn sein lassen …«
»Wer ist Andrea?«, fragte ich. Von ihr stand nichts in dem Bericht.
»Seine Freundin, sie haben zusammengewohnt, jetzt nicht mehr, sie hat ihn rausgeschmissen, jetzt ist er von jemand anderem abhängig …«
»Von wem?«, fragte Sonja und klopfte mit den Blättern nervös auf ihre Hand.
»Weiß ich nicht.«
»Frau Ross«, sagte Sonja und ging auf sie zu. »Sie haben heute Geburtstag und Sie sorgen sich um Ihren Bruder. Gut. Wir helfen Ihnen. Wir nehmen Sie nach München mit, dann lassen wir die Wohnung Ihres Bruders öffnen und sehen nach, ob er da ist. Sind Sie damit einverstanden?«
Sie antwortete nicht.
Ich sagte: »Wir wollen Ihnen nichts vormachen, Frau Ross, wir können Ihre Vermisstenanzeige noch mal aufnehmen und sie in unseren Computer eingeben, damit alle Polizeiinspektionen Bescheid wissen. Aber da passiert nichts weiter. Weil wir nichts Konkretes in der Hand haben, weil wir eigentlich der Meinung sind, Ihr Bruder taucht morgen oder übermorgen oder in ein paar Tagen wieder auf. Und was sollen wir an konkreten Angaben in die Anzeige reinschreiben? Frau Ross …«
Sie hatte den Kopf gesenkt. Ratlos stand Sonja vor ihr. Und ich war mir selbst nicht mehr sicher, ob unser Aufwand gerechtfertigt war. Die Frau war betrunken, sie war in einer miesen Verfassung, vermutlich war ihr Bruder der Einzige, der sie an ihrem Geburtstag anrief, sie hatte niemanden, der sich um sie kümmerte, offenbar hatte sie niemandem von ihrem Besuch bei der Polizei erzählt, nichts in dieser Wohnung deutete darauf hin, dass sie heute Vormittag Besuch bekommen hatte. So wie es aussah, hatte sie einen freien Tag, sie trank mit sich selbst und wartete auf den Anruf ihres Bruders, seit sieben Uhr morgens. Vielleicht wollte sie bloß Aufmerksamkeit erregen, vielleicht wollte sie bloß mit jemandem sprechen, eine andere Stimme hören außer ihrer eigenen. Und vielleicht hatte sie ein Recht dazu an ihrem Geburtstag.
Trotzdem musste ich ihr erklären, weshalb wir zögerten und womöglich den Eindruck erweckten, wir würden an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln.
»Wir können keine genauen Angaben zur Person machen«, sagte ich und drehte den Stuhl, damit ich mir nicht länger den Hals verrenken musste. Aber aufstehen wollte ich nicht. »Sie haben Ihren Bruder vor einem Jahr zuletzt gesehen, wir wissen nicht, ob sich sein Äußeres verändert hat. Wir wissen nicht, was er, sollte er wirklich verschwunden sein, anhat oder bei sich hat, wir wissen nichts über die Umstände seines Verschwindens, nichts über sein mögliches Ziel, und vor allem haben wir keine Ahnung, seit wann genau er verschwunden ist. Bevor wir nicht in seiner Wohnung waren und mit Nachbarn und Freunden gesprochen haben, hat eine Fahndung keinen Sinn, Frau Ross.«
»Es ist kein Problem, die Wohnung aufzubrechen«, sagte Sonja. »Nichts wird dabei beschädigt, nicht die Tür und nicht das Schloss.«
»Wozu soll man die Wohnung aufbrechen?«, sagte Mathilda Ross. »Ich hab einen Schlüssel.«
2
Bevor wir das Dorf verließen, bat sie uns, am Friedhof anzuhalten.
»Ich wollt vorhin grad los«, sagte sie.
An der Mauer, die den Friedhof zur Straße hin abgrenzte, befand sich das Grab, das Mathilda Ross aufsuchte. Auf dem Stein stand der Name Ludwig Ross. Er war fünfunddreißig Jahre alt geworden.
Statt Blumen bedeckten Tannenzweige die Erde, sorgfältig aufeinandergelegt. Grabstein und Umrandung, beides aus Marmor, wirkten frisch geputzt, und in einer grünen Plastikvase steckten fünf dunkelrote Rosen, von denen zwei verwelkt waren.
Mathilda bekreuzigte sich und versank in Schweigen.
Ich ließ sie und Sonja dort zurück und ging durch die Reihen der Gräber. Unter meinen Schuhen knirschte der Kies. Außer mir waren noch zwei Frauen unterwegs, eingehüllt in dicke Mäntel, eine von ihnen hatte grüne Gummihandschuhe an und einen kleinen metallenen Rechen in der Hand. Jedes einzelne Grab sah gepflegt aus, man hätte meinen können, die Hinterbliebenen konkurrierten miteinander um einen Schönheitspreis, den ihnen der Pfarrer an Allerheiligen persönlich überreichte, vielleicht in Form eines versilberten Latschenzweiges oder einer geweihten Schaufel.
Auch in Taging, wo ich geboren wurde und das Grab meiner Mutter ist, bietet der katholische Friedhof den Anblick einer gartenähnlichen Anlage, in der Unkraut verboten oder gar eine Sünde ist. Um das Grab meiner Mutter kümmert sich eine örtliche Gärtnerei, ich bezahle regelmäßig meinen Beitrag und sie pflanzen Veilchen und Schlüsselblumen, bringen jedes Jahr den Rosenstrauch zum Erblühen und sorgen für frische Erde und eine gelegentliche Waschaktion am Stein. Obwohl ich katholisch bin und die Kirchensteuer von meinem Gehalt abgezogen wird, bete ich nie, zumindest nicht zu einer Erscheinung namens Gott. Ich glaube, dass unser Leben einen Sinn hat und damit der Tod, doch ich weiß nicht, welchen, und wenn ich ein Gedicht von Hölderlin lese oder ein Bild von Vincent van Gogh betrachte, begreife ich, dass es Menschen gibt, die dem Geheimnis der Schöpfung näher sind als alle anderen, und dieser Gedanke tröstet mich. Solche Verse und Kunstwerke sind wie Zufluchtsorte in meiner Einsamkeit, die mich nie abweisen, in welch elender Stimmung ich mich auch befinden mag. Das ist meine Art von Religion, und sie genügt mir.
Wahrscheinlich lachst du jetzt, weil du denkst, was erzählt mir dieser Mann, der bloß ein Polizist ist, ein Beamter, dessen Existenz aus Dienstvorschriften und Bürokratie besteht, ein Ordnungshüter, der brav den Gesetzen zu folgen und den Boden der Tatsachen gefälligst nicht zu verlassen hat.
Im Grund hast du mit dieser Einschätzung Recht. Doch auch wenn ich Polizist und Beamter bin, und das seit einem Vierteljahrhundert, und eine Art personifiziertes Regelwerk darstelle, ist mir in manchen Momenten dieser Beruf bis heute so fremd wie mein gesamtes Leben. Ich begreife dann nicht, welchen Zweck ich erfüllen soll und wozu ich jeden Morgen aufstehe, um meiner Arbeit nachzugehen. Was würde passieren, wenn ich einfach liegen bliebe, den ganzen Tag oder wenigstens bis Mittag? Nichts würde passieren. Nach einer bestimmten Zeit würde mir gekündigt werden. Und dann? Zwei, drei Menschen würden sich wundern und versuchen, mich zur Besinnung zu bringen, mich zurückzuführen in die Gemeinschaft der Normalen. Und dann, wenn ich mich weiter weigerte? Nichts. Und dieses Nichts wäre genauso sinnvoll wie meine tägliche Anwesenheit in meinem Büro im Dezernat 11. Kannst du mir das Gegenteil beweisen?
Trotz meines Berufs bedeutet mir das Alleinsein mehr als alles andere, ich sitze in meinem Zimmer und starre die gelben Wände an (das eine meiner beiden Zimmer habe ich komplett gelb gestrichen, warum, erzähle ich dir vielleicht ein andermal), Stunde um Stunde, manchmal rauche ich eine Pfeife dazu, manchmal betrinke ich mich, manchmal schlage ich die Trommel oder tanze. Und manchmal bin ich dabei nackt.
Du hast Recht: Wenn mein Vorgesetzter mich in diesem Zustand sehen würde, wäre ich nächsten Monat arbeitslos. Und vorher hätte ich noch einen Zwangstermin beim Polizeipsychologen.
Es gibt Nächte, da wünsche ich, ich hätte weniger Dunkelheit in mir. Es gibt Nächte, da wünsche ich, meine Mutter würde noch leben und ich könnte sie fragen, wie es war, als ich geboren wurde, in der ersten Stunde, als sie mich zum ersten Mal in den Armen hielt und mich anblickte. Wen sah sie in dieser Sekunde? Und wie war meine Reaktion auf ihren Blick? Es gibt Nächte, da entzieht sich mir mein Wissen, da ist es in meinem Kopf so still wie auf der Erde, bevor es Lebewesen gab. In solchen Nächten ist mein Zimmer ein Grab und die Wände kommen näher, und ich stemme mich mit beiden Händen dagegen und höre Stimmen, ein Murmeln aus dem Inneren der Steine.